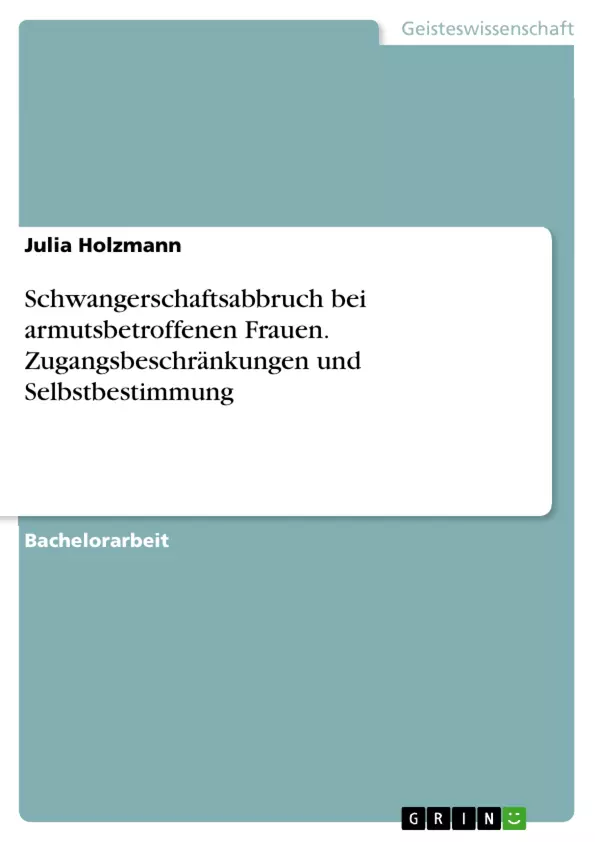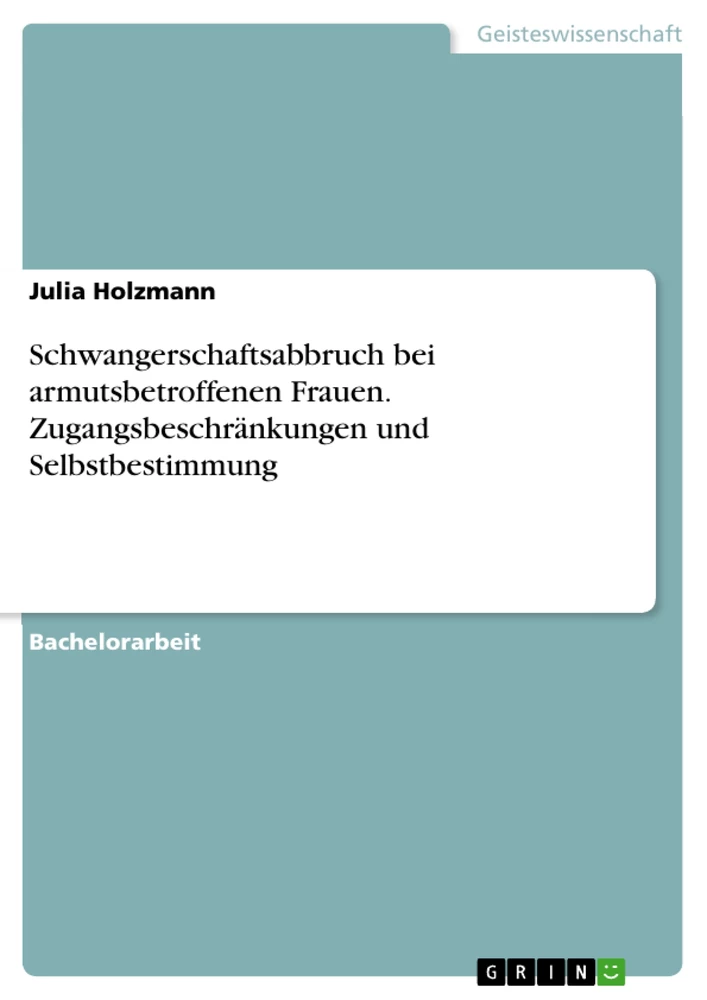
Schwangerschaftsabbruch bei armutsbetroffenen Frauen. Zugangsbeschränkungen und Selbstbestimmung
Bachelorarbeit, 2021
65 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- I. Inhaltsverzeichnis
- II. Abbildungsverzeichnis
- III. Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmung
- 3. Historischer Rückblick
- 3.1. Schwangerschaftsabbruch im Nationalsozialismus
- 3.2. 1945-1974
- 4. Rechtliche Lage in Österreich
- 5. Medizinische Möglichkeiten für einen Schwangerschaftsabbruch
- 5.1. Schwangerschaftsalter
- 5.2. Medikamentöser Schwangerschaftsabbruch
- 5.3. Operativer Schwangerschaftsabbruch
- 5.3.1. Saugkürettage
- 5.3.2. Kürettage
- 5.3.3. Abbruch nach dem ersten Trimester
- 6. Mögliche Folgen eines Schwangerschaftsabbruches
- 6.1. Physische Folgen
- 6.2. Psychische Folgen
- 6.2.1. Depression
- 6.2.2. Angststörung
- 6.2.3. PTBS
- 6.2.4. Post Abort Syndrom
- 7. Status quo
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Situation armutsbetroffener Frauen*, die einen Schwangerschaftsabbruch wünschen. Sie untersucht, ob und in welchem Ausmaß Zugangshürden zu medizinisch fachgerechten Abtreibungen existieren und wie sich diese auf die Selbstbestimmung der Frauen* auswirken. Die Arbeit stützt sich auf aktuelle Daten und Sachverhalte und beleuchtet die Menschenrechte im Zusammenhang mit selbstbestimmten Schwangerschaftsabbrüchen.
- Zugangsbarrieren zu Schwangerschaftsabbrüchen in Österreich
- Auswirkungen dieser Barrieren auf die Selbstbestimmung von Frauen*
- Menschenrechte und selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche
- Lebensweltorientierung in der Sozialen Arbeit
- Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit im Kontext von Schwangerschaftsabbrüchen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik des Schwangerschaftsabbruchs bei armutsbetroffenen Frauen* ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor. Die Relevanz des Themas wird hervorgehoben, und es werden die Ziele und Methoden der Analyse beschrieben.
- Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel definiert wichtige Begriffe, die im Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsabbruch relevant sind. Dazu gehören u.a. die Definition von „Armut", „Selbstbestimmung" und „Schwangerschaftsabbruch".
- Historischer Rückblick: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte des Schwangerschaftsabbruchs, insbesondere im Nationalsozialismus und in der Zeit von 1945 bis 1974. Es werden wichtige Entwicklungen und gesellschaftliche Veränderungen im Umgang mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch aufgezeigt.
- Rechtliche Lage in Österreich: Dieses Kapitel beschreibt die aktuelle Rechtslage in Österreich hinsichtlich des Schwangerschaftsabbruchs. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die relevanten Gesetze zusammengefasst.
- Medizinische Möglichkeiten für einen Schwangerschaftsabbruch: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die medizinischen Möglichkeiten für einen Schwangerschaftsabbruch in Österreich. Es werden verschiedene Verfahren, wie medikamentöser und operativer Abbruch, vorgestellt und die jeweiligen Aspekte hinsichtlich des Schwangerschaftsalters erläutert.
- Mögliche Folgen eines Schwangerschaftsabbruches: Dieses Kapitel behandelt mögliche physische und psychische Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs. Es werden sowohl positive als auch negative Aspekte beleuchtet und verschiedene Studien und Statistiken herangezogen, um die Komplexität des Themas zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Schwangerschaftsabbruch, Armut, Selbstbestimmung, Zugangshürden, Menschenrechte und Lebensweltorientierung. Dabei stehen die Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit im Kontext von Schwangerschaftsabbrüchen bei armutsbetroffenen Frauen* im Mittelpunkt. Die Ergebnisse der Analyse liefern wichtige Erkenntnisse für die Praxis der Sozialen Arbeit und zeigen die Notwendigkeit von Veränderungen im Hinblick auf die Verbesserung der medizinischen Versorgung und die Stärkung der Selbstbestimmung von Frauen*.
Häufig gestellte Fragen
Welche Zugangshürden bestehen für armutsbetroffene Frauen* bei Schwangerschaftsabbrüchen?
Die größten Hürden sind die hohen Kosten, da Abbrüche in Österreich nicht von der Sozialversicherung übernommen werden, sowie regionale Versorgungslücken.
Was bedeutet "Lebensweltorientierung" in der Sozialen Arbeit?
Dieser Ansatz nach Hans Thiersch orientiert sich am Alltag und den konkreten Problemen der Klienten, um deren Selbstbestimmung und Handlungsfähigkeit zu stärken.
Welche medizinischen Methoden für einen Abbruch gibt es in Österreich?
Es wird zwischen medikamentösen Abbrüchen und operativen Verfahren wie der Saugkürettage oder der klassischen Kürettage unterschieden.
Wie hat sich die rechtliche Lage historisch entwickelt?
Die Arbeit beleuchtet die restriktive Praxis im Nationalsozialismus und den Weg zur Fristenregelung in Österreich im Jahr 1974.
Gibt es psychische Folgen nach einem Schwangerschaftsabbruch?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Studien zu Depressionen, Angststörungen und dem umstrittenen "Post Abort Syndrom", wobei oft die soziale Stigmatisierung eine Rolle spielt.
Warum ist das Thema ein Menschenrechtsthema?
Soziale Arbeit sieht sich als Menschenrechtsprofession, die das Recht auf körperliche Integrität und gesundheitliche Selbstbestimmung für alle Frauen* einfordert.
Details
- Titel
- Schwangerschaftsabbruch bei armutsbetroffenen Frauen. Zugangsbeschränkungen und Selbstbestimmung
- Hochschule
- Management Center Innsbruck Internationale Fachhochschulgesellschaft mbH
- Note
- 1,0
- Autor
- Julia Holzmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 65
- Katalognummer
- V1328058
- ISBN (Buch)
- 9783346816757
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Abtreibung selbstbestimmter Schwangerschaftsabbruch Selbstbestimmung Frauenarmut Lebensweltorientierung Selbstbestimmung Frauenarmut
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Julia Holzmann (Autor:in), 2021, Schwangerschaftsabbruch bei armutsbetroffenen Frauen. Zugangsbeschränkungen und Selbstbestimmung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1328058
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-