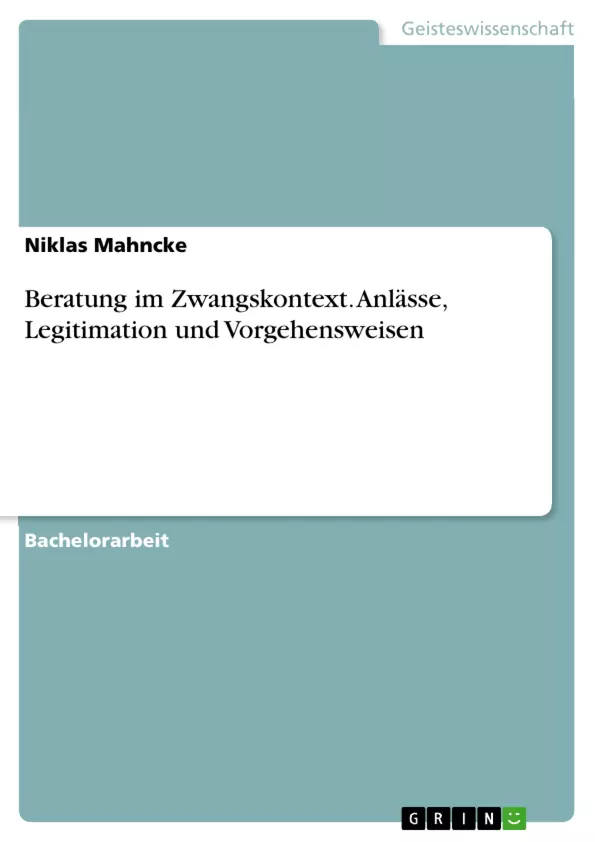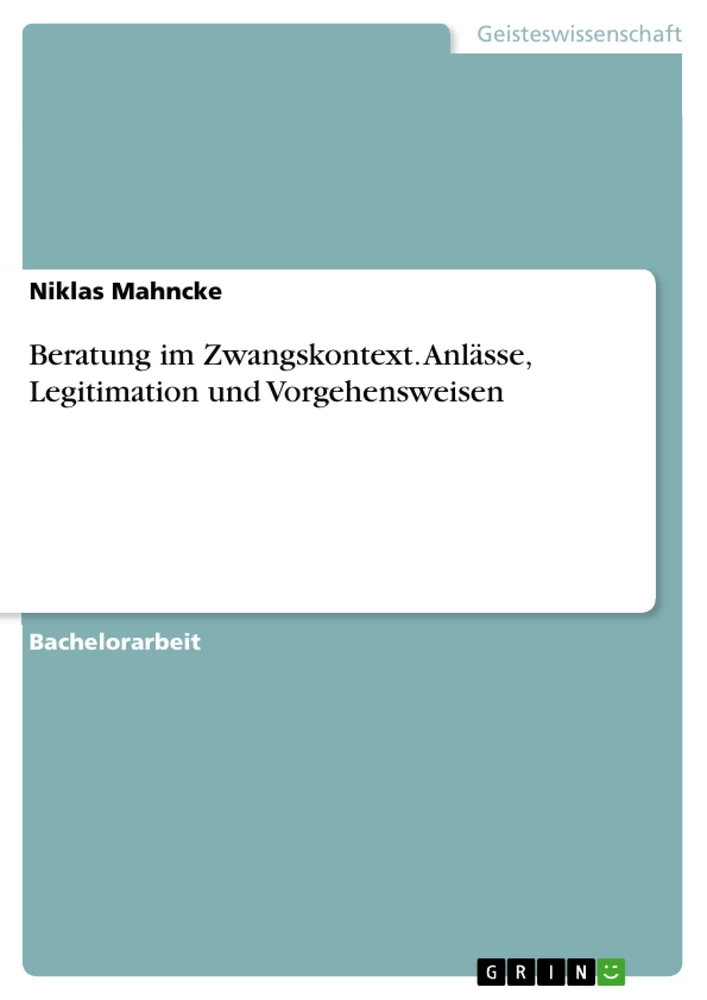
Beratung im Zwangskontext. Anlässe, Legitimation und Vorgehensweisen
Bachelorarbeit, 2021
46 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Beratung
- 2.1 Grundannahmen
- 2.2 Alltagsberatung und professionelle Beratung
- 2.3 Sozialpädagogik und Beratung
- 2.3.1 Personenzentrierte Beratung
- 2.3.2 Der Stellenwert der Autonomie
- 3 Zwangskontexte
- 3.1 Beratung im strafrechtlichen Kontext
- 3.1.1 Strafvollzug
- 3.1.2 Bewährungshilfe
- 3.2 Jobcenter
- 3.3 Schwangerschaftskonfliktberatung
- 3.1 Beratung im strafrechtlichen Kontext
- 4 Rechtfertigung einer Beratung im Zwangskontext
- 5 Vorgehensweisen
- 5.1 Auftrags- und Rollenklärung
- 5.2 Förderung pro-sozialer Verhaltensweisen
- 5.3 Motivorientierte Beziehungsgestaltung
- 5.4 Widerstand und Reaktanz
- 5.4.1 Grundhaltungen
- 5.4.2 Strategien
- 5.5 Problembearbeitung
- 6 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Legitimation und Gestaltung von Beratung im Zwangskontext. Dabei wird die besondere Situation von Beratungsgesprächen betrachtet, in denen die Autonomie der Klienten eingeschränkt ist. Der Fokus liegt auf der Frage, wie sich Beratung in diesem Umfeld zielführend gestalten lässt, trotz der Herausforderungen durch Zwang und eingeschränkter Freiheit.
- Das Spannungsverhältnis zwischen Autonomie und Zwang in der Beratung
- Die Rechtfertigung von Beratung in Zwangskontexten
- Spezifische Herausforderungen und Möglichkeiten der Beratung im Strafvollzug, der Bewährungshilfe, im Jobcenter und in der Schwangerschaftskonfliktberatung
- Die Entwicklung von Vorgehensweisen, die auf die besonderen Bedingungen des Zwangskontextes zugeschnitten sind
- Die Rolle von Widerstand und Reaktanz in der Beratung im Zwangskontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz von Beratung im Zwangskontext und die Forschungsfrage erläutert. Im zweiten Kapitel wird der Begriff der Beratung aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und die Grundannahmen der personenzentrierten Beratung dargestellt, die im weiteren Verlauf als Vergleichspunkt dienen.
Kapitel 3 stellt verschiedene Arbeitsbereiche des Zwangskontextes vor, darunter den Strafvollzug, die Bewährungshilfe, das Jobcenter und die Schwangerschaftskonfliktberatung. Dabei werden die jeweiligen Besonderheiten und das Beratungsverständnis in diesen Bereichen herausgestellt. Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Rechtfertigung von Beratung im Zwangskontext, indem es die ethischen und pragmatischen Argumente für und gegen eine solche Praxis diskutiert.
Kapitel 5 widmet sich schließlich den Vorgehensweisen in der Beratung im Zwangskontext. Dabei werden verschiedene Ansätze zur Auftrags- und Rollenklärung, zur Förderung pro-sozialer Verhaltensweisen und zur Gestaltung einer motivierenden Beratungsbeziehung vorgestellt. Außerdem werden Strategien zur Bewältigung von Widerstand und Reaktanz sowie zur Problembearbeitung erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich dem Thema der Beratung in Zwangskontexten und beleuchtet insbesondere die Herausforderungen und Möglichkeiten der Beratungspraxis, wenn die Autonomie der Klienten eingeschränkt ist. Wichtige Themenfelder sind dabei die Rechtfertigung von Beratung unter Zwang, die Gestaltung von Beratungsbeziehungen in einem schwierigen Kontext sowie die Entwicklung von wirkungsvollen Vorgehensweisen, die die spezifischen Bedürfnisse und Reaktionen von Klienten im Zwangskontext berücksichtigen. Zu den Kernthemen zählen die Personenzentrierte Beratung, die Autonomie, der Strafvollzug, die Bewährungshilfe, das Jobcenter, die Schwangerschaftskonfliktberatung, der Widerstand, die Reaktanz und die Problembearbeitung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Beratung im Zwangskontext?
Es handelt sich um Beratungsgespräche, die nicht auf Freiwilligkeit basieren, sondern durch rechtliche oder institutionelle Vorgaben (z. B. Bewährungshilfe, Jobcenter) erzwungen sind.
Wie lässt sich Beratung ohne Freiwilligkeit rechtfertigen?
Die Rechtfertigung liegt oft im Schutz der Gesellschaft oder in der Unterstützung des Klienten, um weitere Sanktionen zu vermeiden, wobei das Spannungsverhältnis zur Autonomie bestehen bleibt.
Was bedeutet „Reaktanz“ in der Beratung?
Reaktanz ist der Widerstand eines Klienten gegen eine wahrgenommene Einschränkung seiner Handlungsfreiheit, was im Zwangskontext besonders häufig vorkommt.
Wie kann eine motivorientierte Beziehungsgestaltung helfen?
Indem der Berater die individuellen Ziele des Klienten in den Fokus rückt, kann trotz des äußeren Zwangs eine Basis für Zusammenarbeit geschaffen werden.
In welchen Bereichen findet Beratung im Zwangskontext statt?
Typische Bereiche sind der Strafvollzug, die Bewährungshilfe, Maßnahmen der Arbeitsagentur (Jobcenter) und die gesetzlich vorgeschriebene Schwangerschaftskonfliktberatung.
Details
- Titel
- Beratung im Zwangskontext. Anlässe, Legitimation und Vorgehensweisen
- Hochschule
- Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
- Note
- 1,3
- Autor
- Niklas Mahncke (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 46
- Katalognummer
- V1333888
- ISBN (Buch)
- 9783346826114
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Beratung Zwangskontext Rogers Bewährungshilfe Jobcenter Justizvollzug Schwangerschaft Schwangerschaftskonfliktberatung Bezierhungsgestaltung Auftragsklärung Reaktanz Widerstand Autonomie Personenzentrierte Beratung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Niklas Mahncke (Autor:in), 2021, Beratung im Zwangskontext. Anlässe, Legitimation und Vorgehensweisen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1333888
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-