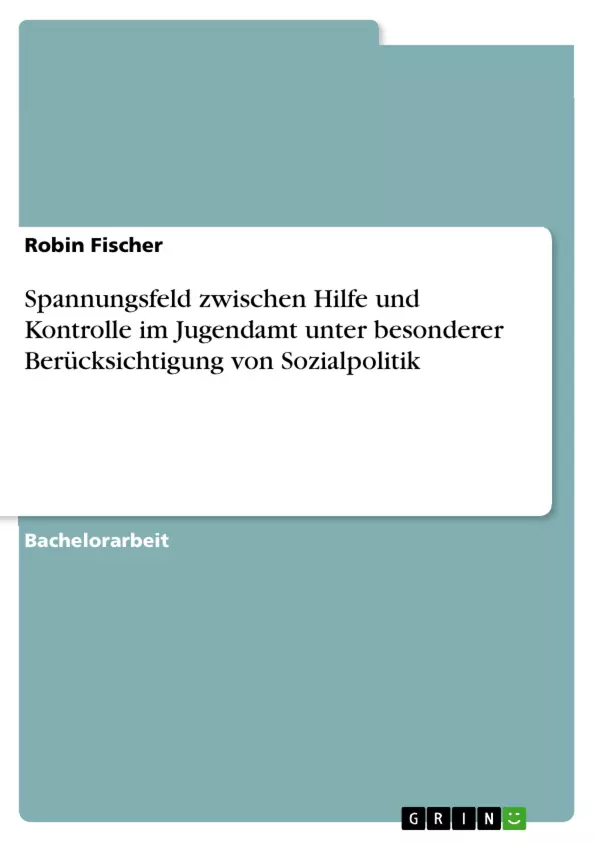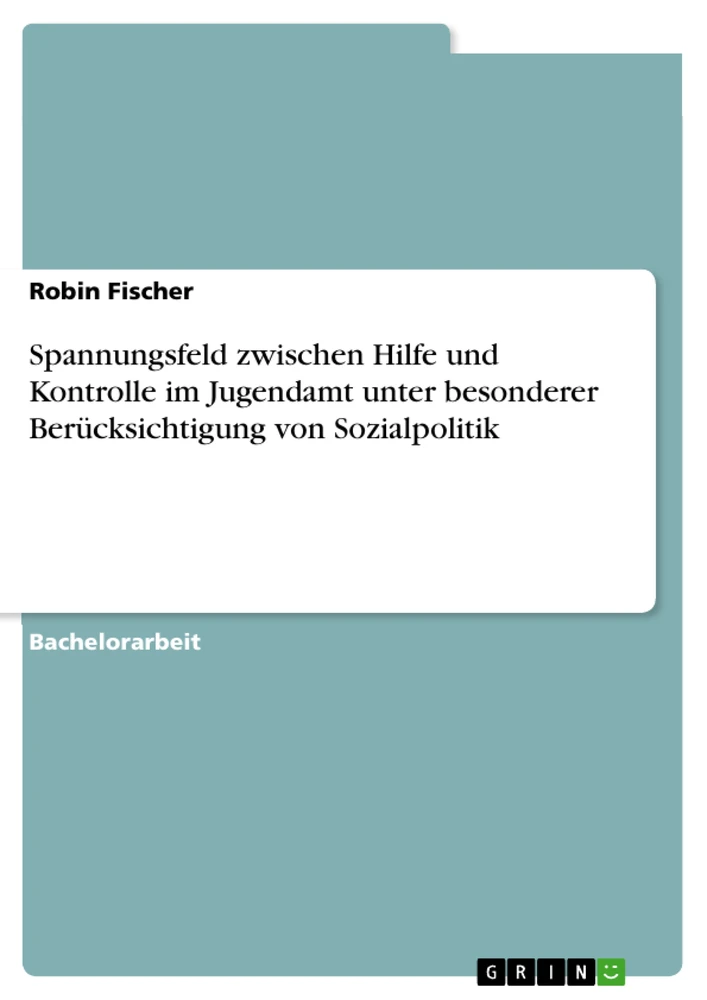
Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle im Jugendamt unter besonderer Berücksichtigung von Sozialpolitik
Bachelorarbeit, 2023
48 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Mandate der Sozialen Arbeit
- 2.1 Das „Doppelmandat“
- 2.2 Das „Tripelmandat“
- 2.3 Begriffe: Hilfe und Kontrolle
- 3. Hilfe und Kontrolle im Jugendamt
- 3.1 Auftrag
- 3.2 Gesetzliche Grundlagen
- 3.3 Das „Kindeswohl“
- 3.4 Handlungsfeld ASD
- 3.4.1 Arbeitsweise
- 3.4.2 Kritik und Ausblick
- 4. Relevante Diskurse
- 4.1 Dienstleistung und Wächteramt
- 4.1.1 Ludwig Salgo
- 4.1.2 Thomas Mörsberger
- 4.2 Jugendamtshandeln als Teil der Sozialpolitik
- 4.2.1 Staatlicher Auftrag und Umgang
- 4.2.2 Punitivität und Arbeitsmarktpolitik
- 5. Schlussfolgerungen der Diskurse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle im Jugendamt und befasst sich insbesondere mit der Gestaltung dieses Verhältnisses im Kontext der Sozialpolitik. Ziel ist es, die Herausforderungen für Fachkräfte in der Praxis zu beleuchten und mögliche Ansätze für eine gelungene Balance zwischen den beiden Polen zu erarbeiten.
- Das Doppelmandat der Sozialen Arbeit: Abwägung zwischen Klienteninteressen und staatlichen Vorgaben
- Das Spannungsverhältnis zwischen Hilfe und Kontrolle im Jugendamt: Analyse der rechtlichen Grundlagen, des „Kindeswohls“ und der Praxis im Handlungsfeld ASD
- Relevante Diskurse: Betrachtung des Streitgesprächs von Ludwig Salgo und Thomas Mörsberger sowie der Rolle der Sozialpolitik im Jugendamtshandeln
- Bedeutung des „Wächteramts“ und die Auswirkungen von Kontrolle auf die Beziehung zwischen Fachkräften und Klienten
- Mögliche Ansätze für eine gelungene Gestaltung des Spannungsfeldes zwischen Hilfe und Kontrolle im Jugendamt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein, indem sie die Frage nach der Bedeutung von Flexibilität und Kompromissbereitschaft in der Sozialen Arbeit stellt. Im Fokus steht das Spannungsverhältnis zwischen Hilfe und Kontrolle, insbesondere im Jugendamt und der Arbeit des ASD.
Kapitel 2 beleuchtet die Mandate der Sozialen Arbeit, insbesondere das Doppelmandat und das Tripelmandat, und die damit verbundenen Herausforderungen in Bezug auf die Definition von Hilfe und Kontrolle.
Kapitel 3 untersucht das Handlungsfeld des Jugendamts und beleuchtet den Auftrag, die gesetzlichen Grundlagen, das „Kindeswohl“ und die Arbeit des ASD. Hierbei werden sowohl die Arbeitsweise des ASD als auch kritische Aspekte im Hinblick auf das Spannungsverhältnis zwischen Hilfe und Kontrolle beleuchtet.
Kapitel 4 befasst sich mit relevanten Diskursen zum Thema Hilfe und Kontrolle. Es werden die Sichtweisen von Ludwig Salgo und Thomas Mörsberger zum Streitgespräch um Dienstleistung und Wächteramt analysiert. Des Weiteren wird der Einfluss der Sozialpolitik auf das Jugendamtshandeln betrachtet.
Schlüsselwörter
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit den zentralen Themenbereichen Hilfe und Kontrolle im Jugendamt, Sozialpolitik, Doppelmandat, „Kindeswohl“, ASD, „Wächteramt“, Ludwig Salgo, Thomas Mörsberger, Punitivität und Arbeitsmarktpolitik.
Details
- Titel
- Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle im Jugendamt unter besonderer Berücksichtigung von Sozialpolitik
- Hochschule
- Frankfurt University of Applied Sciences, ehem. Fachhochschule Frankfurt am Main
- Note
- 2,0
- Autor
- Robin Fischer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2023
- Seiten
- 48
- Katalognummer
- V1333915
- ISBN (Buch)
- 9783346825773
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Soziale Arbeit Jugendamt Spannungsfeld ASD Sozialpolitik Kindeswohl
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Robin Fischer (Autor:in), 2023, Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle im Jugendamt unter besonderer Berücksichtigung von Sozialpolitik, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1333915
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-