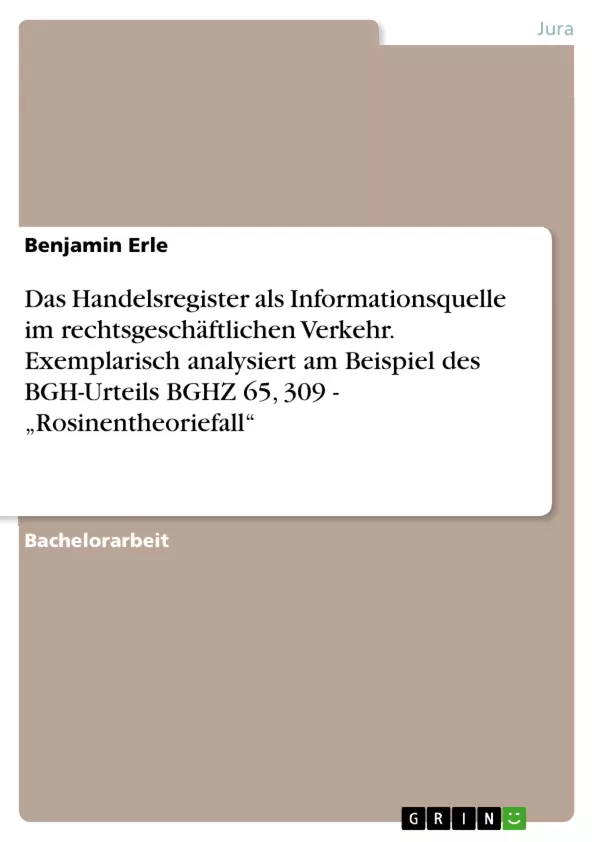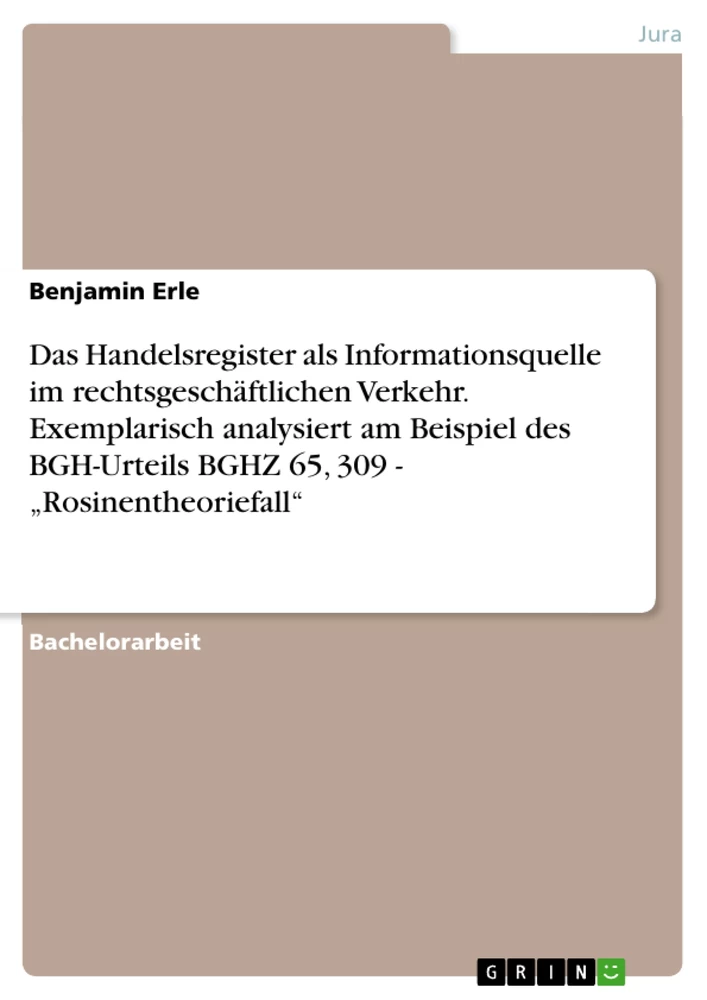
Das Handelsregister als Informationsquelle im rechtsgeschäftlichen Verkehr. Exemplarisch analysiert am Beispiel des BGH-Urteils BGHZ 65, 309 - „Rosinentheoriefall“
Bachelorarbeit, 2020
35 Seiten, Note: 2,2
Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Handelsgesetzbuch
- 2.1 Die Entstehung und Entwicklung des HGB
- 2.2 Der Aufbau
- 2.3 Der Geltungsbereich
- 2.4 Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
- 2.4.1 Grundsatz der Vollständigkeit
- 2.4.2 Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit
- 2.4.3 Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit
- 2.4.4 Grundsatz der Vorsicht
- 2.4.5 Grundsatz der Einzelbewertung
- 3 Das Handelsregister
- 3.1 Historische Entwicklung
- 3.2 Systematik und Zweck
- 3.2.1 Aufbau
- 3.2.2 Eintragungspflichtige und eintragungsunfähige Tatsachen
- 3.3 Die Funktionen des Handelsregisters
- 3.3.1 Publikations-, Kontroll- und Beweisfunktion
- 3.3.2 Publizitätsfunktion
- 4 Der Rosinentheoriefall - BGHZ 65, 309
- 4.1 Der Sachverhalt
- 4.2 Das Urteil
- 4.3 Problematik und Kritik
- 5 Handlungsempfehlung und Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Schutzfunktionen des Handelsregisters als Informationsquelle im rechtsgeschäftlichen Verkehr. Sie analysiert insbesondere den „Rosinentheoriefall“, ein wegweisendes BGH-Urteil, um die Funktionsweise und Bedeutung des Handelsregisters im Kontext des Schutzbedürfnisses des rechtsgeschäftlichen Verkehrs zu erörtern.
- Schutzfunktionen des Handelsregisters
- Relevanz des Handelsregisters als Informationsquelle
- Der „Rosinentheoriefall“ als Fallstudie
- Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung des Handelsregisters
- Das Verhältnis von Rechtsgeschäft und Handelsregister
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Handelsgesetzbuch (HGB) und beleuchtet dessen Entstehung, Aufbau, Geltungsbereich und die Prinzipien der ordnungsgemäßen Buchführung. Im Anschluss wird das Handelsregister im Detail betrachtet, wobei seine historische Entwicklung, Systematik, Zweck und Funktionen beleuchtet werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Publikations-, Kontroll- und Beweisfunktion sowie der Publizitätsfunktion des Handelsregisters. Kapitel 4 widmet sich dem „Rosinentheoriefall“, einem prominenten Urteil des Bundesgerichtshofes, das die Anwendung und Auslegung des Handelsregisters im Kontext von Rechtsgeschäften verdeutlicht. Abschließend werden Handlungsempfehlungen und ein Fazit zum Schutz des rechtsgeschäftlichen Verkehrs durch das Handelsregister formuliert.
Schlüsselwörter
Handelsregister, Rechtsgeschäftlicher Verkehr, Schutzfunktionen, Informationsquelle, BGH-Urteil, Rosinentheorie, Handelsgesetzbuch, Publizitätsfunktion, Beweisfunktion, Kontrollfunktion, Handlungsempfehlung, Rechtsicherheit.
Details
- Titel
- Das Handelsregister als Informationsquelle im rechtsgeschäftlichen Verkehr. Exemplarisch analysiert am Beispiel des BGH-Urteils BGHZ 65, 309 - „Rosinentheoriefall“
- Note
- 2,2
- Autor
- Benjamin Erle (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 35
- Katalognummer
- V1335257
- ISBN (Buch)
- 9783346835062
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- handelsregister informationsquelle verkehr beispiel bgh-urteils rosinentheoriefall
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 21,99
- Preis (Book)
- US$ 24,99
- Arbeit zitieren
- Benjamin Erle (Autor:in), 2020, Das Handelsregister als Informationsquelle im rechtsgeschäftlichen Verkehr. Exemplarisch analysiert am Beispiel des BGH-Urteils BGHZ 65, 309 - „Rosinentheoriefall“, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1335257
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-