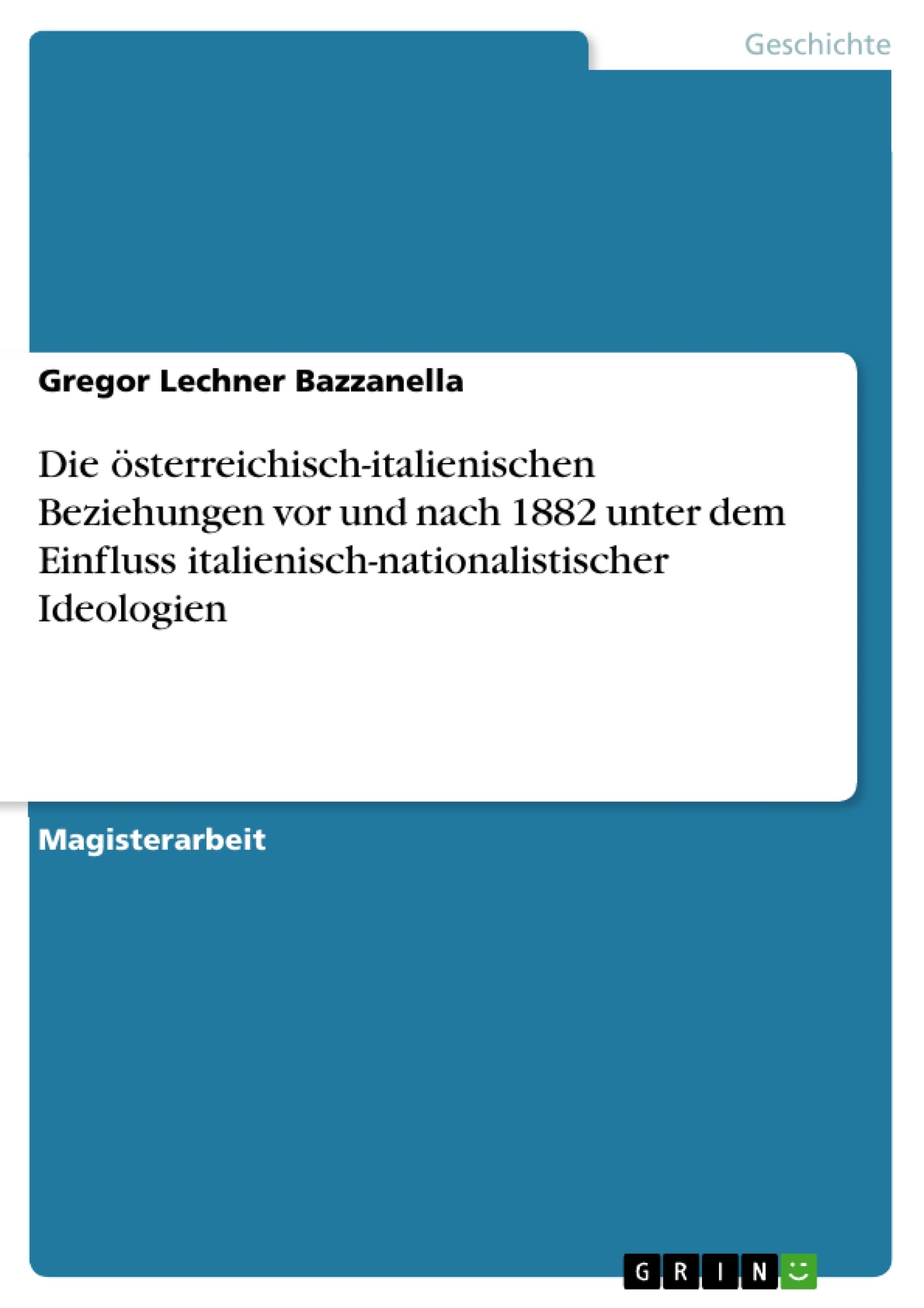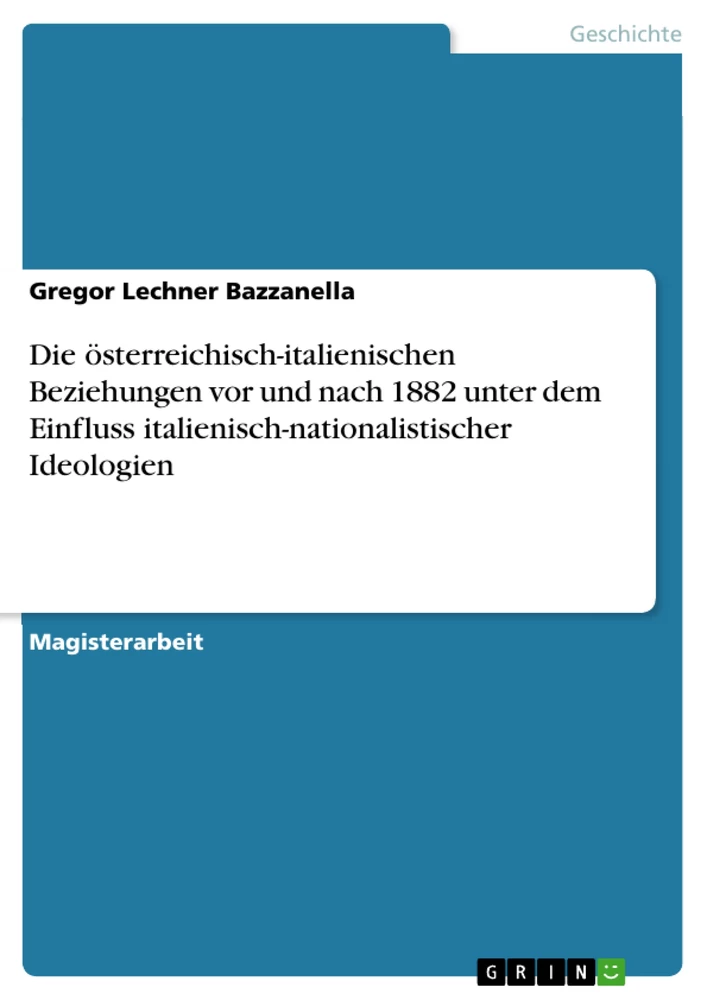
Die österreichisch-italienischen Beziehungen vor und nach 1882 unter dem Einfluss italienisch-nationalistischer Ideologien
Magisterarbeit, 2016
113 Seiten, Note: 2
Geschichte Europas - Neuzeit, Absolutismus, Industrialisierung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Zwischen italienischer Einigung und politischer Annäherung.
- Die Katzelmacher: Das Bild der Italiener und Italiens in Österreich
- Die katholische Kirche im Trentino und Triest.
- Morte ai tedeschi: Das Bild der Österreicher in Italien...
- Das Risorgimento: Die Bewegung der italienischen Einheit und ihre Folgen
- Die Italia Irredenta
- Der italienische Irredentismus: Die politischen Anfänge und historischen Grundlagen der Italia Irredenta.........
- Der Irredentismus und Österreich-Ungarn: Die nationalistischen Bestrebungen in Italien und ihre Rezeption durch die politischen Eliten der Habsburgermonarchie .…………………………..
- Die Italia Irredenta..
- Der Dreibund und die Irredenta: Die Beziehungen zwischen Italien und Österreich während des Bündnisvertrages und der weiterhin vorherrschende Irredentismus.
- Grundlagen und erste Überlegungen für einen Bündnisvertrag: „Tunesische Ohrfeige“ und römische Frage ....
- Der Dreibund und die italienische Politik: Innen- und außenpolitisches Kalkül der neuen Regierung Depretis am Vorabend des Dreibundes
- Der Dreibund und die Irredenta: Die Rezeption der Irredenta in Österreich und Italien und der Beginn der Vertragsverhandlungen
- Dreibund und italienischer Irredentismus: Die ersten Jahre des Bündnisses und das Fortbestehen der Irredenta
- Die neue Irredenta und der Fall Oberdank: Irredentistischer Terrorismus in Italien und Österreich, die reaktionären Maßnahmen der italienischen Regierung und die Hagiographie der irredentistischen „Märtyrer“.
- Politische und publizistische Maßnahmen: Die österreichische und italienische Innen- und Außenpolitik nach der Verhaftung Oberdans und weitere irredentistische Aktionen ..
- Der endgültige Bruch der italienischen Regierung mit der Irredenta: Mancinis öffentliche Abrechnung mit dem Irredentismus und die Auswirkungen auf den Dreibund
- Der Dreibund und die Irredenta nach 1883: „L’interesse e la grandezza del mio paese”
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert das Verhältnis zwischen Italien und der Habsburgermonarchie im Kontext der Italia Irredenta und des Einflusses italienischer Nationalismen. Die Arbeit untersucht die politischen Ereignisse und Handlungen sowie die innen- und außenpolitischen Gegebenheiten vor und nach dem Dreibundvertrag von 1882.
- Die Entwicklung und Ausprägung des italienischen Nationalismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
- Die Italia Irredenta als politisches Konzept und ihre Auswirkungen auf die österreichisch-italienischen Beziehungen
- Der Einfluss des Irredentismus auf die österreichische und italienische Innen- und Außenpolitik
- Die Rolle des Dreibundvertrages im Kontext der Irredenta
- Die Bedeutung der Italia Irredenta im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert den Schwerpunkt der Diplomarbeit, die Analyse der Beziehungen zwischen Italien und der Habsburgermonarchie im Hinblick auf die Italia Irredenta und den Einfluss italienischer Nationalismen. Sie beleuchtet die Diskrepanz zwischen Österreich und Italien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und stellt das Risorgimento als Antithese zur österreichischen Politik dar.
Zwischen italienischer Einigung und politischer Annäherung: Dieses Kapitel untersucht die politischen und gesellschaftlichen Diskrepanzen zwischen Österreich und Italien. Es analysiert die Wahrnehmung der Italiener in Österreich, die Rolle der katholischen Kirche im Trentino und Triest, das Bild der Österreicher in Italien und die Bedeutung des Risorgimento für die Beziehungen zwischen beiden Ländern.
Die Italia Irredenta: Das Kapitel behandelt die Genese der Italia Irredenta und deren politischen Einfluss. Es untersucht die historischen Grundlagen des Irredentismus, die nationalistischen Bestrebungen in Italien und deren Rezeption durch die politischen Eliten der Habsburgermonarchie. Außerdem werden die territorialen Ansprüche des Irredentismus auf die italienischen Gebiete unter österreichischer Herrschaft (Trient, Triest) sowie auf Korsika, Tunesien, Nizza und Malta beleuchtet.
Der Dreibund und die Irredenta: Dieses Kapitel analysiert die Beziehungen zwischen Italien und Österreich während des Dreibundvertrages und den Einfluss des Irredentismus auf diese Beziehungen. Es behandelt die Grundlagen und ersten Überlegungen für einen Bündnisvertrag, die Innen- und Außenpolitik Italiens am Vorabend des Dreibundes, die Rezeption der Irredenta in Österreich und Italien sowie die Verhandlungen über den Vertrag. Außerdem werden die ersten Jahre des Bündnisses und das Fortbestehen des Irredentismus, der Fall Oberdank und dessen Folgen, die politischen und publizistischen Maßnahmen in Österreich und Italien sowie der Bruch der italienischen Regierung mit der Irredenta und dessen Auswirkungen auf den Dreibund analysiert.
Schlüsselwörter
Italien, Österreich, Habsburgermonarchie, Italia Irredenta, Irredentismus, Nationalismus, Risorgimento, Dreibund, Österreichisch-italienische Beziehungen, Politik, Geschichte, 19. Jahrhundert, Trentino, Triest.
Häufig gestellte Fragen
Was war die „Italia Irredenta“?
Es war eine nationalistische Bewegung in Italien, die den Anschluss „unerlöster“ Gebiete (terre irredente) forderte, die unter habsburgischer Herrschaft standen, insbesondere Triest und das Trentino.
Wie beeinflusste der Irredentismus den Dreibund von 1882?
Obwohl Italien, Österreich-Ungarn und Deutschland im Dreibund verbündet waren, belasteten die irredentistischen Forderungen das Verhältnis zwischen Rom und Wien massiv und führten zu ständigen Spannungen.
Wer war Guglielmo Oberdan (Oberdank)?
Oberdan war ein italienischer Irredentist, der ein Attentat auf Kaiser Franz Joseph I. plante. Seine Hinrichtung machte ihn in Italien zum „Märtyrer“ und verschärfte den Konflikt mit Österreich.
Welche Rolle spielte das Risorgimento für diese Entwicklung?
Das Risorgimento war die Bewegung zur Einigung Italiens. Der Irredentismus wurde als deren Fortsetzung betrachtet, da die nationale Einigung ohne die Gebiete im Norden als unvollständig galt.
Warum schloss sich Italien trotz der Spannungen dem Dreibund an?
Italien suchte nach Schutz vor Frankreich (nach der Besetzung Tunesiens) und wollte seine Position als Großmacht festigen, auch wenn dies ein Zweckbündnis mit dem „Erbfeind“ Österreich bedeutete.
Details
- Titel
- Die österreichisch-italienischen Beziehungen vor und nach 1882 unter dem Einfluss italienisch-nationalistischer Ideologien
- Hochschule
- Universität Wien
- Note
- 2
- Autor
- Gregor Lechner Bazzanella (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 113
- Katalognummer
- V1335843
- ISBN (Buch)
- 9783346836175
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- beziehungen einfluss ideologien
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Gregor Lechner Bazzanella (Autor:in), 2016, Die österreichisch-italienischen Beziehungen vor und nach 1882 unter dem Einfluss italienisch-nationalistischer Ideologien, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1335843
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-