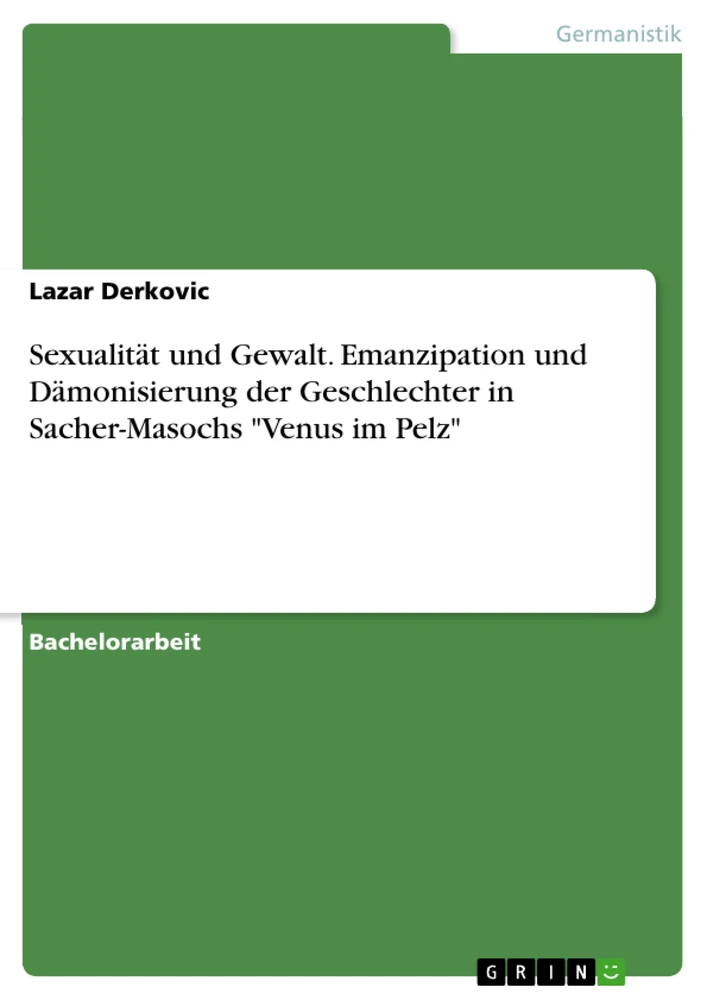
Sexualität und Gewalt. Emanzipation und Dämonisierung der Geschlechter in Sacher-Masochs "Venus im Pelz"
Bachelorarbeit, 2023
48 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Standardwerke und Erkenntnisse - Forschungslager und Unzulänglichkeiten
III. Historischer Kontext: Die Frauenfrage und die Krise der Männlichkeit
IV. Die phallozentrische Prämisse als empirischer Vorspann der folgenden Theorien
V. Die Theorie der hegemonialen Männlichkeit nach Raewyn Connell
VI. Pierre Bourdieus Habituskonzept als praktische Substantiierung Connells
VII. Zusammenfiihrung der Theorien und Genese eines methodischen Leitfadens
VIII. Die geschlechtliche Klassifikation des Merkmals Besitz und die Inbesitznahme der Frau als männliches Ziel
IX. Die Transformation der Ehe auf Probe und die sanfte, aber mächtige Gewalt der Überredung: Der Inbesitznahme Wandas näherkommen
X. Kongruenzen zwischen dem männlichen Habitus und dem Masochismus. Die Initiierung einer masochistischen Ehe
XI. Die Fetischisierung Wandas - Phallus und Macht - Peitschenhiebe als Substitut für Sex und Ausdruck von Bindung
XII. Wandas Loslösung aus der masochistischen Ehe als emanzipatives Moment?
XIII. Alexis Tod und Wandas Rückkehr zur Aspasia: Drei Erziehungsstränge, drei Frauen, drei Spiegel und die weibliche Identitätslosigkeit
XIV. Männliche Kritik am Männlichen - Eine verkappte emanzipative Botschaft?
XV. Severins männliche Reanimation am Ideal der hegemonialen Männlichkeit
XVI. Schluss
Literaturverzeichnis
Primärtext
Sekundärtexte
Intemetressourcen
Details
- Titel
- Sexualität und Gewalt. Emanzipation und Dämonisierung der Geschlechter in Sacher-Masochs "Venus im Pelz"
- Hochschule
- Universität Paderborn (Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft)
- Note
- 1,0
- Autor
- Lazar Derkovic (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2023
- Seiten
- 48
- Katalognummer
- V1335853
- ISBN (Buch)
- 9783346836137
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Masochismus Sadismus Sacher-Masoch Venus im Pelz Hegemoniale Männlichkeit Phallogozentrismus Habitus Freud Irigaray Lacan Emanzipation Sexualität Iran Gewalt Geschlechterordnung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Lazar Derkovic (Autor:in), 2023, Sexualität und Gewalt. Emanzipation und Dämonisierung der Geschlechter in Sacher-Masochs "Venus im Pelz", München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1335853
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









