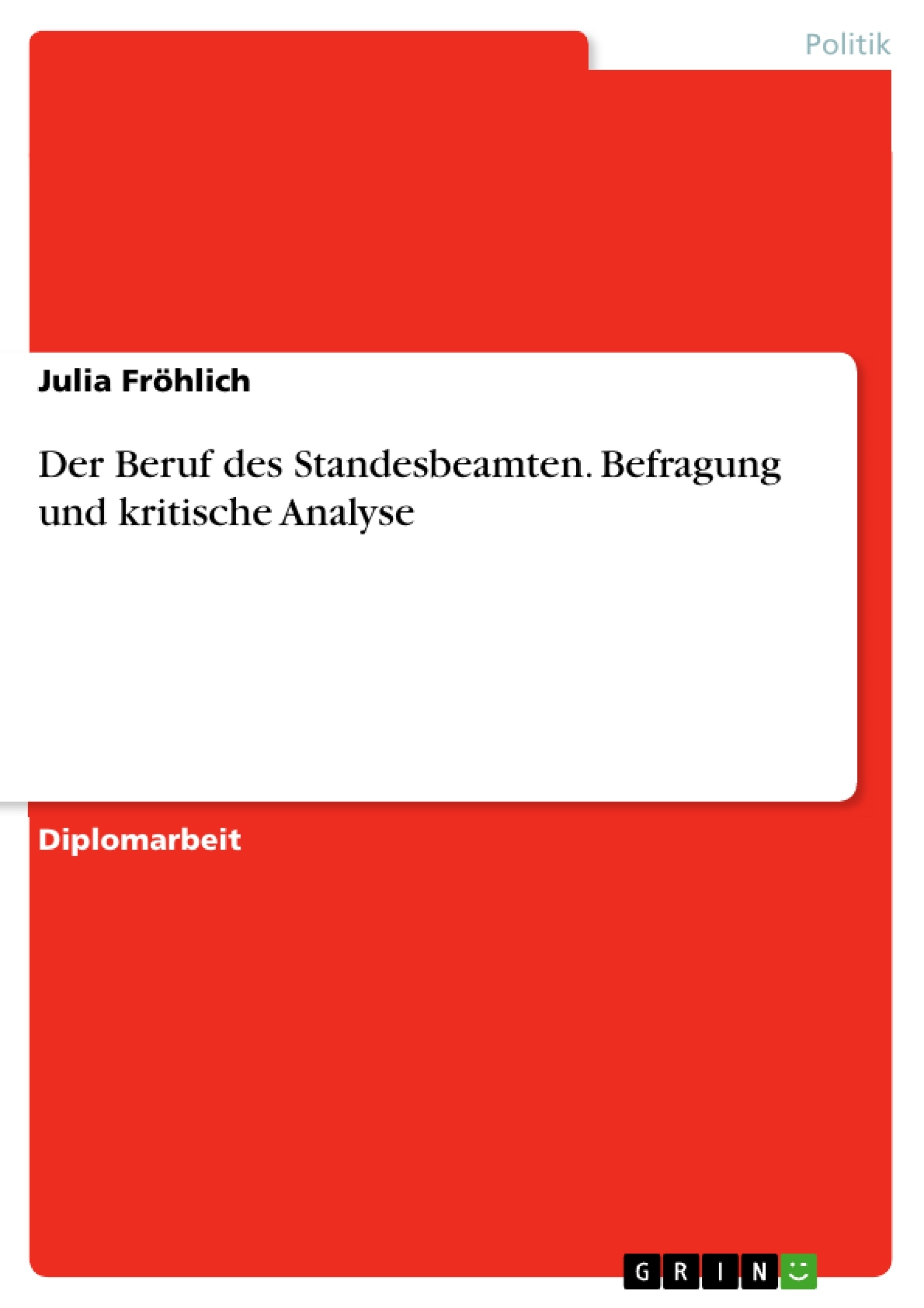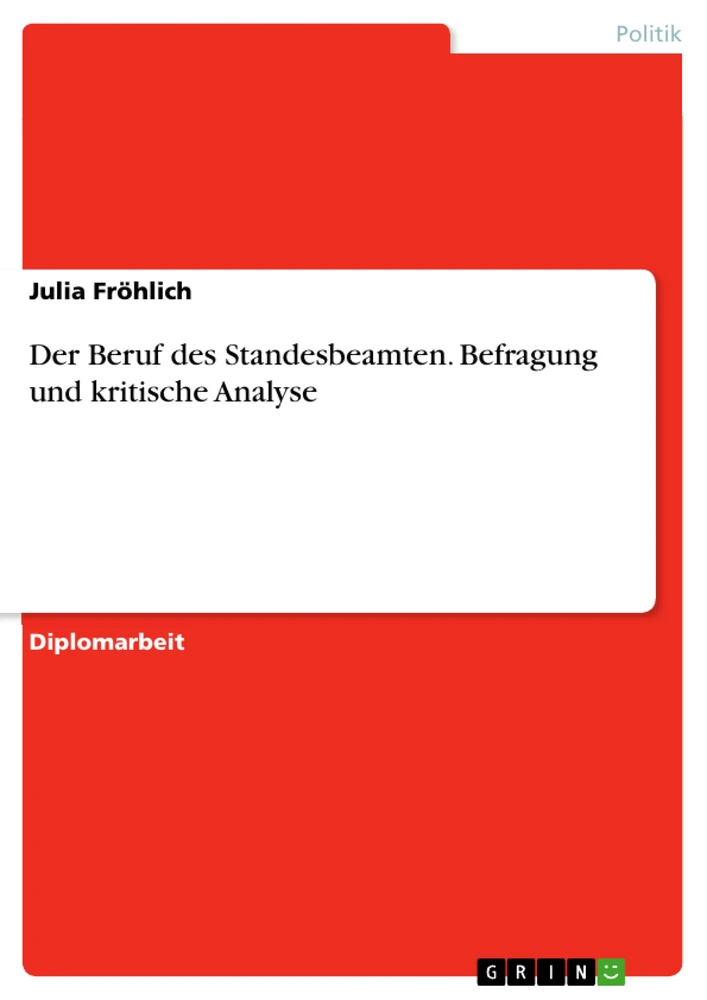
Der Beruf des Standesbeamten. Befragung und kritische Analyse
Diplomarbeit, 2018
45 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zur Forschungsfrage
- Traumjob Standesbeamter?
- Berufsbild Standesbeamter
- Problem
- Methode
- Zielgruppe der Befragung
- Konstruktion des Fragebogens
- Optimierung des Fragebogens
- Durchführung der Befragung
- Ergebnisse
- Software
- Kodierung des Fragebogens
- Grundauswertung
- Prüfen von Zusammenhängen
- Diskussion
- Hinweis zur Interpretation von Korrelationen
- Vergleich der verwendeten Methoden
- Zwischenfazit zur gemessenen Berufszufriedenheit
- Ergänzende Items
- Personenbezogene Daten
- Repräsentativität der Studie
- Hauptgütekriterien
- Fazit und Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Berufszufriedenheit von Standesbeamten in Bayern. Die Arbeit beleuchtet die Erwartungen an den Traumjob und vergleicht diese mit der aktuellen Realität der Berufstätigkeit. Die Untersuchung befasst sich mit der Frage, inwiefern der Beruf des Standesbeamten den Vorstellungen von einem Traumjob entspricht und welche Faktoren die Berufszufriedenheit beeinflussen.
- Berufsbild und Anforderungen des Standesbeamten
- Berufszufriedenheit und ihre Einflussfaktoren
- Vergleich von Erwartungen und Realität
- Methoden zur Analyse von Berufszufriedenheit
- Repräsentativität und Gütekriterien der Studie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Untersuchung darlegt. Im ersten Kapitel wird das Berufsbild des Standesbeamten beleuchtet, einschließlich der Aufgaben, Kompetenzen und Anforderungen. Im zweiten Kapitel wird das Problem der Berufszufriedenheit im Allgemeinen und im Speziellen im Kontext des Standesbeamtenberufs thematisiert.
Kapitel III beschreibt die Methode der Untersuchung, die auf einer Befragung von Standesbeamten in Bayern basiert. Das Kapitel erläutert die Zielgruppe, die Konstruktion des Fragebogens, die Optimierung und die Durchführung der Befragung. Kapitel IV präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, die sowohl quantitative als auch qualitative Daten beinhalten. Das Kapitel analysiert die Ergebnisse im Hinblick auf die Berufszufriedenheit und die Einflussfaktoren.
Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert. Es wird auf die Interpretation der Ergebnisse eingegangen und die Stärken und Schwächen der Untersuchung betrachtet. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse der Untersuchung zusammenfasst und Empfehlungen für die Praxis ableitet.
Schlüsselwörter
Berufszufriedenheit, Standesbeamter, Traumjob, Befragung, Qualitative Forschung, Quantitative Forschung, Berufsbild, Arbeitsbedingungen, Erwartungen, Realität, Einflussfaktoren, Repäsentativität, Gütekriterien.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Beruf des Standesbeamten wirklich ein „Traumjob“?
Die Diplomarbeit untersucht dieses Klischee kritisch durch eine Befragung bayerischer Standesbeamter und vergleicht Erwartungen mit der tatsächlichen Berufszufriedenheit.
Wie wurde die Berufszufriedenheit in der Studie gemessen?
Die Messung erfolgte über zwei Wege: einen Soll-Ist-Abgleich spezifischer Berufsaspekte zur Ermittlung einer Gesamtzufriedenheit sowie eine direkte Frage nach der Einschätzung als „Traumjob“.
Welche Faktoren beeinflussen die Zufriedenheit von Standesbeamten?
Die Arbeit analysiert Einzelaspekte wie Arbeitsbedingungen, Aufgabenfelder und die Übereinstimmung von persönlichen Erwartungen mit der beruflichen Realität.
Welche Methodik wurde für die Untersuchung genutzt?
Es handelt sich um eine Lotstudie, die quantitative und qualitative Daten aus Fragebögen kombiniert, um Zusammenhänge zwischen Personengruppen und ihrer Zufriedenheit zu prüfen.
An wen richtet sich die Studie?
Die Zielgruppe der Befragung waren Standesbeamte in Bayern, wobei auch die Repräsentativität und die Hauptgütekriterien der Studie diskutiert werden.
Details
- Titel
- Der Beruf des Standesbeamten. Befragung und kritische Analyse
- Veranstaltung
- Sozialwissenschaftlichen Grundlagen des Verwaltungshandelns
- Note
- 1,0
- Autor
- Julia Fröhlich (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 45
- Katalognummer
- V1336553
- ISBN (Buch)
- 9783346835611
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Berufswahl Berufszufriedenheit Standesbeamte verwaltung arbeitszufriedenheit Arbeitsmotivation
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Julia Fröhlich (Autor:in), 2018, Der Beruf des Standesbeamten. Befragung und kritische Analyse, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1336553
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-