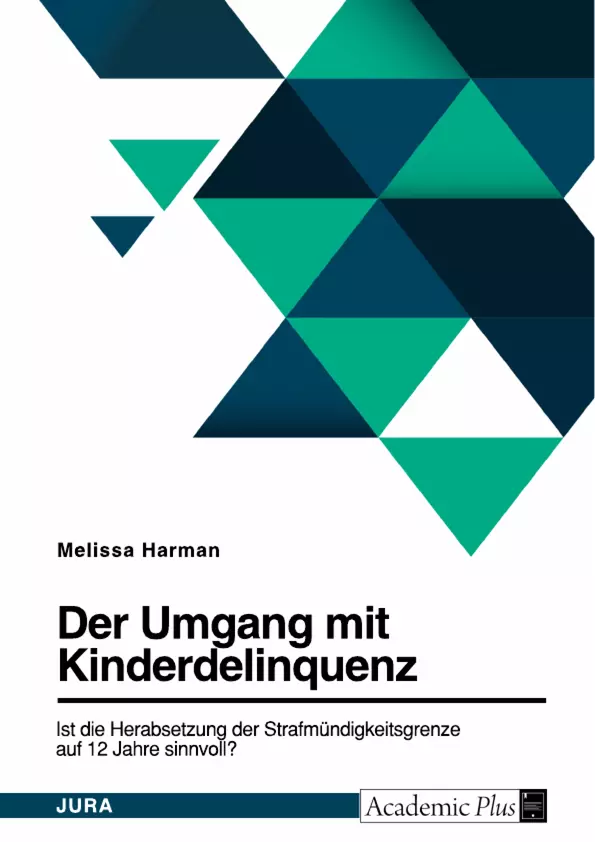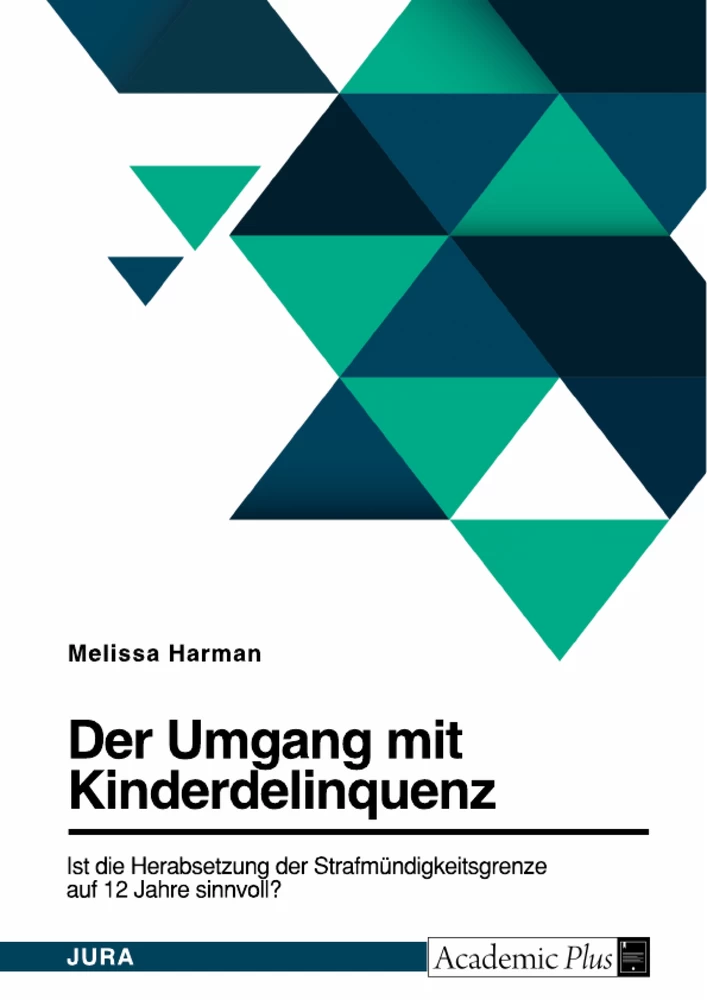
Die Diskussion um die Herabsetzung der Strafmündigkeitsgrenze auf 12 Jahre in Deutschland
Bachelorarbeit, 2020
66 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung der Strafmündigkeitsgrenze in Deutschland
- Die Strafmündigkeitsgrenze im historischen Kontext
- Aktuelle Debatte um die Herabsetzung der Strafmündigkeitsgrenze
- Argumente für die Herabsetzung der Strafmündigkeitsgrenze
- Stärkung des Rechtssystems und der Rechtsordnung
- Präventive Wirkung und Abschreckungspotenzial
- Schutz der Gesellschaft und der Opfer
- Sicherung der Verhältnismäßigkeit von Strafe und Schuld
- Argumente gegen die Herabsetzung der Strafmündigkeitsgrenze
- Entwicklungsstand und Reifegrad von Kindern und Jugendlichen
- Risiken der Stigmatisierung und der Kriminalisierung
- Möglichkeiten der Jugendarbeit und der sozialen Prävention
- Potenzielle Effekte auf die Kriminalitätsentwicklung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die aktuelle Diskussion um die Herabsetzung der Strafmündigkeitsgrenze in Deutschland und beleuchtet die Argumente für und gegen eine Änderung des geltenden Rechts. Sie untersucht die Entwicklung der Strafmündigkeitsgrenze in einem historischen Kontext und beleuchtet die aktuellen Herausforderungen im Bereich der Jugendkriminalität.
- Entwicklung der Strafmündigkeitsgrenze in Deutschland
- Argumente für und gegen die Herabsetzung der Strafmündigkeitsgrenze
- Herausforderungen der Jugendkriminalität
- Möglichkeiten der Prävention und Intervention
- Rechtliche und gesellschaftliche Auswirkungen einer Herabsetzung der Strafmündigkeitsgrenze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas sowie die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit erläutert. Anschließend wird die Entwicklung der Strafmündigkeitsgrenze in Deutschland im historischen Kontext beleuchtet. Dabei werden die wichtigsten Meilensteine und die zugrundeliegenden politischen und gesellschaftlichen Strömungen dargestellt. Das dritte Kapitel widmet sich den Argumenten für die Herabsetzung der Strafmündigkeitsgrenze. Hier werden die verschiedenen Perspektiven und Begründungen für eine Änderung des geltenden Rechts präsentiert. Das vierte Kapitel analysiert die Argumente gegen die Herabsetzung der Strafmündigkeitsgrenze. Es werden die Bedenken und kritischen Punkte hinsichtlich einer Änderung des geltenden Rechts dargelegt.
Schlüsselwörter
Strafmündigkeitsgrenze, Jugendkriminalität, Herabsetzung, Strafrecht, Jugendstrafrecht, Entwicklung, Reifegrad, Prävention, Intervention, Stigmatisierung, Kriminalisierung, Rechtssystem, Rechtsordnung, Gesellschaft, Opfer, Verhältnismäßigkeit, Strafe, Schuld.
Details
- Titel
- Die Diskussion um die Herabsetzung der Strafmündigkeitsgrenze auf 12 Jahre in Deutschland
- Hochschule
- Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
- Note
- 2,0
- Autor
- Melissa Harman (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 66
- Katalognummer
- V1339293
- ISBN (Buch)
- 9783346851963
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Mit Academic Plus bietet GRIN ein eigenes Imprint für herausragende Abschlussarbeiten aus verschiedenen Fachbereichen. Alle Titel werden von der GRIN-Redaktion geprüft und ausgewählt. Unsere Autor:innen greifen in ihren Publikationen aktuelle Themen und Fragestellungen auf, die im Mittelpunkt gesellschaftlicher Diskussionen stehen. Sie liefern fundierte Informationen, präzise Analysen und konkrete Lösungsvorschläge für Wissenschaft und Forschung.
- Schlagworte
- Strafrecht Rechtswissenschaften Strafmündigkeit Kinder Kinderdelinquenz Straftaten Strafmündigkeitsgrenze Jugendstrafrecht polizeiliche Kriminalstatistik
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Melissa Harman (Autor:in), 2020, Die Diskussion um die Herabsetzung der Strafmündigkeitsgrenze auf 12 Jahre in Deutschland, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1339293
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-