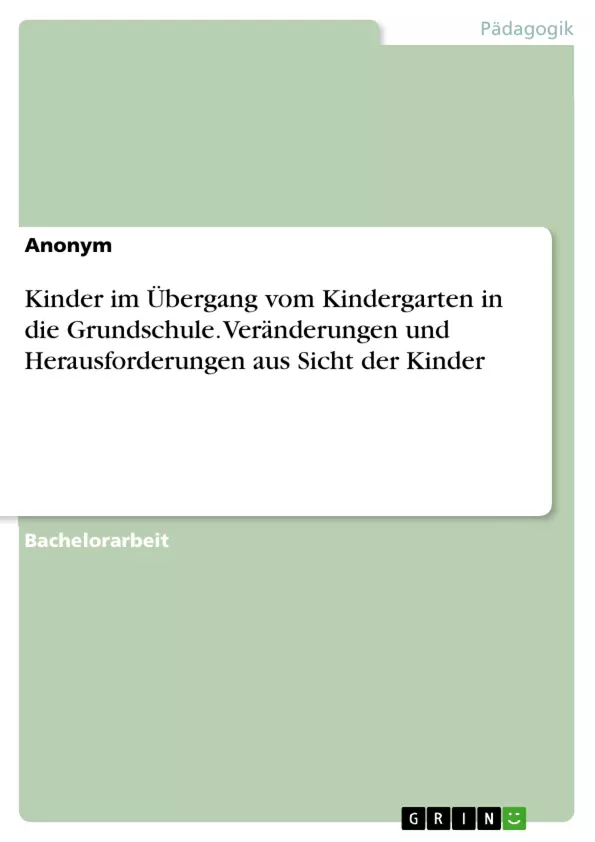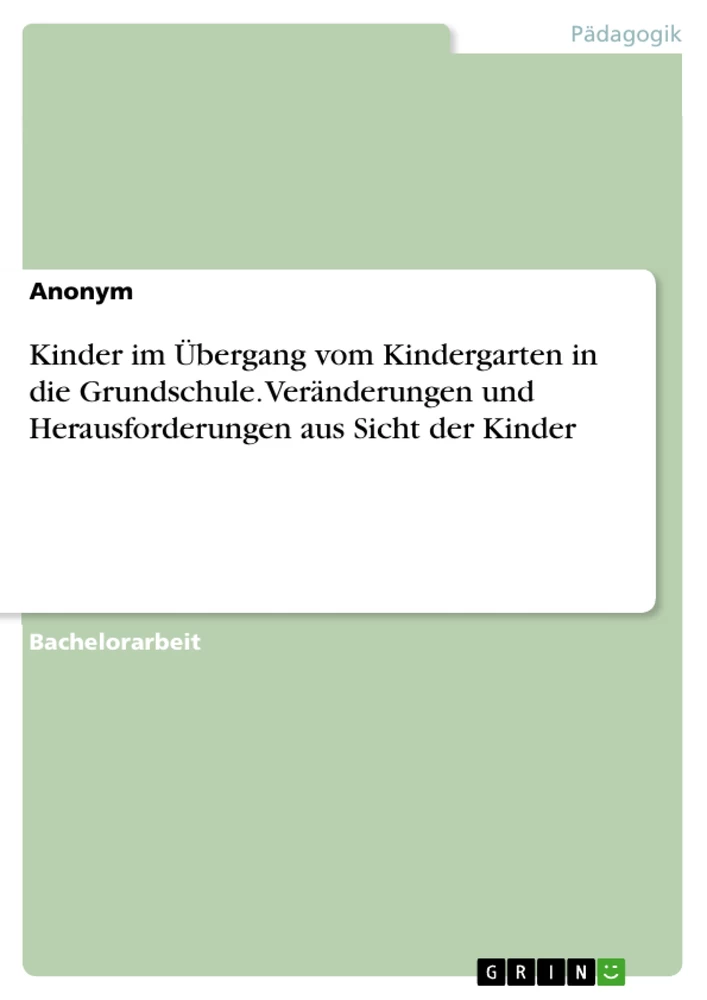
Kinder im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. Veränderungen und Herausforderungen aus Sicht der Kinder
Bachelorarbeit, 2022
45 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Begriffsbestimmungen: Übergang und Transition
- 1.1 Übergang - der Versuch einer Definition
- 1.2 Der Transitionsbegriff
- 1.3 Der Übergang in die Grundschule für Kindergartenkinder
- 2. Veränderungen beim Übergang in die Grundschule
- 2.1 Institutionen im Vergleich: Kindergarten - Grundschule
- 2.2 Veränderungen beim Kind und in seiner Umgebung
- 2.3 Veränderungen auf individueller, interaktionaler und kontextueller Ebene
- 3. Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen als Herausforderungen
- 3.1 Kognitive Entwicklung
- 3.2 Entwicklung des Lernens
- 3.3 Entwicklung des Spielverhaltens
- 3.4 Sprachentwicklung
- 3.5 Entwicklung der Motivation
- 4. Stand der Forschung – Wie Kinder den Übergang sehen
- 4.1 Übersicht über die Studien
- 4.2 Lernen und Spielen in den Institutionen
- 4.2.1 Spielen in den Institutionen
- 4.2.2 Sicht der Kinder auf das Lernen in den Institutionen
- 4.3 Beziehungen von Kindern beim Übergang
- 4.3.1 Beziehung zu anderen Kindern
- 4.3.2 Beziehungen zu Erwachsenen
- 4.3.3 Familiäre Beziehungen
- 4.4 Institutionen aus Sicht der Kinder
- 4.4.1 Sicht auf die Schule
- 4.4.2 Das Kinderbildungshaus mit Unterscheidung zum Kindergarten und der Grundschule
- 4.4.3 Sicht auf den Kindergarten
- 5. Gegenüberstellung der theoretischen Erkenntnisse und des aktuellen Forschungsstands
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Sichtweisen von Kindern auf den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. Ziel ist es, die Herausforderungen aufzuzeigen, vor denen Kinder im Übergangsprozess stehen und wie sie diesen erleben. Die Arbeit analysiert drei Studien, die sich mit den Perspektiven von Kindern auf Lernen, Spielen, Beziehungen und Institutionen auseinandersetzen.
- Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule als kritisches Lebensereignis
- Veränderungen und Herausforderungen im institutionellen, sozialen und individuellen Kontext
- Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen als notwendige Voraussetzungen für den Übergang
- Die Sichtweise von Kindern auf Lernen, Spielen und Beziehungen im Übergangsprozess
- Die Rolle der Institutionen Kindergarten und Grundschule aus der Perspektive der Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Die ersten drei Kapitel der Arbeit befassen sich mit dem theoretischen Hintergrund des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule. Kapitel 1 definiert die Begriffe „Übergang“ und „Transition“ und erläutert die Besonderheiten des Übergangs in die Grundschule. Kapitel 2 analysiert die Veränderungen, die Kinder beim Übergang in die Grundschule erleben, sowohl auf institutioneller als auch auf individueller Ebene. Kapitel 3 beschreibt die Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen, die für Kinder im Übergangsprozess von Bedeutung sind.
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse dreier Studien, die sich mit den Perspektiven von Kindern auf den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule auseinandersetzen. Die Studien beleuchten die Sichtweisen der Kinder auf Lernen, Spielen, Beziehungen und Institutionen, sowohl vor als auch nach dem Schuleintritt.
Schlüsselwörter
Kindergarten, Grundschule, Übergang, Transition, Entwicklung, Lernen, Spielen, Beziehungen, Kinderperspektive, institutionelle Veränderungen, individuelle Herausforderungen, Forschungsstand, Studienanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie erleben Kinder den Übergang in die Grundschule?
Kinder nehmen den Übergang oft als fordernde Aufgabe wahr, die mit Gefühlen wie Neugier, aber auch Unsicherheit und Ängstlichkeit verbunden ist.
Was ist der Unterschied zwischen „Übergang“ und „Transition“?
Transition beschreibt den komplexen Prozess der Veränderung der Identität und der sozialen Beziehungen während eines Bildungswechsels.
Welche Herausforderungen sehen Kinder beim Lernen?
Kinder unterscheiden stark zwischen dem freien Spielen im Kindergarten und dem strukturierten Lernen in der Schule, was eine Umstellung der Motivation erfordert.
Wie verändern sich soziale Beziehungen im Übergang?
Bestehende Freundschaften werden auf die Probe gestellt, und es müssen neue Beziehungen zu Lehrkräften und Mitschülern aufgebaut werden.
Warum ist die Sicht der Kinder in der Forschung wichtig?
Kinder sind die Experten für ihren eigenen Übergang. Ihre Perspektive hilft dabei, den Schuleintritt kindgerechter zu gestalten und Ängste abzubauen.
Details
- Titel
- Kinder im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. Veränderungen und Herausforderungen aus Sicht der Kinder
- Hochschule
- Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
- Note
- 1,7
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 45
- Katalognummer
- V1355525
- ISBN (Buch)
- 9783346869418
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Kinder Übergang Kindergarten Grundschule Kindergarten - Grundschule Kita Veränderungen Herausforderungen Forschungsstand
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Kinder im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. Veränderungen und Herausforderungen aus Sicht der Kinder, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1355525
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-