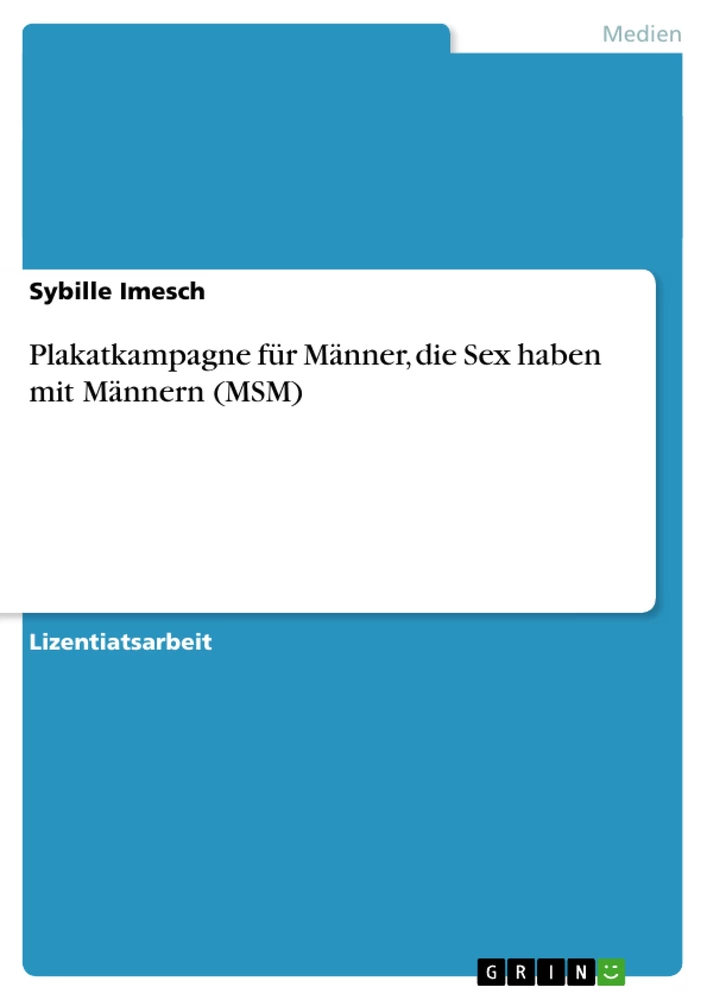
Plakatkampagne für Männer, die Sex haben mit Männern (MSM)
Lizentiatsarbeit, 2005
204 Seiten, Note: 5,7 (insigni cum laude)
Medien / Kommunikation - Public Relations, Werbung, Marketing, Social Media
Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
Danksagungen
Vorwort
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. EINLEITUNG
1.1 Problemstellung und Ausgangslage
1.2 Zielsetzung der Arbeit
2. AIDS
2.1 Geschichte und Grundlage
2.2 Aids-Prävention
2.1.1 Gründe für einen Anstieg an Infektionen
2.2.1.1 Gründe bei der Zielgruppe MSM
2.2.2 Kommunikationsebenen
2.2.2.1 Zielgruppenspezifische Prävention
2.2.3 Herausforderungen für MSM
2.3 Umsetzung für MSM
2.3.1 Regionale Projekte
2.3.3 Nationale Projekte
2.4 Evaluation
2.4.1 Evaluation bei MSM
2.4.2 Soziodemografische Merkmale
2.4.3 Konfrontation mit HIV/Aids
2.4.4 Saunabesucher
2.4.5 Präventivverhalten
2.4.6 Informationsquellen
3. PLAKAT
3.1 Plakatwerbung
3.1.1 Werbeausgaben in der Schweiz
3.1.2 Vor- und Nachteile der Plakatwerbung
3.2 Plakatwirkung
3.2.1 Ziele der Werbewirkung
3.2.2 Abgrenzung nach Studientypen
3.2.2.1 Werbeträger
3.2.3 Ziele der Plakatwirkungsforschung
3.2.4 Neuere Ansätze zur Plakatwirkungsmessung
3.2.5 Wirkungsebenen
3.3 Werbewirkungsmodelle
3.3.1 Stufenmodelle der Werbewirkung
3.3.1.1 AIDA-Modell
3.3.1.2 Das 6-Stufenmodell von Lavidge und Steiner
3.3.1.3 Modell von McGuire
3.3.2 Hierarchie-von-Effekten Modell
3.3.3 Alternative-Wege-Modell von Batra und Ray
3.3.4 Das duale Vermittlungssystem
3.3.5 Hypothesenbildung
4. UMFRAGE
4.1 Untersuchungsplanung und Datenerhebung
4.1.1 Erhebungsdesign und -methode
4.1.2 Stichprobe
4.1.3 Datenauswertung
4.2 Ergebnisse
4.2.1 Auswertung der offenen Fragen
4.2.2 Auswertung der geschlossenen Fragen
4.2.3 Überprüfung der Hypothesen/Auswertung
4.3 Handlungsempfehlungen für eine nächste Kampagne
5. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN
6. LITERATURVERZEICHNIS
7. ANHANG
DANKSAGUNGEN
An dieser Stelle möchte allen herzlich danken, welche mir bei der Erstellung dieser Arbeit in verschiedenster Art und Weise geholfen haben.
Ein ganz grosses Dankeschön geht an Herrn Alex Sibilla, welcher mir die Arbeit im Bereich des Bundesamtes für Gesundheit ermöglichte. Zudem danke ich den Saunabesitzern Herrn Erich Zgraggen, Herrn Alain Henguely und Herrn Hanspeter Steger, die sich Zeit genommen haben, meine Fragebogen an ihre Kunden zu verteilen und ausfüllen zu lassen.
Mein Dank geht ebenfalls an Herrn Professor Louis Bosshart und seinen Assistenten Herrn Daniel Beck für die fachliche Unterstützung, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen hat.
Ein besonderer Dank geht zudem an meine Geschwister Brigitte und Sebastian für die gewissenhafte und wertvolle Durchsicht der Arbeit.
Im Speziellen danke ich Frau Sandra Brechbühl für ihr aufmerksames Korrekturlesen.
Die vorliegende Arbeit widme ich meiner Familie, die mir eine wertvolle Ausbildung ermöglicht hat. Dafür bin ich sehr dankbar.
VORWORT
Die Sujets der Stopp-Aids-Plakate wollen provozieren und lösen oft Debatten aus. Das BAG (Bundesamt für Gesundheit) informierte mich, dass die gesamtschweizerischen Kampagnen von Stopp-Aids regelmässig evaluiert werden.[1] Die zielgruppenspezifische Kampagne für Männer, die Sex haben mit Männern (MSM) wurde dabei vernachlässigt.
Das Interesse war vorhanden, diese Kampagne zu untersuchen. Es wurden zwei Plakate speziell für MSM konzipiert. Zum einen, weil in dieser Gruppe eine hohe Ansteckungsgefahr und somit ein hoher Präventionsbedarf besteht. Zum anderen, weil bei dieser Gruppe die Plakate etwas provokativer ausfallen konnten als bei der Gesamtbevölkerung und deshalb ein grösserer Spielraum für Gestalterisches bleibt. Zudem werden bei dieser Gruppe oft erste Anzeichen einer Gesamtentwicklung beobachtet.
Ich selber fand die Untersuchung zweier Plakatsujets ein spannendes Thema und war neugierig, ob die Plakate einen bleibenden Eindruck auf die Besucher von Schwulensaunas hinterlassen habe.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spass bei der Lektüre.
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abb.1 Aufbau der Arbeit
Abb.2 Aidsfälle in der Schweiz nach Ansteckungsweg und Diagnosejahr.
Abb.3 Ziele und Interventionsebenen der Aidsprävention
Abb.4 „STOP AIDS“ Logo.
Abb.5 Kosten der Medienkampagne pro Jahr. (inkl. Website www.stopaids.ch)
Abb.6 Altersverteilung bei Männern mit positiven HIV-Tests nach Ansteckungsweg seit 1997
Abb.7 Plakat Menpower
Abb.8 Plakat „Piktogramme“ in Schwulensaunas.
Abb.9 Region der Nationalität an HIV-Arztmeldungen im Jahr 2002 für MSM.
Abb.10 Schätzung der Anzahl neu diagnostizierter HIV-Infektionen bei MSM
Abb.11 Anzahl positiver HIV-Tests im Jahr 2002.
Abb.12 Labormeldungen positiver HIV-Testresultate nach Kanton/Region.
Abb.13 Vergleich der Werbeumsätze in Mio. Fr. gerundet
Abb.14 grafischer Vergleich von Werbeumsätze für das Jahr 2003.
Abb.15 Forschungsrahmen.
Abb.16 Beurteilungskriterien für Werbemittel.
Abb.17 Verschiedene Ebenen der Wirksamkeit einer Kommunikation.
Abb.18 Drei-Hierarchie-Effekten-Modellen nach Ray.
Abb. 19 Das Alternative-Wege-Modell nach Batra und Ray
Abb. 20 Leistungswerte von Plakaten in Kombination mit anderen Medien
Abb. 21 Räumlichkeiten der Sauna Pink Beach
Abb. 22 Räumlichkeiten der Sauna Moustache“.
Abb. 23 Anzahl der befragten Besucher der Schwulensaunas.
Abb. 24 Beachtung der Medien
Abb. 25 Medianbeachtung
Abb. 26 Beachtung in der Sauna
Abb. 27 Aufmerksamkeit in der Sauna
Abb. 28 Erinnerung an die Plakate
Abb. 28 Erinnerung Piktogramme/Saunabesuch
Abb. 29 Erinnerung Menpower/Saunabesuch
Abb. 30 Erinnerung der Plakate/Sensibilisierung
Abb. 31 Über Plakate gesprochen/Sensibilisierung
Abb. 32 Kampagne/Sensibilisierung
Abb. 33 Informationsbeschaffung/Sensibilisierung
Abb. 34 Note für die Plakate
Abb. 35 Werte für die Plakate
Abb. 36 Note Menpower/Merkmale
Abb. 37 Note Piktogramme/Merkmale
Abb. 39 Rangfolge der Präventionsthemen in Städten von Kalifornien
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
1.1 Problemstellung und Ausgangslage
In den Jahren 2001 und 2002 verzeichnete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erstmals seit 1991 eine massive Zunahme der HIV-und Aids-Fälle. Dass eine erfolgreiche Prävention ihre Wirksamkeit nicht auf ewig gebucht hat, war abzusehen. Zwar sanken die epidemiologischen Zahlen noch, und verschiedene Studien attestierten ein hohes Schutzverhalten in allen Bevölkerungsteilen. An der Front wurden jedoch erste Stimmen vernommen, die von einer bislang ungewohnten Unachtsamkeit sprachen. Wie schwerwiegend sich eine solche Verhaltensänderung auswirken kann, zeigt der Bereich für Männer, die Sex mit Männern haben (MSM). Mit einem Anstieg von HIV-Erstdiagnosen von einem Drittel[2] war eine Entwicklung zu beobachten, welche die Alarmglocken klingeln liess. Der Präventionsbedarf ist zur Zeit am höchsten für Homosexuelle und Männer, die ungeschützten Analverkehr praktizieren.
In der Schwulenszene waren das BAG und die Aids-Hilfe Schweiz (AHS) schon seit längerer Zeit nicht mehr mit Präventionsbotschaften sichtbar gewesen. Es wurde davon ausgegangen, dass die Präventionsbotschaft bekannt ist und sich Plakat- und Inseratenkampagnen deshalb erübrigen würden. Die seit 2001 steigenden Zahlen haben veranlasst, zusätzlich zur gesamtschweizerischen Stopp-Aids-Kampagne zielgruppenorientierte Massnahmen einzuleiten. So wurden die Besucher schwuler Sexlokale mit speziellen Plakaten vor Ort auf die Problematik angesprochen.
Die Plakate waren zum einen das Plakat „Menpower“.[3] Zum anderen zwei Plakate mit Piktogrammen, welche einer gesamtschweizerischen Kampagne ähnelte[4].
1.2 Zielsetzung der Arbeit
Die vorliegende Arbeit ist eine rezipientenorientierte Evaluation, welche eine Befragung in der Romandie und der Deutschschweiz vorsieht. Sie will zwei Plakate vergleichen, welche speziell für die Gruppe der MSM konzipiert wurden.
Dabei stellen sich zunächst ganz grundlegende Fragen wie etwa, warum die HIV-Aids-Fälle in den letzten beiden Jahren bei MSM zunahmen. Oder die Frage, welche Strategien und Herausforderungen das BAG in der Aidsprävention verfolgt. Welche Projekte gibt es speziell für MSM?
Zudem werden Fragen bezüglich der Zielgruppe der MSM gestellt: Welche spezifischen Merkmale hat die Zielgruppe? Was für Erkenntnisse hatten andere Evaluationsstudien über MSM zutage gebracht?
Für das Plakat als Medium stellen sich folgende Fragen: Was für Vor- und Nachteile hat die Plakatwerbung? Wie wird die Plakatwirkung untersucht? Welche Werbewirkungsmodelle gibt es und was erklären sie?
Schliesslich ergeben sich für meine Umfrage folgende Fragen: Erreichen die Botschaften der Plakate das intendierte Zielpublikum? Erinnern sich die schwulen Saunagäste an die Plakate? Werden diese beachtet und wird darüber gesprochen?
Wie kommt das Plakat beim Zielpublikum an? Welches der Plakate gefällt besser und warum? Gibt es beim Gefallen Unterschiede zwischen Schweizern und Nicht-Schweizern, zwischen Jungen und Alten oder zwischen Leuten mit einer guten oder einen schlechten Schulbildung? Und als Letztes: Waren die beiden Plakate erfolgreich? Wird eine weitere Kampagne speziell für MSM überhaupt erwünscht?
Am Ende meiner Lizentiatsarbeit sollten die oben gestellten Fragen beantwortet sein. Dazu werden Hypothesen im theoretischen Teil aufgestellt und anhand der Fragebogen überprüft.
1.3 Aufbau der Arbeit
Am Anfang der Arbeit steht eine Einleitung (Kapitel 1). Diese enthält neben einigen allgemeinen Bemerkungen zum Thema die Problemstellung sowie die Zielsetzung und Angaben zum Aufbau der Arbeit. Die Lizentiatsarbeit besteht aus sieben Kapiteln. Abbildung 1 zeigt die Kapitelfolge:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1 Aufbau der Arbeit.
In Kapitel 2 wird auf die Problematik von Aids eingegangen. Das Unterkapitel 2.1 zeigt einen geschichtlichen Abriss über die letzen Jahre der Aids-Präventionsarbeit. Unterkapitel 2.2 ist etwas ausführlicher. Zunächst werden Gründe aufgezählt, welche zu einer Zunahme von Aids führten. Danach werden drei Interventionsebenen bei der Prävention unterschieden, wobei z.B. die Stopp-Aids-Kampagne für die Gesamtbevölkerung ist. Es folgen Herausforderungen und Ziele des BAG. Hierbei wird auf die zielgruppenspezifische Prävention der MSM fokussiert. Das Unterkapitel 2.3 beschäftigt sich mit der Umsetzung der formulierten Ziele für MSM. Dabei werden nationale und regionale Projekte unterschieden. Im Unterkapitel 2.4 werden die Ergebnisse von Evaluationsstudien präsentiert, die im Zusammenhang mit MSM stehen. Dabei wird der Bezug zum empirischen Teil hergestellt, genauer auf die Fragen 25 bis 35 im Fragebogen.[5]
In Kapitel 3 wird das Plakat thematisiert. So stellt das Unterkapitel 3.1 das Plakat als Medium vor; es werden Vor- und Nachteile aufgezählt und die jährlichen Ausgaben für die Plakatwerbung angegeben. In Unterkapitel 3.2 wird zunächst auf die Plakatwirkung eingegangen. Dazu werden vier Studientypen vorgestellt, wobei v.a. zwischen Werbeträger und Werbemittel unterschieden wird. Danach steht die Plakatwirkungsforschung mit ihren speziellen Rahmenbedingungen im Vordergrund. Hier wird zuerst Allgemeines zur Plakatwirkungsforschung genannt, anschliessend Ziele sowie neuere Ansätze der Plakatmessung. Nachdem die Autorin im siebten Kapitel noch auf die Wirkungsebenen zu sprechen kommt, werden im Unterkapitel 3.3 Werbewirkungsmodelle präsentiert. Am Ende des dritten Kapitels steht die Hypothesenbildung.
In Kapitel 4 werden die aus dem Theorieteil entwickelten Forschungsfragen aufgeführt und das Vorgehen und die Methodik zur empirischen Studie erklärt. Die Ergebnisse aus der empirischen Untersuchung werden im Unterkapitel 4.3 angegeben und ausführlich diskutiert. Sie sind thematisch gegliedert. Durch die Auswertung der Fragebogen sollen die unter Kapitel 3.3 formulierten Hypothesen bestätigt oder abgelehnt werden. Zudem gibt die Verfasserin Handlungsempfehlungen für die Optimierung einer nächsten MSM-spezifischen Kampagne.
In Kapitel 5 werden abschliessende Bemerkungen gemacht. Das Literaturverzeichnis findet sich im Kapitel 6. Abgerundet wird die Arbeit mit dem Anhang als 7. Kapitel. Dort finden sich die in der Arbeit erwähnten Zusatzmaterialien.
2. Aids
Der unbekannten Seuche fielen vorwiegend junge Männer zum Opfer. Bei den ersten Fällen war eine Gemeinsamkeit festzustellen[6]: Die Opfer waren Homosexuelle, die in zwei grossen Zentren der USA lebten. (nämlich New York und San Francisco). Die unheimliche und unerklärliche Krankheit erhielt daher zunächst den Namen GRID, Gay Related Immunodeficiency, zu Deutsch etwa “in Verbindung mit Homosexualität auftretende Immunschwäche”. Selbst wenn sich der Name nicht lange hielt, so stellte er doch die Verbindung zwischen einer ansteckenden, tödlichen Krankheit und Homosexualität her. Die Immunschwäche wurde zur „Schwulenseuche“ erklärt. [7]
Die Krankheit wurde 1982 in Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome) umgetauft. Bis Mitte der achtziger Jahre waren die Erkrankung, der Erreger HIV (Human Immunodeficiency Virus) und die Übertragungswege identifiziert.
2.1 Geschichte und Grundlage
Die Einführung von Kombinationstherapien markierte in den 90er Jahren den Wendepunkt in der Aids-Epidemie der westlichen Länder. Dank den neuen Therapien konnte der Verlauf einer HIV-Infektion bei vielen Betroffenen in Richtung einer chronischen Krankheit verschoben werden. Die Zahlen von aidskranken und an Aids verstorbenen Menschen sanken massiv.
Das Schutzverhalten in der Allgemeinbevölkerung liegt heute auf einem hohen Niveau. In vielen Zielgruppen konnte sich ein risikoarmes Verhalten etablieren. Viele Menschen mit HIV können dank der Kombinationstherapie über lange Zeit ohne Symptome leben. Somit hat HIV den Charakter einer schweren chronischen Erkrankung erhalten. Trotzdem gilt weiterhin:
Aids ist eine tödliche Infektionskrankheit ohne adäquate Behandlungsmöglichkeit.
Die Erfolge in der Prävention und Therapie von HIV haben in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre die so genannte „Normalisierung“ eingeleitet. Normalisierung bezeichnet für Rosenbrock dabei einen Prozess, „in dessen Verlauf ein Phänomen, das zuvor für ausserordentlich - gross oder klein, gut oder böse, bedrohlich oder bereichernd - gehalten wurde, diesen Status verliert und in Wahrnehmung wie Handeln in die Welt des Bekannten, Gewohnten zurückkehrt.“[8]
Rosenbrock unterschied im Prozess des gesellschaftlichen und politischen Umgangs mit Aids vier Phasen:[9]
1. Phase (ca. 1981-1986)
Entstehung des „Exceptionalism“; das Auftreten von Aids löst hohe politische Handlungs- und finanzielle Ausgabenbereitschaft aus und erlaubt Innovationen auf vielen Gebieten.
2. Phase (ca. 1986-1991)
Praxis und Konsolidierung des „Exceptionalism“; Aids behält seinen Sonderstatus, die Verfahren, Aufgabenteilungen und Institutionen konsolidieren sich.
3. Phase (ca. 1991-1996)
Auflösung des „Exceptionalism“ und erste Anzeichen der Normalisierung. Der Sonderstatus von Aids erodiert durch stabile Verhältnisse bezüglich Prävention und Diskriminierung und erste Therapieerfolge. Das Aids-Management konsolidiert und professionalisiert sich.
4. Phase (ca. 1996-?)
Normalisierung und Normalität dank Prävention. Therapien verlängern die Überlebenszeit, Spardruck und Integration bedrohen Innovationen.
Die Krankheit Aids wird in Europa zunehmend als eine unter vielen anderen chronischen Infektionskrankheiten gesehen und behandelt. In Abbildung 2 sind die Aidsfälle der Schweiz nach Ansteckungsweg und Diagnosejahr dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2 Aidsfälle in der Schweiz nach Ansteckungsweg und Diagnosejahr.[10]
Heute stellt sich die Frage, ob die Aids-Arbeit in der Schweiz ab 2001 in eine neue Phase getreten ist.
Die neu gemeldeten positiven HIV-Tests stiegen wieder an, 2001 um wenige Prozent, 2002 um 25%. Bei MSM gar um 37%. Gleichzeitig war der Spardruck noch nie so hoch wie in den Jahren 2002 und 2003. Es scheint, dass mit den sinkenden Investitionen in die Präventionsarbeit seit Mitte der neunziger Jahre der Präventionsdruck und damit möglicherweise das Schutzverhalten nachliessen.
Dazu ist mit dem Wegfall der Todesbedrohung in den westlichen Industrieländern ein starkes Motiv für das Schutzverhalten entfallen. In den Medien findet Aids “nur“ noch als Katastrophe in der Dritten Welt (also weit weg) und/oder als medizinische Erfolgsstory statt (neue Medikamente).[11]
2.2 Aids-Prävention
Die Prävention ist wichtig, auch aus Gründen der Kosteneffizienz. Eine Analyse der sozialen Kosten von HIV und Aids ergab folgendes:[12]
Die Kosten für die HIV-Prävention wurden 1998 für die Schweiz auf 55 Mio. CHF geschätzt. Demgegenüber standen als Folge der HIV-Infektion direkte Kosten (ambulante und stationäre Behandlung von HIV/Aids-Patienten) von geschätzten 143 Mio. CHF. Die Kosten der Medikamente machten dabei mit 91 Mio. CHF über 50% dieser direkten Kosten aus.
Indirekte Kosten als Folge von Krankheit und Tod wurden gar auf 275 Mio. CHF hochgerechnet. Diese Kosten sind ein Fünffaches mehr, als Geld auszugeben für die Prävention. Die Analyse zeigte also, dass die Prävention immer noch billiger ist als die Therapie.
2.1.1 Gründe für einen Anstieg an Infektionen
Die steigenden Zahlen an positiven Testresultaten zeigen, dass das Schutzverhalten bei Sexualkontakten unter den Bedingungen der „Normalisierung“ von Aids nachgelassen hat. Bevor eine Präventionskampagne gestartet wird, sollte nach den Gründen für einen Anstieg gefragt werden. Warum hat das Schutzverhalten bei MSM nachgelassen? Warum gehen Menschen wieder mehr Risiken ein, wenn sie sich sexuell begegnen? Antworten darauf zu geben ist nicht einfach. Die Kluft zwischen Wissen und Verhalten können wir ebenfalls bei anderem gesundheitsrelevanten Verhalten wie Rauchen, körperlicher Bewegung, Ernährung etc. feststellen.
Bei Sexualkontakten kommt als weitere Komplikation hinzu, dass die Verwendung von Kondomen nicht von einer Person alleine abhängt. Sie ist das Resultat einer Interaktion zwischen zwei oder mehreren Personen. Thomas Bucher, wissenschaftlicher Mitarbeiter am psychologischen Institut an der Universität Zürich, meint dazu: „Auf der Suche nach Abenteuer, Liebe, Lust, Zuneigung, Bestätigung, Thrill, Entspannung oder was auch immer die Menschen mit Sexualität verbinden, bestimmen Situationen und Gelegenheiten das Geschehen oft mehr als Treueideale, die eigene Einstellung oder gute Vorsätze, welche alleine im stillen Kämmerlein gefasst wurden - fernab jeglicher Gefahr irgendeiner Versuchung.“ [13]
2.2.1.1 Gründe bei der Zielgruppe MSM
Eine Studie aus Kalifornien[14] befragte 113 MSM nach den Gründen für die erhöhte Risikobereitschaft. Die Resultate waren folgende:[15]
1) HIV ist nicht mehr die gleiche Bedrohung wie früher.
2) Leute sprechen nicht mehr so oft wie früher über HIV und die soziale Unterstützung hat abgenommen
3) Es hat eine Veränderung in der Gemeinschaft gegeben. Ungeschützter Geschlechtsverkehr wird zunehmend akzeptiert.
A) Änderung der Drohwahrnehmung
HIV wird als weniger bedrohlich wahrgenommen als auch schon. Der Erfolg von neuen HIV-Medikamenten führte zu einem neuen Verständnis, v.a. unter nicht infizierten Männern. HIV sei keine unheilbare Krankheit mehr, sondern behandelbar. Die folgenden Aussagen illustrieren diese Sicht: „The message I get is that AIDS is inconvenient... It was more scary before. People don’t look at it as a death sentence.” Ein anderer Befragter meinte: „They are taking more risks and taking more chances, saying, ‘I don’t need to have safe sex anymore. I can get HIV and medicine will keep me alive.’ ”[16]
Die Teilnehmer dieser Studie aus Kalifornien berichteten, dass die erschreckenden visuellen Konsequenzen einer HIV Ansteckung einst so leicht sichtbar waren. Dies hat sich drastisch verändert durch den Erfolg von neuen Therapien. Der Kräftezerfall und die vielen Todesfälle unter Freunden und Kollegen sind nicht mehr an der Tagesordnung. Viele ältere Männer sagen, dass die Jungen solche Erfahrung nie gemacht haben und so auch nicht persönlich betroffen sind von der Bedrohung Aids. Ein Teilnehmer machte folgende Bemerkung: „Through the 80’s and the 90’s I watched my friends die, bang, bang, bang... The new generation people didn’t have to watch their friends die- every other day- one or two of your friends. They didn’t have to go through that.”[17]
Wenn nicht-infizierten Männer keine persönliche Erfahrung mit infizierten Freunden oder Partnern haben, dann sind sie sich der Konsequenzen einer HIV Infektion weniger bewusst, wie etwa die Nebenwirkungen der Medikamente oder emotionaler Stress.
Teilnehmer hatten oft auch allzu hohe Behandlungsmöglichkeiten angegeben im Glauben, dass eine Heilmethode für Aids bald gefunden werde. Dieser Glaube wurde gar erweitert mit der falschen Auffassung, dass es bereits eine Heilmethode gibt und diese nur zurückbehalten wird oder nur für sehr Reiche offen steht. „In our community, they really think it’s a cure and they think it’s here and they think Magic (Johnson) bought this because he had the money.”[18]
B) Abnehmende Kommunikation und soziale Unterstützung
Teilnehmer berichteten, dass weniger Diskussionen unter Freunden und der Familie über HIV stattfinden. Das Umfeld ist gewöhnlich eine Quelle für soziale Unterstützung. Ein HIV-negativer Teilnehmer beschrieb in der Studie die Schwierigkeit, eine Unterhaltung über HIV mit seinem Partner zu führen. Obwohl er letztendlich die Unterhaltung nützlich fand, erklärte er, dass er sich unwohl fühlte, eine Unterhaltung über HIV überhaupt anzufangen.
In der Gemeinschaft haben Diskussionen über HIV-Positive ebenfalls abgenommen, weil Männer mit HIV länger und gesünder leben als die HIV-Positiven vor 10 Jahren.
Die folgende Feststellung eines Teilnehmers beschreibt diesen neuen Trend: „I’ve had a lot of friends that have drilled it into my head for years, ‘be careful, please, be careful. Look what happened to me. I’m sick.’ But these same people are feeling better... they’re not talking about it as much.”[19]
Teilnehmer bemerkten, dass die reduzierte Medienaufmerksamkeit über die HIV Epidemie und die zunehmende Betonung auf die handhabbare Natur der HIV-Infektion zum Schweigen beigetragen hat. Die Frustration über fehlende Medienaufmerksamkeit wurde von vielen Teilnehmern erwähnt. Z.B.: „I hear more negative talk about cigarettes than I do about HIV. “[20]
C) Wechsel von sozialen Normen
Ungeschützter Sex wurde als eine Sex-Variante akzeptiert. Geschützter Verkehr ist nicht mehr die Norm. Diese Veränderung manifestiert sich ebenfalls im Internet, wo Sexpartner gesucht werden. Dort plädieren die inserierenden Männer für ungeschützten Sex und für den „barebacking“[21], also „ungesattelten“ Geschlechtsverkehr: „The internet helped deteriorate the idea that condoms only is the only way. That’s not the community norm anymore. Now the community norm is there’s lots of ways you can have sex. And one of those that’s legitimate is without rubbers”. [22]
Die Normalisierung des Begriffs „barebacking“ kombiniert mit der geringen Medienaufmerksamkeit und weniger Gemeinschaftsdiskussion hat dazu beigetragen, dass das eigene Verhalten sehr unterschiedlich in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Es wird ein sozialer Zwang geschaffen, sich anzupassen. Einige antworteten, dass sie sich früher ebenbürtig fühlten, wenn sie Kondome brauchten, aber nun fühlen sie sich „gezwungen“, barebacking zu machen: „It’s hard because you got these people who wants to bareback and want you to bareback. It’s difficult. And peer pressure is a killer. It really is.”[23] Auch in der Schweiz wird barebacking immer populärer. Als Grund gibt Thomas Bucher folgendes an: „Die Kondomverwendung widerspricht sexuellen Phantasien und Wünschen, welche auf grenzenlose Vereinigung oder auch aggressiv getönte Penetration und das ungehinderte Abspritzen oder Weitergeben von Sperma abzielen.“[24]
2.2.2 Kommunikationsebenen
Die HIV/Aids-Prävention basiert auf drei Interventionsebenen:[25]:
1) Bevölkerungsbezogene Information (Breitenwirkung): Alle in der Schweiz lebenden Personen sollen regelmässig über HIV/Aids und dessen Schutzmöglichkeiten informiert werden.
2) Zielgruppenspezifische Information (Breiten- und Tiefenwirkung): Betrifft jene Personen, die sich riskant verhalten oder jene, die durch ihre Lebensumstände gefährdet sind. Diese Leute werden gezielt informiert und für die Prävention motiviert.
3) Individuelle Prävention und Beratung (Tiefenwirkung): Dezentrale Angebote stehen zur individuellen und personenspezifischen Information zur Verfügung.
Diese drei Interventionsebenen werden in Abbildung 3 dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.3 Ziele und Interventionsebenen der Aidsprävention.
Seit 1987 informieren das BAG und die AHS mit der Stopp-Aids-Kampagne die ganze Bevölkerung (zuständig für Breitenwirkung). Die Stopp-Aids-Kampagne ist die bekannteste Präventionskampagne der Schweiz. Ihr Erinnerungswert liegt zwischen 70 und 80%.[26] Der universal verständliche Schriftzug „STOP AIDS“ und die rosarote Scheibe sind zum Symbol der Aidsverhütung schlechthin geworden. Das Logo ist auf praktisch allen Plakat-Kampagnen zu sehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.4 „STOP AIDS“ Logo.[27]
„STOP AIDS“ ist heute eine Marke, die mit Werten wie „offene, aktive und provokative Information“, „soziales Engagement“ und „gegenseitiger Schutz“ assoziiert ist.[28]
Die Informationen werden über verschiedene Kanäle verbreitet:
- Plakatkampagnen, Inserate, TV-, Kino- und Radiospots.
- Pressemitteilungen.
- Website www.stopaids.ch.
- Gratis herunterladbares Spiel "Catch the sperm"; ein Spiel in Partnerschaft mit
der Aids-Hilfe Schweiz und ihren regionalen Organisationen.
Die Stopp-Aids-Kampagne muss seit Mitte der neunziger Jahre mit weniger Geld auskommen. Während im Spitzenjahr von 1993 noch 5 Mio. CHF in die Kampagne investiert werden konnte, muss heute mit 2.8 Mio. CHF gewirtschaftet werden. Das Budget von 1987 bis 2003 ist in Abbildung 5 grafisch dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.5 Kosten der Medienkampagne pro Jahr. (inkl. Website www.stopaids.ch).[29]
2.2.2.1 Zielgruppenspezifische Prävention
Für Menschen, die sich riskant verhalten, genügen die Botschaften „tout public“ nicht, sie ausreichend zu informieren. Deshalb ist es notwendig und sinnvoll, diese Leute mit zielgruppenspezifischer Prävention anzusprechen. Dies birgt allerdings auch die Gefahr von Stigmatisierung. Deshalb ist Partizipation, Differenziertheit und Sensibilität besonders wichtig bei einer zielgruppenspezifischen Prävention. Die Zielgruppen sind dabei weder stabil noch homogen. Innerhalb einer Gruppe können verschiedene Subgruppen mit unterschiedlichem Risiko existieren.
Der Präventionsbedarf ist zurzeit am höchsten für:[30]
- Homosexuelle und Männer, die ungeschützten Analverkehr praktizieren.
- Migranten aus Ländern mit hoher Aids-Rate und deren Sexualpartner.
- intravenös Drogenkonsumierende.
- Sexworker.
- Freier sowie Reisende in Endemiegebiete, die sich nicht schützen.
Die Zielgruppe der Homosexuellen umfasst Männer mit unterschiedlichen Identitäten, deren gemeinsames Merkmal darin besteht, dass sie - zumindest gelegentlich-sexuelle Beziehungen mit anderen Männern haben. (MSM)
Daneben unterscheidet sich diese Zielgruppe ebenfalls durch weitere Parameter:[31]
- Szenegänger und Nicht-Szenegänger.
- MSM in einer Beziehung und Singles.
- HIV-positive und HIV-negative MSM.
Als grobe Schätzung der Zielgruppe gibt es:
- 100'000 MSM mit schwuler Identität.
- 100'000 MSM mit bi- oder heterosexueller Identität.
Besonders diejenigen MSM, die sich nicht oder nur selten in schwulen Szenen bewegen, sind schwer erreichbar. Angesprochen sind damit insbesondere:
- Junge MSM vor dem Coming-out.
- Ältere MSM, die sich nicht mehr in den Szenen bewegen.
- MSM, die nicht schwul sind (Heterosexuelle, Bisexuelle).
2.2.3 Herausforderungen für MSM
Die Präventionsarbeit für MSM hat schnell Früchte getragen. Die Ansteckungszahlen bei homosexuellem Geschlechtsverkehr gingen von rund 500 (Anfang 90er-Jahre) auf 120 (2001) zurück. Trotzdem steckt sich jeder zehnte Mann an, der Sex haben will mit einem anderen Mann[32]. Das ist eine hohe Anzahl von Ansteckungen. So infizieren sich die meisten Männer beim Geschlechtsverkehr mit anderen Männern, wie aus Abbildung 6 hervorgeht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.6 Altersverteilung bei Männern mit positiven HIV-Tests nach Ansteckungsweg seit 1997.[33]
Bei der markant höheren Übertragungseffizienz des Analverkehrs resultieren schon bei einer geringfügigen Abnahme des Schutzverhaltens sehr schnell neue HIV-Infektionen. Seit 2002 stiegen die Zahlen der neu gemeldeten positiven HIV-Tests bei MSM gegenüber dem Vorjahr wieder, und zwar um 37%. Aus diesem Grund sind dringend Massnahmen für die sexuell aktive Schwulenszene zu ergreifen. So sollen Präventionsbotschaften gut sichtbar präsent sein, insbesondere an Orten, wo Sex zwischen Männern „sur place“ möglich ist. (Also in Saunas, Bars und Diskotheken mit Darkrooms). Seit Sommer 2001 setzt sich die AHS zudem neu das Ziel, die Zielgruppen neben HIV/Aids über weiterer sexuell übertragbarer Krankheiten zu informieren (Hepatitis, Syphilis, Tripper etc).
2.3 Umsetzung für MSM
Die zielgruppenspezifische Prävention kann auf nationaler oder regionaler Ebene verlaufen. Auf nationaler Ebene wird die Prävention einerseits geleitet und Hauptbotschaften gestreut. Anderseits wird vor Ort durch sog. Outreachworker (ORW) regionale Präventionsarbeit betrieben. Es handelt sich dabei um schwule Männer, die in lokalen Szenen verankert sind und die Bedürfnisse aus erster Hand kennen. Damit wird eine zielgruppennahe Arbeit ermöglicht, die auf grosse Akzeptanz stösst.
2.3.1 Regionale Projekte
Besonders in ländlichen Regionen kommt der Prävention grosse Bedeutung zu. Hier fehlen oftmals die Strukturen einer schwulen Szene. Die Aufgabe des ORW's kann z.B. sein, aktiv der Gründung und Begleitung von Jugendgruppen, Treffpunkten etc. Hand zu bieten. Die Aufgaben der ORW sind vielfältig. Neben Einsätzen an Szeneorten mit Beratertätigkeiten gehören ebenso Vernetzungsarbeit und Lobbying auf gesellschaftlich - politischer Ebene dazu. Zusätzlich setzen die ORW selbständig grössere und kleinere Projekte um. Solche Projekte sind z.B. Filmfestivals, Benefiz-Parties oder Theateranlässe.
2.3.2 Nationale Projekte
A) Informationsmaterial zur Verfügung stellen
Eine zentrale Aufgabe auf nationaler Ebene besteht in der Produktion und Verteilung von Präventionsmaterial. Es werden sog. „Love Packs“ zur Verfügung gestellt, welche Kondome mit zusätzlichem Gleitmittel enthalten. Zudem hat die Aids-Hilfe verschiedene Broschüren herausgegeben, die speziell für Männer publiziert wurden.[34] Dies sind:
- „Liebe, Lust und Schutz“: Informationen über HIV-Aids und sexuell übertragbare Krankheiten.
- „Mundart“: Informationen über Oralsex.
- „Love Bugs“: Informationen über sexuell übertragbaren Krankheiten.
Mit den Broschüren ist gewährleistet, dass in allen Regionen Präventionsmaterial verfügbar ist. [35]
B) Die Website Dr.Gay
Eine weitere nationale Dienstleistung ist die Internetberatung Dr.Gay (www.drgay.ch)[36], welche im Juli 1999 aufgeschaltet wurde. Auf dieser Website werden von erfahrenen Redaktoren Fragen zu HIV/Aids, Safer Sex und weitere zusammenhängende Fragen beantwortet. Die Ratsuchenden können die Antwort auf ihre Frage nach einer Frist von zwei bis drei Tagen durch Eingeben eines Passworts einsehen. Die Dienstleistung ist neben Deutsch und Französisch seit Anfang 2003 ebenfalls auf Italienisch verfügbar. 2002 hat die AHS zusammen mit dem Psychologischen Institut der Universität Zürich eine Evaluation über die Klienten der Website in Auftrag gegeben.[37] Die „Wo tut es denn www?“-Studie gibt Auskunft über demografische Daten und die Art der Beratung.
Die Onlineberatung Dr.Gay konnte sich als erfolgreiches Angebot etablieren und ist zu einem zentralen Standbein der nationalen Präventionskampagnen geworden. Seit Beginn 2003 werden pro Tag im Schnitt fünf bis sechs Anfragen verzeichnet, gegenüber drei Anfragen pro Tag zu Beginn des Jahres 2002. Die Tendenz ist weiterhin steigend. Die Zahl der Besucher steigt ebenfalls und bewegt sich im Moment bei rund 250 bis 300 pro Tag.
Zudem brachte die Studie folgende Ergebnisse:
- Die Mehrheit der Klientel stammt aus den Kantonen Zürich, Waadt, Bern und Genf, also aus Kantonen mit Grossstädten (über 57% der Anfragen).
- Die Klientel von Dr.Gay wohnt zu zwei Dritteln in städtischer Umgebung.
- Rund ein Drittel der Anfragen wurden in französischer Sprache gemacht.
- Männer, welche Dr.Gay konsultieren, weisen ein breites Altersspektrum auf. Dies ist ein Hinweis, dass Aufmachung und Inhalt der Internetseite sowohl Junge wie auch Ältere ansprechen.
Die Fragebogen meiner Untersuchung wurden in Zürich, Lausanne und Bern durchgeführt, also genau an jenen Orten, wo die Mehrheit der Klientel herkommt. Es ist demensprchend anzunehmen, dass in meiner Untersuchung viele die Internetseite drgay.ch kennen und sich schon über diese informiert haben.
Die starke Übervertretung von Fragen aus dem Kanton Zürich erstaunt die Autoren der „Wo tut es denn www?“-Studie nicht: Hier dürfte sich wohl bestätigen, dass die Stadt Zürich das „schwule Mekka“ der Schweiz darstellt und eine entsprechende Sogwirkung auf MSM hat. Gleichzeitig finden in Zürich regelmässig Grossanlässe statt, an welchen für Dr.Gay die Werbetrommel gerührt wird, wie z.B. der Christopher Street Day. Dr.Gay steht allen Interessierten offen. Es werden zudem schwierig zu erreichende Zielgruppensegmente angesprochen, welches ein grosses Plus der Website ist.
C) Telefonnummer 01 447 11 11
Die Telefonnummer wurde auf dem Plakat „Menpower“ als Hotline angegeben, ist aber die eigentliche Nummer der AHS. Die Nummer ist somit nicht ausschliesslich für Homosexuelle offen, sondern für alle Interessierten. Es wurden keine Daten im Stil der Evaluation wie Dr.Gay erhoben. Demografische Angaben über die Anrufer gibt
es somit nicht. [38] Die meisten Fragen werden rund um eine mögliche Ansteckung gestellt. Am Montag/Dienstag wird v.a. über ungeschützte Aktivitäten des jeweils vergangenen Wochenendes gesprochen. Viele Fragen betreffen den Aids-Test. Die Dienstleistung gibt es seit 1985. Also gleich lange wie es die AHS gibt. Der Service gibt Auskunft in den drei Landesprachen deutsch, französisch und italienisch sowie in englischer Sprache. Pro Tag gibt es in etwa 50-60 Anrufe. Die Hotline wird aus Sicht der AHS als erfolgreich eingestuft. Allerdings ist der Erfolg nur schwer messbar. Für die Anrufer ist es sicher eine gute Dienstleistung und in den meisten Fällen kann weitergeholfen werden. Oft werden die Anrufer „beruhigt" und sie bekommen die Gewissheit, dass der geschilderte Ansteckungsweg nicht gefährlich ist für eine Ansteckung. Auf der Nummer 01 447 11 11 wird je nach Fall auch auf die regionale Aids-Hilfe-Stelle des Anrufers vermittelt. Die regionalen Aids-Hilfen sind die eigentlichen Vor-Ort-Beratungsstellen. Oft ist jedoch gerade die gewünschte Anonymität der Grund, nicht bei der näheren regionalen Aids-Hilfe anzurufen, sondern bei der Geschäftsstelle des nationalen Dachverbandes (AHS).
D) Plakat Menpower
Das Plakat Menpower (siehe Abbildung 7) wurde Anfang des Jahres 2004 an verschiedene Schwulenclubs verteilt. Es wurde von der Firma Partner- Partner in Winterthur konzipiert. Das BAG will v.a. die HIV-Übertragung durch den Geschlechtsverkehr verhindern, indem sie warnt, dass „Sex ohne (Kondom) gefährdet ihre Gesundheit“. Im Einzelnen wird folgendes beabsichtigt:
- Informationen über die aktuelle Situation geben z.B. dass jeder Zehnte Schwule mit dem HIV infiziert ist.
- Motivieren, um sich in Risikosituationen vor einer Infektion zu schützen.
- Warnen, dass das Aussehen kein verlässlicher Hinweis auf eine Ansteckung ist. Eine HIV-Infektion sieht man jemandem in der Regel nicht an.
- Aufklären, dass HIV und Aids behandelbar sind, aber nicht heilbar. Die Behandlung ist aufwändig, beschwerlich, teuer und in ihrem Erfolg nicht gewiss.
- Die Hotline Nummer 01 447 1111 bekannt machen, welche wertvolle Informationen über Aids gibt (zum Festnetztarif).
- Die Internetseite www.dr.gay.ch anpreisen.
Eine Projektskizze über die Ziele des Plakats der Firma Partner-Partner befindet sich im Anhang. Eine Möglichkeit, um die Wirksamkeit einer Kampagne zu untersuchen, wäre z.B. gewesen, die Befragten diese Informationen abzufragen. Z.B.: Wie viele HIV-Infizierte gibt es unter 100 Schwulen? Mein Ziel ist es allerdings nicht, Lerneffekte beim Befragten festzustellen, sondern zu fragen, ob das Plakat gesehen wurde oder ob man sich daran erinnert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.7 Plakat Menpower..[39]
E) Plakat Piktogramme
Die Plakate in Abbildung 8 zeigen Liebesspiele von Männern. Diese sind durch Piktorgramme dargestellt, welche and an die Praxis des „Safer Sex“ erinnern sollen. Eine gesamtschweizerische Kampagne[40] mit Piktogrammen wurde ebenfalls lanciert, welche Sexpraktiken von beiden Geschlechtern zeigte. In diesen Piktogrammen war der Mann allerdings ohne Penis dargestellt, d.h. ohne schwarzen Balken. Die abgebildeten Plakate waren nur in Schwulensaunas zu sehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.8 Plakat „Piktogramme“ in Schwulensaunas. [41]
2.4 Evaluation
Bei diesem Kapitel wird auf Evalutionensstudien der Subgruppe der MSM eingegangen. Dabei darf sich die Evaluation nicht selbst überschätzen. Sie kann weder absolutes Wissen noch allgemeingültige Regeln für „richtiges Handeln“ aufstellen.
2.4.1 Evaluation bei MSM
Die Evaluation der Ergebnisse der HIV/Aids-Präventionsstrategie bei MSM beruht auf einer Umfrage, die regelmässig bei dieser Bevölkerungsgruppe in der Deutsch-und Westschweiz wiederholt wird. [42]
Anhand von sechs Umfragen (1987, 1990-92-94-97, 2000) lässt sich die Entwicklung des Präventivverhaltens der MSM in der Schweiz verfolgen. Für jede dieser Studien wurden über die Homosexuellenpresse und die Homosexuellenorganisationen Fragebögen verteilt. Je nach Jahr wurden zwischen 800 und 1200 Fragebogen zurückgeschickt. Es ist unmöglich abzuschätzen, wie repräsentativ diese Art von selbstgewählter Auswahl ist, da Telefonumfragen in der Allgemeinbevölkerung es nicht erlauben, ein detailliertes Profil der homosexuellen Bevölkerung zu skizzieren. Trotzdem wird angenommen, dass die Antwortenden zu jenem Segment der homosexuellen Bevölkerungsgruppe gehören, die sich am klarsten definieren und in Sachen Prävention besser informiert und stärker motiviert ist. Die Jungen sind in dieser Art von Umfragen schlecht repräsentiert.
Hier werden einige Resultate von diesen Studien aufgezeigt, welche im Zusammenhang mit dem Fragebogen stehen (Frage 25-35).
[...]
[1] Vom „Institut universitaire de médecine sociale et préventive“ in Lausanne.
[2] Mit 197 Meldungen waren es 37% mehr als im Jahr zuvor.
[3] Vgl. Abb.7.
[4] Vgl. Abb.8. Einziger Unterschied besteht darin, dass ausschliesslich Liebesspiele mit Männern dargestellt wurden und der Penis als schwarzer Balken zu sehen ist. Zudem ist eine Sexstellung mit drei Männern abgebildet (Gruppensex).
[5] Die Fragebogen auf deutsch und französisch befinden sich im Anhang.
[6] Der erste Aids-Fall wurde in der Schweiz 1981 diagnostiziert.
[7] Bundesamt für Gesundheit [BAG] (Hrsg.): Nationales HIV/Aids-Programm 2004-2008, Bern 2003a, S.9.
[8] Rosenbrock, R./Schaeffer, D.: Die Normalisierung von Aids: Erinnerungen für die Zukunft. Vorwort der Herausgeber. In: Rosenbrock, R./Schaeffer, D. (Eds.):Die Normalisierung von Aids. In: Edition sigma 7-8, 2002.
[9] Rosenbrock, R./Schaeffer, D./Moers, M./Dubois-Arber, F./Pinell, P./Setbon, M.: Die Normalisierung von Aids in Westeuropa. Der Politik-Zyklus am Beispiel einer Infektionskrankheit. In: Aids Infothek 5, 1999, S.4-15.
[10] Eine detaillierte Übersicht zur HIV/Aids-Epidemiologie wird jährlich vom BAG herausgegeben. Quelle: BAG 2003a, S.27.
[11] BAG, 2003a, S.33.
[12] Zurn, P./Taffé, P./Rickenbach, M./Danthine, J.-P.: Social cost of HIV Infection in Switzerland, 2001. URL: http://www.hospvd.ch/iems/images/Rapportsida.PDF (3.09.2004), S.17.
[13] Bucher, T.: Das Nachlassen im Schutzverhalten oder warum der Gummi unbenutzt bleibt. In: Zürcher Aids Hilfe [AHS] (Hrsg.): Aids-Arbeit im Wandel. Vom Leben zum Sterben und wieder zurück (Ein Themenheft mit Jahresbericht). Zürich 2003, S.10.
[14] Morin, S.F./Vernon, K./Harcourt J.J./Steward, W.T./Volk, J./Riess, T.H./Neilands, T.B./Mc Laughlin, M.: Why HIV Infections have increased among men who have sex with men and what to do about it. (Findings from California Focus Group). In: Aids and Behaviour Plenum 7, 2003, S.353-362. Auf diese Studie wird in Kapitel 5 bei den Empfehlungen nochmals eingegangen.
[15] Während der Untersuchung hatte die Autorin viele Gespräche mit MSM und diese haben oft die gleichen Gründe für eine Zunahme genannt. Die Autorin ist daher der Meinung, dass in der Schweiz ähnliche Gründe für eine Zunahme von HIV/Aids gelten.
[16] „Die Botschaft, die ich erhalten habe, war die, dass AIDS lästig ist...vorher war es beängstigender. Leute schauen es nicht mehr an als Todesurteil an.“ Und „ Sie riskieren mehr und sagen öfters; ich muss nicht mehr Safer Sex praktizieren. Ich kann HIV bekommen und Medikamente werden mich am Leben erhalten.“ Eigene Übersetzung aus Morin et al., 2003, S.356.
[17] „In den 80er und 90er Jahren sah ich meine Freunde sterben, bang, bang, bang... die neue Generation von Leuten mussten nicht zusehen, wie ihre Freunde starben- jeden Tag, ein oder zwei Freunde von dir. Sie mussten das nicht durchmachen.“ Eigene Übersetzung aus Morin et al., 2003, S.356.
[18] „In unserer Gemeinschaft glauben sie wirklich, dass es ein Heilmittel gibt und sie glauben auch, dass es hier ist und Magic (Johnson) dieses gekauft hat, weil er soviel Geld hat.“ Morin et al., 2003,
S.356.
[19] „Ich hatte viele Freunde, die mir eingehämmert haben ’sei vorsichtig, bitte sei vorsichtig. Schau was mir passiert ist. Ich bin krank.’ Aber die gleichen Leute fühlen sich heute besser... sie sprechen nicht mehr soviel darüber.“ Eigene Übersetzung aus Morin et al., 2003, S.357.
[20] „Ich höre mehr Negatives über Zigaretten als über HIV:“ Eigene Übersetzung aus Morin et al., 2003, S.357.
[21] Der Begriff „Barebacking“ wurde von Mund zu Mund in die Gemeinschaft gebracht. „Barebacking“ wurde ursprünglich gebraucht, um den absichtlich gewählten, ungeschützten Analverkehr zu bezeichnen. Heute wird er alltäglich gebraucht und meint eher die unbeabsichtigten, ungeschützten „Slips-up“. So gebrauchten die Teilnehmer das Wort „barebacking“, wenn sie ungeschützten Analverkehr meinten. Vgl. Morin et al, 2003, S.360.
[22] „Es ist das Internet, bei welchem die Idee verliert, dass der Kondomgebrauch der einzige Weg ist. Das ist nicht mehr die gesellschaftliche Norm. Jetzt ist die gesellschaftliche Norm die, dass es verschiedene Arten von Sexpraktiken gibt. Und eine von diesen (Sexpraktiken), welche berechtig ist, ist Sex ohne Gummi.“ Eigene Übersetzung aus Morin et al, 2003, S.357.
[23] „Es ist hart, weil du diese Leute hast, die barebacking haben wollen. Sie wollen dann auch, dass du barebacking machst. Es ist schwierig. Und Gruppenzwang ist tödlich. Das ist es wirklich.“ Eigene Übersetzung aus Morin et al, 2003, S.357.
[24] Bucher, 2003, S.10.
[25] BAG, 2003a, S.19.
[26] Post-Tests der STOP AIDS-Kampagnen 1995, 1997, 1999, 2001 (repräsentative Befragungen).
[27] TECFA: Jan 1997. URL. http://tecfa.unige.ch/tecfa/research/humanities/AIDS-campaign/stopAidsLogoSmall.gif (3.Sept. 2004).
[28] BAG, 2003a, S.20.
[29] Eigene Darstellung. Zahlen von BAG: Kampagne Budget, 31. 03. 2004. URL http://www.suchtundaids.bag.admin.ch/themen/aids/stopaids/unterebenen/01295/index.html?language =de&schriftgrad (3. Sept. 2004).
[30] BAG, 2003a, S.21.
[31] Aids Hilfe Schweiz [AHS] (Hrsg.): MSM: ein Präventionsprojekt der Aids-Hilfe Schweiz. O.J. URL: http://www.aids.ch/d/ahs/msm.php (2.09.2004).
[32] Über alle Altersgruppen gemittelt. Vgl. Häusermann, M./Wang, J.: Projet santé gaie. Les premiers résultats de l'enquête sur la santé des hommes gais de Genève. Genève 2003.
[33] BAG: Altersverteilung bei männlichen Personen mit positiven HIV-Tests nach Ansteckungsweg seit 1997, 11.2003. URL:http://www.bag.admin.ch/infekt/publ/wissenschaft/d/jahresb.pdf (3. 09. 2004), S.27.
[34] Die Broschüren können unter www.aids.ch gratis bestellt werden.
[35] Vgl. AHS: O J., 2004.
[36] AHS: Dr.Gay O.J. URL: http://www.drgay.ch/d/index.php (3.09.2004).
[37] Die Aids-Hilfe hat mir ein Vorabdruck des Evaluationsberichts zugeschickt und die ersten Resultate dürfen hier publiziert werden. An dieser Stelle sei herzlich gedankt für die gute Zusammenarbeit. Bucher, T./Wittwer, U.: Wo tut es denn www? Evaluation der Klientendaten von www.dr.gay am Psychologischen Institut der Universität Zürich, Zürich 2003.
[38] Herr Oliver Villiger von der AHS hat mir per Mail über diese Telefonnummer Auskunft gegeben. Er ist Mitarbeiter von AHS und zuständig für den Bereich MSM. An dieser Stelle sei ihm gedankt für die schnelle und freundliche Auskunft.
[39] Quelle: BAG 2004.
[40] Die Kampagne waren überall in der Schweiz vom 19. April bis Ende Mai 2004 zu sehen.
[41] Bei der Untersuchung hat die Verfasserin neben dem „Menpower-Plakat“ bei den Piktogrammen-Plakaten nur das Plakat „Kamasutra“ als A-4-Format mit den Fragebogen mitgeschickt. Quelle: BAG 2004.
[42] Dubois-Arber, F. et al. , 2003.
Details
- Titel
- Plakatkampagne für Männer, die Sex haben mit Männern (MSM)
- Hochschule
- Université de Fribourg - Universität Freiburg (Schweiz)
- Note
- 5,7 (insigni cum laude)
- Autor
- Sybille Imesch (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2005
- Seiten
- 204
- Katalognummer
- V135561
- ISBN (Buch)
- 9783640887323
- ISBN (eBook)
- 9783640887484
- Dateigröße
- 1671 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- plakatkampagne männer männern
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 41,99
- Preis (Book)
- US$ 55,99
- Arbeit zitieren
- Sybille Imesch (Autor:in), 2005, Plakatkampagne für Männer, die Sex haben mit Männern (MSM), München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/135561
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









