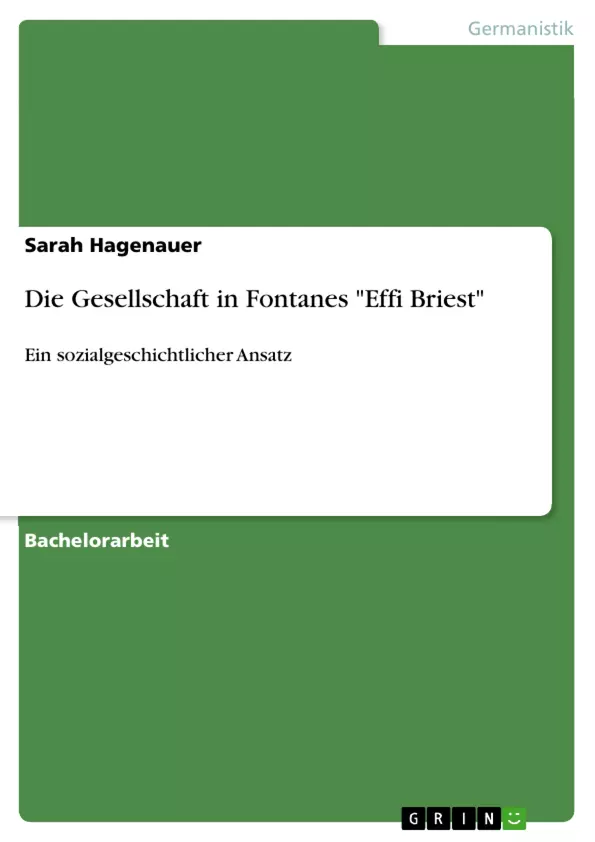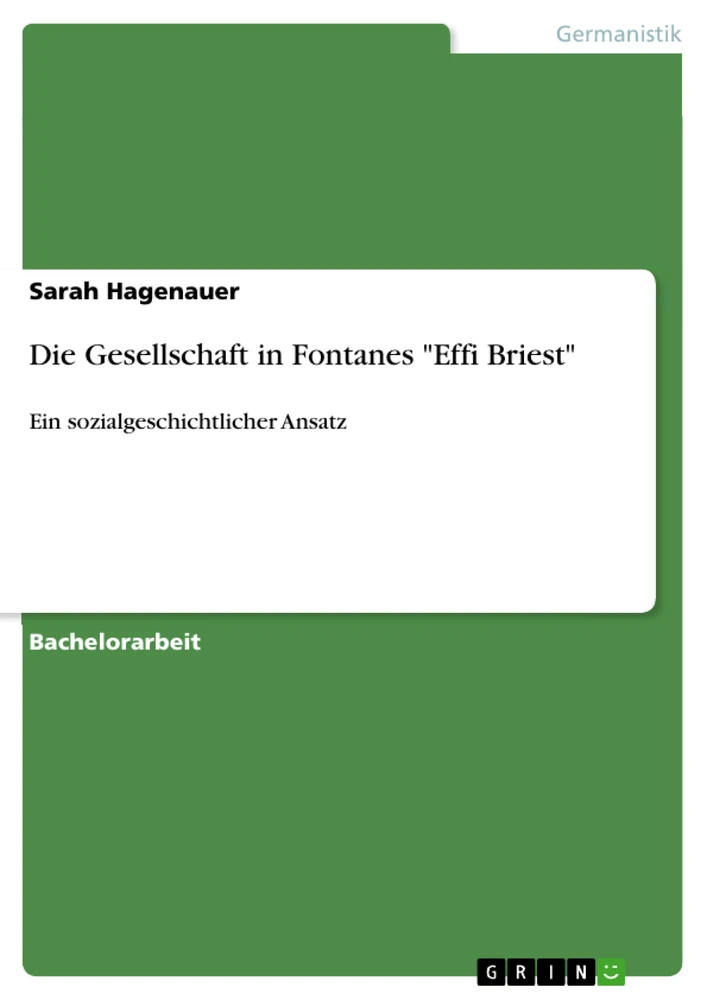
Die Gesellschaft in Fontanes "Effi Briest"
Bachelorarbeit, 2020
36 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wesen und Funktion des Gesellschaftsromans
- Effi Briest als Gesellschaftsroman
- Definition des Bösen mit besonderer Berücksichtigung der Moralvorstellung der Gesellschaft
- Die Gesellschaftsordnung des 19. Jahrhunderts als böse Instanz
- Die Frauenproblematik im Gesellschaftsroman
- Situation der Frau in der Familie des 19. Jahrhunderts
- Infantilisierung der Frau: Die Ehefrau als wesentlicher Besitz des Mannes
- Gesellschaftliche Stellung vor Mutterliebe
- Das Frauenbild bei Barbara Duden
- Kritik an der patriarchalen Machtstruktur
- Opfer der Gesellschaft
- Die Rolle von Effi Briest in der bürgerlichen Gesellschaft
- Die Rolle als Kind
- Die Rolle in der Natur
- Die Rolle als Ehefrau
- Ehebruchskandale: Weiterführende Überlegungen zu Effi Briest, Emma Bovary und Anna Karenina
- Vergleich der Werke
- Das Natur- und Objektmotiv
- Gründe des Ehebruchs
- Der Tod der Protagonistinnen
- Conclusio des Vergleichs
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit zielt darauf ab, die Manifestation des Bösen in der Gesellschaft anhand von Fontanes Roman "Effi Briest" zu untersuchen. Dabei werden verschiedene Aspekte der Frauenproblematik beleuchtet und die Infantilisierung der Frau im 19. Jahrhundert analysiert. Die Arbeit strebt an, die gesellschaftliche Struktur des 19. Jahrhunderts kritisch zu betrachten und die Gesellschaft als böse Instanz zu identifizieren.
- Die Rolle des Gesellschaftsromans in der Literatur und die Reaktion der Menschen auf gesellschaftskritische Werke
- Die Infantilisierung der Frau im 19. Jahrhundert und die damit verbundene Begrenzung ihrer Handlungsfreiheit
- Die Frage, ob die Gesellschaft für böse Taten und deren Folgen verantwortlich gemacht werden kann
- Der Einfluss der moralischen Zwänge und Normen auf das Leben und die Entscheidungen von Frauen
- Der Vergleich der Ehebruchskandale in Fontanes "Effi Briest", Flauberts "Madame Bovary" und Tolstois "Anna Karenina"
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Bachelorarbeit vor und erläutert die zentrale These, dass die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, geprägt von ihren moralischen Normen, für das Schicksal von Effi Briest verantwortlich ist.
- Wesen und Funktion des Gesellschaftsromans: Dieses Kapitel beleuchtet den Gesellschaftsroman als literarisches Genre und untersucht die Funktion von "Effi Briest" als Gesellschaftsroman. Es werden Definitionen des Bösen im Kontext der gesellschaftlichen Moralvorstellungen des 19. Jahrhunderts erörtert und die Gesellschaftsordnung als potentielle böse Instanz betrachtet.
- Die Frauenproblematik im Gesellschaftsroman: Dieses Kapitel widmet sich der Rolle der Frau in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Es werden die soziale und familiäre Situation von Frauen sowie die Infantilisierung der Frau durch die gesellschaftlichen Normen analysiert. Die Arbeit beleuchtet die Kritik an der patriarchalen Machtstruktur dieser Zeit und untersucht, inwiefern Frauen Opfer der gesellschaftlichen Verhältnisse waren.
- Die Rolle von Effi Briest in der bürgerlichen Gesellschaft: Dieses Kapitel betrachtet die Rolle von Effi Briest in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Es werden ihre Rollen als Kind, Naturwesen und Ehefrau analysiert und der Zusammenhang zwischen diesen Rollen und ihrem späteren Ehebruch aufgezeigt.
- Ehebruchskandale: Weiterführende Überlegungen zu Effi Briest, Emma Bovary und Anna Karenina: Dieses Kapitel vergleicht die Werke "Effi Briest", "Madame Bovary" und "Anna Karenina" und untersucht, ob die Protagonistinnen aufgrund der gesellschaftlichen Normen ihres jeweiligen Jahrhunderts zum Scheitern verurteilt waren.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Gesellschaftsroman, Effi Briest, Moralvorstellung, Frauenproblematik, Infantilisierung, Ehebruch, gesellschaftliche Normen, patriarchale Machtstruktur, Opfer, Sozialisation, 19. Jahrhundert, literarische Analyse, sozialgeschichtlicher Ansatz.
Details
- Titel
- Die Gesellschaft in Fontanes "Effi Briest"
- Untertitel
- Ein sozialgeschichtlicher Ansatz
- Hochschule
- Pädagogische Hochschule Oberösterreich (Neuere Deutsche Literatur)
- Veranstaltung
- Pädagogische Hochschule Linz
- Note
- 1,0
- Autor
- Sarah Hagenauer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 36
- Katalognummer
- V1359087
- ISBN (Buch)
- 9783346877420
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Effi Briest Theodor Fontane Frauengeschichte
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Sarah Hagenauer (Autor:in), 2020, Die Gesellschaft in Fontanes "Effi Briest", München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1359087
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-