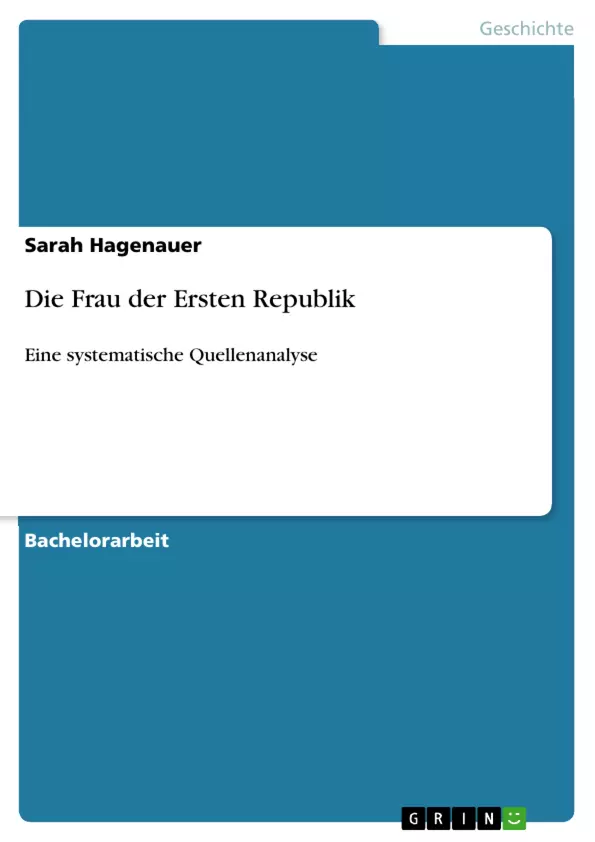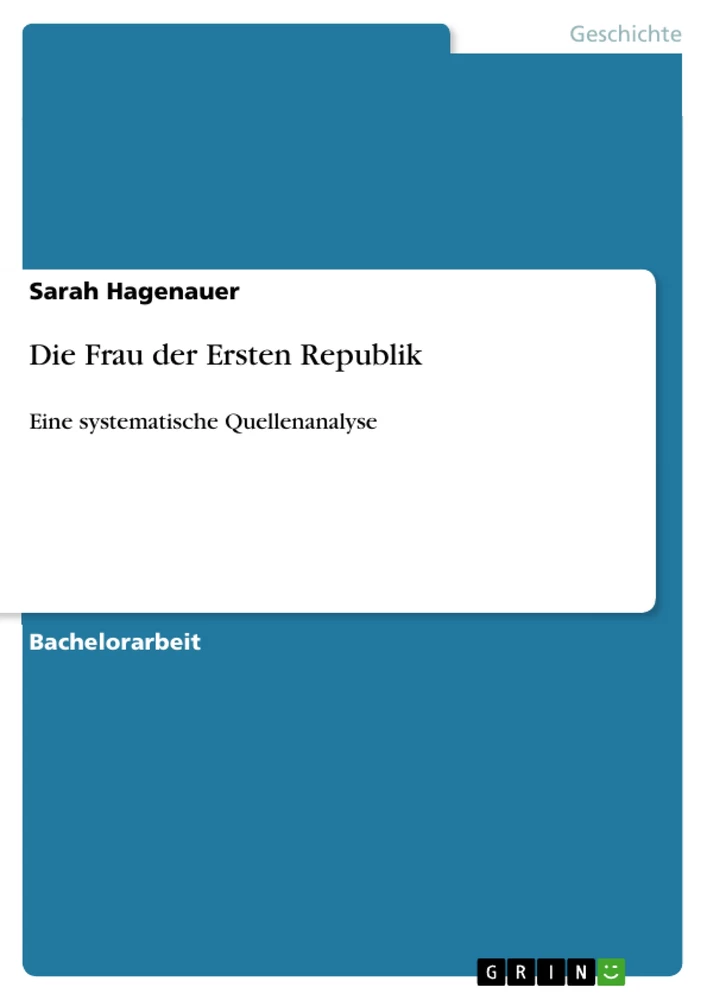
Die Frau der Ersten Republik
Bachelorarbeit, 2020
47 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Erste Republik
- Die Frauenrolle in der Ersten Republik
- Die politische Rolle der Frau
- Die Frauenbewegungen
- Entwicklung der Frauenteilnahme in politischen Parteien
- Die Frauentage
- Die soziale Rolle der Frau
- Das Eheleben der Frau
- Sexualität und Moral der Frau
- Die Entstehung des Wohlfahrtstaates
- Die gesellschaftliche Rolle der Frau
- Die rechtliche Rolle der Frau
- Das Wahlrecht 1918
- Schutzgesetze für Frauen und Frauenberufe
- Recht auf Bildung
- Rechte der Mütter
- Die politische Rolle der Frau
- Das Frauenbild
- Kunst und Kultur
- Die Darstellung der Frau in den Medien
- Frauensport in der Zwischenkriegszeit
- Exkurs: Vergleich mit dem amerikanischen Frauenbild
- Die Mode der „neuen“ Frau
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit analysiert die gesellschaftliche, soziale und politische Rolle der Frau in der Ersten Republik, insbesondere in Österreich und Deutschland. Sie zielt darauf ab, die Veränderungen des Frauenbildes und der Frauenrechte im Zeitraum von 1918 bis 1938, vor allem in den 1920er Jahren, aufzuzeigen.
- Entwicklung der Frauenrechte und -bewegungen
- Die soziale und gesellschaftliche Rolle der Frau
- Die Darstellung der Frau in Kunst, Kultur und Medien
- Der Einfluss des Ersten Weltkriegs auf die Frauenrolle
- Das Bild der „neuen“ Frau und ihre Emanzipation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Themenbereich der Arbeit vor und skizziert die gesellschaftlichen Umwälzungen des Ersten Weltkriegs, die zu einem Wandel der Frauenrolle führten. Das zweite Kapitel beleuchtet die politische, soziale und rechtliche Situation der Frau in der Ersten Republik. Die Kapitel 3.1 bis 3.4 gehen detailliert auf die Entwicklungen in den Bereichen der politischen Partizipation, der sozialen Rolle in Familie und Beruf, der gesellschaftlichen Anerkennung und der rechtlichen Stellung der Frau ein. Das vierte Kapitel analysiert das Frauenbild in Kunst, Kultur und Medien, während das fünfte Kapitel die Mode der „neuen“ Frau und ihre Bedeutung als Symbol der Emanzipation behandelt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Erste Republik, Frauenrolle, Frauenrechte, Emanzipation, Frauenbewegungen, Geschlechterrollen, Wahlrecht, Bildung, Beruf, Familie, Medien, Kunst, Kultur, Mode, „neue“ Frau.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte der Erste Weltkrieg die Rolle der Frau?
Der Krieg beschleunigte soziale Umgestaltungen, die Frauen mehr Rechte, politische Mitbestimmung und neue Chancen im Erwerbsleben ermöglichten.
Wann erhielten Frauen in Österreich das Wahlrecht?
Das Wahlrecht wurde Frauen in Österreich erstmals im Jahr 1918 verliehen, was ihnen eine politische Stimme gab.
Was zeichnet das Bild der "neuen Frau" in den 1920ern aus?
Es steht für Emanzipation, ein neues Selbstbewusstsein in Mode und Sport sowie eine veränderte Stellung innerhalb der Familie und Gesellschaft.
Welche rechtlichen Fortschritte gab es in der Ersten Republik?
Neben dem Wahlrecht wurden Schutzgesetze für Frauenberufe, das Recht auf Bildung und verbesserte Rechte für Mütter etabliert.
Wie wurden Frauen in den Medien der Zwischenkriegszeit dargestellt?
Die Arbeit analysiert das Frauenbild in Kunst, Kultur und Medien und zieht einen Vergleich zum amerikanischen Frauenbild jener Zeit.
Details
- Titel
- Die Frau der Ersten Republik
- Untertitel
- Eine systematische Quellenanalyse
- Hochschule
- Johannes Kepler Universität Linz (Neuere Geschichte und Zeitgeschichte)
- Note
- 1,0
- Autor
- Sarah Hagenauer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 47
- Katalognummer
- V1359088
- ISBN (Buch)
- 9783346877444
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- frau ersten republik eine quellenanalyse
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Sarah Hagenauer (Autor:in), 2020, Die Frau der Ersten Republik, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1359088
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-