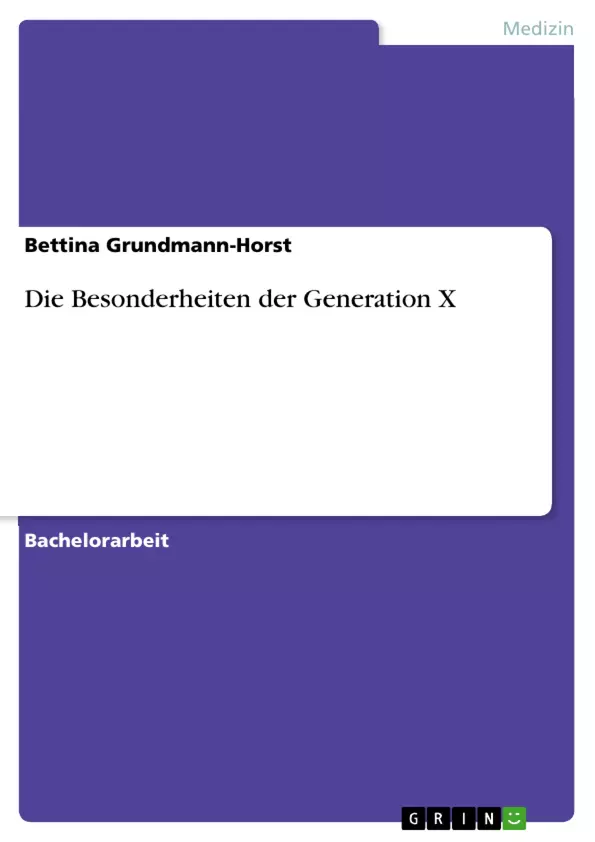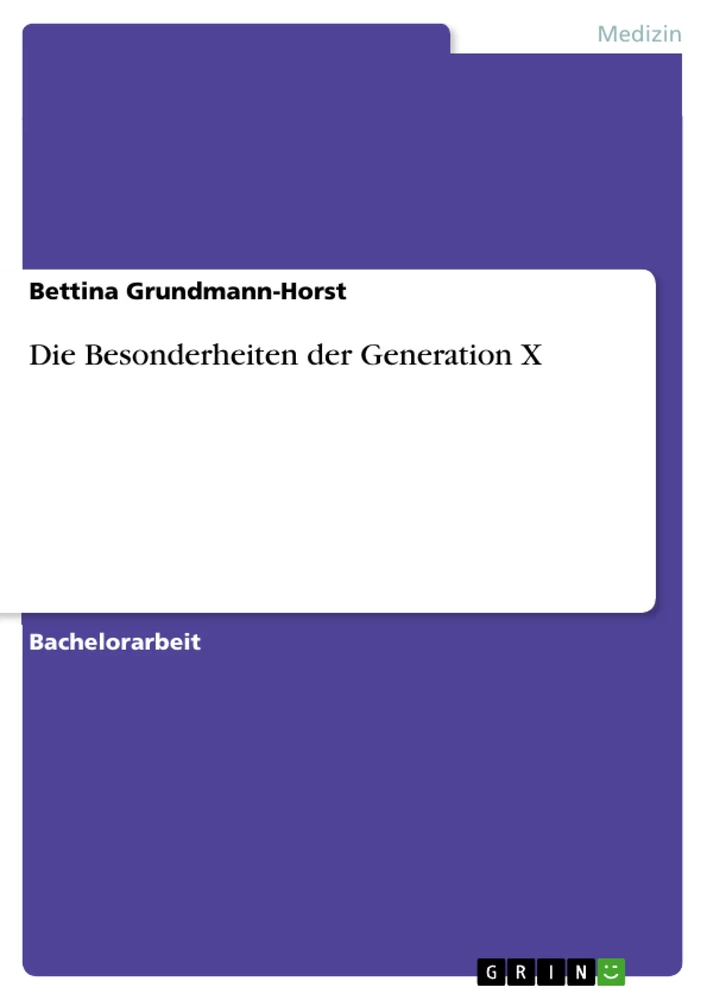
Die Besonderheiten der Generation X. Werden aktuell angewandte gerontopsychiatrische Pflegemodelle den spezifischen Aspekten dieser Generation gerecht?
Bachelorarbeit, 2018
39 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Pflegemodelle
- 2.1.1 Psychobiographisches Modell nach Böhm
- 2.1.2 Gezeitenmodell nach Phil Barker
- 2.2 Generationen
- 2.2.1 Generationenkonzepte
- 2.2.2 Generationenüberblick
- 2.2.3 Die Generation X
- 2.2.4 Generation Golf
- 2.2.5 Die dritte Generation Ost
- 2.2.6 Generation X international
- 3. Wissenschaftliche Zielsetzung und Fragestellung
- 4. Methodik
- 5. Charakteristika der Generation X
- 5.1 Generationsspezifische Fremdzuschreibungen
- 5.2 Generationsspezifische Selbstzuschreibungen
- 5.3 Zusammenfassung der generationsspezifischen Attribute
- 6. Erörterung der generationenspezifischen Eigenschaften im Kontext der ausgewählten Pflegemodelle
- 6.1 Generation X im Psychobiographischen Modell nach Böhm
- 6.2 Generation X im Gezeitenmodell nach Barker
- 7. Schlussfolgerung/ Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Generation X (Geburtsjahrgänge 1965-1980) und deren spezifische Bedürfnisse im Kontext der gerontopsychiatrischen Pflege. Das Hauptziel ist die Überprüfung der Anwendbarkeit aktueller Pflegemodelle auf diese Generation, die bald das Rentenalter erreicht. Die Arbeit analysiert, inwiefern die individuellen Biografien und kognitiven Fähigkeiten der Generation X in den bestehenden Modellen berücksichtigt werden.
- Generationsspezifische Werte und Eigenschaften der Generation X
- Anwendbarkeit aktueller gerontopsychiatrischer Pflegemodelle
- Berücksichtigung individueller Biografien und kognitiver Fähigkeiten in der Pflege
- Zukunftsperspektiven der gerontopsychiatrischen Pflege für die Generation X
- Analyse von Pflegemodellen im Hinblick auf die Bedürfnisse der Generation X
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den aktuellen Pflegenotstand und die demografische Entwicklung in Deutschland. Sie hebt die Bedeutung der Anpassung der Pflegeangebote an die Bedürfnisse der verschiedenen Generationen hervor und fokussiert dabei speziell auf die Generation X, die in naher Zukunft verstärkt pflegebedürftig sein wird. Die Arbeit untersucht daher, ob bestehende Pflegemodelle die generationsspezifischen Aspekte dieser Kohorte ausreichend berücksichtigen.
2. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Rahmen für die Arbeit. Es werden zunächst verschiedene Pflegemodelle, insbesondere das psychobiographische Modell nach Böhm und das Gezeitenmodell nach Barker, vorgestellt und erläutert. Anschließend wird der Begriff "Generation" definiert und ein Überblick über verschiedene Generationen gegeben, mit besonderem Fokus auf die Generation X und ihren soziokulturellen Kontext. Die verschiedenen Generationenkonzepte liefern die Grundlage für das Verständnis der Generation X und deren Prägungen.
5. Charakteristika der Generation X: Dieses Kapitel beschreibt die Charakteristika der Generation X, differenziert zwischen Fremd- und Selbstzuschreibungen und synthetisiert diese zu einem Gesamtbild der Generation. Es werden die Werte, Einstellungen und prägenden Lebenserfahrungen dieser Generation untersucht, die ihren Einfluss auf die Pflegebedürfnisse im Alter haben. Die Analyse legt den Schwerpunkt auf die spezifischen Herausforderungen, die sich aus den individuellen Lebensläufen ergeben und die für eine altersgerechte Pflege von Bedeutung sind.
6. Erörterung der generationenspezifischen Eigenschaften im Kontext der ausgewählten Pflegemodelle: In diesem Kapitel wird analysiert, wie die im vorherigen Kapitel beschriebenen Eigenschaften der Generation X in den ausgewählten Pflegemodellen (psychobiographisches Modell nach Böhm und Gezeitenmodell nach Barker) zum Tragen kommen. Es wird untersucht, inwiefern die Modelle geeignet sind, die individuellen Bedürfnisse und Biografien der Generation X zu berücksichtigen und eine passgenaue Pflege zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der Modelle und der Anpassung an die spezifischen Herausforderungen, die sich aus den Lebenserfahrungen der Generation X ergeben.
Schlüsselwörter
Generation X, Gerontopsychiatrie, Pflegemodelle, Psychobiografisches Modell, Gezeitenmodell, Biografiearbeit, Kognitive Fähigkeiten, Altersvorsorge, Demografischer Wandel, Pflegebedürftigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Generation X in der gerontopsychiatrischen Pflege
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Generation X (Geburtsjahrgänge 1965-1980) und deren spezifische Bedürfnisse im Kontext der gerontopsychiatrischen Pflege. Das Hauptziel ist die Überprüfung der Anwendbarkeit aktueller Pflegemodelle auf diese Generation, die bald das Rentenalter erreicht. Die Arbeit analysiert, inwiefern die individuellen Biografien und kognitiven Fähigkeiten der Generation X in den bestehenden Modellen berücksichtigt werden.
Welche Pflegemodelle werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf zwei Pflegemodelle: das psychobiographische Modell nach Böhm und das Gezeitenmodell nach Barker. Diese Modelle werden daraufhin analysiert, wie gut sie die spezifischen Bedürfnisse und Lebenserfahrungen der Generation X berücksichtigen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: generationsspezifische Werte und Eigenschaften der Generation X, Anwendbarkeit aktueller gerontopsychiatrischer Pflegemodelle, Berücksichtigung individueller Biografien und kognitiver Fähigkeiten in der Pflege, Zukunftsperspektiven der gerontopsychiatrischen Pflege für die Generation X und die Analyse von Pflegemodellen im Hinblick auf die Bedürfnisse der Generation X.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund (inkl. Pflegemodelle und Generationenkonzepte), Wissenschaftliche Zielsetzung und Fragestellung, Methodik, Charakteristika der Generation X (Fremd- und Selbstzuschreibungen), Erörterung der generationsspezifischen Eigenschaften im Kontext der ausgewählten Pflegemodelle und Schlussfolgerung/Fazit. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis findet sich im Dokument.
Welche Charakteristika der Generation X werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl fremde Zuschreibungen als auch Selbstzuschreibungen der Generation X, um ein umfassendes Bild ihrer Werte, Einstellungen und prägenden Lebenserfahrungen zu erstellen. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen, die sich aus den individuellen Lebensläufen für die altersgerechte Pflege ergeben.
Wie werden die Ergebnisse der Analyse präsentiert?
Die Ergebnisse werden in Form einer detaillierten Analyse der Anwendbarkeit der ausgewählten Pflegemodelle auf die Generation X präsentiert. Es wird untersucht, inwieweit die Modelle geeignet sind, die individuellen Bedürfnisse und Biografien der Generation X zu berücksichtigen und eine passgenaue Pflege zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der Modelle und der Anpassung an die spezifischen Herausforderungen der Generation X.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Generation X, Gerontopsychiatrie, Pflegemodelle, Psychobiografisches Modell, Gezeitenmodell, Biografiearbeit, Kognitive Fähigkeiten, Altersvorsorge, Demografischer Wandel, Pflegebedürftigkeit.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit gerontopsychiatrischer Pflege, der Generation X und dem demografischen Wandel auseinandersetzen, insbesondere für Pflegekräfte, Pflegewissenschaftler, Gerontologen und Sozialarbeiter.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und Entwicklungen in der gerontopsychiatrischen Pflege im Hinblick auf die Bedürfnisse der Generation X. (Der genaue Inhalt der Schlussfolgerung ist im vollständigen Dokument enthalten.)
Details
- Titel
- Die Besonderheiten der Generation X. Werden aktuell angewandte gerontopsychiatrische Pflegemodelle den spezifischen Aspekten dieser Generation gerecht?
- Hochschule
- Fachhochschule der Diakonie GmbH
- Note
- 1,3
- Autor
- Bettina Grundmann-Horst (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 39
- Katalognummer
- V1359206
- ISBN (eBook)
- 9783346876829
- ISBN (Buch)
- 9783346876836
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Diese Arbeit ist eine wertvolle Orientierungshilfe, um bereits heute Akzente in der Pflege zu setzen, damit die Generation X sich mit ihren Bedürfnissen im Bereich der Pflege in der Zukunft wahrgenommen fühlt.
- Schlagworte
- Pflege Generation X
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Bettina Grundmann-Horst (Autor:in), 2018, Die Besonderheiten der Generation X. Werden aktuell angewandte gerontopsychiatrische Pflegemodelle den spezifischen Aspekten dieser Generation gerecht?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1359206
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-