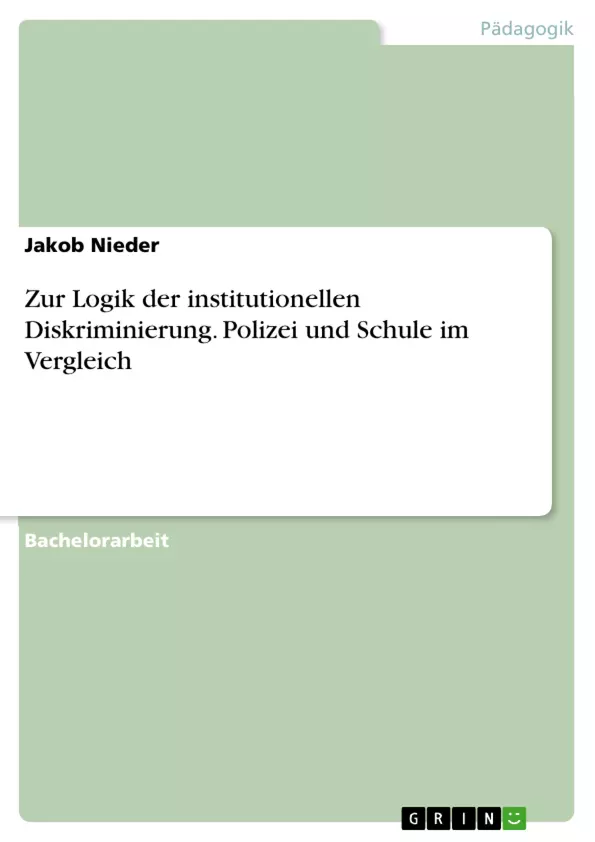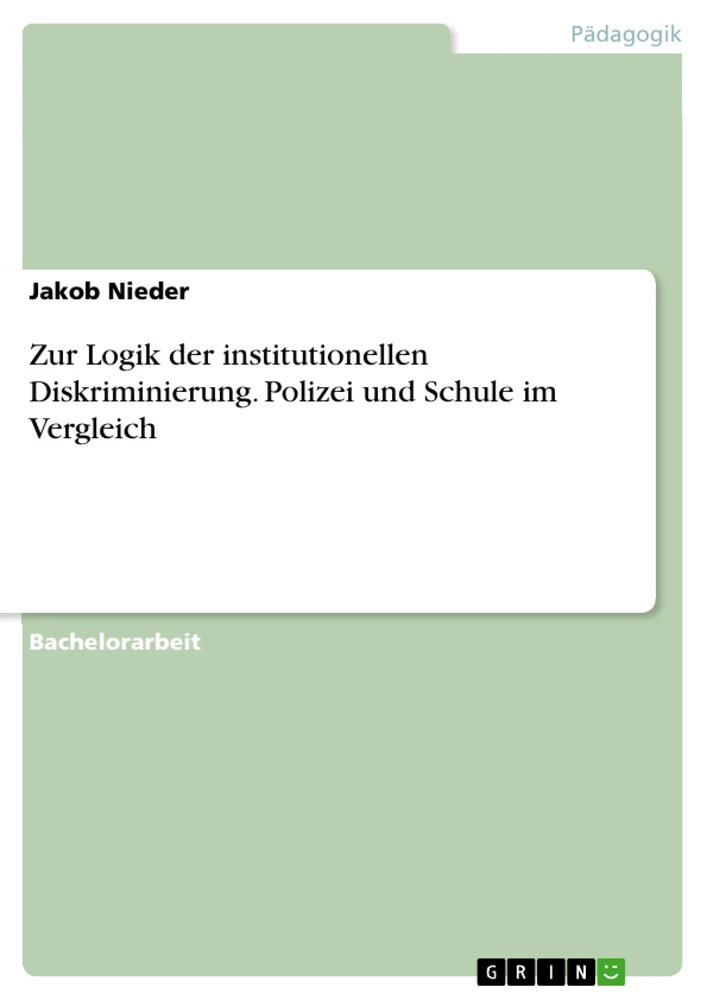
Zur Logik der institutionellen Diskriminierung. Polizei und Schule im Vergleich
Bachelorarbeit, 2022
38 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition Diskriminierung
- 2.1. Institutionelle Diskriminierung
- 2.2 Exkurs über die Problematik des Begriffs, Menschen mit Migrationshintergrund'
- 3. Die Begründung für einen Vergleich zwischen den Institutionen Polizei und Schule
- 4. Aufbau und Organisation der Institution Polizei
- 4.1. Zusammensetzung und institutionelle Lebenswelt der Polizei
- 5. Aufbau und Organisation der Institution Schule
- 5.1. Zusammensetzung der Schule
- 6. Einführung Vergleichsmaßstäbe
- 6.1 Vergleichsmaßstab Schlussregeln und Begründungsmuster
- 6.2 Vergleichsmaßstab Ermessensspielraum
- 7. (Staatliche) Logik hinter institutioneller Diskriminierung
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Phänomen der institutionellen Diskriminierung, insbesondere im Vergleich der Institutionen Polizei und Schule. Ziel ist es, die Mechanismen und Wirkungsweisen hinter institutioneller Diskriminierung zu analysieren, indem der Fokus auf die jeweiligen organisatorischen Strukturen, rechtlichen Rahmenbedingungen und Normalitätserwartungen gelegt wird.
- Definition und Abgrenzung verschiedener Diskriminierungsformen
- Analyse der institutionellen Lebenswelt von Polizei und Schule
- Untersuchung der Auswirkungen von Ermessensspielräumen und Schlussregeln
- Bewertung des Beitrags von Normalitätserwartungen zur (Re-)Produktion von Ungleichheit
- Konkrete Beispiele aus Studien und Forschungsprojekten
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und verdeutlicht die Relevanz von Diskriminierungs- und Chancengleichheitsthemen in einer zunehmend diversen Gesellschaft. Es werden Beispiele für Diskriminierungserfahrungen in den Bereichen Schule und Polizei aufgezeigt, die die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit institutionellen Diskriminierungsformen betonen.
- Kapitel 2: Definition Diskriminierung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Diskriminierung und grenzt ihn von anderen Formen ab, insbesondere institutionelle Diskriminierung. Die Problematik des Begriffs "Menschen mit Migrationshintergrund" wird ebenfalls beleuchtet, um die Macht der Sprache im Hinblick auf gesamtgesellschaftliche Denk- und Handlungsmuster zu verdeutlichen.
- Kapitel 3: Die Begründung für einen Vergleich zwischen den Institutionen Polizei und Schule: Hier wird die Relevanz des Vergleichs von Polizei und Schule im Kontext der institutionellen Diskriminierung begründet. Es werden gemeinsame Merkmale der Institutionen im Hinblick auf ihre Rolle in der Gesellschaft, ihre hierarchischen Strukturen und ihre Bedeutung für die (Re-) Produktion von Ungleichheit hervorgehoben.
- Kapitel 4: Aufbau und Organisation der Institution Polizei: Dieses Kapitel beleuchtet den organisatorischen Aufbau und die institutionelle Lebenswelt der Polizei. Es werden Aspekte wie die Zusammensetzung der Polizei, ihre rechtlichen Rahmenbedingungen, Ermessensspielräume und Normalitätserwartungen betrachtet, um die Bedingungen für mögliche institutionelle Diskriminierung aufzuzeigen.
- Kapitel 5: Aufbau und Organisation der Institution Schule: In diesem Kapitel werden der Aufbau und die Organisation der Institution Schule analysiert. Es werden die Zusammensetzung der Schule, die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen, Ermessensspielräume und die damit verbundenen Normalitätserwartungen betrachtet, um potenzielle Mechanismen institutioneller Diskriminierung zu identifizieren.
- Kapitel 6: Einführung Vergleichsmaßstäbe: Dieses Kapitel führt wichtige Vergleichsmaßstäbe für die Analyse von institutioneller Diskriminierung in Polizei und Schule ein. Es werden die Bedeutung von Schlussregeln und Begründungsmustern sowie die Rolle des Ermessensspielraums in den jeweiligen Institutionen untersucht.
- Kapitel 7: (Staatliche) Logik hinter institutioneller Diskriminierung: Hier werden konkrete Beispiele aus Studien und Forschungsprojekten zur institutionellen Diskriminierung in Polizei und Schule vorgestellt. Es wird analysiert, wie die bewusste Weitfassung von Ermessensspielräumen in Kombination mit institutionellem Wissen und Normalitätserwartungen zur (Re-)Produktion von Ungleichheit beitragen kann.
Schlüsselwörter
Institutionelle Diskriminierung, Polizei, Schule, Vergleich, Ermessensspielraum, Normalitätserwartung, Schlussregeln, Begründungsmuster, (Re-) Produktion von Ungleichheit, Macht der Sprache, Menschen mit Migrationshintergrund.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter institutioneller Diskriminierung?
Es handelt sich um Diskriminierung, die durch organisatorische Strukturen, rechtliche Rahmenbedingungen und Normalitätserwartungen innerhalb von Institutionen wie Polizei und Schule entsteht.
Warum werden gerade Polizei und Schule miteinander verglichen?
Beide Institutionen verfügen über weite Ermessensspielräume und hierarchische Strukturen, die maßgeblich zur (Re-)Produktion gesellschaftlicher Ungleichheit beitragen können.
Welche Rolle spielt die Sprache bei der Diskriminierung?
Die Arbeit analysiert die Macht der Sprache am Beispiel des Begriffs „Menschen mit Migrationshintergrund“ und wie dieser Denk- und Handlungsmuster beeinflusst.
Wie führen Ermessensspielräume zu Ungleichheit?
Die Auslegung von Spielräumen ist oft durch institutionelles Wissen und Normalitätserwartungen der Beamten geprägt, was zu unbewusster Benachteiligung führen kann.
Welche Studien werden in der Arbeit herangezogen?
Die Arbeit vergleicht die Studie „Institutionelle Diskriminierung“ (Gomolla & Radtke) aus dem Schulbereich mit dem Projekt „KORSIT“ aus dem Polizeibereich.
Details
- Titel
- Zur Logik der institutionellen Diskriminierung. Polizei und Schule im Vergleich
- Hochschule
- Universität Bielefeld
- Note
- 1,0
- Autor
- Jakob Nieder (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 38
- Katalognummer
- V1359239
- ISBN (Buch)
- 9783346876690
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- "Insgesamt legt Jakob Nieder eine weit überdurchschnittliche Bachelorarbeit vor, die zu den inhaltlich und sprachlich besten Bachelorarbeiten gehört, die ich begutachtet habe, seit es Bachelorarbeiten gibt."
- Schlagworte
- Polizei Diskriminierung Schule Instiutionen Ermessensspielraum Gleichbehandlung Ungleichbehandlung Migrationshintergrund Organisationen Rassismus Alltagsrassismus
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Jakob Nieder (Autor:in), 2022, Zur Logik der institutionellen Diskriminierung. Polizei und Schule im Vergleich, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1359239
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-