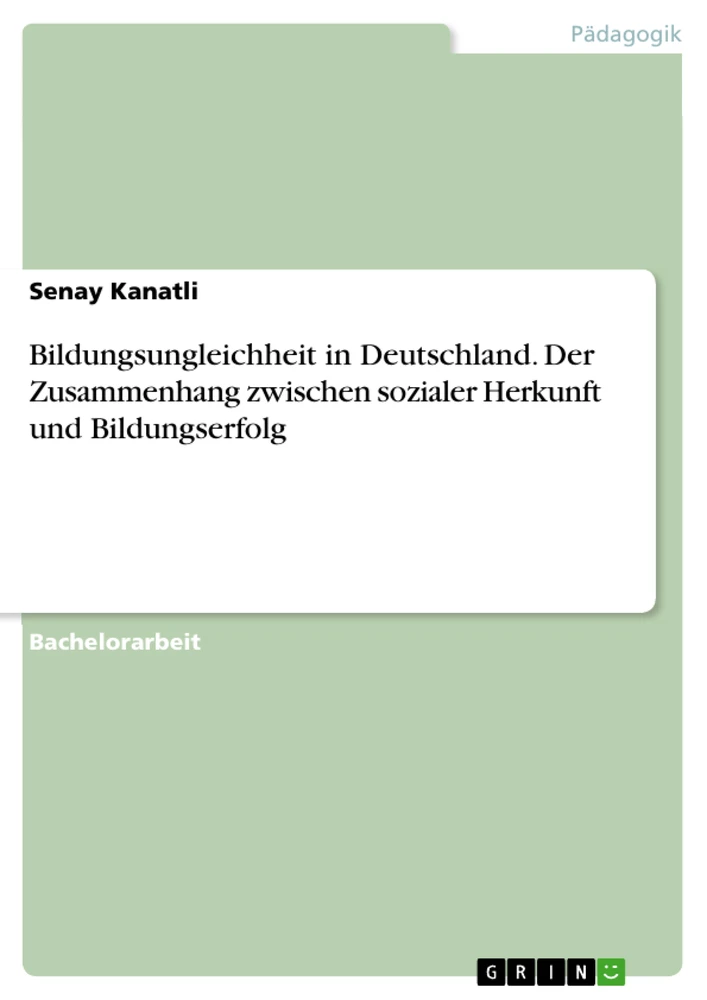
Bildungsungleichheit in Deutschland. Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg
Bachelorarbeit, 2022
59 Seiten, Note: 1.0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffsbestimmungen
2.1 Bildungsungleichheit
2.2 Soziale Herkunft
2.3 Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit?
3 Das deutsche Bildungssystem
3.1 Geschichtliche Entwicklung des deutschen Bildungssystems
3.2 Struktur und Aufbau des deutschen Bildungssystems
3.2.1 Elementarbereich
3.2.2 Primarbereich
3.2.3 Sekundarbereich I
3.2.4 Sekundarbereich II
3.2.5 Tertiärbereich
3.3 Funktionen von Schule
4 Theorien zur Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungswe- sen
4.1 Der Rational-Choice-Ansatz Raymond Boudons
4.1.1 Primäre Herkunftseffekte
4.1.2 Sekundäre Herkunftseffekte
4.2 Bourdieus Theorie der sozialen Praxis
4.2.1 Der Habitus
4.2.2 Der soziale Raum
4.2.3 Die Kapitalarten
5 Zum aktuellen Stand der Forschung
5.1 Operationalisierung der Begriffe ‚Bildungserfolg‘ und ‚soziale Herkunft‘
5.2 Forschungsergebnisse
6 Empfehlungen zum Abbau herkunftsbedingter Bildungsungleich- heit am Beispiel Estlands
6.1 Struktur und Aufbau des estnischen Bildungssystems
6.1.1 Elementarbereich
6.1.2 Primarbereich
6.2 Verpflichtende Vorschule
6.3 Abschaffung der Mehrgliedrigkeit
6.4 Ganztagsschulen
7 Fazit und Ausblick
8 Literaturverzeichnis
9 Abbildungsverzeichnis
10 Tabellenverzeichnis
Details
- Titel
- Bildungsungleichheit in Deutschland. Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg
- Hochschule
- Pädagogische Hochschule Heidelberg
- Note
- 1.0
- Autor
- Senay Kanatli (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 59
- Katalognummer
- V1359465
- ISBN (eBook)
- 9783346878229
- ISBN (Buch)
- 9783346878236
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- bildungsungleichheit deutschland zusammenhang herkunft bildungserfolg
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Senay Kanatli (Autor:in), 2022, Bildungsungleichheit in Deutschland. Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1359465
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









