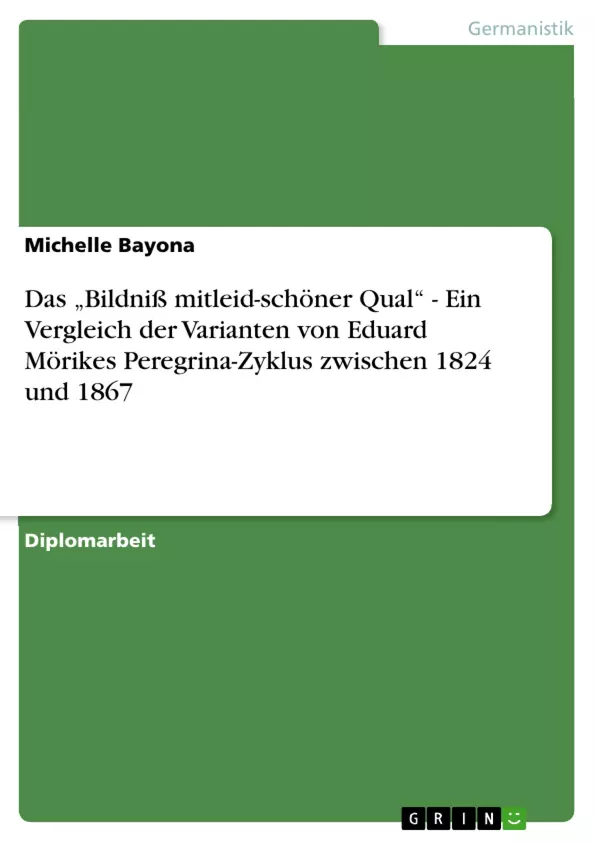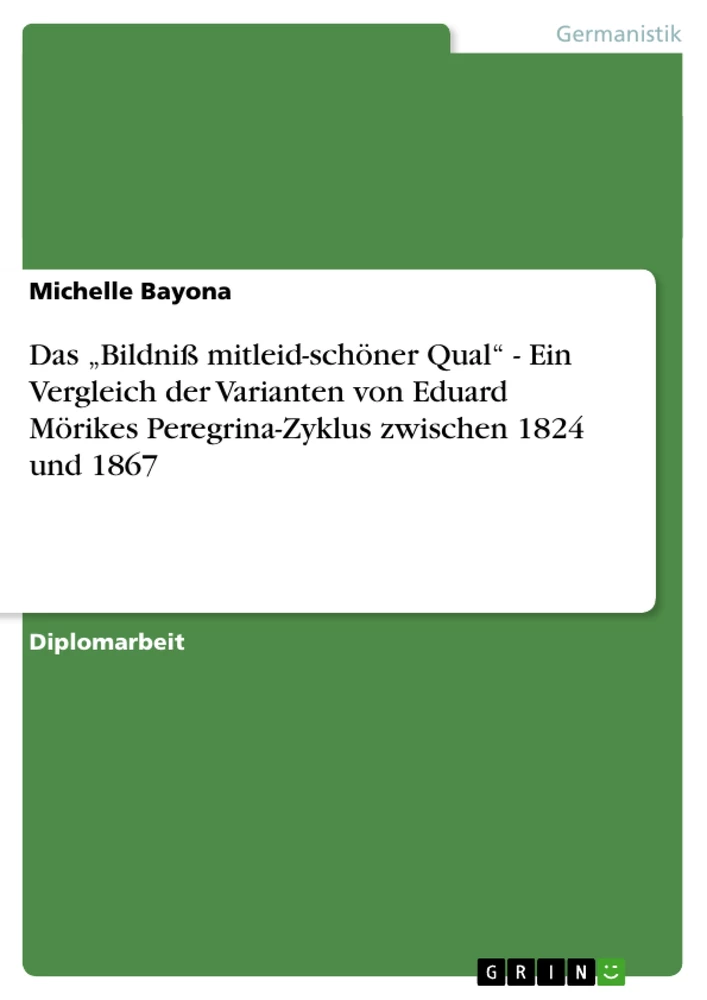
Das „Bildniß mitleid-schöner Qual“ - Ein Vergleich der Varianten von Eduard Mörikes Peregrina-Zyklus zwischen 1824 und 1867
Diplomarbeit, 2008
129 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- A Einheit und Vielfalt des Peregrina-Zyklus’
- 1. Thematische Eingrenzung
- 2. Zielsetzung und methodische Vorgehensweise
- B Entwicklung und Aufnahme der Peregrina-Dichtung
- 1. Urbild-Die schöne Fremde Maria Meyer
- 2. Vorbild: Literarische Reminiszenzen
- 3. Bildentwicklung: Die Textgenese und das Problem der Datierung
- 3.1 Mörikes dichterischer Arbeitsprozess
- 3.2 Chronologie und Entstehungszeiträume der Gedichte
- 4. Öffentlichkeitsbild: Zeitgenössische Rezeption in Wort und Bild
- C Der Gedichtzyklus und seine Varianten
- 1. Das Spiegelbild: Peregrina I.
- 1.1 Die Verführung
- 1.2 Die Doppelung der Verführung
- 2. Das Hochzeitsbild: Peregrina II.
- 2.1 Das „fantastische“ Umfeld der Hochzeit
- 2.2 Die seltsame Braut
- 2.3 Der Lust-Garten
- 2.4 Der magische und der erotische Liebesbund
- 3. Das Trugbild: Peregrina III
- 3.1 Der Liebesverrat
- 3.2 Wahnsinn und Schuldfrage
- 3.3 Die Rückwirkung der Verstoßung
- 3.3.1 Zwischen Welt und „Heideland“ - Varianten von 1824 - 1856
- 3.3.2 Der Zwang des Zauberfadens - Varianten ab 1867
- 4. Das „Bildniß mitleid-schöner Qual“: Peregrina IV.
- 5. Das Heiligenbild: Peregrina V
- 5.1 Die Büßerin am Pfahl
- 5.2 Der endgültige Verlust
- D Die Peregrina-Dichtung im Werkkontext des „Maler Nolten“
- 1. „Er hat mir’s geschworen“ – Die Bindung des Mannes an das weibliche Elementarwesen
- 2. Magische Schicksalsorte
- 3. Abbilder Peregrinas
- 3.1 Agnes, die hysterische Pastorentochter
- 3.2 Elisabeth, die unschuldige Verführerin
- E Eduard Mörikes Prozess „Mitleid-schöner Qual“
- 1. Tendenzen im Verlauf der Peregrina-Dichtung
- 2. Die Peregrina-Dichtung und Mörikes literarische Ästhetik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und die Varianten des Peregrina-Zyklus von Eduard Mörike zwischen 1824 und 1867. Ziel ist es, die Veränderungen in Mörikes Werk über einen Zeitraum von über vierzig Jahren zu analysieren und mögliche Trends in seinem Umformungsprozess aufzuzeigen. Die Arbeit betrachtet die Gedichte nicht nur als eigenständigen Zyklus, sondern auch im Kontext ihrer verschiedenen Veröffentlichungsformen und -varianten.
- Entwicklung des Peregrina-Zyklus über vierzig Jahre
- Analyse der verschiedenen Varianten und deren Unterschiede
- Die Rolle von Maria Meyer als Inspiration
- Der Einfluss von Zeitumständen und literarischen Epochen
- Die Verbindung zwischen den Gedichten und Mörikes Lebenserfahrungen
Zusammenfassung der Kapitel
A Einheit und Vielfalt des Peregrina-Zyklus’: Dieses einleitende Kapitel beschreibt die zahlreichen Varianten des Peregrina-Zyklus und die damit verbundene Herausforderung, die Gedichte in ihrer Gesamtheit zu verstehen. Es wird die Komplexität des Zyklus hervorgehoben und die Bedeutung der Analyse der verschiedenen Fassungen betont. Der Fokus liegt auf der Vielschichtigkeit des Werkes und dem Rätselhaften, das es trotz intensiver Forschung aufweist. Die Verbindung zu Mörikes Liebesbeziehung mit Maria Meyer wird angesprochen, aber auch die Notwendigkeit, den Zyklus nicht lediglich als autobiografische Verarbeitung dieser Beziehung zu betrachten, wird klargestellt.
B Entwicklung und Aufnahme der Peregrina-Dichtung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und der Rezeption der Peregrina-Gedichte. Es untersucht die Rolle von Maria Meyer als mögliches „Urbild“ und analysiert literarische Vorbilder und Einflüsse. Der dichterische Arbeitsprozess Mörikes, die Chronologie der Entstehung der Gedichte und deren öffentliche Rezeption werden umfassend beleuchtet. Der Abschnitt zeigt die langjährige Bearbeitung der Gedichte und deren kontinuierliche Veränderung auf.
C Der Gedichtzyklus und seine Varianten: Dieses Kapitel analysiert die einzelnen Peregrina-Gedichte und ihre zahlreichen Varianten. Es untersucht die jeweilige Thematik und die Entwicklung der Motivführung von Version zu Version. Die Kapitel unterteilen die Analyse nach den einzelnen Gedichten (Peregrina I-V), wobei der Fokus auf den übergreifenden Themen wie Liebe, Verrat, Schuld und Verlust liegt. Der Kapitel verfolgt die Entwicklung der verschiedenen Motive und deren Bedeutung für den gesamten Zyklus.
D Die Peregrina-Dichtung im Werkkontext des „Maler Nolten“: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen dem Peregrina-Zyklus und Mörikes Werk „Maler Nolten“. Es werden Parallelen und Unterschiede zwischen den verschiedenen weiblichen Figuren beider Werke aufgezeigt und die Bedeutung dieser Verbindung für das Verständnis des Peregrina-Zyklus erörtert. Es wird die Rolle von Magie und Schicksalsorten in beiden Werken beleuchtet.
Schlüsselwörter
Eduard Mörike, Peregrina-Zyklus, Gedichtvarianten, Textgenese, Maria Meyer, Liebeslyrik, Biedermeier, Verführung, Verrat, Schuld, Wahnsinn, magische Elemente, literarische Ästhetik, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Eduard Mörike Peregrina-Zyklus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Peregrina-Zyklus von Eduard Mörike, seine Entwicklung über vierzig Jahre hinweg und die verschiedenen Varianten der Gedichte. Sie untersucht die Veränderungen in Mörikes Werk und mögliche Trends in seinem Umformungsprozess. Der Fokus liegt auf der Vielschichtigkeit des Zyklus und seinen verschiedenen Veröffentlichungsformen.
Welche Themen werden im Peregrina-Zyklus behandelt?
Der Zyklus befasst sich mit zentralen Themen wie Liebe, Verrat, Schuld, Wahnsinn und Verlust. Die Gedichte erzählen die Geschichte einer rätselhaften Frau, Peregrina, und ihren komplexen Beziehungen. Magische Elemente und Schicksalsorte spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Wer war Maria Meyer und welche Rolle spielt sie?
Maria Meyer wird als mögliches „Urbild“ für Peregrina angesehen. Die Arbeit untersucht ihren Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung des Gedichtzyklus, betont aber gleichzeitig, dass der Zyklus nicht nur als autobiografische Verarbeitung dieser Beziehung verstanden werden sollte.
Wie ist der Peregrina-Zyklus strukturiert?
Der Zyklus umfasst fünf Gedichte (Peregrina I-V), die jeweils in mehreren Varianten existieren. Die Arbeit analysiert die einzelnen Gedichte und ihre Entwicklung von Version zu Version, fokussiert auf die übergreifenden Themen Liebe, Verrat, Schuld und Verlust. Die einzelnen Gedichte werden nach ihren Bildaspekten (Spiegelbild, Hochzeitsbild, Trugbild, Bildnis mitleid-schöner Qual, Heiligenbild) gegliedert.
Welche anderen Werke Mörikes werden in Bezug zum Peregrina-Zyklus untersucht?
Die Arbeit untersucht die Verbindung zwischen dem Peregrina-Zyklus und Mörikes Werk „Maler Nolten“, zeigt Parallelen und Unterschiede zwischen den weiblichen Figuren beider Werke auf und erörtert die Bedeutung dieser Verbindung für das Verständnis des Peregrina-Zyklus. Es wird insbesondere die Rolle von Magie und Schicksalsorten in beiden Werken beleuchtet.
Welche Methode wird in dieser Arbeit angewendet?
Die Arbeit analysiert die verschiedenen Versionen der Gedichte, ihre Entstehungszeiträume und die zeitgenössische Rezeption. Sie untersucht literarische Vorbilder und Einflüsse und betrachtet den Zyklus sowohl als eigenständigen Zyklus als auch im Kontext von Mörikes Gesamtwerk und seiner literarischen Ästhetik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Eduard Mörike, Peregrina-Zyklus, Gedichtvarianten, Textgenese, Maria Meyer, Liebeslyrik, Biedermeier, Verführung, Verrat, Schuld, Wahnsinn, magische Elemente, literarische Ästhetik, Rezeption.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: A) Einheit und Vielfalt des Peregrina-Zyklus’; B) Entwicklung und Aufnahme der Peregrina-Dichtung; C) Der Gedichtzyklus und seine Varianten; D) Die Peregrina-Dichtung im Werkkontext des „Maler Nolten“; E) Eduard Mörikes Prozess „Mitleid-schöner Qual“.
Details
- Titel
- Das „Bildniß mitleid-schöner Qual“ - Ein Vergleich der Varianten von Eduard Mörikes Peregrina-Zyklus zwischen 1824 und 1867
- Hochschule
- Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germanistik)
- Note
- 1,7
- Autor
- Michelle Bayona (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2008
- Seiten
- 129
- Katalognummer
- V137766
- ISBN (eBook)
- 9783640456369
- ISBN (Buch)
- 9783640456475
- Dateigröße
- 1043 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Nolten Mörike Eduard Biedermeier Maria Meyer Gedichtzyklus Peregrina Peregrina-Zyklus
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Michelle Bayona (Autor:in), 2008, Das „Bildniß mitleid-schöner Qual“ - Ein Vergleich der Varianten von Eduard Mörikes Peregrina-Zyklus zwischen 1824 und 1867, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/137766
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-