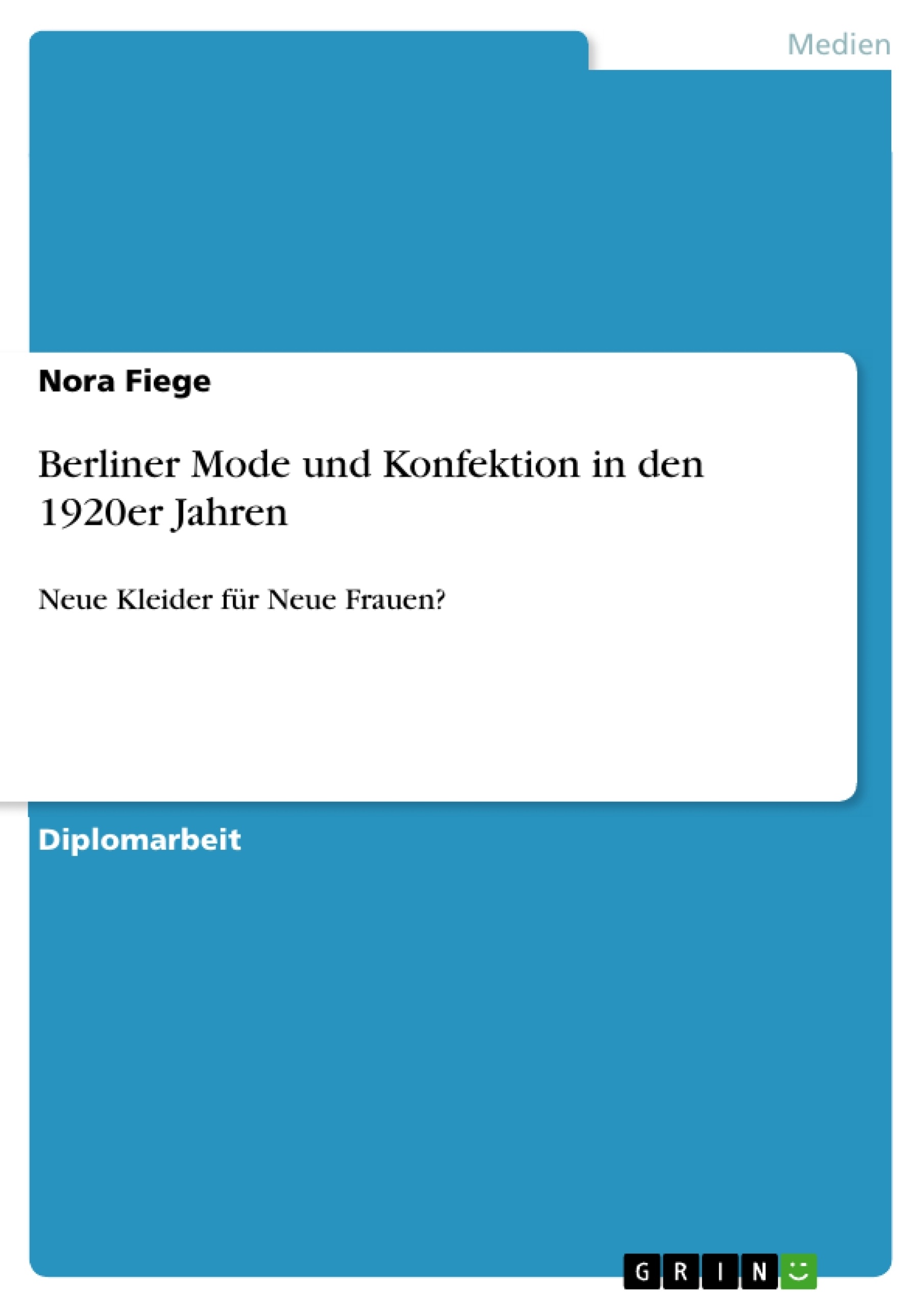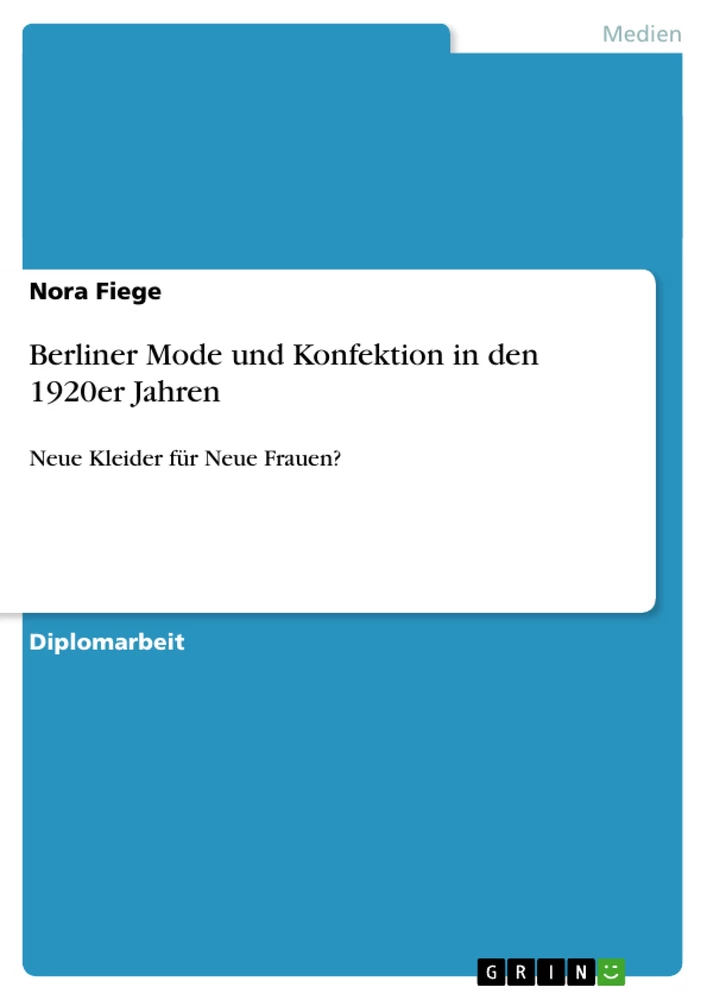
Berliner Mode und Konfektion in den 1920er Jahren
Diplomarbeit, 2008
74 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historische Ausgangspunkte
- 2.1: Preußische Uniformproduktion
- 2.2: Jüdische Textilhandelstradition
- 2.3: Anfänge der Serienproduktion von Bekleidung
- 2.4: Die ersten Berliner Konfektionshäuser im 19. Jahrhundert
- 2.3-1: Herrmann Gerson
- 2.3-2: Nathan Israel
- 2.3-3: Gebrüder Manheimer
- 2.3-4: Rudolph Hertzog
- 3. Die Berliner Modebranche in den Zwanziger Jahren
- 3.1: Industrie ohne Fabriken: Berliner Konfektionsfirmen in den zwanziger Jahren
- 3.2: Der Verband der deutschen Modenindustrie
- 3.3: Berlin - Paris
- 3.4: Die Berliner Durchreise
- 3.5: Mode, Bühne und Film
- 3.6: Berliner Modepresse
- 3.7: Warenhauskultur
- 3.7-1: Hermann Tietz (Hertie)
- 3.7-2: Wertheim
- 3.7-3: Das Kaufhaus des Westens
- 4. Die „Neue Frau“
- 4.1: Weibliche Angestellte: Verkäuferinnen und Sekretärinnen
- 4.2: Arbeiterinnen
- 4.3: Frauenberufe in der Berliner Konfektions- und Modebranche
- 5. Die Berliner Damenmode der 1920er Jahre
- 5.1: Schönheitsideale
- 5.2: Wäsche
- 5.3: Tagesmode
- 5.4: Sportmode
- 5.5: Abendmode
- 5.6: Mäntel
- 5.7: Accessoires
- 5.8: Schmuck
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Berliner Mode und Konfektionsindustrie der 1920er Jahre, beleuchtet ihre historischen Wurzeln und Produktionsweisen, und analysiert den Einfluss der Mode auf das Leben der „Neuen Frau“. Zentrale Fragen sind die Entwicklung eines Berliner Modestils, die Beziehungen zu anderen Wirtschafts- und Kulturbereichen, sowie die Wechselwirkungen zwischen Mode und gesellschaftlichen Veränderungen im Alltag und Berufsleben von Frauen.
- Historische Entwicklung der Berliner Konfektionsbranche
- Das Berliner Zwischenmeistersystem und seine Besonderheiten
- Der Einfluss der „Neuen Frau“ auf die Mode
- Die Rolle der Modepresse und der Warenhäuser
- Berliner Mode im Kontext von Bühne und Film
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt die Entstehung der Arbeit, das persönliche Interesse der Autorin an Frauengeschichte und Mode der 1920er Jahre, sowie die Forschungsfrage, die sich mit den Wurzeln der Berliner Konfektionsbranche, einem möglichen Berliner Modestil, den Schnittstellen zu anderen Bereichen und dem Zusammenhang zwischen Mode und gesellschaftlichen Entwicklungen befasst. Die Schwierigkeiten der Recherche werden angesprochen, da nur wenige originale Kleidungsstücke erhalten sind und die Aufarbeitung des Themas lange vernachlässigt wurde.
2. Historische Ausgangspunkte: Dieses Kapitel untersucht die Vorläufer der Berliner Konfektionsbranche, beginnend mit der Entwicklung der mechanischen Textilproduktion und der Nähmaschine. Es beleuchtet die Bedeutung der preußischen Uniformproduktion mit ihren standardisierten Maßen und der jüdischen Textilhandelstradition, die trotz gesellschaftlicher Ausgrenzung eine wichtige Rolle im Bekleidungshandel spielte. Weiterhin werden die Anfänge der Serienproduktion von Wäsche und Mänteln und die Gründung der ersten Berliner Konfektionshäuser im 19. Jahrhundert detailliert beschrieben, inklusive Porträts wichtiger Firmen wie Hermann Gerson, Nathan Israel, Gebrüder Manheimer und Rudolph Hertzog.
3. Die Berliner Modebranche in den 1920er Jahren: Dieses Kapitel beschreibt die Berliner Modeindustrie der 1920er Jahre, die als „Industrie ohne Fabriken“ charakterisiert wird, aufgrund des Zwischenmeistersystems. Es erläutert die Organisation der Branche, die Rolle des Verbandes der deutschen Modenindustrie, die Beziehung zu Paris als Modevorbild, die Bedeutung der „Berliner Durchreise“ als Modemesse, den Einfluss von Bühne und Film, die Rolle der Modepresse, und die Warenhauskultur mit ihren drei wichtigsten Vertretern (Hertie, Wertheim, KaDeWe).
4. Die „Neue Frau“: Dieses Kapitel hinterfragt den Mythos der „Neuen Frau“ der 1920er Jahre, indem es das Klischee der berufstätigen, unabhängigen und emanzipierten Frau mit der realen Lebenssituation der Mehrheit der Frauen gegenüberstellt. Es analysiert die verbesserte soziale Stellung der Frau durch Wahlrecht und Zugang zu Bildung, die Herausforderungen der Frauenerwerbstätigkeit, die ambivalenten Aspekte weiblicher Selbstbestimmung, und die Doppelbelastung von Beruf und Familie. Die Kapitel unterteilen sich in die Betrachtung weiblicher Angestellter, Arbeiterinnen und die spezifischen Frauenberufe innerhalb der Modebranche.
5. Die Berliner Damenmode der 1920er Jahre: Dieses Kapitel beschreibt die Berliner Damenmode der 1920er Jahre, beginnend mit der Abschaffung des Korsetts und der Rockverkürzung. Es analysiert die verschiedenen modischen „Typen“ (Girl, Dame, Garconne), die jeweiligen Schönheitsideale, und die Bedeutung von Accessoires. Die verschiedenen Kleidungsstücke werden detailliert dargestellt: Wäsche, Tagesmode, Sportmode und Abendmode, sowie Mäntel und Schmuck. Die Kapitel unterteilen sich in die Betrachtung von Schönheitsidealen, Wäsche, Tagesmode, Sportmode, Abendmode, Mäntel und Accessoires.
Schlüsselwörter
Berliner Mode, Konfektionsindustrie, 1920er Jahre, Neue Frau, Zwischenmeistersystem, Warenhauskultur, Modepresse, Schönheitsideale, Arbeitnehmerinnen, Jüdische Unternehmer, Arisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Berliner Mode und Konfektionsindustrie der 1920er Jahre
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Berliner Mode und Konfektionsindustrie der 1920er Jahre, ihre historischen Wurzeln, Produktionsweisen und den Einfluss der Mode auf das Leben der „Neuen Frau“. Es werden Fragen zur Entwicklung eines Berliner Modestils, den Beziehungen zu anderen Wirtschafts- und Kulturbereichen und den Wechselwirkungen zwischen Mode und gesellschaftlichen Veränderungen im Alltag und Berufsleben von Frauen behandelt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der Berliner Konfektionsbranche, das Berliner Zwischenmeistersystem, den Einfluss der „Neuen Frau“ auf die Mode, die Rolle der Modepresse und der Warenhäuser sowie Berliner Mode im Kontext von Bühne und Film.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Historische Ausgangspunkte, Die Berliner Modebranche in den Zwanziger Jahren, Die „Neue Frau“ und Die Berliner Damenmode der 1920er Jahre. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche historischen Ausgangspunkte werden untersucht?
Kapitel 2 untersucht die Vorläufer der Berliner Konfektionsbranche, die preußische Uniformproduktion, die jüdische Textilhandelstradition, die Anfänge der Serienproduktion und die Gründung der ersten Berliner Konfektionshäuser im 19. Jahrhundert (z.B. Hermann Gerson, Nathan Israel, Gebrüder Manheimer, Rudolph Hertzog).
Wie wird die Berliner Modebranche der 1920er Jahre beschrieben?
Kapitel 3 beschreibt die Berliner Modeindustrie der 1920er Jahre als „Industrie ohne Fabriken“ aufgrund des Zwischenmeistersystems. Es analysiert die Branchenorganisation, den Verband der deutschen Modenindustrie, den Einfluss von Paris, die „Berliner Durchreise“, Bühne und Film, die Modepresse und die Warenhauskultur (Hertie, Wertheim, KaDeWe).
Wie wird die „Neue Frau“ dargestellt?
Kapitel 4 hinterfragt den Mythos der „Neuen Frau“, vergleicht das Klischee mit der Realität und analysiert die verbesserte soziale Stellung der Frau, die Herausforderungen der Frauenerwerbstätigkeit, die ambivalenten Aspekte weiblicher Selbstbestimmung und die Doppelbelastung von Beruf und Familie. Es betrachtet weibliche Angestellte, Arbeiterinnen und Frauenberufe in der Modebranche.
Wie wird die Berliner Damenmode der 1920er Jahre beschrieben?
Kapitel 5 beschreibt die Berliner Damenmode, die Abschaffung des Korsetts, die Rockverkürzung, verschiedene modische „Typen“, Schönheitsideale und die Bedeutung von Accessoires. Es analysiert Wäsche, Tagesmode, Sportmode, Abendmode, Mäntel und Schmuck.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Berliner Mode, Konfektionsindustrie, 1920er Jahre, Neue Frau, Zwischenmeistersystem, Warenhauskultur, Modepresse, Schönheitsideale, Arbeitnehmerinnen, Jüdische Unternehmer, Arisierung.
Welche Forschungsfragen werden in der Einleitung genannt?
Die Einleitung benennt die Forschungsfragen nach den Wurzeln der Berliner Konfektionsbranche, einem möglichen Berliner Modestil, den Schnittstellen zu anderen Bereichen und dem Zusammenhang zwischen Mode und gesellschaftlichen Entwicklungen. Die Schwierigkeiten der Recherche aufgrund des Mangels an originalen Kleidungsstücken und der langen Vernachlässigung des Themas werden angesprochen.
Details
- Titel
- Berliner Mode und Konfektion in den 1920er Jahren
- Untertitel
- Neue Kleider für Neue Frauen?
- Hochschule
- Kunsthochschule Berlin-Weissensee Hochschule für Gestaltung
- Note
- 1,3
- Autor
- Diplom Designerin Nora Fiege (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2008
- Seiten
- 74
- Katalognummer
- V139013
- ISBN (eBook)
- 9783640469291
- ISBN (Buch)
- 9783640469482
- Dateigröße
- 4425 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Mode-Geschichte Kostümgeschichte Berliner Konfektion Konfektionsgeschichte Mode der Zwanziger Jahre Modesoziologie Berlin Frauen in den Zwanziger Jahren Design Nationalsozialismus Berlin Geschichte
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 44,99
- Arbeit zitieren
- Diplom Designerin Nora Fiege (Autor:in), 2008, Berliner Mode und Konfektion in den 1920er Jahren, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/139013
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-