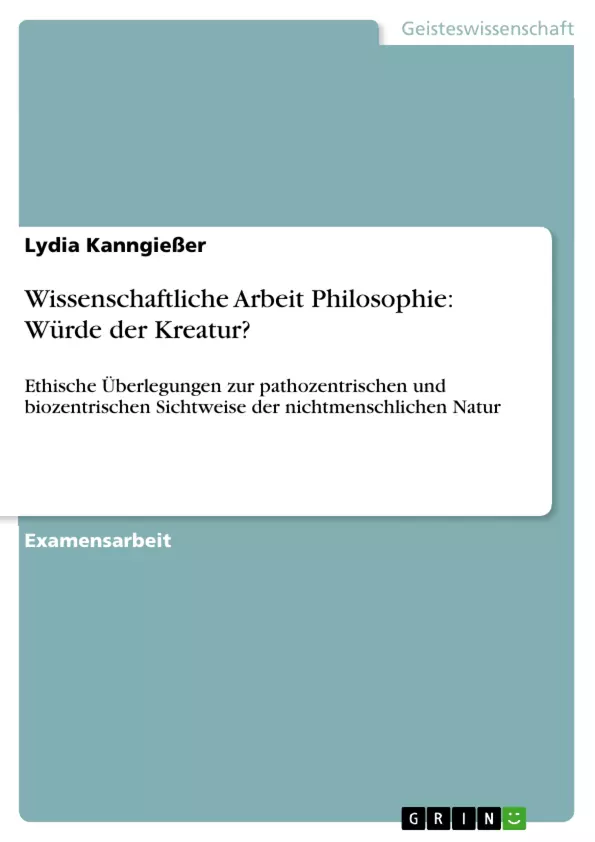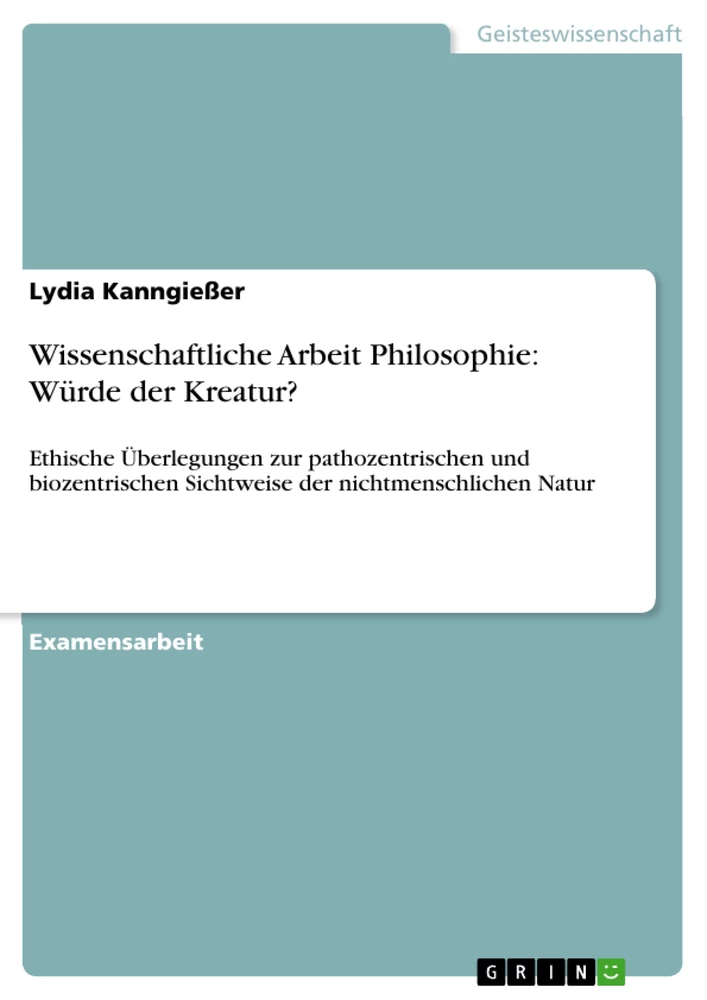
Wissenschaftliche Arbeit Philosophie: Würde der Kreatur?
Examensarbeit, 2009
91 Seiten, Note: 2.0
Philosophie - Praktische (Ethik, Ästhetik, Kultur, Natur, Recht, ...)
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodisches Vorgehen
- Eine pathozentrische Sichtweise und ihre ethischen Implikationen
- Gründe für die Wahl Peter Singers
- Singers Präferenzutilitarismus
- Grundlagen: der klassische Utilitarismus
- Das Prinzip der gleiche Interessenberücksichtigung und das Kriterium der Leidensfähigkeit
- Der Begriff der Person und die Frage nach dem Wert von Leben
- Praktische Folgen im Umgang mit Tieren und Pflanzen
- Der Umgang mit Personen und empfindungsfähigen Wesen
- Der Umgang mit 'empfindungslosen' Entitäten
- Singers Ethik auf dem Prüfstand
- Die Problematik der utilitaristischen Prämissen
- Die Unzulänglichkeit von Singers Ansatz
- Eine biozentrische Sichtweise und ihre ethischen Implikationen
- Zur Bedeutung des Begriffs 'Würde der Kreatur'
- Ansatz einer biozentrische Ethik: Die Ehrfurcht vor dem Leben
- Zum Würde-Verständnis
- Würde der Kreatur: rechtliche Möglichkeiten
- Würde der Kreatur: biologische Grundlagen
- Würde der Kreatur: philosophische Überlegungen
- Würde des Menschen versus Würde der Kreatur
- Die Problematik von inhärenten Werten in der Natur
- Praktische Anwendung des Würdebegriffs: die Interpretation der Gutachter
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ethischen Implikationen des menschlichen Verhältnisses zur Natur, indem sie pathozentrische und biozentrische Perspektiven vergleicht. Sie beleuchtet die Herausforderungen traditioneller ethischer Ansätze im Angesicht neuer, durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt entstandener Probleme.
- Der Vergleich pathozentrischer (Singer) und biozentrischer ethischer Ansätze
- Die Kritik an anthropozentrischen Naturauffassungen
- Die Bedeutung von Leidensfähigkeit und Würde als ethische Kriterien
- Die ethischen Herausforderungen der modernen Biotechnologie und Massentierhaltung
- Die Notwendigkeit einer veränderten Grundeinstellung zum Umgang mit der Natur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik des gestörten Verhältnisses zwischen Mensch und Natur dar und führt zahlreiche Beispiele an, die diese Störung verdeutlichen – von Gentechnik über Umweltkatastrophen bis hin zur Massentierhaltung. Sie unterstreicht die Notwendigkeit, das Selbstverständnis des Menschen angesichts dieser Herausforderungen zu hinterfragen und neue philosophische Ansätze zu entwickeln, da traditionelle Modelle unzureichend sind.
Methodisches Vorgehen: [Dieses Kapitel beschreibt die Methodik, jedoch wird hier kein Inhalt wiedergegeben, da der Fokus auf inhaltstragenden Kapiteln liegt]
Eine pathozentrische Sichtweise und ihre ethischen Implikationen: Dieses Kapitel analysiert Peter Singers Präferenzutilitarismus und seine ethischen Implikationen für den Umgang mit Tieren und Pflanzen. Es beleuchtet Singers Argumentation für die gleiche Interessenberücksichtigung und die Bedeutung der Leidensfähigkeit. Die praktischen Folgen von Singers Ansatz werden diskutiert, einschließlich der Kritik an seinen utilitaristischen Prämissen und der Unzulänglichkeit seines Ansatzes in Bezug auf verschiedene Aspekte des Naturverständnisses.
Eine biozentrische Sichtweise und ihre ethischen Implikationen: Dieses Kapitel erörtert eine biozentrische Ethik, die auf dem Konzept der „Würde der Kreatur“ basiert und die Ehrfurcht vor dem Leben betont. Es untersucht verschiedene Aspekte des Würde-Verständnisses – rechtliche, biologische und philosophische – und diskutiert die Problematik inhärenter Werte in der Natur. Schließlich wird die praktische Anwendung des Würdebegriffs anhand der Interpretation von Gutachtern erläutert.
Schlüsselwörter
Pathozentrismus, Biozentrismus, Präferenzutilitarismus, Tier- und Naturethik, Würde der Kreatur, Anthropozentrismus, Leidensfähigkeit, moderne Biotechnologie, Massentierhaltung, ökologische Verantwortung, ethische Implikationen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Ethische Implikationen des Verhältnisses Mensch-Natur
Was ist der Hauptfokus dieses Textes?
Der Text untersucht die ethischen Implikationen des menschlichen Verhältnisses zur Natur, indem er pathozentrische und biozentrische Perspektiven vergleicht. Er beleuchtet die Herausforderungen traditioneller ethischer Ansätze angesichts neuer Probleme, die durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt entstanden sind.
Welche ethischen Ansätze werden verglichen?
Der Text vergleicht einen pathozentrischen Ansatz, repräsentiert durch Peter Singers Präferenzutilitarismus, mit einem biozentrischen Ansatz, der auf dem Konzept der "Würde der Kreatur" basiert. Der Vergleich dient dazu, die Stärken und Schwächen beider Ansätze im Umgang mit ethischen Fragen der Natur und des menschlichen Verhältnisses zu ihr zu beleuchten.
Was ist der Präferenzutilitarismus nach Singer und wie wird er im Text behandelt?
Der Text analysiert Singers Präferenzutilitarismus und seine ethischen Implikationen für den Umgang mit Tieren und Pflanzen. Es wird Singers Argumentation für die gleiche Interessenberücksichtigung und die Bedeutung der Leidensfähigkeit beleuchtet. Der Text diskutiert auch die praktischen Folgen von Singers Ansatz und die Kritik an seinen utilitaristischen Prämissen.
Was ist der biozentrische Ansatz und wie wird er dargestellt?
Der Text erörtert eine biozentrische Ethik, die auf dem Konzept der „Würde der Kreatur“ basiert und die Ehrfurcht vor dem Leben betont. Untersucht werden verschiedene Aspekte des Würde-Verständnisses – rechtliche, biologische und philosophische – und die Problematik inhärenter Werte in der Natur. Die praktische Anwendung des Würdebegriffs wird anhand der Interpretation von Gutachtern erläutert.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Text zentral?
Zentrale Begriffe sind Pathozentrismus, Biozentrismus, Präferenzutilitarismus, Tier- und Naturethik, Würde der Kreatur, Anthropozentrismus, Leidensfähigkeit, moderne Biotechnologie, Massentierhaltung, ökologische Verantwortung und ethische Implikationen.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es jeweils?
Der Text beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zum methodischen Vorgehen, ein Kapitel zu einer pathozentrischen Sichtweise (Singer), ein Kapitel zu einer biozentrischen Sichtweise und eine Schlussbetrachtung. Die einzelnen Kapitel befassen sich mit den oben genannten Themen, wobei der Fokus auf der Analyse und dem Vergleich der ethischen Ansätze liegt.
Welche Kritikpunkte werden an den vorgestellten ethischen Ansätzen geübt?
Der Text übt Kritik an den utilitaristischen Prämissen von Singers Ansatz und an der Unzulänglichkeit seines Ansatzes in Bezug auf verschiedene Aspekte des Naturverständnisses. Auch die Problematik inhärenter Werte in der Natur und die Herausforderungen bei der praktischen Anwendung des biozentrischen Ansatzes werden diskutiert.
Welche Schlussfolgerung zieht der Text?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass traditionelle ethische Modelle angesichts der Herausforderungen des modernen Verhältnisses von Mensch und Natur unzureichend sind. Es wird die Notwendigkeit einer veränderten Grundeinstellung zum Umgang mit der Natur betont.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Dieser Text ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit Fragen der Ethik, insbesondere der Tier- und Naturethik, auseinandersetzt. Die detaillierte Auseinandersetzung mit philosophischen Konzepten und die wissenschaftliche Herangehensweise machen ihn besonders für Studierende der Philosophie, Ethik, Biologie und verwandter Disziplinen relevant.
Details
- Titel
- Wissenschaftliche Arbeit Philosophie: Würde der Kreatur?
- Untertitel
- Ethische Überlegungen zur pathozentrischen und biozentrischen Sichtweise der nichtmenschlichen Natur
- Hochschule
- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Philosophisches Seminar)
- Veranstaltung
- -
- Note
- 2.0
- Autor
- Lydia Kanngießer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 91
- Katalognummer
- V139506
- ISBN (eBook)
- 9783640496785
- ISBN (Buch)
- 9783640496822
- Dateigröße
- 902 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Würder der Kreatur Tierethik Biozentrismus Pathozentrismus Peter Singer Albert Schweitzer Utilitarismus Präfernezutilitarismus Personenbegriff Leidensfähigkeit Wert von Leben Ehrfrucht vor dem Leben inhärenter Wert der Natur
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Lydia Kanngießer (Autor:in), 2009, Wissenschaftliche Arbeit Philosophie: Würde der Kreatur?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/139506
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-