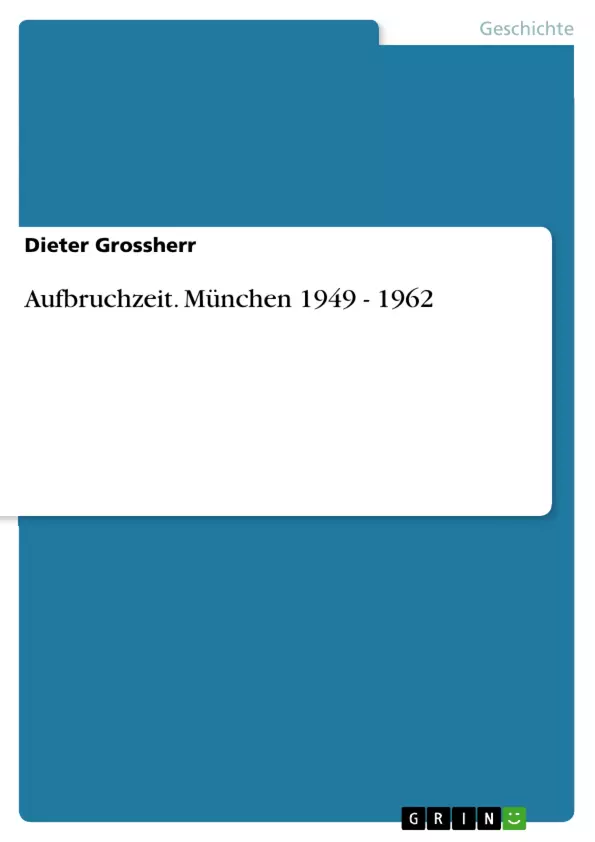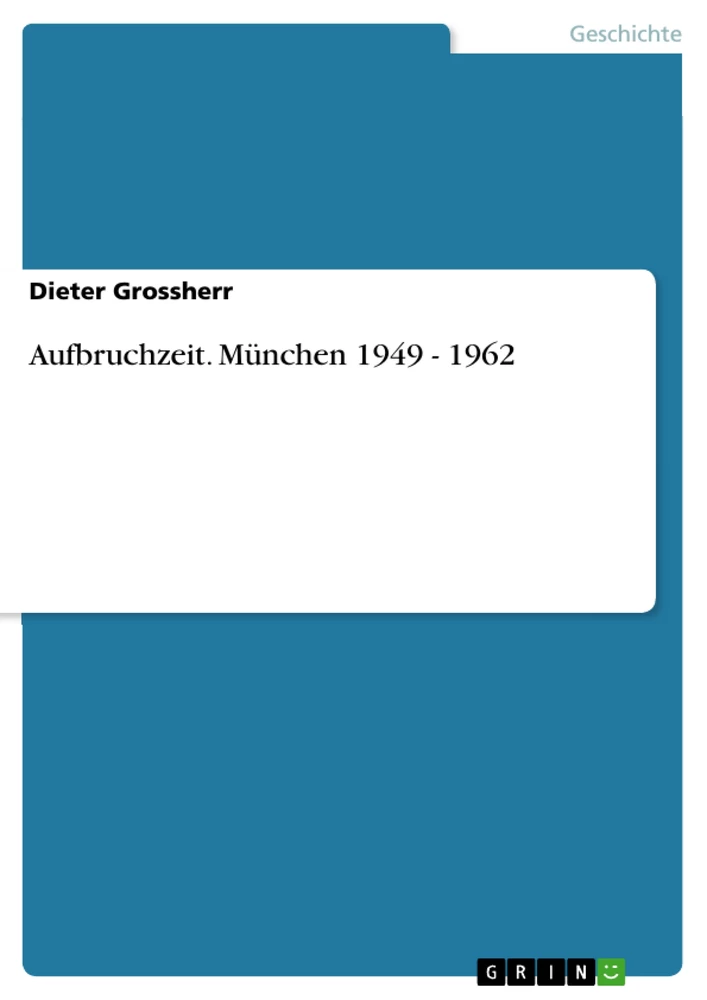
Aufbruchzeit. München 1949 - 1962
Fachbuch, 2009
201 Seiten
Geschichte Europas - Neueste Geschichte, Europäische Einigung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1949 Zu neuen Ufern
- 1950 Spitze Federn, scharfe Zungen
- 1951 Weder Angsthasen noch Duckmäuser
- 1952 Großdemonstration gegen Wiederaufrüstung
- 1953 Alte Burschenherrlichkeit im Zwielicht
- 1954 Die Rückkehr der roten Bulldogge
- 1955 Mobilmachung der Vernunft
- 1956 Hauptstadt der Gegenbewegung
- 1957 Stadtrat ruft auf zum Widerstand
- 1958 Jubiläumsfeiern und Proteste
- 1958 Der Rundfunk soll gesäubert werden
- 1958 Vom Wimmer Damerl zum Vogel Hansi
- 1961/62 Wetterleuchten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Buch zeichnet ein Bild des Münchens der 1950er und frühen 1960er Jahre, einer Zeit des Wiederaufbaus und des Aufbruchs nach dem Zweiten Weltkrieg. Es beleuchtet die Entwicklung der Stadt zur heimlichen Hauptstadt Deutschlands, die Blüte des kulturellen Lebens und die politischen Auseinandersetzungen dieser Ära. Der Fokus liegt auf der Darstellung eines dynamischen und vielschichtigen Münchens, welches nicht nur vom Wirtschaftswunder, sondern auch von Protesten und Widerstand geprägt war.
- Der Wiederaufbau Münchens nach dem Zweiten Weltkrieg
- Das kulturelle Leben in München: Literatur, Kabarett, Theater, Film
- Politische Auseinandersetzungen: Wiederaufrüstung, Kalter Krieg, Anti-Atombewegung
- Die Rolle der Medien und des Journalismus
- Schwabing als Zentrum des künstlerischen und politischen Lebens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den zeitlichen Rahmen des Buches (1949-1962) und den Ansatz des Autors als Zeitzeuge. Sie hebt die Ambivalenz der Zeit hervor: einerseits das Wirtschaftswunder und die Normalisierung des Lebens, andererseits der Kalte Krieg und die Gefahr einer Wiederaufrüstung. München wird als ein Ort besonderer Dynamik und geistiger Offenheit dargestellt, im Gegensatz zu einer oft als „geistfeindlich“ wahrgenommenen bundesdeutschen Gesamtsituation. Der Aufstieg Münchens zur heimlichen Hauptstadt Deutschlands wird thematisiert.
1949 Zu neuen Ufern: Das Kapitel beschreibt die ersten Jahre der Bundesrepublik und den Wiederaufbau Münchens unter Oberbürgermeister Thomas Wimmer. Es thematisiert den beginnenden Kalten Krieg und die Ambivalenz der Haltung gegenüber den USA, sowie die Zensur durch die amerikanische Besatzungsmacht. Die Gründung der Neuen Zeitung und der Einfluss von bedeutenden Persönlichkeiten wie Hans Wallenberg und Walter von Cube auf den kritischen Journalismus werden beleuchtet. Die frühen Nachkriegsfilme und die Kontroverse um Werner Egks Ballett "Abraxas" illustrieren den Konflikt zwischen künstlerischer Freiheit und konservativen Kräften.
1950 Spitze Federn, scharfe Zungen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rolle der Münchner Presse, insbesondere der Süddeutschen Zeitung, als Sprachrohr für Weltoffenheit und kritischen Journalismus. Es beschreibt die Warnungen vor Wiederaufrüstung und atomarer Aufrüstung und beleuchtet die Auseinandersetzungen mit der CSU und ihrem konservativen Kultusminister Alois Hundhammer. Die Gründung der Hochschule für politische Wissenschaften und des Instituts für Zeitgeschichte sowie die wachsende Bedeutung der Kabarettszene, mit Persönlichkeiten wie Bertolt Brecht und Therese Giehse, werden dargestellt.
1951 Weder Angsthasen noch Duckmäuser: Das Kapitel beschreibt die Fortsetzung des literarisch-politischen Kabaretts mit der "Kleinen Freiheit" und deren Auseinandersetzung mit den Themen Wiederaufrüstung und gesellschaftliche Restauration. Der kritische Journalismus der Süddeutschen Zeitung unter Werner Friedmann und die Münchner Abendzeitung werden hervorgehoben, ebenso der gesellschaftliche Protest gegen Restauration und Militarismus. Der Roman "Tauben im Gras" von Wolfgang Koeppen wird als Beispiel für eine gesellschaftlich kritische Literatur der Nachkriegszeit präsentiert.
1952 Großdemonstration gegen Wiederbewaffnung: Dieses Kapitel dokumentiert die massive Protestbewegung gegen die Wiederaufrüstung und die zunehmende militaristische Tendenz in der Bundesrepublik. Es beschreibt die große Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes in München und die kritischen Stimmen aus Medien und Politik. Die Veröffentlichung von Leonhard Franks Autobiografie "Links wo das Herz ist" wird als bedeutendes Ereignis im Kontext der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit dargestellt.
1953 Alte Burschenherrlichkeit im Zwielicht: Das Kapitel beschreibt die Konflikte um die traditionellen Studentenverbindungen und die Reaktivierung des studentischen Korporationswesens. Die Gründung des Kabaretts "Kleine Fische" und dessen Auseinandersetzung mit der Zensur werden dargestellt. Die kritische Position von Professor Romano Guardini wird hervorgehoben, ebenso die Rolle studentischer Organisationen wie SDS und LSD im Kampf gegen reaktionäre Tendenzen.
1954 Die Rückkehr der roten Bulldogge: Das Kapitel fokussiert auf die Wiederauflage der satirischen Zeitschrift Simplicissimus und deren ambivalente Rolle zwischen kritischer Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und der Befriedigung spießbürgerlicher Sehnsüchte. Die Proteste gegen verlängerte Ladenöffnungszeiten, der Streik der bayerischen Metallarbeiter und die Weltmeisterschaft im Fußball werden als wichtige Ereignisse beschrieben. Der Erfolg von Helmut Käutners Film "Ludwig II." und die Kontroverse um Samuel Becketts "Warten auf Godot" werden beleuchtet.
1955 Mobilmachung der Vernunft: Dieses Kapitel zeigt die Fortsetzung der Friedensbewegung und der Proteste gegen die Wiederaufrüstung und die allgemeine Wehrpflicht. Die Inszenierung von Shakespeares "Julius Cäsar" durch Fritz Kortner wird als drastische Darstellung der Schrecken des Krieges beschrieben. Der Roman "Die Stalinorgel" von Gert Ledig wird als eindrucksvolles Beispiel für die zeitgenössische Literatur hervorgehoben.
1956 Hauptstadt der Gegenbewegung: Das Kapitel beschreibt die zunehmende Militarisierung der Bundesrepublik und die Entstehung einer starken Gegenbewegung. Die Reaktivierung von Hitler-Generälen und die hohe Anzahl von Traditionsverbänden werden kritisiert. Die Gründung des Grünwalder Kreises und die Zeitschrift "Blätter für deutsche und internationale Politik" werden als wichtige Elemente der demokratischen Gegenwehr gegen den aufkommenden Neo-Nazismus dargestellt.
1957 Stadtrat ruft auf zum Widerstand: Dieses Kapitel beleuchtet die "Göttinger Erklärung" und den Appell an die Bevölkerung, sich gegen die Atombombe zu engagieren. Die Gründung des Komitees gegen Atomrüstung wird beschrieben und der anhaltende Widerstand gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr hervorgehoben. Die Gründung der Zeitschrift "Filmkritik" durch Enno Patalas und deren kritische Auseinandersetzung mit der Filmindustrie werden dargestellt.
1958 Jubiläumsfeiern und Proteste: Das Kapitel beschreibt die Feierlichkeiten zum 800-jährigen Stadtjubiläum Münchens und die parallelen Protestkundgebungen gegen die Atomrüstung. Der Konflikt um den Wiederaufbau der Staatsoper wird dargestellt und die Aktivitäten der Künstlergruppe SPUR werden erwähnt. Der Konflikt um die Inschrift am Siegestor symbolisiert die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Gesellschaft.
1958 Der Rundfunk soll gesäubert werden: Dieses Kapitel behandelt die zunehmende Einflussnahme der CSU auf den Bayerischen Rundfunk und die Versuche, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Die politischen Hintergründe der Angriffe auf den Rundfunk werden offengelegt und die Auseinandersetzungen mit Persönlichkeiten wie Alois Hundhammer und Walter Becher geschildert. Der Simplicissimus gerät ebenfalls verstärkt unter Beschuss von rechts.
1958 Vom Wimmer Damerl zum Vogel Hansi: Das Kapitel beschreibt den Wechsel im Amt des Münchner Oberbürgermeisters von Thomas Wimmer zu Hans-Jochen Vogel. Die Angriffe auf kritische Journalisten wie Werner Friedmann werden dargestellt. Die Tucholsky-Feier im Jahr 1960 und die Veröffentlichung der Memoiren von Ilja Ehrenburg werden erwähnt.
1961/62 Wetterleuchten: Das Kapitel beginnt mit dem Eklat um die Ausstrahlung von Kortners Inszenierung der "Lysistrata" und beschreibt den Weggang von Gerhard Szczesny vom Bayerischen Rundfunk. Die Landtagswahlen von 1962 und der "Spiegel"-Affäre werden als bedeutende Ereignisse dargestellt, die den Übergang zur Revolte der 1960er Jahre einleiten. Die Schwabinger Krawalle werden als Höhepunkt der gesellschaftlichen Spannungen beschrieben und als ein Vorbote kommender Veränderungen interpretiert.
Schlüsselwörter
München, Nachkriegszeit, Wiederaufbau, Kultur, Kabarett, Theater, Film, Journalismus, Politik, Wiederaufrüstung, Kalter Krieg, Atombewaffnung, Friedensbewegung, Protest, Widerstand, Schwabing, Studentenbewegung, CSU, SPD, Neo-Nazismus, Demokratie, Pressefreiheit.
Häufig gestellte Fragen zu "München in den 1950er und frühen 1960er Jahren"
Was ist der Inhalt dieses Buches?
Das Buch zeichnet ein umfassendes Bild des Münchens der 1950er und frühen 1960er Jahre, beginnend 1949 bis etwa 1962. Es beleuchtet den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, die Entwicklung Münchens zur heimlichen Hauptstadt Deutschlands, das blühende kulturelle Leben (Literatur, Kabarett, Theater, Film), politische Auseinandersetzungen (Wiederaufrüstung, Kalter Krieg, Anti-Atombewegung), die Rolle der Medien und den Einfluss Schwabings als Zentrum des künstlerischen und politischen Lebens. Der Fokus liegt auf der Darstellung eines dynamischen und vielschichtigen Münchens, geprägt vom Wirtschaftswunder, aber auch von Protesten und Widerstand.
Welche Kapitel umfasst das Buch?
Das Buch gliedert sich in Kapitel, die jeweils ein Jahr oder einen Zeitraum (z.B. 1961/62) abdecken. Jedes Kapitel befasst sich mit den wichtigsten politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Ereignissen dieses Zeitraums in München. Die Kapitelüberschriften bieten einen guten Überblick über die behandelten Themen (z.B. "Zu neuen Ufern", "Spitze Federn, scharfe Zungen", "Wetterleuchten"). Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im Buch enthalten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind der Wiederaufbau Münchens nach dem Zweiten Weltkrieg, das kulturelle Leben (Literatur, Kabarett, Theater, Film), politische Auseinandersetzungen (Wiederaufrüstung, Kalter Krieg, Anti-Atombewegung), die Rolle der Medien und des Journalismus, und Schwabing als Zentrum des künstlerischen und politischen Lebens. Das Buch analysiert die Ambivalenz dieser Zeit: Wirtschaftswunder einerseits, Kalter Krieg und die Gefahr der Wiederaufrüstung andererseits.
Welche Rolle spielt die Presse und der Journalismus?
Die Münchner Presse, insbesondere die Süddeutsche Zeitung, spielt eine zentrale Rolle im Buch. Sie wird als Sprachrohr für Weltoffenheit und kritischen Journalismus dargestellt. Das Buch beleuchtet die Auseinandersetzungen der Presse mit der CSU und konservativen Kräften, die Warnungen vor Wiederaufrüstung und die Rolle des Journalismus im Widerstand gegen politische Entwicklungen. Der Einfluss der Zensur wird ebenfalls thematisiert.
Welche kulturellen Aspekte werden behandelt?
Das Buch beleuchtet das vielseitige kulturelle Leben Münchens, inklusive Literatur, Kabarett (z.B. "Kleine Freiheit", "Kleine Fische"), Theater und Film. Es werden wichtige Persönlichkeiten der damaligen Zeit genannt, wie Bertolt Brecht und Therese Giehse im Kabarett, sowie bedeutende Werke der Literatur und des Films. Der Einfluss der Kultur auf die politischen Auseinandersetzungen wird ebenfalls analysiert.
Wie werden die politischen Auseinandersetzungen dargestellt?
Das Buch beschreibt ausführlich die politischen Auseinandersetzungen der Zeit, insbesondere den Widerstand gegen die Wiederaufrüstung und den Kalten Krieg, die Anti-Atombewegung und den Kampf gegen reaktionäre Tendenzen. Die Rolle der CSU, der SPD und studentischer Organisationen wie SDS und LSD wird beleuchtet. Die "Göttinger Erklärung" und die Proteste gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr werden als wichtige Ereignisse dargestellt.
Welche Rolle spielt Schwabing?
Schwabing wird als das Zentrum des künstlerischen und politischen Lebens in München dargestellt. Es war ein Ort der Begegnung von Künstlern, Intellektuellen und Aktivisten, die sich gegen die politischen Entwicklungen zur Wehr setzten. Schwabing war ein Schmelztiegel der Ideen und des Widerstands.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, das Dokument enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels. Diese Zusammenfassungen geben einen detaillierten Überblick über die in jedem Kapitel behandelten Ereignisse und Themen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Buch?
Schlüsselwörter, die das Buch treffend beschreiben, sind: München, Nachkriegszeit, Wiederaufbau, Kultur, Kabarett, Theater, Film, Journalismus, Politik, Wiederaufrüstung, Kalter Krieg, Atombewaffnung, Friedensbewegung, Protest, Widerstand, Schwabing, Studentenbewegung, CSU, SPD, Neo-Nazismus, Demokratie, Pressefreiheit.
Details
- Titel
- Aufbruchzeit. München 1949 - 1962
- Autor
- Dieter Grossherr (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 201
- Katalognummer
- V140125
- ISBN (eBook)
- 9783640802005
- ISBN (Buch)
- 9783640802258
- Dateigröße
- 20881 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Schlagworte
- OpenOffice
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 41,99
- Preis (Book)
- US$ 54,99
- Arbeit zitieren
- Dieter Grossherr (Autor:in), 2009, Aufbruchzeit. München 1949 - 1962, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/140125
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-