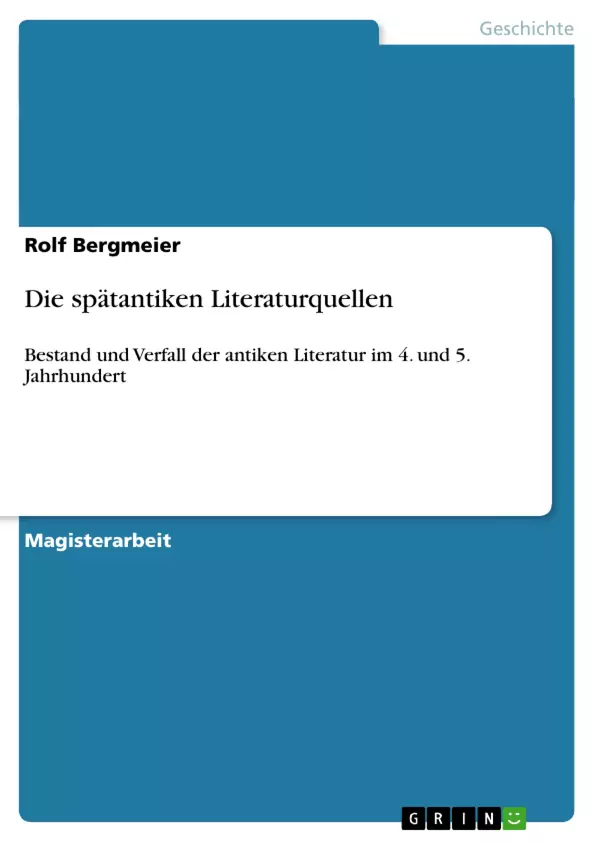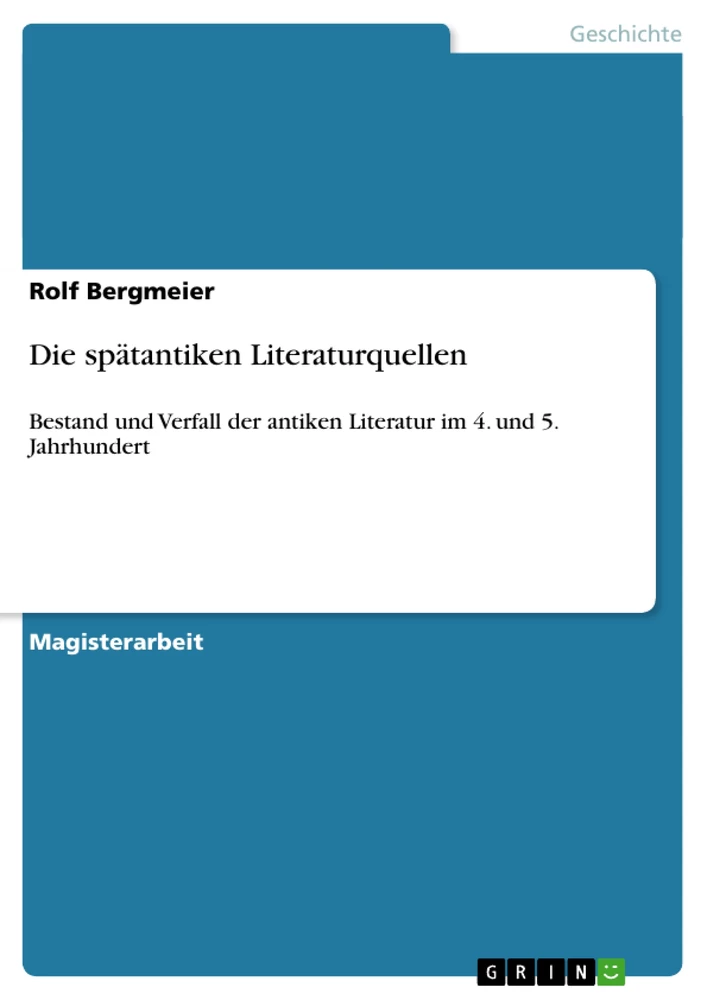
Die spätantiken Literaturquellen
Magisterarbeit, 2008
112 Seiten, Note: gut
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anlaß
- Methodik
- Eingrenzung des Themas
- Die antiken Literaturbestände bis ca. 400 n.Chr.
- Der Bildungshunger des antiken Bürgers
- Die Privatbibliotheken. Tradition und Bedeutung
- Die staatlichen Bibliotheksbestände bis ca. 400 n.Chr.
- Die Bibliotheken in Alexandria
- Die Bibliotheken in Rom
- Zusammenfassung: Die Schätze der Vergangenheit werden gepflegt
- Die Literaturkrise ab dem 5. Jahrhundert
- Zahlen und Daten. Ein Überblick
- Die Literaturkrise am Beispiel der Bibliotheken
- Der Untergang der staatlichen Bibliotheken
- Die Bibliotheken von Alexandria
- Die Bibliotheken in Rom
- Die Auflösung der Privatbestände
- Zusammenfassung: Das literarische "Trümmerfeld"
- Ursachen. Der Literaturverfall im Urteil der Forschung
- Vergreisung der Literatur? Die Dekadenztheorie
- Der Barbarensturm
- "Völkerwanderung". Die Fakten
- Germanen als Kulturzerstörer? Theorie und Wirklichkeit. Eine Bewertung
- Habent sua fata libelli. Die Selektions- oder Verrottungstheorie
- Zusammenfassung und Ausschau nach anderen zerstörerischen Kräften
- Die entscheidende Ursache. Voraussetzungen und treibende Kräfte
- Voraussetzung: Die Toleranz schaufelt sich ihr eigenes Grab
- Kaiser und Kirche
- Bilanz: Der Untergang der freien Literatur
- Reste und Fragmente. Warum dennoch antike Werke überliefert sind
- Das Erbe der römischen Senatoren
- Papyrusfunde
- Palimpseste
- Byzantinische und arabische Überlieferung
- Christliche Überlieferungen
- Epilog: Requiem für die antike Kultur
- Abkürzungen
- Bibliographie
- Texteditionen und Übersetzungen
- Monografien
- Aufsätze
- Kompendien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit dem Bestand und Verfall der antiken Literatur im 4. und 5. Jahrhundert. Sie untersucht die Ursachen für den Verlust eines Großteils der antiken Literatur und analysiert die Faktoren, die zur Überlieferung der uns heute bekannten Werke beigetragen haben. Die Arbeit verfolgt das Ziel, ein wissenschaftlich fundiertes Urteil über die Ursachen des Literaturverlustes zu bilden und dieses in einer klaren und verständlichen Form darzustellen.
- Die Entwicklung der antiken Bibliotheken und ihre Bedeutung für die Bewahrung der Literatur
- Die Rolle der "Völkerwanderung" und der Germanen im Kontext des Literaturverlustes
- Die Bedeutung der christlichen Überlieferung für die Erhaltung antiker Texte
- Die Faktoren, die zur Selektion und zum Verfall der antiken Literatur beigetragen haben
- Die Bedeutung von Papyrusfunden und Palimpsesten für die Rekonstruktion des antiken Literaturbestandes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Anlaß und die Methodik der Arbeit dar und grenzt das Thema ein. Sie beleuchtet die Kontroversen in der Forschung über die Ursachen des Literaturverlustes. Das zweite Kapitel befasst sich mit den antiken Literaturbeständen bis ca. 400 n.Chr. Es untersucht den Bildungshunger des antiken Bürgers, die Bedeutung der Privatbibliotheken und die staatlichen Bibliotheksbestände in Alexandria und Rom. Das dritte Kapitel analysiert die Literaturkrise ab dem 5. Jahrhundert, die sich in der Auflösung der staatlichen Bibliotheken und der Privatbestände zeigt. Es beleuchtet die Rolle der "Völkerwanderung" und der Germanen im Kontext des Literaturverlustes. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Ursachen des Literaturverlustes im Urteil der Forschung. Es untersucht die Dekadenztheorie, die Rolle der Germanen und die Selektions- oder Verrottungstheorie. Das fünfte Kapitel analysiert die entscheidende Ursache für den Literaturverlust, die in der Toleranz und der Macht der Kirche zu sehen ist. Das sechste Kapitel zieht eine Bilanz des Untergangs der freien Literatur. Das siebte Kapitel beleuchtet die Reste und Fragmente der antiken Literatur, die uns dennoch überliefert sind. Es untersucht das Erbe der römischen Senatoren, die Bedeutung von Papyrusfunden, Palimpsesten, byzantinischen und arabischen Überlieferungen sowie die Rolle der christlichen Überlieferung. Der Epilog fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zeichnet ein Requiem für die antike Kultur.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Bestand und Verfall der antiken Literatur, die antiken Bibliotheken, die Rolle der "Völkerwanderung" und der Germanen, die Bedeutung der christlichen Überlieferung, die Selektion und Verrottung der antiken Literatur, Papyrusfunde, Palimpseste und die Rekonstruktion des antiken Literaturbestandes.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Hauptursache für den Verlust der antiken Literatur?
Entgegen der oft genannten „Völkerwanderung“ ermittelt die Arbeit die Ernennung der katholischen Kirche zur Staatskirche (380 n. Chr.) und die damit verbundene Vernichtung „heidnischer“ Kultur als Hauptursache.
Wie wirkte sich Kaiser Theodosius auf die Literatur aus?
Mit dem Erlass „cunctos populos“ und weiteren Edikten leitete er die systematische Zerstörung antiker Bibliotheken und Schriften ein, die nicht dem christlichen Dogma entsprachen.
Welche Rolle spielten die Bibliotheken von Alexandria und Rom?
Diese staatlichen Bibliotheken waren die Schatzhäuser der antiken Bildung. Ihr Untergang im 5. Jahrhundert markiert das Ende einer jahrhundertelangen Tradition der Literaturpflege.
Sind Klosterbibliotheken eine sichere Quelle für antike Texte?
Nur bedingt. Sie überlieferten lediglich selektierte Bestände, wobei viele Texte durch Auslassungen, Veränderungen oder Einschübe (Fälschungen) angepasst wurden.
Welche anderen Quellen retteten antike Werke?
Wichtige Überlieferungen stammen aus dem Erbe römischer Senatoren, Papyrusfunden, Palimpsesten (wiederbeschriebenen Pergamenten) sowie aus byzantinischen und arabischen Quellen.
Was besagt die „Dekadenztheorie“ in der Forschung?
Diese Theorie führt den Literaturverfall auf eine innere Vergreisung oder Verwahrlosung des Römischen Reiches zurück, was in dieser Arbeit jedoch kritisch hinterfragt wird.
Details
- Titel
- Die spätantiken Literaturquellen
- Untertitel
- Bestand und Verfall der antiken Literatur im 4. und 5. Jahrhundert
- Hochschule
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz
- Note
- gut
- Autor
- Rolf Bergmeier (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2008
- Seiten
- 112
- Katalognummer
- V140787
- ISBN (eBook)
- 9783640499755
- ISBN (Buch)
- 9783640499977
- Dateigröße
- 1840 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Schlagworte
- Literaturquellen Bestand Verfall Literatur Jahrhundert
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 51,99
- Arbeit zitieren
- Rolf Bergmeier (Autor:in), 2008, Die spätantiken Literaturquellen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/140787
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-