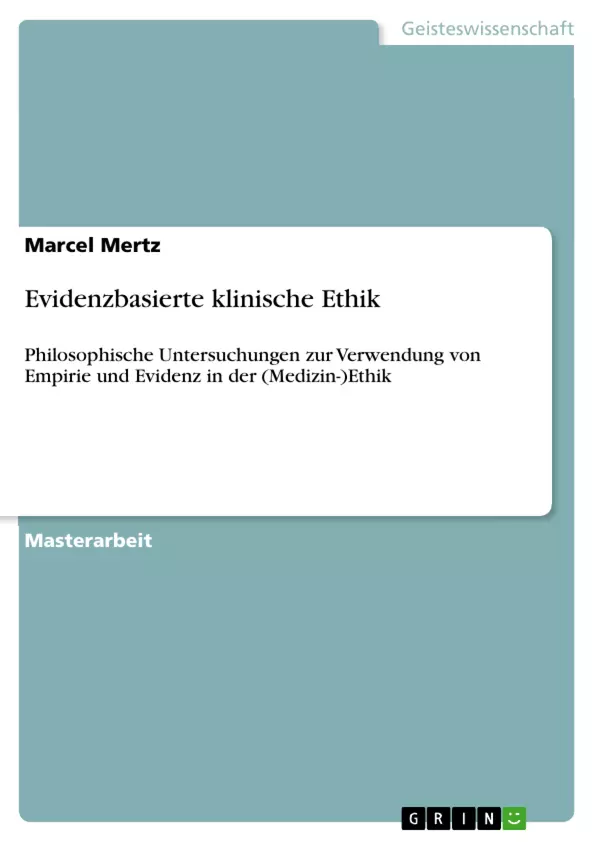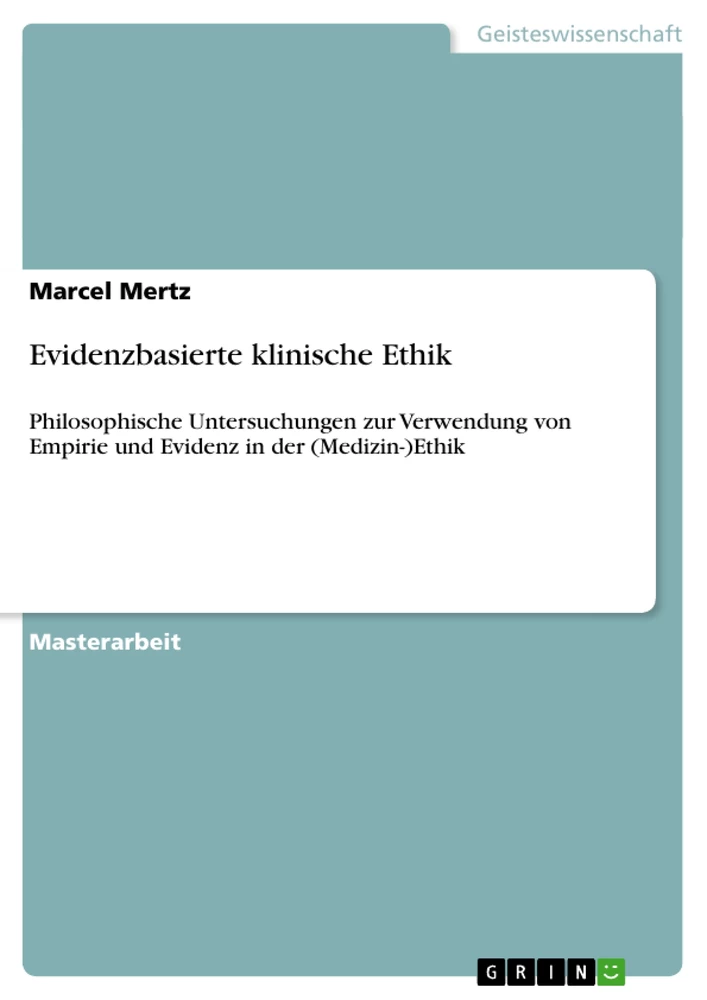
Evidenzbasierte klinische Ethik
Masterarbeit, 2011
220 Seiten, Note: 1
Philosophie - Praktische (Ethik, Ästhetik, Kultur, Natur, Recht, ...)
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Empirie, Evidenz und Ethik
- Teil I
- Drei Historische und Systematische Wenden
- Die „empirische Wende“
- Die „pragmatische Wende“
- Die „soziologische Wende“
- Praxisorientierte Angewandte Ethik (PAE)
- Beobachtungen und Hauptargument (Teil I)
- Drei Historische und Systematische Wenden
- Teil II
- Was ist „empirische Ethik“?
- Das „traditionelle“ Verständnis von Ethik und Empirie
- Historische und moderne „empirische Ethik“
- Empirische Ethik als metaethische Position
- Empirische Ethik als methodologische Position
- Was ist „Empirie“ in der empirischen Ethik?
- Der Einsatz deskriptiver Komponenten in der Ethik
- Beobachtungen und Hauptargument (Teil II)
- Was ist „empirische Ethik“?
- Teil III
- Was ist „evidenzbasierte Ethik“ (EBE)?
- Evidenzbasierte Klinische Ethik (EbCE)
- Beobachtungen und Hauptargument (Teil III)
- Konklusion
- Zur Möglichkeit und Unverzichtbarkeit einer EbCE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeit einer evidenzbasierten klinischen Ethik (EbCE), insbesondere im Kontext der Entwicklung klinisch-ethischer Leitlinien. Sie hinterfragt die scheinbare Unvereinbarkeit von Evidenzbasierung und traditionellem Ethikverständnis und argumentiert für die theoretische Möglichkeit und praktische Relevanz einer EbCE.
- Der Zusammenhang zwischen der „empirischen Wende“, „pragmatischen Wende“ und „soziologischen Wende“ in der Medizin-/Bioethik und dem Aufkommen evidenzbasierter Ansätze.
- Die Definition und Funktion von „empirischer Ethik“ und die Rolle empirischer Daten in der medizinethischen Forschung.
- Die Entwicklung eines Evidenzverständnisses, das eine EbCE ermöglicht und die damit verbundenen philosophischen Voraussetzungen.
- Die Anwendung von Evidenzbasierung auf die Entwicklung klinisch-ethischer Leitlinien.
- Die ethische Rechtfertigung und Verantwortung einer EbCE.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der evidenzbasierten Ethik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Möglichkeit und Legitimität einer solchen Ethik im Kontext der Medizin. Sie verortet die Arbeit innerhalb der aktuellen Debatte um Evidenzbasierung und thematisiert die Herausforderungen, die sich aus dem scheinbaren Widerspruch zwischen empirischer Evidenz und normativen ethischen Prinzipien ergeben.
Empirie, Evidenz und Ethik: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss der evidenzbasierten Medizin (EbM) auf andere Bereiche des Gesundheitswesens und die zunehmende Popularität des Begriffs „Evidenz“. Es diskutiert unterschiedliche Auffassungen von Evidenz und deren Bedeutung im Kontext wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Debatten. Kritische Auseinandersetzung mit dem Szientismus und Postmodernismus wird in Bezug auf die Konzeption von Evidenz angesprochen.
Teil I: Drei Historische und Systematische Wenden: Dieser Teil beleuchtet drei historische Entwicklungen in der Medizin- und Bioethik – die empirische, pragmatische und soziologische Wende – und zeigt deren Einfluss auf das Verständnis von Angewandter Ethik auf. Die Kapitel analysieren die Herausforderungen und Chancen, die jede dieser „Wenden“ für eine evidenzbasierte Ethik mit sich bringt.
Teil I: Praxisorientierte Angewandte Ethik (PAE): Dieses Kapitel entwickelt ein Konzept der praxisorientierten Angewandten Ethik (PAE) als transdisziplinäre wissenschaftliche Praxis. Es beschreibt die verschiedenen Aspekte einer PAE, einschließlich der Erkenntnisinteressen, institutionellen Rahmenbedingungen, Methoden und des Umgangs mit ethischen Theorien. Der Fokus liegt auf der Integration von empirischen Erkenntnissen in den ethischen Entscheidungsprozess.
Teil I: Beobachtungen und Hauptargument (Teil I): Dieses Kapitel fasst die Beobachtungen aus den vorherigen Kapiteln zusammen und präsentiert das „historische Argument“ der Arbeit. Es verdeutlicht, wie die drei beschriebenen Wenden zu einem veränderten Verständnis von Angewandter Ethik geführt haben, das die Möglichkeit einer evidenzbasierten Ethik eröffnet.
Teil II: Was ist „empirische Ethik“?: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Verständnisse von „empirischer Ethik“, unterscheidet zwischen metaethischen und methodologischen Positionen und klärt den Begriff „Empirie“ im Kontext ethischer Forschung. Es beleuchtet die Rolle der empirischen Daten in der Ethik und diskutiert kritisch die Sein-Sollen-Problematik im Zusammenhang mit empirischen ethischen Untersuchungen.
Teil II: Der Einsatz deskriptiver Komponenten in der Ethik: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung empirischer Daten für die Ethik. Es präsentiert eine transdisziplinäre Systematik des Einsatzes deskriptiver Komponenten und diskutiert deren kognitive Ziele und systematische Integration in ethische Überlegungen. Die Relevanz ethischer Theorien in diesem Kontext wird hervorgehoben.
Teil II: Beobachtungen und Hauptargument (Teil II): Dieses Kapitel fasst die zentralen Erkenntnisse aus Teil II zusammen und präsentiert das „methodologische Argument“. Es verdeutlicht die Rolle empirischer Daten in der ethischen Forschung und betont die Bedeutung einer methodisch reflektierten Anwendung empirischer Methoden in der Ethik.
Teil III: Was ist „evidenzbasierte Ethik“ (EBE)?: Dieses Kapitel definiert den Begriff „evidenzbasierte Ethik“ (EBE) und setzt ihn in Beziehung zur evidenzbasierten Medizin (EbM). Es analysiert verschiedene Lesarten von EBE und diskutiert kritisch die Frage, ob eine nicht-triviale EBE möglich ist und ob sie eher als Ethik oder Sozialtechnologie verstanden werden sollte.
Teil III: Evidenzbasierte Klinische Ethik (EbCE): Dieses Kapitel entwickelt ein Konzept der EbCE, mit besonderem Fokus auf die Entwicklung evidenzbasierter Leitlinien. Es untersucht die verschiedenen Arten von Evidenz (empirische und normative Evidenz) und ihr Verhältnis zueinander. Die ethische Rechtfertigung und Verantwortung der EbCE sowie deren Leistungen und Grenzen werden diskutiert.
Teil III: Beobachtungen und Hauptargument (Teil III): Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse aus Teil III zusammen und präsentiert das „konzeptionelle Argument“ der Arbeit. Es zeigt auf, wie ein spezifisches Evidenzverständnis und eine methodisch reflektierte Anwendung empirischer Daten die Möglichkeit einer EbCE begründen.
Schlüsselwörter
Evidenzbasierte Klinische Ethik (EbCE), Evidenzbasierte Medizin (EbM), Empirische Ethik, Angewandte Ethik, Leitlinienentwicklung, Empirie, Normativität, Transdisziplinarität, Methodologie, Wissenschaftstheorie, Sein-Sollen-Problem.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Evidenzbasierte Klinische Ethik (EbCE)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeit und Legitimität einer evidenzbasierten klinischen Ethik (EbCE), insbesondere im Kontext der Entwicklung klinisch-ethischer Leitlinien. Sie beleuchtet den scheinbaren Widerspruch zwischen Evidenzbasierung und traditionellem Ethikverständnis und argumentiert für die theoretische Möglichkeit und praktische Relevanz einer EbCE.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Zusammenhang zwischen der „empirischen Wende“, „pragmatischen Wende“ und „soziologischen Wende“ in der Medizin-/Bioethik und dem Aufkommen evidenzbasierter Ansätze. Sie definiert und untersucht die Funktion von „empirischer Ethik“ und die Rolle empirischer Daten in der medizinethischen Forschung. Weiterhin entwickelt sie ein Evidenzverständnis, das eine EbCE ermöglicht, und analysiert die Anwendung von Evidenzbasierung auf die Entwicklung klinisch-ethischer Leitlinien. Schließlich geht sie auf die ethische Rechtfertigung und Verantwortung einer EbCE ein.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist gegliedert in Einleitung, ein Kapitel zu Empirie, Evidenz und Ethik, drei Teile (I-III) mit jeweils mehreren Unterkapiteln, eine Konklusion und ein abschließendes Kapitel zur Möglichkeit und Unverzichtbarkeit einer EbCE. Die Teile befassen sich mit drei historischen und systematischen Wenden in der Medizin-/Bioethik, dem Verständnis von empirischer Ethik, dem Einsatz deskriptiver Komponenten in der Ethik und der Definition und Anwendung von evidenzbasierter Ethik (EBE) und EbCE.
Was sind die zentralen Argumente der Arbeit?
Die Arbeit präsentiert drei Hauptargumente: ein historisches Argument, das die Entwicklung der Angewandten Ethik im Kontext der drei beschriebenen Wenden beleuchtet; ein methodologisches Argument, das die Rolle empirischer Daten in der ethischen Forschung betont; und ein konzeptionelles Argument, das ein spezifisches Evidenzverständnis und eine methodisch reflektierte Anwendung empirischer Daten als Grundlage für die Möglichkeit einer EbCE darstellt.
Was wird unter „empirischer Ethik“ verstanden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Verständnisse von „empirischer Ethik“, zwischen metaethischen und methodologischen Positionen. Sie klärt den Begriff „Empirie“ im Kontext ethischer Forschung und beleuchtet die Rolle empirischer Daten in der Ethik unter kritischer Berücksichtigung der Sein-Sollen-Problematik.
Was ist das Ziel einer evidenzbasierten klinischen Ethik (EbCE)?
Das Ziel der EbCE ist die Entwicklung eines Konzepts, das evidenzbasierte Ansätze in die klinische Ethik integriert, insbesondere im Kontext der Entwicklung evidenzbasierter Leitlinien. Dabei werden verschiedene Arten von Evidenz (empirische und normative Evidenz) und deren Verhältnis zueinander untersucht. Die ethische Rechtfertigung und Verantwortung der EbCE, sowie deren Leistungen und Grenzen, werden diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Evidenzbasierte Klinische Ethik (EbCE), Evidenzbasierte Medizin (EbM), Empirische Ethik, Angewandte Ethik, Leitlinienentwicklung, Empirie, Normativität, Transdisziplinarität, Methodologie, Wissenschaftstheorie und Sein-Sollen-Problem.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler*innen, die sich mit Medizin-, Bio- oder Angewandter Ethik befassen, insbesondere für diejenigen, die an der Entwicklung und Anwendung von ethischen Leitlinien arbeiten. Sie ist auch relevant für ärztliches und Pflegepersonal, das ethische Fragen im klinischen Kontext bearbeiten muss.
Details
- Titel
- Evidenzbasierte klinische Ethik
- Untertitel
- Philosophische Untersuchungen zur Verwendung von Empirie und Evidenz in der (Medizin-)Ethik
- Hochschule
- Universität Basel (Philosophisches Seminar)
- Note
- 1
- Autor
- MA Marcel Mertz (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 220
- Katalognummer
- V141681
- ISBN (eBook)
- 9783640499922
- ISBN (Buch)
- 9783640500086
- Dateigröße
- 1850 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Überarbeitete und erweiterte Version der ursprünglichen Masterarbeit.
- Schlagworte
- Ethik Medizinethik empirische Ethik evidenz-basierte Ethik evidenz-basierte Medizin Evidenz empirical ethics evidence-based ethics METAP
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 25,99
- Preis (Book)
- US$ 36,99
- Arbeit zitieren
- MA Marcel Mertz (Autor:in), 2011, Evidenzbasierte klinische Ethik, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/141681
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-