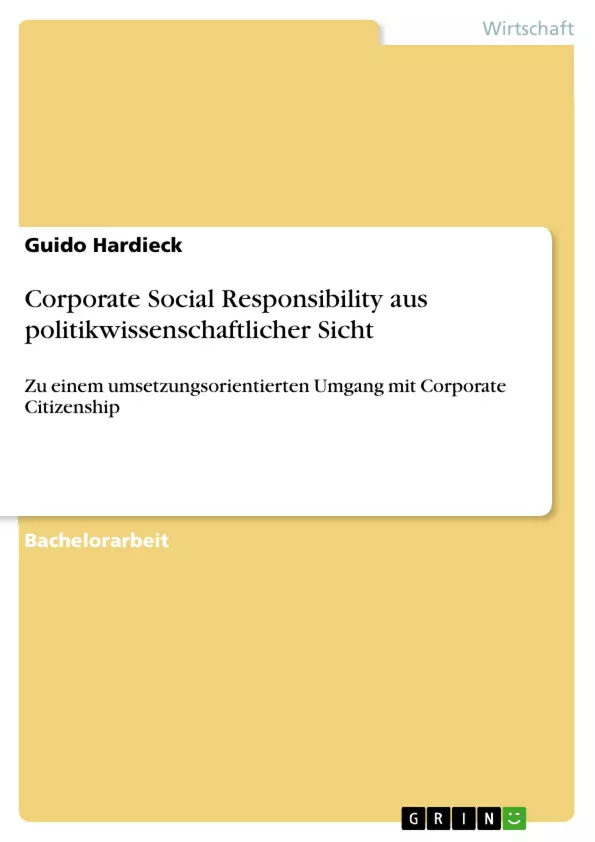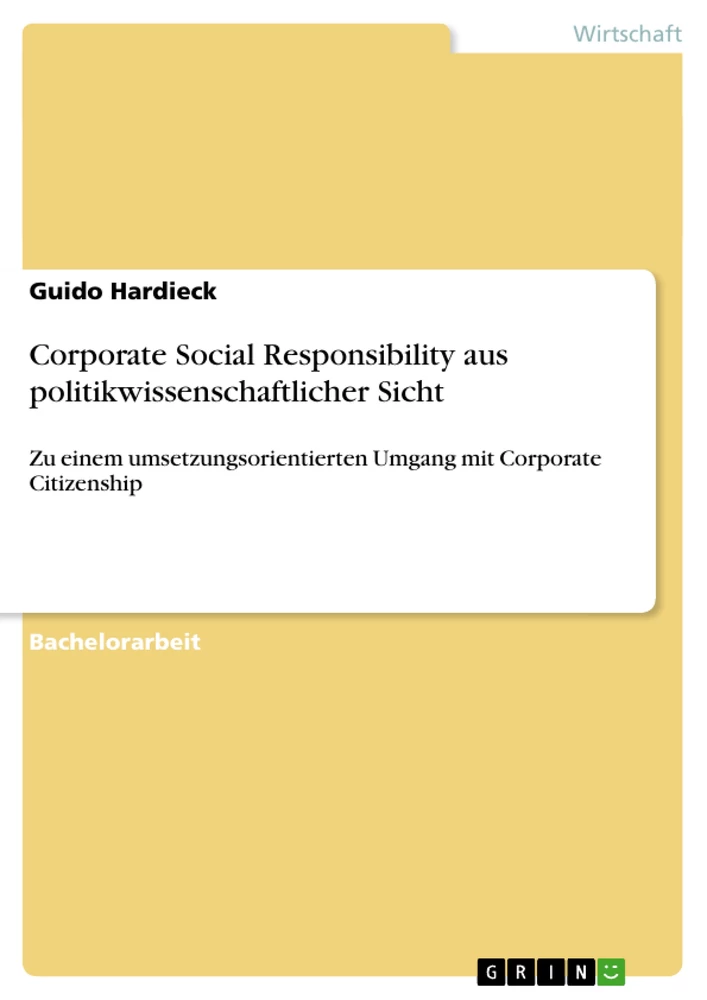
Corporate Social Responsibility aus politikwissenschaftlicher Sicht
Bachelorarbeit, 2008
48 Seiten, Note: 1.0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlegende Kritik an Corporate Social Responsibility
- 2.1 Rolle der Eigentümer
- 2.2 Mangelnde Legitimation
- 2.3 Mangelnde Expertise und fehlende Informationen
- 3 Zu den Begriffen Corporate Social Responsibility und Corporate Citizenship
- 3.1 Definitionen und Abgrenzung
- 3.2 Kritik
- 4 Politisches System und soziale Ordnung
- 4.1 Zur Zuschreibung gesellschaftlicher Verantwortung an Unternehmen
- 4.2 Zur sozialen Ordnung im Kontext von Corporate Citizenship
- 4.3 Zum politischen System und seiner Funktion im Kontext von Corporate Citizenship
- 5 Corporate Citizenship in der politischen Realität
- 5.1 Negativbeispiel
- 5.2 Positive Beispiele
- 6 Zum politischen Umgang mit Corporate Citizenship
- 6.1 Integrativ, überprüfbar und anpassungsfähig
- 6.2 Verantwortlichkeit, Selbstbindung und Nutzen
- 6.3 Funktionswandel des politischen Systems und Legitimität
- 6.4 Zu einer dynamischen Definition von Corporate Citizenship
- 6.5 Das Problem der Freiwilligkeit
- 7 Fazit -„Wirklichkeiten, in denen wir leben“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den umsetzungsorientierten Umgang der Politik mit Corporate Citizenship. Sie analysiert die Kritik an Corporate Social Responsibility, beleuchtet die Begriffe Corporate Social Responsibility und Corporate Citizenship und deren Operationalisierbarkeit, und betrachtet das politische System und die soziale Ordnung im Kontext von Corporate Citizenship. Die Arbeit fokussiert sich auf die nationale Dimension und das deutsche politische System.
- Kritik an Corporate Social Responsibility und deren theoretische Fundierung
- Definition und Abgrenzung von Corporate Social Responsibility und Corporate Citizenship
- Die Rolle des politischen Systems in Bezug auf gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen
- Positive und negative Beispiele für Corporate Citizenship in der Praxis
- Ein handlungsorientierter Umgang der Politik mit Corporate Citizenship
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sozialen Verantwortung von Unternehmen ein und beschreibt den zunehmenden Fokus auf Unternehmen im Kontext abnehmenden Einflusses des Nationalstaates und einer professionelleren Zivilgesellschaft. Sie benennt die Herausforderungen für Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Moral und Kerngeschäft und skizziert den Aufbau der Arbeit, welcher die Problemfelder unternehmerischer Verantwortung anhand von Friedmans Kritik erläutert und anschließend in die Begriffsbestimmung von Corporate Social Responsibility und Corporate Citizenship einführt. Das Ziel der Arbeit, die Umschreibung eines handlungsorientierten Umgangs mit der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen, wird ebenfalls definiert.
2 Grundlegende Kritik an Corporate Social Responsibility: Dieses Kapitel präsentiert Milton Friedmans Kritik an Corporate Social Responsibility, welche die Profitmaximierung als einzige soziale Verantwortung von Unternehmen sieht. Es werden drei zentrale Kritikpunkte ausgeführt: die Interessen der Eigentümer, die mangelnde Legitimation unternehmerischen Eingreifens in gesellschaftliche Probleme und die mangelnde Verfügbarkeit von Informationen über die Wirkung sozialen Engagements. Die Ausführungen basieren auf dem Prinzipal-Agent-Verhältnis und zeigen die potenziellen Konflikte zwischen den Interessen der Eigentümer und dem sozialen Engagement des Managements auf.
3 Zu den Begriffen Corporate Social Responsibility und Corporate Citizenship: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung der Begriffe Corporate Social Responsibility und Corporate Citizenship. Es analysiert die bestehenden Definitionen und diskutiert die Herausforderungen bei der Operationalisierung dieser Konzepte. Die geringe Praktikabilität der diskutierten Ansätze wird hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Klärung der zentralen Begriffe und der Herausarbeitung ihrer Grenzen.
4 Politisches System und soziale Ordnung: Dieses Kapitel untersucht das politische System und die soziale Ordnung im Kontext von Corporate Citizenship. Es analysiert die Zuschreibung gesellschaftlicher Verantwortung an Unternehmen, die Rolle der sozialen Ordnung und die Funktion des politischen Systems im Umgang mit Corporate Citizenship. Die Analyse verdeutlicht den komplexen Zusammenhang zwischen politischen Strukturen, gesellschaftlichen Erwartungen und unternehmerischem Handeln im Bereich der sozialen Verantwortung.
5 Corporate Citizenship in der politischen Realität: Dieses Kapitel beleuchtet die praktische Umsetzung von Corporate Citizenship anhand von positiven und negativen Beispielen. Es gibt einen Einblick in konkrete Fälle, die die Bandbreite der unternehmerischen Praxis im Bereich der sozialen Verantwortung veranschaulichen. Die Gegenüberstellung dient der Illustration der unterschiedlichen Ausprägungen und Ergebnisse von Corporate Citizenship-Initiativen.
6 Zum politischen Umgang mit Corporate Citizenship: Dieses Kapitel widmet sich der Gestaltung eines effektiven und praxisorientierten Umgangs der Politik mit Corporate Citizenship. Es diskutiert verschiedene Aspekte wie Integrierbarkeit, Überprüfbarkeit, Anpassungsfähigkeit, Verantwortlichkeit, Selbstbindung und Nutzen, den Funktionswandel des politischen Systems, Legitimität und das Problem der Freiwilligkeit. Das Kapitel analysiert, wie die Politik die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen wirksam steuern und fördern kann.
Schlüsselwörter
Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Citizenship, unternehmerische Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung, Politik, soziales Engagement, Prinzipal-Agent-Problem, Legitimation, politisches System, soziale Ordnung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Umgang der Politik mit Corporate Citizenship
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den umsetzungsorientierten Umgang der Politik mit Corporate Citizenship in Deutschland. Sie analysiert die Kritik an Corporate Social Responsibility (CSR), beleuchtet die Begriffe CSR und Corporate Citizenship und deren Operationalisierbarkeit, und betrachtet das politische System und die soziale Ordnung im Kontext von Corporate Citizenship.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Kritik an CSR und deren theoretische Fundierung; Definition und Abgrenzung von CSR und Corporate Citizenship; die Rolle des politischen Systems in Bezug auf gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen; positive und negative Beispiele für Corporate Citizenship in der Praxis; und ein handlungsorientierter Umgang der Politik mit Corporate Citizenship.
Welche Kritik an Corporate Social Responsibility wird dargestellt?
Die Arbeit präsentiert vor allem Milton Friedmans Kritik an CSR, die die Profitmaximierung als einzige soziale Verantwortung von Unternehmen sieht. Drei zentrale Kritikpunkte werden behandelt: die Interessen der Eigentümer, die mangelnde Legitimation unternehmerischen Eingreifens in gesellschaftliche Probleme und die mangelnde Verfügbarkeit von Informationen über die Wirkung sozialen Engagements.
Wie werden Corporate Social Responsibility und Corporate Citizenship definiert und abgegrenzt?
Das Kapitel zu den Begriffen CSR und Corporate Citizenship analysiert bestehende Definitionen und diskutiert die Herausforderungen bei der Operationalisierung dieser Konzepte. Die geringe Praktikabilität der diskutierten Ansätze wird hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Klärung der zentralen Begriffe und der Herausarbeitung ihrer Grenzen.
Welche Rolle spielt das politische System?
Die Arbeit untersucht die Rolle des politischen Systems und der sozialen Ordnung im Kontext von Corporate Citizenship. Es wird analysiert, wie gesellschaftliche Verantwortung an Unternehmen zugeschrieben wird, welche Rolle die soziale Ordnung spielt und wie das politische System mit Corporate Citizenship umgeht. Der komplexe Zusammenhang zwischen politischen Strukturen, gesellschaftlichen Erwartungen und unternehmerischem Handeln wird beleuchtet.
Welche Beispiele für Corporate Citizenship werden genannt?
Die Arbeit präsentiert sowohl positive als auch negative Beispiele für Corporate Citizenship aus der Praxis, um die Bandbreite unternehmerischen Handelns im Bereich der sozialen Verantwortung zu veranschaulichen.
Wie sollte die Politik mit Corporate Citizenship umgehen?
Das Kapitel zum politischen Umgang mit Corporate Citizenship diskutiert einen effektiven und praxisorientierten Ansatz. Es werden Aspekte wie Integrierbarkeit, Überprüfbarkeit, Anpassungsfähigkeit, Verantwortlichkeit, Selbstbindung, Nutzen, der Funktionswandel des politischen Systems, Legitimität und das Problem der Freiwilligkeit analysiert. Ziel ist es zu zeigen, wie die Politik die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen wirksam steuern und fördern kann.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Citizenship, unternehmerische Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung, Politik, soziales Engagement, Prinzipal-Agent-Problem, Legitimation, politisches System, soziale Ordnung, Deutschland.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, grundlegender Kritik an CSR, den Begriffen CSR und Corporate Citizenship, dem politischen System und der sozialen Ordnung im Kontext von Corporate Citizenship, Corporate Citizenship in der politischen Realität, dem politischen Umgang mit Corporate Citizenship und einem abschließenden Fazit.
Details
- Titel
- Corporate Social Responsibility aus politikwissenschaftlicher Sicht
- Untertitel
- Zu einem umsetzungsorientierten Umgang mit Corporate Citizenship
- Hochschule
- Universität Münster (Institut für Politikwissenschaft)
- Note
- 1.0
- Autor
- Bachelor of Arts Guido Hardieck (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2008
- Seiten
- 48
- Katalognummer
- V142017
- ISBN (Buch)
- 9783640516544
- ISBN (eBook)
- 9783640516728
- Dateigröße
- 1598 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Corporate Social Responsibility Corporate Citizenship Unternehmensethik CSR CC
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Guido Hardieck (Autor:in), 2008, Corporate Social Responsibility aus politikwissenschaftlicher Sicht , München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/142017
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-