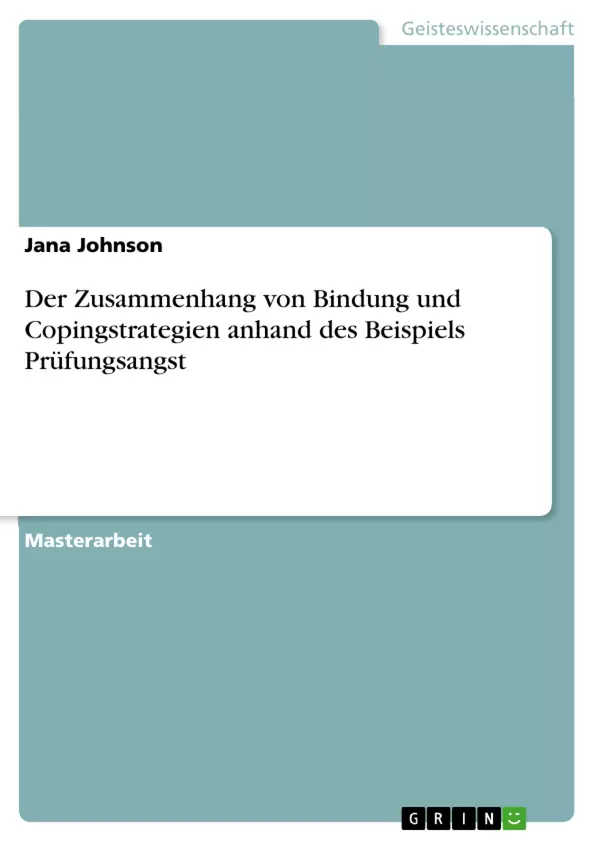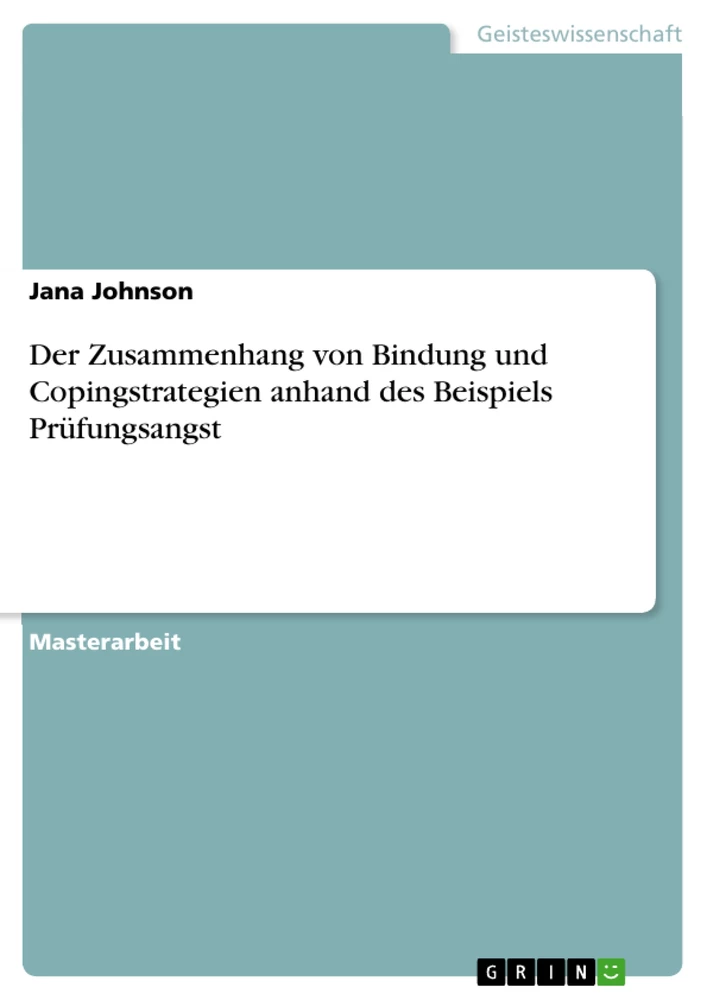
Der Zusammenhang von Bindung und Copingstrategien anhand des Beispiels Prüfungsangst
Masterarbeit, 2021
91 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Bindungsstil, Copingstrategien und Prüfungsangst. Ziel ist es, die Forschungslücke in diesem Bereich zu schließen und den Einfluss des Bindungsstils auf kognitive Prüfungsangst zu analysieren, wobei die Rolle ausgewählter Copingstrategien als potenzielle Mediatoren im Fokus steht.
- Der Einfluss von Bindungsstilen auf Prüfungsangst
- Die Rolle von Copingstrategien als Mediator zwischen Bindung und Prüfungsangst
- Analyse spezifischer Copingmechanismen (z.B. positives Denken, Vermeidung, soziale Unterstützung)
- Interpretation der Ergebnisse im Kontext bestehender Bindungs- und Stressforschung
- Ableitung von Implikationen für zukünftige Forschung und Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Masterarbeit ein, beschreibt den Forschungsstand und formuliert die Forschungsfrage und Hypothesen. Sie begründet die Relevanz der Untersuchung und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Theorie: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der relevanten Theorien. Es erläutert die Bindungstheorie, verschiedene Bindungsstile (sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent, desorganisiert), sowie die Konzepte von Prüfungsangst und Stressbewältigung (Coping). Die Kapitelteile beschreiben detailliert die verschiedenen theoretischen Modelle und Ansätze zur Erklärung von Bindung, Prüfungsangst und Coping, um einen soliden theoretischen Rahmen für die empirische Untersuchung zu schaffen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der relevanten Konstrukte und ihrer Zusammenhänge.
Aktuelle Forschungslage: Dieses Kapitel präsentiert den aktuellen Forschungsstand zum Thema Bindung, Coping und Prüfungsangst. Es werden relevante Studien und Ergebnisse aus der Literatur vorgestellt und kritisch diskutiert, um die Forschungslücke zu belegen und die eigene Forschungsarbeit einzuordnen. Der Überblick über die bestehende Literatur bildet die Grundlage für die Formulierung der Forschungsfrage und der Hypothesen.
Methode: Das Kapitel "Methode" beschreibt detailliert die Vorgehensweise der Studie. Es wird die Stichprobe (Bachelorstudierende der ersten beiden Semester), das Studiendesign (Querschnittdesign), die Erhebungsinstrumente (Fragebögen zur Erfassung von Bindungsstil, Prüfungsangst und Copingstrategien) und die statistischen Auswertungsverfahren vorgestellt. Die genaue Beschreibung der Methodik ermöglicht die Nachvollziehbarkeit und Bewertung der Ergebnisse.
Ergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studie präsentiert. Sowohl deskriptive als auch inferenzstatistische Ergebnisse werden dargestellt und kommentiert. Es werden die Ergebnisse der Hypothesentests beschrieben, inklusive der statistischen Kennwerte. Die Präsentation der Ergebnisse ist transparent und nachvollziehbar.
Diskussion: Die Diskussion interpretiert die Ergebnisse vor dem Hintergrund der theoretischen Grundlagen und der aktuellen Forschungslage. Es werden die Stärken und Schwächen der Studie kritisch reflektiert und mögliche Erklärungen für unerwartete Ergebnisse gegeben. Schließlich werden Implikationen für zukünftige Forschung und die praktische Anwendung der Ergebnisse formuliert.
Schlüsselwörter
Bindungstheorie, Bindungsstil, Prüfungsangst, Copingstrategien, Mediation, Stress, positives Denken, Vermeidung, soziale Unterstützung, Online-Fragebogen, Querschnittstudie.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Bindungsstil, Copingstrategien und Prüfungsangst. Ziel ist es, den Einfluss des Bindungsstils auf kognitive Prüfungsangst zu analysieren und die Rolle ausgewählter Copingstrategien als Mediatoren zu untersuchen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Bindungstheorie (Bindungsaufbau, Bindungsqualitäten nach Ainsworth, Bindungsstile im Erwachsenenalter), Prüfungsangst (Phänomenbeschreibung, Störungstheorien, aktuelle Lage), Stress und Coping (reaktionsbezogene, situationsbezogene und transaktionale Ansätze, Theorie der Ressourcenerhaltung, Copingstrategien).
Welche Bindungsstile werden untersucht?
Die Arbeit berücksichtigt verschiedene Bindungsstile, darunter sichere Bindung, unsicher-vermeidende Bindung, unsicher-ambivalente Bindung und unsicher-desorganisierte/desorientierte Bindung (nach Mary Main).
Welche Copingstrategien werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert spezifische Copingmechanismen wie positives Denken, Vermeidung und soziale Unterstützung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Theorie, aktuelle Forschungslage, Methode, Ergebnisse und Diskussion.
Was beinhaltet das Kapitel "Theorie"?
Das Kapitel "Theorie" bietet eine umfassende Darstellung der relevanten Theorien zu Bindung, Prüfungsangst und Stressbewältigung (Coping). Es erläutert die Bindungstheorie, verschiedene Bindungsstile und die Konzepte von Prüfungsangst und Stressbewältigung.
Was wird im Kapitel "Aktuelle Forschungslage" dargestellt?
Das Kapitel "Aktuelle Forschungslage" präsentiert den aktuellen Forschungsstand zum Thema Bindung, Coping und Prüfungsangst. Es werden relevante Studien und Ergebnisse aus der Literatur vorgestellt und kritisch diskutiert.
Was beinhaltet das Kapitel "Methode"?
Das Kapitel "Methode" beschreibt detailliert die Vorgehensweise der Studie, einschließlich der Stichprobe, des Studiendesigns, der Erhebungsinstrumente und der statistischen Auswertungsverfahren.
Welche statistischen Verfahren werden verwendet?
Die Arbeit verwendet statistische Auswertungsverfahren zur Analyse der Daten und zur Überprüfung der Hypothesen.
Was wird im Kapitel "Ergebnisse" präsentiert?
Im Kapitel "Ergebnisse" werden die Ergebnisse der Studie präsentiert, sowohl deskriptive als auch inferenzstatistische Ergebnisse.
Was beinhaltet das Kapitel "Diskussion"?
Die Diskussion interpretiert die Ergebnisse vor dem Hintergrund der theoretischen Grundlagen und der aktuellen Forschungslage. Es werden die Stärken und Schwächen der Studie reflektiert und Implikationen für zukünftige Forschung und die praktische Anwendung der Ergebnisse formuliert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Bindungstheorie, Bindungsstil, Prüfungsangst, Copingstrategien, Mediation, Stress, positives Denken, Vermeidung, soziale Unterstützung, Online-Fragebogen, Querschnittstudie.
Welche Zielgruppe hat die Studie?
Die Stichprobe besteht aus Bachelorstudierenden der ersten beiden Semester.
Details
- Titel
- Der Zusammenhang von Bindung und Copingstrategien anhand des Beispiels Prüfungsangst
- Autor
- Jana Johnson (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 91
- Katalognummer
- V1436654
- ISBN (Buch)
- 9783346989796
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- zusammenhang bindung copingstrategien beispiels prüfungsangst
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 51,99
- Arbeit zitieren
- Jana Johnson (Autor:in), 2021, Der Zusammenhang von Bindung und Copingstrategien anhand des Beispiels Prüfungsangst, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1436654
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-