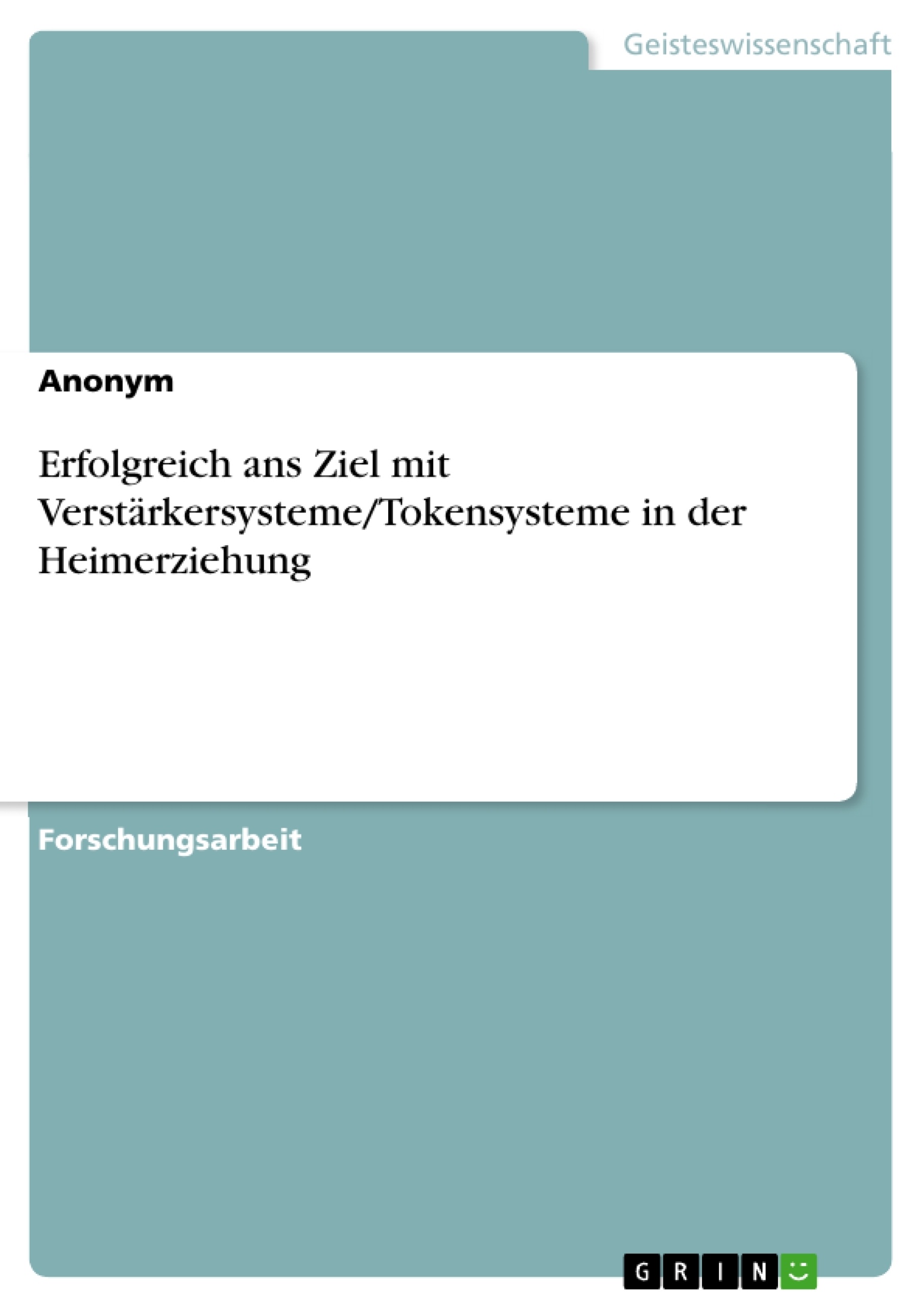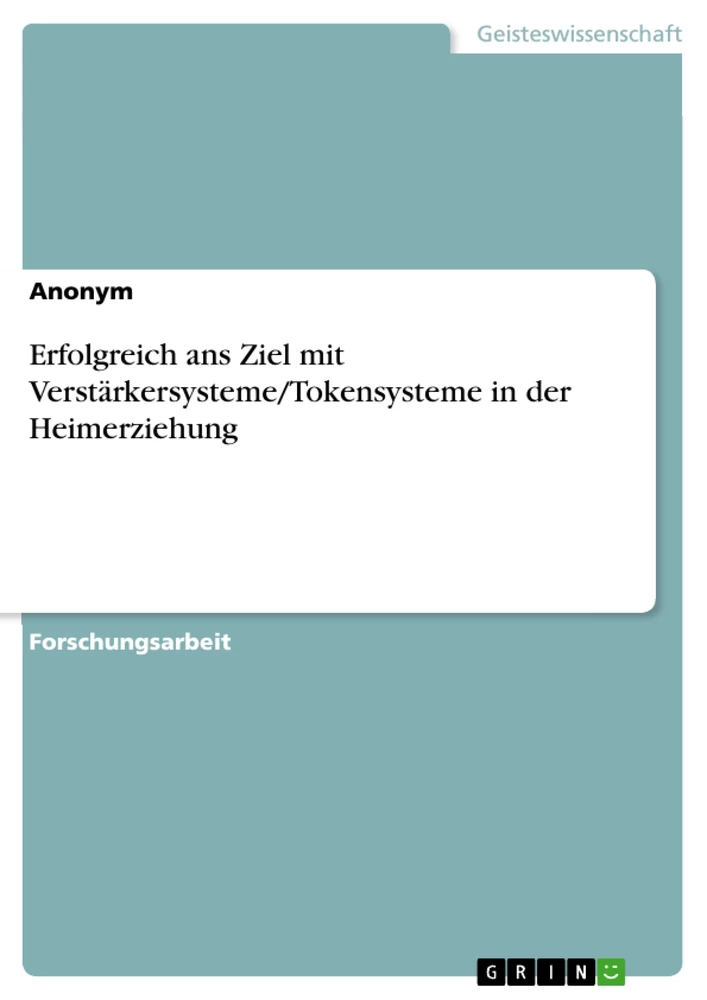
Erfolgreich ans Ziel mit Verstärkersysteme/Tokensysteme in der Heimerziehung
Forschungsarbeit, 2009
58 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Gedanken.
- Die theoretischen Grundlagen zum Praxisprojekt.......
- Lerntheorien
- Behaviorismus.....
- Operante Konditionierung .
- Verstärkung
- Verstärkerpläne..........\li>
- Begründung der Wahl einer operanten Methode für das Praxisprojekt......
- Ziele in der stationären Jugendhilfe ..
- Lerntheorien
- Die Idee des Praxisprojektes und die daraus resultierende Forschungsthese................12
- Zielentwicklung im Rahmen des Praxisprojektes.
- Wirkungsziel
- Handlungsziele und Handlungsschritte....
- Planung und Durchführung des Praxisprojektes.............
- Grundlagen im Team schaffen.
- Kurzes Vorstellen des Teams
- Klärung offener Fragen und Planung des genauen Vorgehens im Team..\li>
- Grundlagen bei den Jugendlichen schaffen..
- Kurzes Vorstellen der Mädchengruppe.
- Neugierde und Motivation bei den Jugendlichen wecken.
- Ablauf des Praxisprojektes.
- Grundlagen im Team schaffen.
- Evaluationsdesign
- Eingrenzung des Untersuchungsfeldes
- Ableitung der Fragestellungen ...
- Entwicklung des Evaluationsinstruments
- Strukturierte Beobachtung (quantitative Erhebung).
- Schriftliche Gruppenbefragung (qualitative Erhebung)..\li>
- Auswertung der Erhebung
- Eingrenzung des Untersuchungsfeldes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Praxisprojekt „Erfolgreich ans Ziel“ verfolgt das Ziel, die Effektivität eines Verstärkersystems in einer heilpädagogischen Mädchengruppe zu untersuchen. Es wird analysiert, inwiefern die Anwendung von Belohnungen und Anreizen das Erlernen neuen Verhaltens und die Zielerreichung der Jugendlichen positiv beeinflussen kann.
- Anwendung von Lerntheorien, insbesondere des Behaviorismus und der operanten Konditionierung
- Entwicklung eines Verstärkersystems und dessen Implementierung in der Praxis
- Analyse des Einflusses des Verstärkersystems auf das Verhalten und die Motivation der Jugendlichen
- Evaluation der Wirksamkeit des Verstärkersystems mittels qualitativer und quantitativer Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
Die einleitenden Gedanken des Praxisprojekts „Erfolgreich ans Ziel“ beleuchten die Bedeutung von Projektarbeit und Motivation in der stationären Jugendhilfe. Im Kapitel „Die theoretischen Grundlagen zum Praxisprojekt“ werden Lerntheorien, insbesondere der Behaviorismus und die operante Konditionierung, vorgestellt. Kapitel 3 erläutert die Idee des Praxisprojekts und die daraus resultierende Forschungsthese. Die Zielentwicklung wird in Kapitel 4 detailliert beschrieben, wobei sowohl das Wirkungsziel als auch die Handlungsziele und Handlungsschritte dargestellt werden. Kapitel 5 befasst sich mit der Planung und Durchführung des Praxisprojekts, wobei die Einbindung des Teams und der Jugendlichen im Mittelpunkt steht. Das Evaluationsdesign und die verwendeten Erhebungsmethoden werden in Kapitel 6 behandelt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Praxisprojekts sind: stationäre Jugendhilfe, heilpädagogische Mädchengruppe, Motivation, Verstärkersystem, operante Konditionierung, Behaviorismus, Zielerreichung, Verhaltensänderung, Evaluation, qualitative und quantitative Methoden.
Details
- Titel
- Erfolgreich ans Ziel mit Verstärkersysteme/Tokensysteme in der Heimerziehung
- Hochschule
- Frankfurt University of Applied Sciences, ehem. Fachhochschule Frankfurt am Main
- Note
- 1,0
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 58
- Katalognummer
- V143688
- ISBN (eBook)
- 9783640530731
- ISBN (Buch)
- 9783640659180
- Dateigröße
- 966 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Bitte die Arbeit anonymisieren!
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2009, Erfolgreich ans Ziel mit Verstärkersysteme/Tokensysteme in der Heimerziehung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/143688
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-