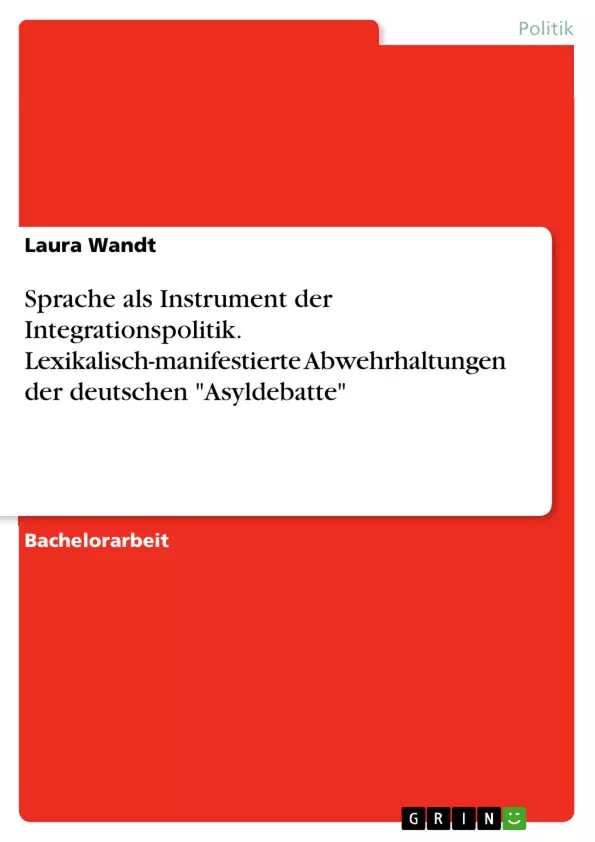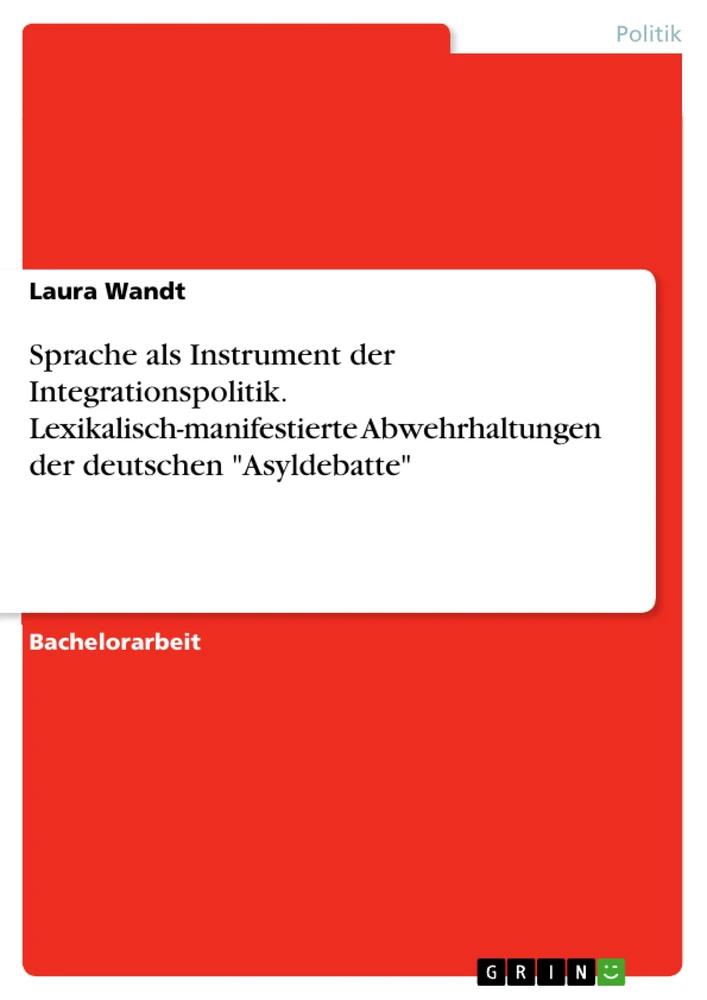
Sprache als Instrument der Integrationspolitik. Lexikalisch-manifestierte Abwehrhaltungen der deutschen "Asyldebatte"
Bachelorarbeit, 2021
45 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Warum ist Sprache politisch?
- 2. Sprache und Politik
- 2.1. Politikbegriff(e)
- 2.2. Politizität von Sprache
- 2.2.1. Politische Sprache im Gefüge des Deutschen
- 2.3. Politolinguistik
- 2.3.1. Funktionen politischer Sprache
- 2.3.2. Analyse auf der Wortebene
- 2.3.3. Das Lexikon der Politik
- 3. Asyldiskurse in Deutschland – Ein (Linguistischer) Vergleich
- 3.1. Asyldebatten früher bis heute
- 3.2. Bewertetes Reden über Migrant*innen im Bundestag
- 4. Lexikalisch manifestierte Abwehrhaltungen
- 4.1. Sprache und Ideologie
- 4.2. Wechselwirkungen politischer und Alltagssprache
- 4.2.1. Rechte Diskursstrategien von den Wurzeln bis zur AfD
- 4.2.2. Wie sie zur Sprache des Volkes wird
- 5. Sprache und gesellschaftliche Wirklichkeit
- 5.1. Sprechen über Eigenes und Fremdes
- 6. Perspektive oder: Warum wir politisch korrekte Sprache brauchen
- 7. Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Rolle von Sprache in der deutschen Asyldebatte und analysiert, wie lexikalisch manifestierte Abwehrhaltungen gegenüber Migrant*innen entstehen und sich im politischen und gesellschaftlichen Diskurs verbreiten. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen Sprache und Politik, insbesondere die Funktionen und Strategien politischer Sprache. Sie untersucht die historischen Entwicklungen der Asyldebatten und analysiert aktuelle Diskursmuster im Bundestag. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Wirkung von Sprache auf die Wahrnehmung von Eigenem und Fremdem in der Gesellschaft.
- Zusammenhang zwischen Sprache und Politik
- Analyse lexikalisch manifestierter Abwehrhaltungen in der Asyldebatte
- Historische Entwicklung und aktuelle Diskursmuster im Bundestag
- Wirkung von Sprache auf die Wahrnehmung von Eigenem und Fremdem
- Rolle von Political Correctness
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Ursprung und der Wirkung abwertender Begriffe in der öffentlichen Asyldebatte. Sie skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die linguistische Analyse politischer Sprache mit politikwissenschaftlichen Perspektiven verbindet. Der Fokus liegt auf der Untersuchung lexikalisch manifestierter Abwehrhaltungen und deren Weg von der politischen in die Alltagssprache.
2. Sprache und Politik: Dieses Kapitel etabliert den theoretischen Rahmen, indem es den Zusammenhang zwischen Sprache und Politik aus linguistischer und politikwissenschaftlicher Sicht beleuchtet. Es werden verschiedene Politikbegriffe diskutiert und die Politizität von Sprache herausgearbeitet. Die Einführung in die Politolinguistik liefert die methodologische Grundlage für die Analyse der politischen Sprache auf der Wortebene.
3. Asyldiskurse in Deutschland – Ein (Linguistischer) Vergleich: Dieses Kapitel bietet einen historischen Abriss der Asyldebatten in Deutschland, um den Kontext für die Entstehung lexikalisch manifestierter Abwehrhaltungen zu schaffen. Es analysiert, wie Bewertungen von Migrant*innen im Bundestag sprachlich ausgedrückt werden und vergleicht vergangene und aktuelle Diskurse.
4. Lexikalisch manifestierte Abwehrhaltungen: Dieses Kapitel untersucht die sprachlichen Strategien, die zur Konstruktion und Verbreitung von Abwehrhaltungen gegenüber Migrant*innen beitragen. Es analysiert den Einfluss von Ideologie und die Wechselwirkungen zwischen politischer und Alltagssprache. Der Fokus liegt auf der Nachverfolgung des Weges dieser Strategien von rechten Diskursen in die öffentliche und alltägliche Sprache.
5. Sprache und gesellschaftliche Wirklichkeit: In diesem Kapitel wird untersucht, wie Sprache die Wahrnehmung von Eigenem und Fremdem beeinflusst und wie dies die Aufnahme und Reproduktion von Abwehrhaltungen fördert. Es werden die gesellschaftlichen Folgen der untersuchten sprachlichen Phänomene beleuchtet.
6. Perspektive oder: Warum wir politisch korrekte Sprache brauchen: Dieses Kapitel diskutiert die Bedeutung politisch korrekter Sprache als eine Möglichkeit, diskriminierende und abwertende Äußerungen zu vermeiden und einen respektvollen Umgang miteinander zu fördern.
Schlüsselwörter
Sprache, Politik, Asyldebatte, Integration, Migration, Lexikalische Analyse, Abwehrhaltungen, Ideologie, Diskurs, Politolinguistik, Politische Korrektheit, Migrant*innen, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Sprache und Politik in der deutschen Asyldebatte
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Rolle von Sprache in der deutschen Asyldebatte. Der Fokus liegt auf der Analyse lexikalisch manifestierter Abwehrhaltungen gegenüber Migrant*innen und deren Verbreitung im politischen und gesellschaftlichen Diskurs. Es wird der Zusammenhang zwischen Sprache und Politik beleuchtet, insbesondere die Funktionen und Strategien politischer Sprache.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie abwertende Begriffe in der öffentlichen Asyldebatte entstehen und welche Wirkung sie haben. Die Arbeit untersucht die historischen Entwicklungen der Asyldebatten und analysiert aktuelle Diskursmuster im Bundestag. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Wirkung von Sprache auf die Wahrnehmung von Eigenem und Fremdem in der Gesellschaft und die Rolle von "Political Correctness".
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verbindet linguistische Analysen politischer Sprache mit politikwissenschaftlichen Perspektiven. Es wird eine lexikalische Analyse durchgeführt, um die sprachlichen Strategien zur Konstruktion und Verbreitung von Abwehrhaltungen zu untersuchen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Sprache und Politik (inkl. Politolinguistik), Asyldiskurse in Deutschland – Ein (Linguistischer) Vergleich, Lexikalisch manifestierte Abwehrhaltungen, Sprache und gesellschaftliche Wirklichkeit, Perspektive oder: Warum wir politisch korrekte Sprache brauchen und Conclusio (Schlussfolgerung).
Was wird im Kapitel "Sprache und Politik" behandelt?
Dieses Kapitel legt den theoretischen Rahmen fest. Es beleuchtet den Zusammenhang zwischen Sprache und Politik aus linguistischer und politikwissenschaftlicher Sicht, diskutiert verschiedene Politikbegriffe und arbeitet die Politizität von Sprache heraus. Die Einführung in die Politolinguistik bildet die methodologische Grundlage für die Analyse der politischen Sprache auf Wortebene.
Was wird im Kapitel "Asyldiskurse in Deutschland" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Asyldebatten in Deutschland, um den Kontext für die Entstehung von Abwehrhaltungen zu schaffen. Es analysiert die sprachliche Darstellung von Bewertungen von Migrant*innen im Bundestag und vergleicht vergangene und aktuelle Diskurse.
Was wird im Kapitel "Lexikalisch manifestierte Abwehrhaltungen" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die sprachlichen Strategien, die zur Konstruktion und Verbreitung von Abwehrhaltungen beitragen. Es untersucht den Einfluss von Ideologie und die Wechselwirkungen zwischen politischer und Alltagssprache, mit Fokus auf der Entwicklung rechter Diskursstrategien und deren Einfluss auf die Alltagssprache.
Was wird im Kapitel "Sprache und gesellschaftliche Wirklichkeit" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Sprache auf die Wahrnehmung von Eigenem und Fremdem und wie dies die Aufnahme und Reproduktion von Abwehrhaltungen beeinflusst. Die gesellschaftlichen Folgen der untersuchten sprachlichen Phänomene werden beleuchtet.
Was wird im Kapitel "Warum wir politisch korrekte Sprache brauchen" behandelt?
Dieses Kapitel diskutiert die Bedeutung politisch korrekter Sprache, um diskriminierende und abwertende Äußerungen zu vermeiden und einen respektvollen Umgang zu fördern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Sprache, Politik, Asyldebatte, Integration, Migration, Lexikalische Analyse, Abwehrhaltungen, Ideologie, Diskurs, Politolinguistik, Politische Korrektheit, Migrant*innen, Deutschland.
Details
- Titel
- Sprache als Instrument der Integrationspolitik. Lexikalisch-manifestierte Abwehrhaltungen der deutschen "Asyldebatte"
- Hochschule
- Universität Rostock (Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften)
- Note
- 1,7
- Autor
- Laura Wandt (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 45
- Katalognummer
- V1453848
- ISBN (Buch)
- 9783963566745
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- sprache instrument integrationspolitik lexikalisch-manifestierte abwehrhaltungen asyldebatte
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Laura Wandt (Autor:in), 2021, Sprache als Instrument der Integrationspolitik. Lexikalisch-manifestierte Abwehrhaltungen der deutschen "Asyldebatte", München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1453848
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-