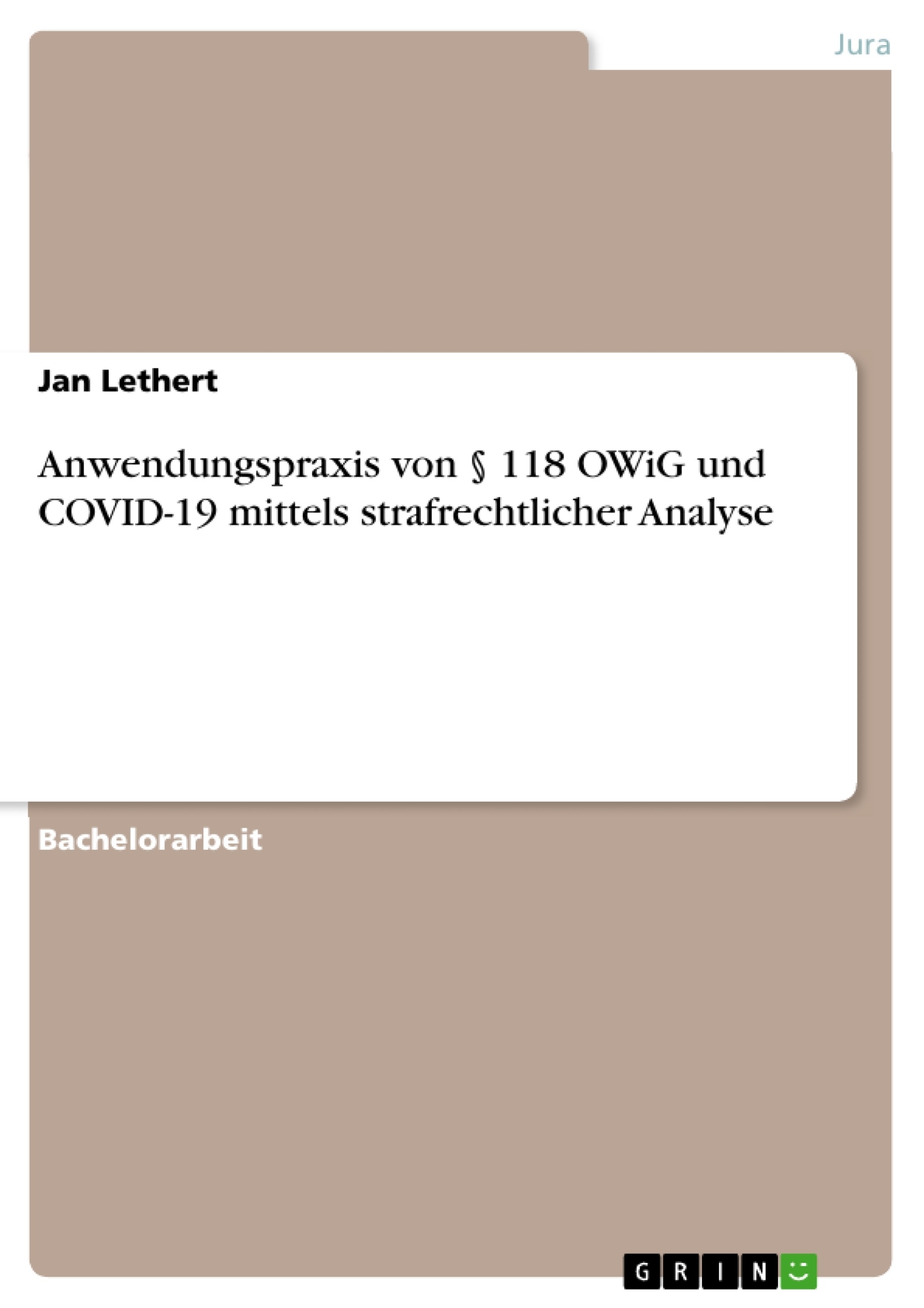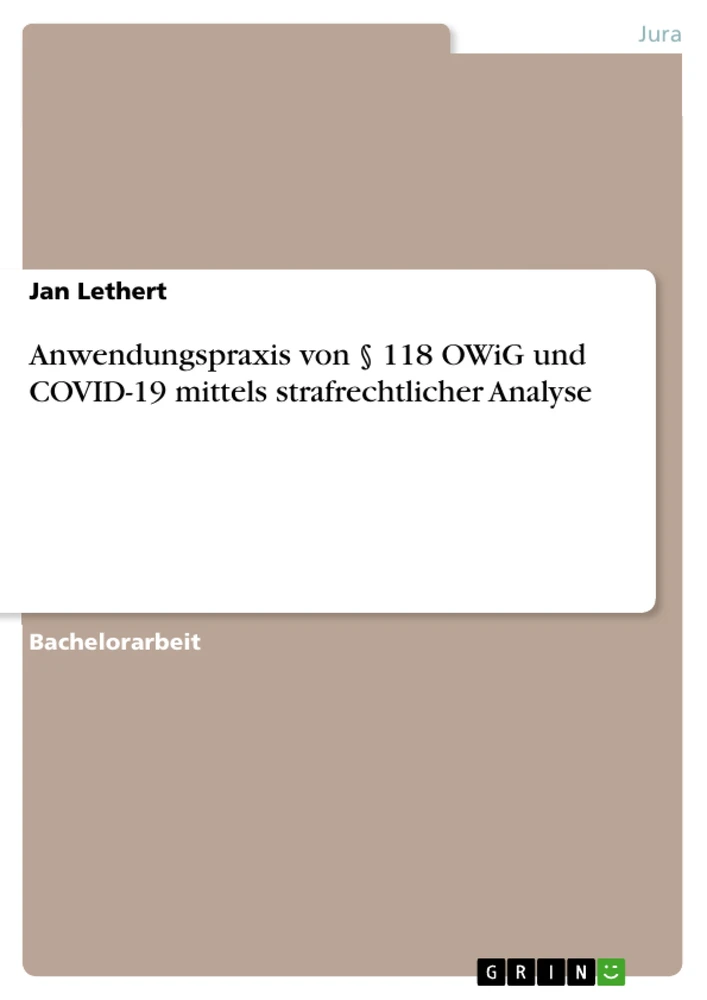
Anwendungspraxis von § 118 OWiG und COVID-19 mittels strafrechtlicher Analyse
Bachelorarbeit, 2022
43 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- I. Relevanz und Entwicklung
- II. Forschungsfrage
- III. Methodik und Aufbau
- B. Rechtliche Untersuchung
- I. Normzweck des § 118 OWIG
- 1. Historie
- 2. Zuständigkeit
- 3. Höhe der Geldbuße
- 4. Verjährung
- 5. Ahndungsvoraussetzungen
- II. Auftretende Probleme
- C. Anwendungsfälle in der Praxis
- I. Kasuistik Rechtsprechung
- II. Erhebung praktischer Anwendungsbereiche
- III. Abgleich Theorie und Praxis
- D. Ahndung von „Fake News“
- I. Quelle und Problembeschreibung
- II. Fake News
- III. Ahndung mittels des § 118 Abs. 1 OWIG
- IV. Anwendungshindernisse
- V. Zwischenfazit
- E. Anwendungsempfehlung
- F. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den zweckmäßigen und praxistauglichen Gebrauch subsidiärer Ordnungswidrigkeitentatbestände, insbesondere des § 118 Abs. 1 OWIG. Der Fokus liegt auf der Anwendung dieser Vorschrift im Kontext der COVID-19-Pandemie und der Herausforderungen, die durch die Verbreitung von „Fake News“ entstehen. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen, die praktische Anwendung und mögliche Probleme bei der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 118 Abs. 1 OWIG.
- Analyse des Normzwecks und der rechtlichen Voraussetzungen des § 118 Abs. 1 OWIG
- Untersuchung der praktischen Anwendung des § 118 Abs. 1 OWIG in der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis
- Bewertung der Eignung des § 118 Abs. 1 OWIG zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit „Fake News“ während der COVID-19-Pandemie
- Diskussion der Anwendungshindernisse und Herausforderungen bei der Anwendung des § 118 Abs. 1 OWIG
- Formulierung von Anwendungsempfehlungen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung: Dieses Kapitel führt in das Thema ein, erläutert die Relevanz subsidiärer Ordnungswidrigkeitentatbestände und die Forschungsfrage der Arbeit. Es wird die Bedeutung des § 118 Abs. 1 OWIG im Kontext der COVID-19-Pandemie und der Herausforderungen durch „Fake News“ hervorgehoben. Der Aufbau der Arbeit und die angewandte Methodik werden vorgestellt. Die öffentliche Ordnung wird als schützenswertes Gut definiert und die Problematik der Anwendung subsidiärer Normen, wie § 118 Abs. 1 OWIG, im Kontext von spezialgesetzlichen Regelungen diskutiert.
B. Rechtliche Untersuchung: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den rechtlichen Grundlagen des § 118 Abs. 1 OWIG. Es werden der Normzweck, die Historie, die Zuständigkeit, die Höhe der Geldbuße, die Verjährung und vor allem die detaillierten Ahndungsvoraussetzungen (Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Vorwerfbarkeit) untersucht. Besonderes Augenmerk liegt auf den unbestimmten Rechtsbegriffen wie „öffentliche Ordnung“, „Gefährdung“ und „Belästigung“, deren Ausgestaltung in der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis analysiert wird. Die Probleme des Bestimmtheitsgebots, der Subsidiarität und des Wertewandels im Zusammenhang mit dem § 118 Abs. 1 OWIG werden kritisch beleuchtet.
C. Anwendungsfälle in der Praxis: Kapitel C präsentiert Anwendungsfälle des § 118 Abs. 1 OWIG in der Praxis. Es werden sowohl tatbestandsmäßige als auch nicht tatbestandsmäßige Fälle aus der Rechtsprechung dargestellt und analysiert. Die Ergebnisse einer empirischen Erhebung zu praktischen Anwendungsbereichen werden präsentiert und mit der theoretischen Betrachtung abgeglichen. Der Vergleich zwischen Theorie und Praxis soll Lücken und Diskrepanzen aufzeigen und die praktische Relevanz des § 118 Abs. 1 OWIG verdeutlichen.
D. Ahndung von „Fake News“: Dieses Kapitel untersucht die Anwendung des § 118 Abs. 1 OWIG auf die Ahndung von „Fake News“ im Kontext der COVID-19-Pandemie. Es erfolgt zunächst eine Begriffsdefinition von „Fake News“ und eine Analyse der Verbreitungsmedien. Die Arbeit analysiert die Ausstrahlungswirkung auf Grundrechte (Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit) und die Subsidiarität gegenüber Straftaten (Straftaten gegen die persönliche Ehre, Straftaten gegen die öffentliche Ordnung). Ausgewählte Beispiele für „Fake News“ werden auf ihre Tatbestandsmäßigkeit geprüft und die Anwendungshindernisse (Haftung, repressiver Charakter, Bußgeldrahmen, Ausuferung des Tatbestands) werden diskutiert.
Schlüsselwörter
§ 118 Abs. 1 OWIG, Ordnungswidrigkeit, Subsidiarität, öffentliche Ordnung, Gefährdung, Belästigung, Fake News, COVID-19-Pandemie, Rechtsprechung, Verwaltungspraxis, Grundrechte, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Anwendungshindernisse, Bestimmtheitsgebot.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Anwendung des § 118 Abs. 1 OWIG im Kontext von „Fake News“ während der COVID-19-Pandemie
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Arbeit untersucht den zweckmäßigen und praxistauglichen Einsatz des § 118 Abs. 1 OWIG (Ordnungswidrigkeitengesetz) als subsidiären Tatbestand, insbesondere im Kontext der COVID-19-Pandemie und der Verbreitung von „Fake News“. Der Fokus liegt auf der Analyse der rechtlichen Grundlagen, der praktischen Anwendung und der Herausforderungen bei der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dieser Vorschrift.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine umfassende Analyse des § 118 Abs. 1 OWIG, beginnend mit dem Normzweck und der Historie bis hin zu den detaillierten Ahndungsvoraussetzungen (Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit, Vorwerfbarkeit). Sie untersucht die praktische Anwendung in der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis, bewertet die Eignung des § 118 Abs. 1 OWIG zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit „Fake News“, diskutiert Anwendungshindernisse und formuliert abschließende Anwendungsempfehlungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einführung, Rechtliche Untersuchung des § 118 Abs. 1 OWIG, Anwendungsfälle in der Praxis, Ahndung von „Fake News“, Anwendungsempfehlungen und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas, beginnend mit einer allgemeinen Einführung und der Definition der Forschungsfrage, über die detaillierte rechtliche Analyse bis hin zur praktischen Anwendung und der Diskussion der Herausforderungen.
Welche konkreten Aspekte des § 118 Abs. 1 OWIG werden untersucht?
Die Arbeit analysiert den Normzweck, die Zuständigkeit, die Höhe der Geldbuße, die Verjährung und die Ahndungsvoraussetzungen des § 118 Abs. 1 OWIG. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den unbestimmten Rechtsbegriffen wie „öffentliche Ordnung“, „Gefährdung“ und „Belästigung“ und deren Auslegung in der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis. Die Probleme des Bestimmtheitsgebots und der Subsidiarität werden kritisch beleuchtet.
Wie wird der Zusammenhang zwischen § 118 Abs. 1 OWIG und „Fake News“ untersucht?
Die Arbeit untersucht, ob und wie der § 118 Abs. 1 OWIG zur Ahndung von „Fake News“ im Kontext der COVID-19-Pandemie eingesetzt werden kann. Sie definiert den Begriff „Fake News“, analysiert die Verbreitungsmedien und deren Ausstrahlungswirkung auf Grundrechte (Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit). Die Arbeit prüft ausgewählte Beispiele auf ihre Tatbestandsmäßigkeit und diskutiert Anwendungshindernisse wie Haftung, repressiven Charakter, Bußgeldrahmen und die mögliche Ausuferung des Tatbestands.
Welche Ergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert eine umfassende Analyse der rechtlichen Grundlagen und der praktischen Anwendung des § 118 Abs. 1 OWIG, insbesondere im Kontext der „Fake News“ während der COVID-19-Pandemie. Sie identifiziert Probleme und Herausforderungen bei der Anwendung und formuliert konkrete Anwendungsempfehlungen für die Praxis. Die Ergebnisse basieren auf einer Kombination aus Literaturrecherche, Rechtsprechungsanalyse und gegebenenfalls empirischen Erhebungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
§ 118 Abs. 1 OWIG, Ordnungswidrigkeit, Subsidiarität, öffentliche Ordnung, Gefährdung, Belästigung, Fake News, COVID-19-Pandemie, Rechtsprechung, Verwaltungspraxis, Grundrechte, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Anwendungshindernisse, Bestimmtheitsgebot.
Details
- Titel
- Anwendungspraxis von § 118 OWiG und COVID-19 mittels strafrechtlicher Analyse
- Hochschule
- Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen; Köln
- Note
- 1,3
- Autor
- Jan Lethert (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 43
- Katalognummer
- V1455377
- ISBN (Buch)
- 9783389004746
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Anwendungspraxis Falsche Tatsachenbehauptungen Meinungsfreiheit Praktische Beispiele Abwägung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Jan Lethert (Autor:in), 2022, Anwendungspraxis von § 118 OWiG und COVID-19 mittels strafrechtlicher Analyse, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1455377
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-