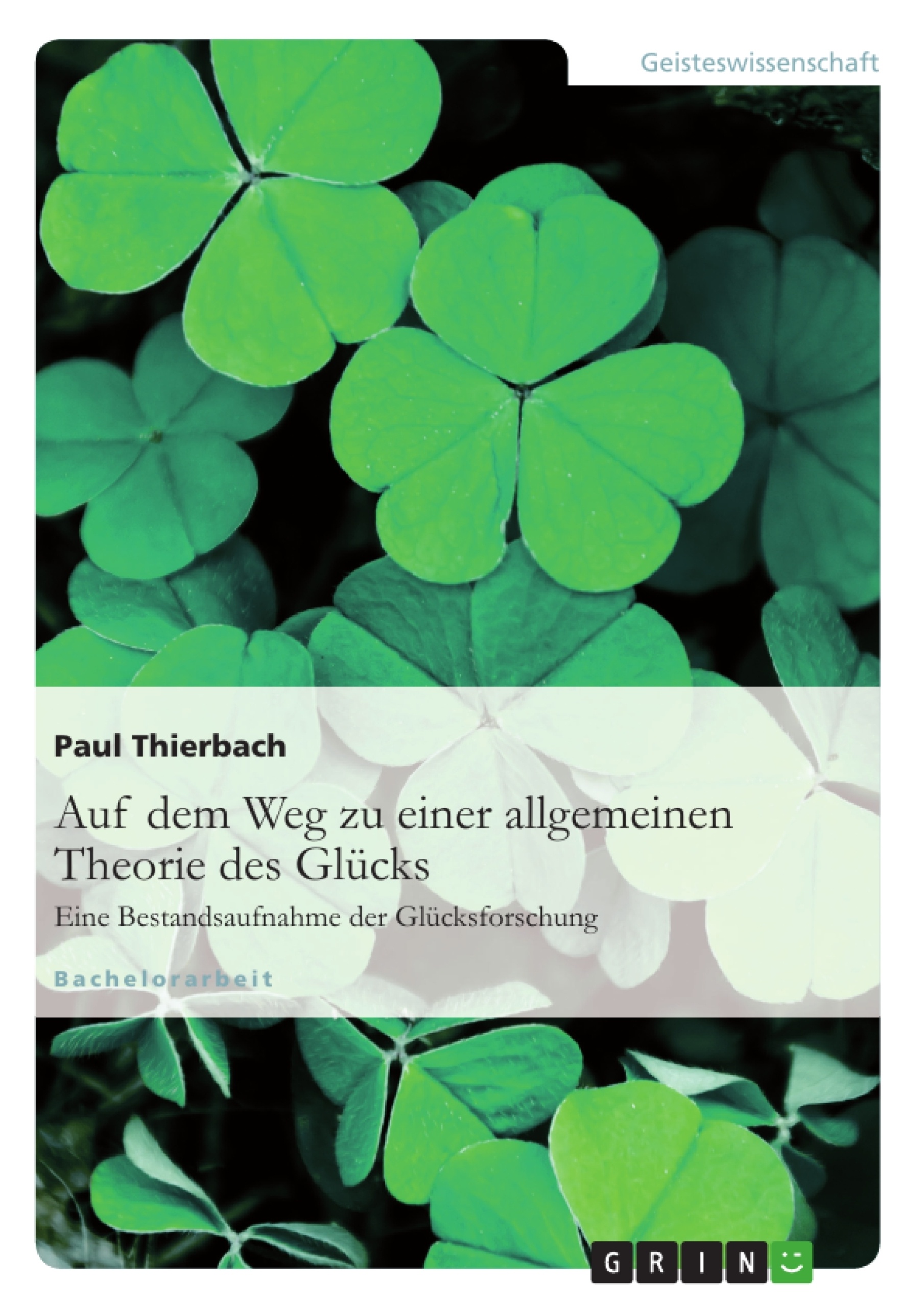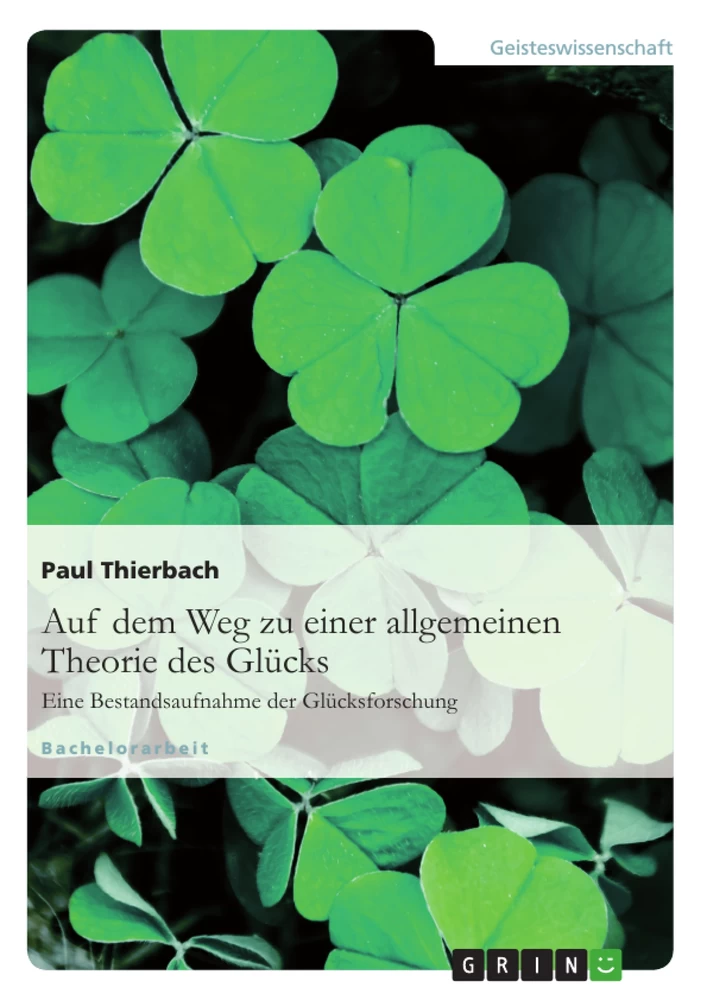
Auf dem Weg zu einer allgemeinen Theorie des Glücks
Bachelorarbeit, 2009
99 Seiten, Note: 1,1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Glück und wie kann man es messen?
- Philosophie des Glücks
- Exkurs: Kurze Apologie des Utilitarismus
- Biologie des Glücks
- Exkurs: Glück im Unglück
- Psychologie des Glücks
- Exkurs: Kurze Apologie des Glücks .......
- Ökonomie des Glücks
- Soziologie des Glücks
- Exkurs: Die Depression als Phänomen der Moderne…...\n.
- Zusammenfassung der Ergebnisse und mögliche Konsequenzen
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage nach der Definition, Erfassung und den verschiedenen Perspektiven auf Glück. Ziel ist es, eine Bestandsaufnahme der Glücksforschung zu liefern und die unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätze, die sich mit dem Thema Glück befassen, zu präsentieren.
- Wissenschaftliche Definitionen und Messmethoden von Glück
- Philosophische, biologische, psychologische, ökonomische und soziologische Perspektiven auf Glück
- Die Rolle von Glück in verschiedenen Lebensbereichen
- Mögliche Folgen der Glücksforschung für die Gesellschaft
- Die Relevanz von Glück für die Soziologie als wissenschaftliche Disziplin
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Bedeutung des Themas Glück in der heutigen Zeit und skizziert die historische Entwicklung der Glücksforschung. Es werden außerdem verschiedene Beispiele aus der Medienlandschaft angeführt, die die aktuelle Relevanz des Themas verdeutlichen.
- Was ist Glück und wie kann man es messen?: Hier werden verschiedene Definitionen von Glück und deren Messbarkeit diskutiert. Es werden verschiedene Ansätze zur operationalisierung von Glück vorgestellt, beispielsweise die subjektive Glücksbewertung, die hedonistische Glückstheorie und die eudaimonistische Glückstheorie.
- Philosophie des Glücks: In diesem Kapitel werden philosophische Konzepte von Glück beleuchtet, wie die Epikureische Glückstheorie, die Stoische Glückstheorie und die aristotelische Glückstheorie. Es werden außerdem die wichtigsten Vertreter der jeweiligen Schulen vorgestellt und deren Argumentationen erläutert.
- Biologie des Glücks: Die biologischen Grundlagen des Glücks werden behandelt, einschließlich der Rolle von Hormonen, Neurotransmittern und Gehirnarealen. Es werden die genetischen Faktoren, die zu Glück und Zufriedenheit beitragen können, untersucht, und die evolutionären Gründe für die Entstehung des Glücksgefühls werden beleuchtet.
- Psychologie des Glücks: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den psychologischen Aspekten des Glücks, zum Beispiel den Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen, Lebensereignissen und psychologischen Interventionen auf das Glücksempfinden. Es werden psychologische Modelle des Glücks vorgestellt und die Ergebnisse empirischer Forschung zu Glück und Zufriedenheit dargestellt.
- Ökonomie des Glücks: Hier wird der Zusammenhang zwischen Glück und wirtschaftlichen Faktoren analysiert, zum Beispiel der Einfluss von Einkommen, Vermögen und Konsum auf das Glücksempfinden. Es werden außerdem ökonomische Modelle des Glücks vorgestellt und die Rolle der Ökonomie bei der Erforschung von Glück und Zufriedenheit diskutiert.
- Soziologie des Glücks: Dieses Kapitel befasst sich mit den sozialen Aspekten von Glück, zum Beispiel den Einfluss von sozialen Beziehungen, Kultur und Gesellschaft auf das Glücksempfinden. Es werden soziologische Theorien des Glücks vorgestellt und empirische Studien zu Glück und Zufriedenheit in verschiedenen Gesellschaften analysiert.
Schlüsselwörter
Glück, Zufriedenheit, Lebensqualität, Happiness Research, Glücksforschung, Psychologie, Soziologie, Biologie, Philosophie, Ökonomie, empirische Forschung, hedonistische Glückstheorie, eudaimonistische Glückstheorie, subjektives Wohlbefinden.
Häufig gestellte Fragen
Ist Glück wissenschaftlich definierbar und messbar?
Ja, die moderne Glückswissenschaft (Science of Happiness) nutzt Methoden wie die subjektive Glücksbewertung und unterscheidet zwischen hedonistischen und eudaimonistischen Ansätzen.
Welche Rolle spielt die Biologie beim Glücksempfinden?
Glück hat biologische Grundlagen in der Genetik, der Hirnforschung und dem Zusammenspiel von Neurotransmittern und Hormonen.
Macht Geld wirklich glücklich?
Die ökonomische Glücksforschung untersucht das komplexe Verhältnis von Einkommen und Zufriedenheit und räumt mit Mythen über den Zusammenhang von Reichtum und Wohlbefinden auf.
Warum ist Depression ein zentrales Phänomen der Moderne?
Die Arbeit beleuchtet soziologische Erklärungen, warum trotz steigenden Wohlstands psychische Erkrankungen wie Depressionen in modernen Gesellschaften zunehmen.
Was ist der Unterschied zwischen hedonistischem und eudaimonistischem Glück?
Hedonismus fokussiert auf kurzfristiges Vergnügen und Schmerzvermeidung, während Eudaimonie auf ein sinnerfülltes Leben und die Entfaltung von Potenzialen abzielt.
Details
- Titel
- Auf dem Weg zu einer allgemeinen Theorie des Glücks
- Untertitel
- Eine Bestandsaufnahme der Glücksforschung.
- Hochschule
- Technische Universität Dresden (Institut für Soziologie)
- Note
- 1,1
- Autor
- BA Paul Thierbach (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 99
- Katalognummer
- V147224
- ISBN (eBook)
- 9783640577736
- ISBN (Buch)
- 9783640577996
- Dateigröße
- 1647 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Kommentare der prüfenden Professoren: Dem Autor ist ein Riesenwurf gelungen, ein äußerst flotter Essay im Durchgang durch die Disziplinen [...] Kurzum eine erstaunliche Arbeit eines großen Talents.[Prof.1] Für jede Teildisziplin konnte er hervorragend die jeweiligen Determinanten für Glück herausarbeiten [...] Zudem ist die Arbeit angenehm zu lesen und ansprechend mit illustrierenden Verweisen und Zitaten aus der Populärkultur versehen.[Prof.2] Sie haben unglaublich viel Material auf vorzügliche Weise zusammen gestellt und interpretiert.[Prof.3]
- Schlagworte
- Glück Glücksforschung Happiness Unglück moderne Gesellschaft Depression Philosophie Biologie Psychologie Soziologie Positive Psychologie Martin Seligman Ruut Veenhoven Richard Easterlin Easterlin Paradox Gerhard Schulze Erlebnisgesellschaft Individualisierung Utilitarismus Epikur Daniel Gilbert Richard Layard Mathias Binswanger hedonic treadmill subjektives Wohlbefinden subjective well-being Alain Ehrenberg quality of life Evolution Evolutionstheorie Bjorn Grinde Darwinian Happiness Selbstverwirklichung Selbstoptimierung Generation Prekär Unsicherheit Verantwortung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 42,99
- Preis (Book)
- US$ 55,99
- Arbeit zitieren
- BA Paul Thierbach (Autor:in), 2009, Auf dem Weg zu einer allgemeinen Theorie des Glücks, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/147224
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-