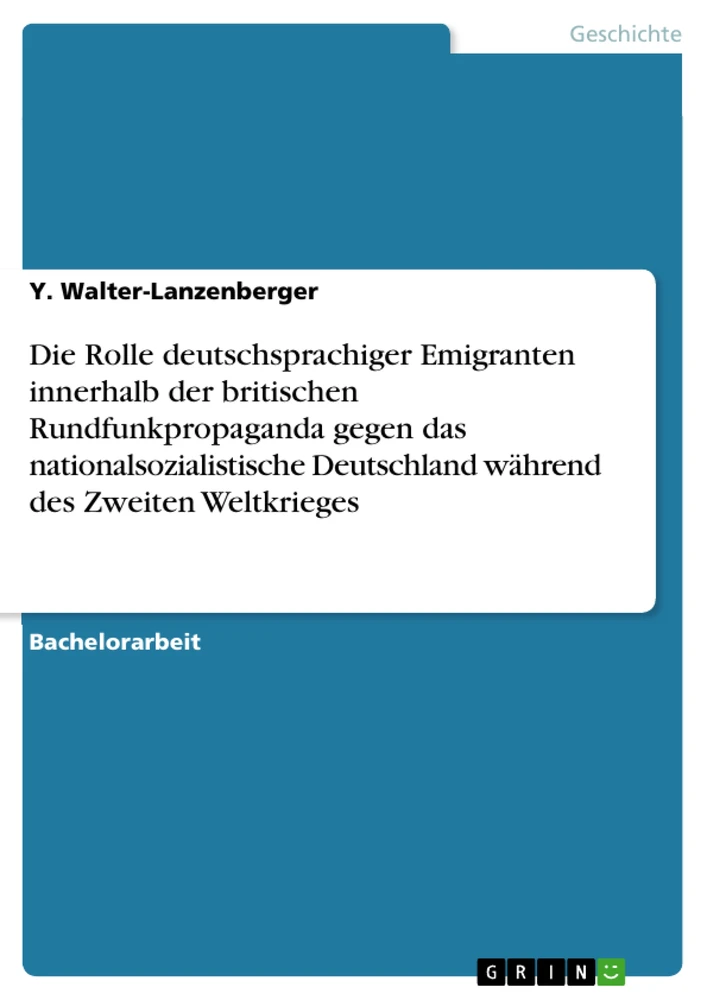
Die Rolle deutschsprachiger Emigranten innerhalb der britischen Rundfunkpropaganda gegen das nationalsozialistische Deutschland während des Zweiten Weltkrieges
Bachelorarbeit, 2023
54 Seiten, Note: 1,5
Geschichte Deutschlands - Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG
1.1 Fragestellung
1.2 Vorgehensweise und Methoden
1.3 Quellenkorpus und Forschungsstand
2. DIE BRITISH BROADCASTING CORPORATION UND DIE BRITISCHE RUNDFUNKPROPAGANDA
2.1 Hier spricht London - der deutschsprachige Dienst der BBC
2.2 Propagandastrategien und Direktiven
3. THOMASMANN
3.1 Zusammenarbeit mit der BBC
3.2 Dasandere Deutschland
3.3 Aufruf zum Widerstand und die Schuldfrage
3.4 Thomas Mann im Spiegel der Direktiven
4. BRUNOADLER
4.1 Lachen über Hitler-antifaschistische Satire als Mittel des Widerstandes
4.2 AdlersSatiresendungen
4.2.1 Frau Wernicke im Spiegel der Direktiven
4.2.2 Kurt und Willi im Spiegel der Direktiven
5. SCHLUSSBETRACHTUNG
6. QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS
1. Einleitung
Was haben der erste Takt von Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie1 und die Morsezeichen für den Buchstaben ,V' (symbolisch für ,Victory') gemeinsam? Eine Abfolge von dreimal kurz und einmal lang. Diese Töne, gespielt auf einer dumpfen Pauke, erklangen als Auftaktsignal vor allen Sendungen des deutschen Dienstes der BBC während des Zweiten Weltkriegs, gefolgt von der Kunde „This is London calling in the European Service of he BBC. London calling Europe. Hier ist England! Hier ist England! Hier spricht der Deutsche Dienst der BBC."2 So wurden zahlreiche Deutsche3 erreicht, die sich trotz Verbot und Strafandrohung den Stimmen aus dem Äther, den Nachrichten, Reden und Beiträgen des ,Feindsenders' hingaben und zuhörten.4 Auf der anderen Seite agierten zu Teilen ebenfalls Deutsche beziehungsweise deutschsprachige Personen, die sich im Exil befanden. Vieler dieser, besonders jene, die von Berufes wegen bereits vorher mit Literatur und Sprache eng verbunden gewesen sind, politisierte spätestens das Leben im Exil und ließ sie einen Weg suchen, die eigenen Gedanken an das deutschsprachige Publikum richten zu können. Der Blick der Exilliteratur richtete sich in erster Linie auf die Geschehnisse in der Heimat. Dabei bestimmten vor allem die Hoffnung auf einen zeitnahen Untergang des nationalsozialistischen Regimes und das stetige Appellieren an das (vermeintlich) unwissende oder furchtsame deutsche Volk und ebenso an das Gewissen der Weltgemeinschaft, den Verbrechen des NS-Regimes Einhalt zu gebieten und dieses nicht den Krieg gewinnen zu lassen, das Handeln.5 Der im September 1938 entstandene Deutsche Dienst der BBC6 lieferte den bis zum Jahr 1939 in Großbritannien ankommenden 70.000 Emigrantinnen aus Deutschland, Österreich und dem Sudetengebiet7 ein lukratives Betätigungsfeld was durch die „große[...] Zahl deutscher Mitarbeiter"8 unterstrichen werden kann. Die meisten Rundfunksendungen des deutschen Dienstes der BBC sind durch den Drang nach Auffilärung entstanden. „In der Emigration gab es keinen windstillen Winkel; das Exil erlaubte keine weltabgewandte Haltung"9, wie der Schriftsteller Franz Carl Weiskopf wenige Jahre nach Kriegsende resümierte. Den deutschsprachigen Emigrantinnen und Emigranten bot neben der klassischen Exilpresse und Exilpublizistik, welche sich weniger eignete, um Rezipientinnen in Deutschland zu erhalten, besonders das zu dieser Zeit noch junge Medium Rundfunk eine exzellente Möglichkeit „den Anschluß an Schicksalsgefährten zu suchen"10 und auch eine ferne, oft unerreichbar wirkende Hörerschaft zu erlangen. Denn die Radiowellen11 machten an den Staatsgrenzen, seien sie noch so verbarrikadiert, keinen Halt und die - zumindest scheinbare - „Freiheit des Äthers"12 lieferte vor allem eines, Hoffnung. Diese Freiheit bildete jedoch für meisten der Emigrierten vielmehr eine Illusion, da spätestens mit fortlaufender Kriegsdauer der Konflikt im Äther aus Sicht der Alliierten und der Gastgeberländer an Relevanz gewann, weshalb methodisch und inhaltlich deren Interessen dominierten und den deutschsprachigen Emigrantinnen und Emigranten nur wenig Freiraum blieb.13 Wie sie diesen dennoch genutzt haben, gilt es folgend herauszuarbeiten.
1.1 Fragestellung
Primär stellt sich in dieser Arbeit die Frage danach, inwiefern die ausgewählten Emigranten14 innerhalb des britischen Rundfunks die Möglichkeit hatten, Einfluss auf das deutschsprachige Programm der BBC während des Zweiten Weltkrieges zu nehmen und welche Rolle sie im Kampf gegen den Nationalsozialismus spielten. Dabei gilt es die Voraussetzungen und Bedingungen, unter welchen sie innerhalb der BBC agierten, herauszuarbeiten. Wie frei sind die Emigrantinnen in ihrer Arbeit, die Teil der britischen Propagandastrategie war, gewesen und inwiefern bestimmten die Vorgaben, Zensuren oder auch andere Faktoren die Arbeitsweise? Welche Gestaltungsräume existierten in dem Spannungsfeld zwischen der eigenen Meinung und der britischen Direktive, wo lagen womöglich auch die Grenzen des Sagbaren? Weiter stellt sich die Frage, wie sich dieses Spannungsfeld im Verlauf des Krieges und durch die zunehmende Institutionalisierung der Propaganda verändert hat, wie die Emigrantinnen mit diesen Veränderungen umgingen und inwieweit die vorgegebenen Themen in den für die Arbeit ausgewählten Sendereihen umgesetzt wurden?
1.2 Vorgehensweise und Methoden
Um die aufgeworfenen Fragen gewinnbringend beantworten zu können, ist es unerlässlich zunächst in einem ersten Kapitel einen genaueren Blick auf die Rahmenbedingungen des britischen Exilrundfunks zu werfen. Weiter soll sich mit den Strukturen der BBC, dem deutschsprachigen Dienst und den Strategien der britischen Rundfunkpropaganda beschäftigt werden. Dabei gilt es zu beachten, den Gesamtkontext mit seinen Verstrickungen und Interaktionen der involvierten Akteure, hervorzuheben. Durch die Analyse der administrativen Prozesse und die Erfassung der britischen Propagandadirektiven sollen die Grundlagen für die weiteren Untersuchungen anhand der beiden ausgewählten Akteure Thomas Mann und Bruno Adler geschaffen werden. Die Auseinandersetzung mit den Quellen, in diesem Fall besonders der Sendemanuskripte, soll dafür im Fokus stehen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind das Produkt eines eher induktiveren Vorgehens, welches anderseits wieder in der Einbettung in den Gesamtkontext kompensiert wird.
Nachdem die Rahmenbedingungen, Umstände und Faktoren untersucht wurden, kann das Hauptaugenmerk auf das Wirken der beiden ausgewählten Emigranten, die in der BBC agierten, gelegt werden. Thomas Mann und seine Rundfunksendung „Deutsche Hörer!"15 sollen neben den genannten Fragestellungen auch einen kurzen Blick auf die, für zahlreiche Emigrierte nicht unbedeutende, Funktion des doppelten Deutschlandbildes beziehungsweise des „anderen Deutschlandes"16 gewähren. Weiter sind Manns Reden ebenso wie die Satiresendungen „Frau Wernicke"17 und „Kurt und Willi" von Bruno Adler partiell zu analysieren. Diese Arbeit will explizit keine Feinanalyse der Rundfunkbeiträge darbieten, sondern diese der Kernfrage entsprechend dahingehend zu untersuchen, welche Einflussmöglichkeiten, Gestaltungsräume und Freiheiten die Autoren Mann und Adler bei der Schaffung dieser Texte und Sendungen hatten. Dazu sind vereinzelte Sendungen durchaus genauer in den Blick zu nehmen, nicht nur um exemplarisch die Arbeit der beiden Emigranten zu veranschaulichen, sondern vor allem auch um deren Inhalte den Direktiven gegenüberzustellen. Das Spannungsfeld zwischen eigener (politischer) Meinung und den Vorgaben der britischen Propaganda gilt es dabei ausführlich zu analysieren. Weiter liefern die Untersuchungen der ausgewählten Rundfunkprogramme auch die Möglichkeit die inhaltlichen Schwerpunktverschiebungen (den Wandel der PropagandaThemen) zu konstruieren und diese vor dem Hintergrund des strategischen Wandels der britischen Propagandabemühungen zu deuten. Partielle Vergleiche zwischen den zwei Akteuren Mann und Adler und ihren verschiedenen Formaten und Kommunikationsformen sind sinnvoll zu ziehen, jedoch stellen die Untersuchungen keinen vollumfänglichen und methodisch gewollten Vergleich der ausgewählten Sendeformate dar. Vielmehr soll eine dezidierte Gegenüberstellung der jeweiligen persönlichen Meinungen und der Vorgaben, Direktiven und Pläne der britischen Propagandamaschinerie dabei helfen, die Wirkungsmöglichkeiten und somit den Einfluss der deutschsprachigen Akteure herauszukristallisieren. Die beiden Kapitel, die sich Mann beziehungsweise Adler widmen, sollen durch eine intensive Quellenarbeit gespeist werden. Neben der Fokussierung auf die erhaltenden Sendebeiträge, wird das Heranziehen von Tagebucheinträgen und Briefen einen entscheidenden Beitrag leisten, um ein möglichst umfangreiches Bild über die Situation im Exil, die Rundfunkaktivitäten und die Partizipation im Widerstand der untersuchten Akteure zu erlangen. Somit wird auf der einen Seite durch die Rahmenbedingungen (Situation im Exil, Lebensumstände, biografischer Hintergrund, Strukturen der BBC, Arbeitsalltag etc.) und andererseits durch die Rundfunkbeiträge, die in gewisser Weise das Produkt der Arbeit darstellen, versucht, die Frage nach dem Einfluss der Emigrierten innerhalb des britischen Rundfunks und deren Rolle im antifaschistischen Widerstand hinreichend zu beantworten.
Die Auswahl des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann findet einerseits aufgrund seiner prominenten Stellung - sowohl seinerzeit als einer der bekanntesten Deutschen im Exil als auch die Prominenz seiner Rundfunkaktivität in der (kollektiven) Erinnerung - statt. Seine Rolle innerhalb der BBC gilt es daher genauer zu untersuchen, da durch den großen Bekanntheitsgrad eine gewisse Sonderbehandlung gegenüber Mann zu vermuten ist. Andererseits ist es besonders Mann, der in seinen Ansprachen an das deutsche Volk deutlich die zentralen Themen - Aufruf zum Widerstand, die Verbrechen der Nationalsozialisten, die deutsche Schuldfrage und das doppelte Deutschlandbild - fast schon redundant wirkend ansprach und so die ideale Voraussetzung liefert, um auch über existierende Kontroversen innerhalb der britischen Propaganda, allen voran die unterschiedlichen DeutschlandKonzeptionen im Exil[18], zu sprechen. Bruno Adler bildet mit seinen satirischen Radiosendungen das perfekte Äquivalent zu Thomas Mann. Er ist, wie der Großteil der deutschsprachigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im britischen Rundfunk, sowohl zu Lebzeiten als auch in der Rückbetrachtung eher unbekannt gewesen. Und dies, obwohl er langjährige Sendungen verantwortete, auch nach dem Zweiten Weltkrieg für den deutschsprachigen Dienst der BBC tätig gewesen ist18 und mit seinen Beiträgen ebenso eine deutsche Hörerschaft erreichte - mit einem anderen Stl aber mit den gleichen und zentralen Inhalten an jene appellierte. Adler steht gewissermaßen auch exemplarisch für die vielen Personen der gesichtslosen Rundfunkpropaganda Großbritanniens.
1.3 Quellenkorpus und Forschungsstand
Die Auswahl Adlers basiert zu Teilen auch auf der vorhandenen Quellenlage. Die Sendemanuskripte seiner Rundfunksendung „Frau Wernicke" sind überwiegend erhalten - im Gegensatz zu denen von „Kurt und Willi" - und bilden neben Thomas Manns „Deutsche Hörer!"-Skripten den zentralen Quellenkorpus meiner Arbeit. Im Falle Manns erweist sich die Berücksichtigung seiner Tagebücher, Briefe und politschen Essays als hilfreich und kontextualisierend. Zu Bruno Adler stehen vergleichbare Hinterlassenschaften leider nicht zur Verfügung, weshalb sich in dem entsprechenden Kapitel - wie auch im allgemein für diese Arbeit - umso mehr die umfangreiche und großartige Ausarbeitung Kristna Mooreheads19 als elementar herausstellt. Sie legt dabei ihren Fokus auf die Satresendungen der BBC (somit auch auf Adler) und die Propagandastrategien des britschen Rundfunks. Die Literatur über Thomas Mann kann mit Sicherheit als umfassend bezeichnet werden, wobei die Schwerpunktsetzung auf die Rundfunkaktvitäten des Literaturnobelpreisträgers eher seltener zu finden sind. Neben den zahlreichen allgemeineren Werken über Mann, soll an dieser Stelle besonders Sonja Valentns Buch „Steine in Hitlers Fenster"20, welches eine dezidierte Auseinandersetzung mit den „Deutsche Hörer!"- Sendungen liefert, erwähnt werden. Conrad Pütters Handbuch zum „Rundfunk gegen das ,Dritte Reich'"21, Matthias Wolbolds „Reden über Deutschland"22, Charmian Brinsons und Richard Doves „Working for the War Effort. German-Speaking Refugees in Britsh Propaganda During the Second World War"23, Kirk Robert Grahams „Britsh Subversive Propaganda During the Second World War.
Germany, National Socialism and the Political Warfare Executive"24 und Carl Brinitzers „Hier spricht London. Von einem der dabei war"25 gehören ebenfalls zum zentraleren Literaturkorpus meiner Arbeit. Brinitzer - selbst deutscher Emigrant und zunächst als Übersetzer und Sprecher, später als Redakteur und Leiter des Übersetzerteams und nach dem Krieg als Leiter der Programmabteilung des deutschen Dienstes der BBC tätig gewesen26 - verfasste zwar eine „seltsam anmutende Mischung aus Autobiographie und einer Geschichte des Propagandakrieges"27, der Wert einiger darin zu lesender Informationen ist dennoch groß. Anderseits kommen historische Verklärungen in seinem Werk nicht zu kurz, weshalb die kritische Betrachtung seiner Aussagen umso wichtiger ist.
2. Die British Broadcasting Corporation und die britische Rundfunkpropaganda
Als die British Broadcasting Corporation, kurz BBC, am 18. Oktober 1922 von einer Gruppe Elektrogerätehersteller in London gegründet wurde, fungierte sie noch als ein Privatunternehmen und ihr erster täglicher Radiodienst 2LO (die vom Postamt ausgestellte Sendelizenz) ging einen knappen Monat später auf Sendung.28 Dem Londoner Studio folgten zunächst unter der Führung des schottischen Managers John Reith schnell weitere in den größeren Städten, sodass die BBC bald im ganzen Land zu hören gewesen ist, ehe aus der Company im Jahr 1926 eine unabhängige und ausschließlich von Gebühren finanzierte Institution wurde.29 Diese Unabhängigkeit gegenüber der Wirtschaft und vor allem auch der Regierung wurde und wird durch die Royal Charter, einer offiziellen Satzung, die vom Staatsoberhaupt verliehen wird, garantiert. Sie zementierte die Geburtsstunde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und bildete die Grundlage für die große Anerkennung, Wertschätzung und das Vertrauen der Bevölkerung Großbritanniens.30 Die Royal Charter ist bis heute die verfassungsrechtliche Grundlage für die BBC und wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert.
Spätestens während des Zweiten Weltkrieges mutierte die BBC wohl zum relevantesten Kommunikationsmittel im In- und teilweise auch im Ausland, da sie nicht nur schneller als die Zeitungen informieren konnte, sondern vor allem, weil sie als seriöse Nachrichtenquelle galt. Kurz nach Ausbruch des Krieges strukturierte die BBC ihre verschiedenen Dienste neu. Dabei lassen sich drei große Gruppen unterscheiden: der Heimatdienst, der für das Programm in Großbritannien zuständig war, das Programm für die Soldaten im Einsatz und die Überseedienste, die sich regional weiter differenzierten.31 Der German Service, der Deutsche Dienst war eine von mehreren Fremdsprachenabteilungen innerhalb des Europa Dienstes und hatte die deutschsprachigen Sendebeiträge zu verantworten.32 Folgend soll nun auf diesen genauer eingegangen werden.
2.1 Hier spricht London - der deutschsprachige Dienst der BBC
Der erste Sendebeitrag in deutscher Sprache ertönte am 27. September 1938 und ließ die übersetzte Rede des britischen Premierministers Neville Chamberlain, welcher diese anlässlich der Sudetenkrise hielt, erklingen.33 Die BBC wurde von diesem Vorhaben durch die britische Regierung gänzlich überrascht und musste innerhalb weniger Stunden Übersetzer, Sprecher und eine prädestinierte und freie Frequenz finden, um die Rede zu senden.34 Für die Übersetzung zogen sie den österreichischen Journalisten Robert Lucas hinzu, welcher Chamberlains Rede in Echtzeit übersetzte, und holten Walter Goetz als Sprecher ins Studio. Goetz, ein in Deutschland geborener Karikaturist des Daily Express, hatte keinerlei Erfahrung mit dem Rundfunk, geschweige denn jemals vor einem Mikrofon gesessen.35 Wie viele Menschen im nationalsozialistischen Deutschland, die schließlich angesprochen werden sollten, diese nicht angekündigte und kurzfristige Sendung überhaupt gehört haben, kann nicht beantwortet werden - mehr als ein paar wenige Zufallshörer werden es jedoch kaum gewesen sein. Zudem war zur selben Zeit eine Rede Hitlers auf den deutschen Empfangsgeräten zu hören.36 Diejenigen, die diese „holprige[...] Übersetzung und stockende[...] Wiedergabe"37 zu hören bekamen, waren in der Lage „sich einen ziemlich klaren Begriff von der Konfusion [zu] machen, die im Senderaum des Londoner Funkhauses herrschte."[39] In England selbst sorgte die unangekündigte Sendung[40] sogar für Entsetzen, da nicht wenige zunächst wegen der deutschen Stimmen im Radio der Annahme verfielen, dass der Krieg bereits begonnen habe.[41] Die Zahl der Rezipientnnen und Rezipienten in Deutschland und die gelinde ausgedrückt dürftige Organisaton außeracht gelassen, bildete dieser erste deutschsprachige Sendebeitrag den Auftakt des Deutschen Dienstes der BBC. Ehe dieser ab dem 16. April 1939 als eigenständiger Dienst agierte, wurde jeden Tag eine in deutscher Sprache verfasste Nachrichtensendung von zehnminütger Dauer ausgestrahlt.[42] Schon zu Beginn hatte der Deutsche Dienst mit fünf Stunden und fünfzehn Minuten wöchentlicher Sendezeit ein umfangreiches Programm im Angebot, bei welchem die Nachrichtensendungen den elementarsten Bestandteil bildeten und durch feste Sendereihen sowie weitere spezielle Programme für einzelne Gruppen und Schichten ergänzt wurden.[43] Grundsätzlich war es jedoch das Ziel, die deutsche Bevölkerung als Ganzes anzusprechen - nicht wie etwa andere sogenannte Schwarzsender einen „Keil in die Bevölkerung zu treiben"[44] - und eine alternatve Informationsquelle neben der massiven Rundfunkpropaganda der Nationalsozialisten zu ermöglichen. In den ersten Monaten hielt sich die Attraktvität der Programmgestaltung in Grenzen. Steife und oft durch starke englische Akzente gezeichnete Nachrichtenvorträge ließen die Sendungen „lendenlahm, sogar langweilig"[45] wirken - besonders im Kontrast zur Propaganda Goebbels, welche viele Britnnen und Briten gar als „nachahmenswertes Muster"[46] betrachteten.
Wie die Schaffung eines Gegengewichtes zur nationalsozialistischen Propaganda im Äther erreicht werden sollte, war den britschen Verantwortlichen, die aus verschiedenen Ministerien (Außen-, Informatonsministerium und das Ministerium für Kriegswirtschaft) kamen, anfangs nicht klar.[47] Das im Februar 1939 geformte Department for Propaganda in Enemy Countries, meist als EH wegen seines Sitzes im Electra House bezeichnet, wurde in den folgenden Monaten wiederholt zwischen den Zuständigkeitsbereichen des Außenministeriums und des Informatonsministeriums transferiert, was zu einer teils desaströsen Organisaton führte. Explizit für die schwarzen Sender verantwortlich, folgte kurze Zeit später mit der Special Operatons Executve eine weitere Abteilung, welche dann wiederum in dem Verantwortungsbereich des Ministeriums für Kriegswirtschaft lag.[48] Diese defizitäre Organisation und Struktur, die einzelnen Akteurinnen zu mehr Gestaltungsfreiheiten verhalf, konnte erst im August 1941 durch die Etablierung der Political Warfare Executive, kurz PWE, mit Bruce Lockhart als Leiter und der vollständigen und alleinigen Verantwortung für alle Rundfunkaktivitäten im Ausland, beendet werden.38 Der Deutsche Dienst selbst musterte sich ebenfalls erst unter der Führung des ehemaligen Berlin-Korrespondenten des Daily Telegraph, Hugh Carlton Greene, der jedoch bereits ab Oktober 1940 Chefredakteur und Leiter des Deutschen Dienstes wurde, zu der alternativen und seriöseren Informationsquelle für alle, die der Propaganda des NS-Regimes misstrauisch oder gar feindlich gegenüberstanden.39 Unter Greenes Leitung wurden die Segmente News, Talks und Features etabliert, damit die Nachrichten erkennbarer von den Meinungen getrennt waren. Weiter sorgte er zügig - trotz der Amtsübernahme während der schwersten Zeit des Krieges für Großbritannien40 - für effizientere Arbeitsstrukturen, neue Programme und Produktionsformen, mehr Variation und den Anstieg der Sendezeiten.41 Während der Umstrukturierungen ertönten immer wieder auch kritische Stimmen aus den eigenen Reihen, die die Programme als „zu offensichtlich propagandistisch, melodramatisch und polemisch"42 bezeichneten. Der deutschsprachige Dienst der BBC stand von Anfang an unter der Kontrolle der Propagandaorgane und fungierte spätestens ab Ende 1940 als das Sprachrohr der britischen Regierung und deren Propagandainstitutionen, sodass sich sämtliche potenzielle Ambitionen der deutschen und britischen Mitarbeiterinnen hintenanstellen mussten. Eine Ausnahme verkörperte dabei Thomas Mann, worauf in einem späteren Kapitel eingegangen werden soll. Die durch die Royal Charter garantierte vermeintliche Unabhängigkeit der BBC war während des Zweiten Weltkrieges für den Deutschen Dienst nicht existent und es musste sich der Zensur (dazu bald mehr) und Kontrolle der Propagandaorgane gefügt werden, da der Auslandsdienst „abhängig von öffentlichen Geldern"43 gewesen ist.
Zu den anfänglichen organisatorischen Schwierigkeiten gesellten sich die technischen Herausforderungen hinzu. Im Deutschen Reich stand Ende der 1930er Jahre der Volksempfänger VE 30 144 in den meisten Haushalten. Der Volksempfänger, dem der Mythos anlastete, dass es unmöglich sei mit diesem die Feindsender zu hören, stellte für die Empfangbarkeit der BBC-Sendungen anfangs tatsächlich ein Problem dar. Die Programme des Deutschen Dienstes liefen ursprünglich auf Kurzwellen, über welche der Volksempfänger jedoch nicht verfügte.[56] Zunächst wurde versucht durch die Verbreitung von Flugblättern mit einer Anleitung zum laienhaften Umbau des Gerätes, um auch Kurzwellen zu empfangen, einer größeren Hörerschaft den Zugang zu ermöglichen.[57] Im Laufe der Zeit sendete der deutschsprachige Dienst dann seine Sendungen auch auf Mittel- und Langwellen. Dadurch dass die BBC ab 1941 Beiträge nicht nur auf mehreren Frequenzen, sondern auch auf allen drei Wellenlängen gleichzeitig ausstrahlte konnte eine Empfangbarkeit im ganzen Reich garantiert und den deutschen Störsendern bestmöglich entgangen werden.[58] Die Funkabwehr Nazi-Deutschlands war zudem durch die Menge an Feindsendern (Radio Moskau, Voice ofAmerica, zahlreiche Geheimsender etc.) und aufgrund mangelnder Kapazität und Personals nicht in der Lage, mittels „Jamming" (das durch die Störsender ausgelöste Rauschen), den Empfang der britischen Sendungen ausreichend zu unterbinden.
Die Stellung und das Ansehen der deutschsprachigen Mitarbeiterinnen innerhalb der BBC war lange gering und die Beteiligung begrenzte sich bis ins Frühjahr 1940 lediglich auf die Übersetzertätigkeiten, ehe dann auch für das Verlesen der Nachrichten teilweise deutsche Sprecherinnen eingesetzt wurden. Sie sollten dabei auf jeden Fall verhindern, dass die Hörerschaft eine etwaige politische Haltung oder emotionale Verbundenheit zu Deutschland vermuten hätte können, was, so die Angst der BBC- Verantwortlichen, zu einer Diskreditierung der so wichtigen Glaubwürdigkeit hätte führen können.[59] Allen voran der britischen Öffentlichkeit musste wiederholt versichert werden, dass die Emigrantinnen keinen „redaktionellen Einfluss [...] [hatten] und schon gar nicht Ausrichtung der Sendungen"[60] beeinflussten, obwohl deren umfangreiches Wissen, engagierte Arbeitsleistung und Sprachkompetenz unerlässlich für die Leistung der Propagandaorgane waren. Der spätere Generalsekretär der PWE, Bruce Lockhart, konstatierte dieses hoch ambivalente Verhältnis zwischen deutschsprachigen Emigrantinnen und den britischen Vorgesetzten mit dem Vergleich zu einem Schoßhund und dessen Herrchen.[61] Hauptgrund für diese, zumindest in den ersten Jahren, schwierige Beziehung war vor allem das fehlende Vertrauen vonseiten der ,Herrchen'. Nicht wenige Britinnen, so auch Führungskräfte bei der BBC, fürchteten sich lange vor der Gefahr, dass es sich bei den Emigrantinnen in Wirklichkeit um eine von den Nationalsozialisten eingeschleuste Gruppe von Agentinnen handele oder dass die Emigranten spätestens bei einer potentiellen Invasion der Wehrmacht, sofort bereitwillig mit dieser kollaborieren würden.[62] Diese Furcht, welche besonders durch die Medien und Politik weiter verstärkt wurde, mündete im Mai 1940 - kurz nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in den Niederlanden und in Belgien und nach der Ernennung Churchills zum Premierminister-sogar in einergroßangelegten Verhaftungswelle.45 Es ist daher keinesfalls schwer, sich vorzustellen, in welch angespannter Situation sich die deutschsprachigen Angestellten - wie auch allgemein die 70.000 ,enemy aliens' unter Generalverdacht in Großbritannien - befanden. Den wenigen Ausnahmen, Personen wie Carl Brinitzer oder Robert Lucas, die bereits länger dabei waren und ausreichend Vertrauen entgegengebracht bekamen, blieben jedoch ebenfalls jegliche Aufstiegschancen innerhalb der Rundfunkstrukturen - zumindest während des Krieges - verwehrt.46 Die anachronistisch anmutende Ernennung des deutschen Walter Rilla zum Chef der Feature-Abteilung im Herbst 1940 wurde ein knappes Jahr später korrigiert und Rilla, der offiziell den Anforderungen nicht gerecht wurde, durch den englischen Schauspieler Marius Goring ersetzt47, um die Kontrolle der Regierung über die Auslandssendungen der BBC zu stärken.
2.2 Propagandastrategien und Direktiven
Reorganisation der Strukturen und Direktiven während der Invasionsangst
Die britische Propaganda hatte in den ersten Kriegsmonaten aufgrund der eigenen organisatorischen Schwierigkeiten und vor allem wegen der militärischen Erfolge Deutschlands einen schwierigen Stand. Hitlers Autorität und Beliebtheit befand sich auf dem Höhepunkt und es existierte keine ernstzunehmende oppositionelle Bewegung innerhalb der deutschen Grenzen, sodass die Primärhoffnung der deutschsprachigen Exilanten, der Aufruf zum Widerstand mittels der Rundfunksendungen, überaus illusionistisch schien.48 In dieser Phase, in der innerhalb Großbritanniens durch die deutschen Eroberungen sich auch die Angst vor der Invasion ausbreitete, kam es bei der BBC zu entscheidenden Umstrukturierungen, die nicht zuletzt teilweise aus der Mentalität heraus entstanden, „dass es nichts mehr zu verlieren gab"49 und so beispielsweise auch die Entstehung neuer Sendeformate begünstigte. Was die Einflussnahme auf die Gestaltung der Rundfunkpropaganda angeht, spielte die Personalpolitik neben den richtungsweisenden Direktiven von oben und den Zensuren die größte Rolle. Erst die vielen personellen Veränderungen, die in erster Linie im Zuge der organisatorischen Umstrukturierungen oder aber auch nach Unstimmigkeiten untereinander zustande kamen, ermöglichten neue Ideen, Herangehensweisen und Sendeformate.50 Was den Begriff der Zensur angeht, bedarf es jedoch definitiv einer gewissen Entschärfung. Selbst während des Krieges herrschte in England keinerlei Vorzensur der Presse oder der BBC. Die dennoch existierende Zensurstelle hatte nicht die Aufgabe einer „Totalzensur der öffentlichen Meinung"51 und niemand in „der Presse oder im Rundfunk wurde zum Schreibautomaten degradiert"52. Stattdessen kann von einer Art freiwilligen Zensur gesprochen werden. Die Zensur fungierte demnach beinahe mehr als eine Art Beratung und Empfehlung durch die Zensurbehörde und handelte nur dann proaktiv, wenn zum Beispiel ein Redakteur oder ein Nachrichtenkommentator „wertvolle Informationen [...] [preisgab und so] gegen die Sicherheitsvorschriften verstieß."53 Die Einflussnahme fand somit weniger durch das Zensieren von Inhalten und Meinungen, sondern vielmehr durch die umfangreichen Vorgaben der Direktiven, deren Befolgung jedoch ebenfalls nur bedingt verpflichtend war, statt. Weitestgehend mittellose Exilant:innen im Dienste der BBC konnten sich dennoch kaum den Vorgaben verweigern, da sie beispielsweise um ihre Anstellung hätten fürchten müssen - dazu im Kapitel zu Bruno Adler mehr.
Die Macht- und Grabenkämpfe zwischen den verschiedenen Institutionen eskalierten nicht zuletzt auch immer wieder wegen der striffigen Frage bezüglich der Rolle der deutschsprachigen Emigrantinnen in der BBC.54 Zudem offenbarten die bei den personellen Wechseln immer wieder entstehenden Machtvakua den deutschen Mitarbeiterinnen die Chance, ihren Einfluss auszuweiten, die Kreativität zu entfalten, neue Aufgaben zu übernehmen oder sogar kurzzeitig Führungsämter zu bekleiden, wie zum Beispiel Walter Rilla. Durch die Non-Existenz einer klaren und einheitlichen Propagandastrategie blieben anfangs mehr Freiräume, welche dem zunehmenden Einfluss und der Kontrolle der Institutionenjedoch weichen mussten.
Den Einfluss der Propagandainstitutionen und deren Kontrolle lässt sich exemplarisch - mehr diesbezüglich in den späteren Kapiteln zu Mann und Adler - an der demonstrativen Trennung von der ,guten' Bevölkerung und der ,bösen' NS-Regierung, die in der experimentelleren Anfangsphase in allen Beiträgen deutlich zu vernehmen gewesen ist, dann aber im Frühjahr 1940 allmählich aus den Sendungen wich, verdeutlichen. Das EH verhing dafür sogar eine offizielle Regel, die den Gebrauch des Wortes Nazi gänzlich verbot.55 Dieser Wandel vollzog sich nicht zuletzt aufgrund der sich ändernden Sicht auf den Kriegsgegner Deutschland, die durch die intensiven Debatten rund um die Deutschlandpolitik und die Frage nach dem doppelten Deutschland geprägt wurde. Die von übergeordneter Stelle (beispielsweise vom EH) gegebenen Weisungen wie diese bezüglich der Verwendung des Wortes Nazi und der damit verbundenen Differenzierung zwischen Deutschen und Nationalsozialisten, waren der Beginn der sich mit der Zeit und im Zuge der sich professionalisierenden Strukturen etablierenden Direktiven, die beinahe einen institutionalisierten Charakter besaßen.
Regierungswechsel, Streit um Kompetenzen und ,schwarze' und ,weiße' Propaganda
Der Regierungswechsel von Chamberlain zu Churchill - welcher ein Wechsel von der erfolgslosen Appeasement Politik hin zu einer aggressiveren Linie war - verdeutlichte sich erkennbar in der Ausrichtung, Organisation und verbalisierten Aggressivität der Propaganda. Churchill trug maßgeblich zur Gründung der Dachorganisation Special Operations Executive (SOE), die offiziell unter dem Deckmantel der Political Intelligence Departments (PID) arbeitete und für die schwarze Propaganda und die Unterstützung aller antideutschen Bewegungen zuständig war, im Mai 1940 bei.56 Das Department for Propaganda in Enemy Countries (EH) existierte jedoch faktisch immer noch und war als Abteilung für die weiße Propaganda im Informationsministerium (Mol) verblieben57, was in erwartbaren Streitigkeiten über die Kontrolle in der Deutschland-Propaganda zwischen SOE und Mol mündete. Die offene oder auch ,weiße' Propaganda, zu der auch beispielsweise der deutsche Dienst der BBC gehörte, und die geheime oder ,schwarze' Propaganda, die ihren britischen Ursprung verbarg und von der Regierung verleugnet wurde, sind erst nach der Etablierung der Political Warfare Executive (PWE) von ein und derselben Organisation koordiniert und verantwortet gewesen. Im Bereich der ,schwarzen' Propaganda richtete die PWE mehr als vierzig eigene geheime Radiosender ein und sorgte für eine rege Verbreitung von gedruckter Propaganda wie Flugblättern.58 Die Inhalte der Rundfunksendungen der BBC und somit auch des deutschen Dienstes unterstanden der Kontrolle des MoI, die Art und Weise der Auffiereitung und der Vermittlung hingegen konnte frei gestaltet werden. Die Unstimmigkeiten, die „Diskrepanz zwischen Anspruch und Erwartung auf beiden Seiten"59 und die teils inkonsequente Befolgung der Direktiven lösten sich erst durch die Übernahme der PWE.
Formierung der PWE und rationalere Direktiven
Die PWE, die ab August 1941 agierte, brachte durch ihre umfassende Kontrolle eine gewisse Konstanz in die Propagandaarbeit. Sie arbeitete als geheime Abteilung des Foreign Office, getarnt unter dem Deckmantel des offiziellen Political Intelligence Departement (PID).60 Das PID selbst war eine Abteilung des Foreign Office, die zu Kriegsbeginn geschaffen wurde, damit das britische Außenministerium seine Rolle im Bereich der Nachrichtendienste ausbauen konnte.61 Hauptaufgabe der PWE war es, dass die unterschiedlichen Gruppen des BBC-Europa-Dienstes, die Flugblätter und auch zu Teilen der BBC- Heimatdienst den selben Schwerpunkten folgten.62 Inhaltlich galt es einerseits die Unterstützung für den Krieg gegen Nazi-Deutschland in der eigenen Bevölkerung zu erhalten und anderseits eben jene Kriegsunterstützung auf Seiten der Anhänger des nationalsozialistischen Regimes zu mindern und möglicherweise sogar in Sympathien für die Sache der Alliierten zu transferieren.63 Der Fokus lag dabei auf der Adressierung der breiten Masse und nicht auf Einzelpersonen oder der deutschen Führungsriege. Nicht nur die britische Öffentlichkeit, sondern auch Parlaments- und sogar Regierungsmitglieder hattenjedoch erhebliche Schwierigkeiten sich ein konkretes Bild über die Arbeit der PWE zu verschaffen, was nicht zuletzt auch an der mangelnden Differenzierung zwischen Nachrichten, Propaganda und politischer Kriegsführung lag.64 Die PWE ist eine große aber vor allem überaus diffuse Organisation gewesen, was mit Sicherheit ein Produkt ihrer Funktion und des historischen Kontextes war.65 Das Mittel der Einflussnahme und Kontrolle waren die Direktiven, welche das „Spiegelbild der offiziellen britischen Deutschlandpolitik"66 symbolisierten. Wöchentlich erhielt der deutschsprachige Dienst eine neue Direktive, die vom Leiter der deutschen Abteilung der PWE, Richard Crossman, verfasst wurde. Der Direktive waren nicht nur die zu behandelnden Themen zu entnehmen, sondern im Regelfall auch die Art und Weise, wie diese verarbeitet werden sollten.67 Wie frei unter solchen Vorgaben noch gearbeitet werden konnte, soll sich bei der genaueren Untersuchung der Arbeit und des Einflusses Manns und Adlers zeigen. Crossman und seine Abteilung gestalteten ihre Richtlinien basierend auf aktuellen Informationen des eigenen Nachrichtendienstes und der neuesten Berichte in der deutschen Presse und aus dem deutschen Rundfunk.68 Diese Informationen bildeten den Lageüberblick am Anfang jeder Direktive, ehe die ausführlichen Handlungshinweise folgten.69 Die Vorgaben beschränkten sich nicht nur auf die Nachrichten, sondern ganz besonders galt die aufmerksame Kontrolle den vom Deutschen Dienst produzierten Features. Diese waren ein wichtiger Teil der psychologischen Kriegsführung der PWE und nichts anderes als Rundfunkpropaganda. Dabei ging es in erster Linie darum, die Behauptungen der Nazi-Propaganda oft mit Satire ins Lächerliche zu ziehen, um die deutsche Moral in der Heimat und auch an der Kriegsfront zu untergraben. Die Sendungen mussten kurz sein, damit der wesentliche Inhalt schnell und verständlich der Hörerschaft vermittelt werden konnte und den deutschen Störversuchen aus dem Weg gegangen werden konnte.70
Es blieb somit keine Zeit für eine ausgefeilte Handlung oder Charakterisierung der handelnden Figuren, vielmehr durfte nur eine kleine und direkt erkennbare Zahl an Charakteren agieren. Diese Leitprinzipien lassen sich am besten anhand der Rundfunksendungen „Kurt und Willi" und „Frau Wernicke" von Bruno Adler, veranschaulichen.
Die Kontrolle der PWE führte in der zweiten Jahreshälfte 1941 zu einer Mäßigung der Direktiven und gewissermaßen zu einem Rationalisierungsprozess. Dieser rationale Ansatz distanzierte sich von dem zuvor bevorzugten individualisierten Ansatz, der sich weniger durch komplexe Sachverhalte, als vielmehr durch den „emotionalen Zugang und den Appell an die moralischen Werte"71 charakterisierte. Zwangsläufig brachte dieser auch die Verwendung einiger Vorgehensweisen und Techniken der NS- Propaganda mit sich. Mit der rationaleren Herangehensweise, die keinesfalls völlig ohne Emotionen auskam, sollte hingegen vor allem eines garantiert werden: die Glaubwürdigkeit der BBC. Der Stellenwert der Wahrheit war für die BBC und ihr Wirken außerordentlich hoch. Häufig wird dabei von der Strategie der Wahrheit gesprochen.72 Am besten wurde diese durch die weiße Propaganda der BBC und deren europäischen Diensten, die immer ihre Identität offenlegten und sogar betonten, vertreten. Auch wenn sich erkennbar um das stetige Vermitteln der Wahrheit, auch wenn diese schmerzhaft war, bemüht wurde, muss dennoch konstatiert werden, dass es sich nicht immer um die ganze Wahrheit handelte.73
Der thematische Schwerpunkt während der Rationalisierungsphase der Direktiven und der Propagandabemühungen lag auf der „Zermürbung und Kriegsmüdigkeit der Deutschen in einem lange andauernden Krieg"74 und Klarstellung, dass die Schuld am Leid der deutschen Bevölkerung in der Heimat und der Soldaten an den Fronten Hitler selbst zuzuschreiben wäre. Das in den Direktiven formulierte Motto ,Go Slow' sollte der deutschen Hörerschaft vermittelt werden und diese zu „dezent subversivem Verhalten und verstecktem Handeln"75 animieren.
Wandel der Direktiven bis Kriegsende
Mit den sich häufenden militärischen Misserfolgen der deutschen Truppen wie beispielsweise in Stalingrad und der Verschiebung der Machtverhältnisse während des Zweiten Weltkrieges zu Gunsten der Alliierten, vollzog sich auch bei den Direktiven ein gewisser Wandel. Grundsätzlich ließ sich die Macht der Alliierten immer besser aufzeigen. Die inhaltliche Ausrichtung der Rundfunkpropaganda wurde spürbar stringenter und fokussierte sich nur noch auf wenige Schwerpunkte, welche dafür umso intensiver und genreübergreifend vermittelt werden sollten.76 Das allmählich steigende Selbstbewusstsein und die stetig steigende Gewissheit, dass der Sieg der Alliierten unausweichlich sei, bestimmten in den letzten beiden Kriegsjahren die inhaltliche Orientierung. Einerseits musste der NS- Propaganda vehement entgegengehalten und das Interesse am „relativen Wohlergehen der deutschen Bevölkerung"77 betont werden, andererseits aber auch die klare Linie der Politik ohne Zugeständnisse vertreten werden. Die zentrale Botschaft sollte die Unausweichlichkeit der deutschen Niederlage sein. Ein schneller Friede sei also im Interesse der Deutschen gewesen und es wurde versucht, durch die Übertragung der Verantwortung des eigenen Schicksals auf die Deutschen, eben diesen herbeizuführen78 - ohne jedoch aktiv zur Revolution aufgerufen zu haben. Da der flächendeckende Widerstand der Bevölkerung ausblieb, musste die grundsätzliche Ausrichtung der Direktiven in der Endphase des Krieges noch einmal variiert werden. Die Direktiven zur Schadensbegrenzung, wie die der letzten Kriegsmonate genannt werden können, sind durch eine „aggressive, fordernde Attitüde"79, wobei nun doch aktiv zum Widerstand und zur Sabotage gegen das NS-Regime und zur Kooperation mit den vorrückenden alliierten Truppen aufgerufen wurde, gekennzeichnet gewesen. Die Rundfunkbeiträge sollten dabei helfen, die alliierte Autorität zu etablieren und sukzessive mit der Umerziehung der Deutschen und der Bewusstseinsschaffung der deutschen Kriegsschuld beginnen.80
Ehe nun in den folgenden Kapiteln auf die Arbeit, das Wirken und die Einflussmöglichkeiten der ausgewählten Emigranten Thomas Mann und Bruno Adler eingegangen wird, sollen die bisherigen Erkenntnisse kurz konstatiert werden. Die anfängliche desaströse Organisation der britischen Rundfunkpropaganda insgesamt und auch des deutschsprachigen Dienstes der BBC hatte diverse Gründe. Die Verantwortlichen der Regierung, der Propagandaorgane und der BBC waren sich einig, was das Ziel, die Schaffung eines vertrauenswürdigen Gegengewichtes zur NS-Propaganda, anging, jedoch mangelte es zunächst an einer klaren Strategie. Personelle Wechsel, defizitäre Strukturen, technische Herausforderungen und vor allem die wechselnden Kompetenzen gestalteten die Rundfunkpropaganda zu Beginn komplex. Endgültig gelöst werden konnten alle Probleme erst durch die Etablierung der PWE, die durch ihre umfassende Kontrolle dafür sorgte, dass die verschiedenen Rundfunkdienste und untergeordneten Propagandaorgane denselben Schwerpunkten folgten und einheitlicher agierten. Die PWE brachte Konstanz in die Propagandaarbeit, blieb für Außenstehende jedoch eine diffuse und undurchsichtige Organisation. Der BBC selbst gelang unter der Leitung Greenes eine erfolgreiche Umstrukturierung, Professionalisierung und effizientere Arbeit. Die eigentlich durch die Royal Charter garantierte Unabhängigkeit der BBC von der Regierung war während des Zweiten Weltkrieges faktisch nicht vorhanden. Der Einfluss der Propagandaorgane - spätestens nach Gründung der PWE im Spätsommer 1941 - durch (freiwillige Selbst-) Zensur und Kontrolle gestaltete sich umfassend. Das Mittel der Einflussnahme bildeten dabei neben entscheidenden Personalbesetzungen die Direktiven, welche nicht nur die zu behandelnden Themen, sondern auch die Umsetzung, Auftereitung und Gestaltung dieser (unterschiedlich explizit) vorgaben. Der Verlauf des Krieges zeigte sich in den sich wandelnden Schwerpunkten und Ausrichtungen der Direktiven, die auch immer als Spiegelbild der britischen Deutschlandpolitik fungierten. Der anfangs stark emotionalisierte Ansatz, der von militärischen Erfolgen Deutschlands und der britischen Angst vor einer deutschen Invasion bestimmt wurde, wich einer rationaleren Herangehensweise, welche sich besser eignete, um der Strategie der Wahrheit' in der Rundfunkpropaganda gerecht zu werden. Das sich wendende Machtverhältnis während des Krieges und das steigende Selbstvertrauen der Alliierten führte zu immer stringenteren Methoden und weniger Schwerpunkten, die dafür umso intensiver verfolgt werden sollten. Während das Ziel, welches heruntergebrochen das Herbeiführen eines schnelleren Kriegsendes und einer deutschen Niederlage war, stetig gleichblieb, veränderte sich die Vorgehensweise und die Art und Weise, wie versucht werden sollte, die deutsche Hörerschaft zu erreichen, kontinuierlich je nach Kriegslage.
Die deutschsprachigen Emigrantinnen und Emigranten, die bei der BBC arbeiteten, befanden sich wie auch alle übrigen Emigrierten in Großbritannien ohnehin in einer angespannten Situation. Die ,enemy aliens' mussten sich innerhalb des britischen Rundfunks mit geringen Stellungen zufriedengeben. Die Einsatzbereiche weiteten sich zwar sukzessive aus, doch ernsthafte Aufstiegschancen blieben während des Zweiten Weltkrieges eine Illusion - die wenigen Ausnahmen, wie beispielsweise die Walter Rillas, bestätigten die Regel und sind zudem alles andere als langfristige Erfolgsgeschichten gewesen. Die Beziehung zwischen den Emigranten und ihren britischen Vorgesetzten, die als sehr ambivalent bezeichnet werden kann, und das im Laufe der Zeit wachsende gegenseitige Vertrauen führten dazu, dass einige Angestellte immer mehr Kompetenzen und Verantwortung erhielten. Wann immer, sei es durch die Machtkämpfe der verschiedenen Propagandaorgane oder durch Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb der Sender und Abteilungen, es zu einem temporären Machtvakuum kam, wuchsen die Freiräume für einzelne Mitarbeiterinnen. Freiheiten und Vertrauen konnten jedoch immer nur bis zu einem gewissen Grad steigen, denn die zunehmende Kontrolle durch die Direktiven beanspruchte diesen Raum. Wie diese Gestaltungsfreiräume, Einflussmöglichkeiten und die Auseinandersetzung mit den sich verfestigenden Kontrollinstanzen und deren Vorgaben im Detail aussahen, soll nun in den folgenden beiden Kapitel genauer erläutert werden.
3. Thomas Mann
„Es ist die Stimme eines Freundes, eine deutsche Stimme; die Stimme eines Deutschlands, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte und wieder zeigen wird als die scheußliche Medusen-Maske, die der Hitlerismus ihm aufgeprägt hat." "
Mit diesen einleitenden Worten wandte sich Thomas Mann im März 1941 das erste Mal mittels seiner eigenen Stimme im Rahmen seiner Rundfunksendung „Deutsche Hörer!" an die deutsche Hörerschaft. Die darin zu hörenden Texte verantwortete Mann bereits seit Oktober des Vorjahres. Er sah sich als Deutscher dazu verpflichtet, das Volk „zu warnen"81 82, es in seinen „schlimmen Ahnungen [zu] bestärken"83 und zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus aufzurufen.
Thomas Mann, einer der prägendsten und bekanntesten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, war für viele Menschen der Inbegriff deutscher Kultur. Er selbst sah - und gefiel - sich ebenfalls in der Rolle des Repräsentanten der deutschen (bürgerlichen) Kultur. Mann postulierte schon früh die heraufziehende Gefahr des Nationalsozialismus und kann aufgrund seiner zahlreichen Äußerungen84 gegen das 1933 an die Macht gekommene NS-Regime als früher Gegner der Nationalsozialisten bezeichnet werden. Seine „sorgsam gepflegte Aura der Autorität und Würde"85 prädestinierten ihn für diese Rolle als starker Akteur und als Gegenspieler Hitlers. Er war von Beginn an „kein Freund der deutschen Machthaber"86, was seine frühe Emigration in die Schweiz 1933 und fünf Jahre später nach Amerika verdeutlichte. Seine Ausbürgerung im Jahr 1936 durch die NSDAP-Regierung war für ihn sinnfrei und bedeutungslos87, da er „in deutschem Leben und deutscher Überlieferung tiefer wurzele als die flüchtigen [...] Erscheinungen, die zur Zeit Deutschland regieren."88 Er registrierte schon verhältnismäßig zeitnah, dass die Nationalsozialisten dabei waren einen gewaltigen Krieg vorzubereiten.89 Das Deutschlandbild Thomas Manns erfuhr in der Zeit des Nationalsozialismus eine negative Wandlung, die sich auch in der Nachkriegszeit durch die große Kontroverse mit den Vertretern der sogenannten ,Inneren Emigration' nicht mehr erholte. Der Autor, der sich einst als unpolitisch bezeichnete, wandelte sich ab den 1930er Jahren zu einem politisch denkenden und handelnden Schriftsteller seiner Zeit, der stets versuchte, seinen Einfluss geltend zu machen. Die Waffe seiner Wahl für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus waren - wie sollte es auch anders sein - die Worte.
3.1 Zusammenarbeit mit der BBC
Im Herbst 1940 trat die BBC an Thomas Mann mit dem Wunsch heran, in regelmäßigen Abständen kurze Rundfunkansprachen an das deutsche Publikum zu richten.90 Neben dem deutschen Literaturnobelpreisträger fanden sich auf der Wunschliste der BBC unter anderem auch die Namen Greta Garbo, Marlene Dietrich und Albert Einstein wieder.91 Sie alle sind deutschsprachige Einwohner der USA, einer breiten Masse bekannt und grundsätzlich nicht abgeneigt, im Deutschen Dienst der BBC zu sprechen, gewesen.92 Ziel war es, eine deutschsprachige Persönlichkeit, die in einem „regelmäßig ausgestrahlten Nachrichtenkommentar über amerikanische Angelegenheiten [...] und aktuelle amerikanische Verhältnisse"93 berichten sollte, zu akquirieren. Weiter ging es, wie Thomas Mann später selbst erläuterte, auch darum, die „Kriegsereignisse [zu] kommentieren und eine Einwirkung auf das deutsche Publikum"94, wenn möglich mit dem Ziel, sie gegen die nationalsozialistische Regierung aufzubringen. Neben den oben genannten Voraussetzungen sollte der neue Nachrichtenkommentar von einer Person mit gutem Urteilsvermögen, hoher Glaubwürdigkeit und umfassendem Wissen bezüglich des politischen Weltgeschehens verfasst werden.95 Die Wahl fiel schlussendlich auf Mann, der die gewünschten Kriterien erfüllte, als Inbegriff deutscher Kultur galt und von den Verantwortlichen im Deutschen Dienst der BBC für „besonders geeignet, im Dienste der britischen Propaganda über ,American opinion' zu berichten"96 gehalten wurde. Nach einem erfolgreichen Treffen beider Seiten Mitte Oktober 1940 in New York und einer als perfekt geeignet befundenden Probeansprache Manns, konnte die langjährige Zusammenarbeit zwischen dem Schriftsteller und dem britischen Rundfunk beginnen. Weshalb sich die BBC für den „greatest living men of letters"97 entschied, ist somit ausreichend geklärt. Was Mann jedoch zu der Zusammenarbeit trieb - neben der Empfehlung seiner Tochter Erika - gilt es im Folgenden ebenso wie seine Einflussmöglichkeiten herauszuarbeiten.
Thomas Manns Rundfunksendung „Deutsche Hörer!", die von Oktober 1940 bis November 1945 - mit einer Unterbrechung zwischen Mai 1944 und Januar 1945 - jeden Monat ausgestrahlt wurde, ist als Teil der britischen Rundfunkpropaganda zu betrachten. Mann hat seine Sendung nicht selbst erfunden und hätte sie auch nicht ohne die ihn umfassenden Strukturen verwirklichen können. Seine insgesamt 58 Rundfunkansprachen und viel mehr Mann selbst sind ein essenzieller Bestandteil der Propaganda der britischen Regierung während des Zweiten Weltkriegs gewesen, welche in den vorangegangenen Kapiteln näher erläutert wurden. Mann stand unter der Kontrolle des Deutschen Dienstes, der anfangs dem EH und später der PWE unterstellt war.98 Die nicht zuletzt auch durch die Kontrolle bedingten Unstimmigkeiten und Spannungen zwischen Schriftsteller und BBC sind im Laufe des Kapitels noch zu skizzieren. Im Grunde aber teilten beide Seiten weitgehend affine Absichten. Das erleichterte Mann die Zusammenarbeit.
Der sich selbst als Repräsentant der deutschen Kultur betrachtende Autor hatte durch die Zusammenarbeit eine hervorragende Möglichkeit, sich politisch zu positionieren und den Kampf gegen den Faschismus in Deutschland auf seine Art und Weise zu unterstützen.99 Seine schriftstellerische Tätigkeit wandte sich während seiner Zeit in den USA ohnehin bereits stark ins Politische, was seine etwa 300 Essays, Reden und Artikel belegen.100 Mann verstand die Rundfunkansprachen nicht als Teil seines künstlerischen, literarischen Schaffens, weshalb er auch seine Gage von der BBC direkt dem British War Relief Fund überweisen ließ101, sondern fasste seine Arbeit als Beitrag des Widerstands gegen den Nationalsozialismus und als Part des politischen Eingreifens der Alliierten auf.102 Durch die Rundfunkansprachen war es Mann zudem jedoch möglich, den Kontakt zu seiner deutschen Leserschaft wieder aufzunehmen - zumindest zu Teilen. Dem gebürtigen Lübecker offenbarte sich so folglich die Chance, seinen seit der Flucht aus Deutschland gehegten Wunsch, mit deutscher Sprache seine Gedanken zum Ausdruck zu bringen, nachzugehen.103 Die zentralen Themen gaben die Direktiven jedoch bereits vor. Einige dieser, wie das Bild des doppelten Deutschlands, den Aufruf zum Widerstand oder auch die Schuldfrage, sollen in diesem Kapitel noch genauer untersucht werden. Neben den zentralen inhaltlichen Schwerpunkten, die genauso wie die von den Nazis verübten Verbrechen redundant thematisiert wurden, ertönen in seinen Radioansprachen auch immer wieder persönliche Motive Manns. Dazu gehören etwa die gelegentlichen literarischen Anekdoten über die Großen seiner Zunft, vor allem Schiller und Goethe, oder die polemische und diffamierende Sprache gegenüber Adolf Hitler und seinen Anhängern.104 Regelmäßig nutzte Mann die Dämonisierung des „bösen Kettenhundes"105 Hitlers in seinen Sendungen und war stetig darum bemüht diesen als Lügner darzustellen. Die diffamierenden sprachlichen Auswüchse, die nicht zu den Direktiven passten und bekanntermaßen nicht der übliche Stil des Schriftstellers waren, verdeutlichen einmal mehr, wie persönlich und emotional Mann diese Ansprachen an das deutsche Volk verfasste. Die „abstoßendste Figur [...] der Geschichte"106 habe jeden Realitätsbezug verloren und sei als Herrscher eines Landes von Anfang an schon nicht tragbar, da er politisch, militärisch und kulturell völlig unfähig sei, gewesen.107 Die animalischen Tiermetaphoriken, mit denen Thomas Mann das „Monstrum"108 Adolf Hitler häufig charakterisierte, sollten aufzeigen, wie defekt dessen Menschlichkeit war. Ironische Bemerkungen über den „österreichischen Schmierenkomödianten"109 wie auch über andere führende Personen des „Hitler-Gesindel"110, das die „blutige wie alberne Travestie der Macht"111 sei, bestehend aus „apokalyptischen Lausbuben"112, „Narren"113, „Nachtgaunern"114 und „Staatsschurken"115 tauchten in den Reden ebenfalls auf. Namentlich sind es neben Hitler besonders Goebbels, das „weit aufgesperrte Lügenmaul"116, und der „fette[...], putzsüchtige[...] Groß-, Erz- und Reichsmarschall"117 Göring, die Mann ins Visier nahm. Innerhalb der BBC herrschte teilweise Entsetzen aufgrund der verbalen Attacken und der verwendeten Worte. Wiederholt erhielt Mann Anweisungen, sich bei seiner Wortwahl zu mäßigen.118 Er versprach gegenüber der BBC künftige Besserung, doch zu hören war die Fortführung des Diffamierung- und Verbalinjurien-Stils.119 Mit vulgären Ausdrücken war Thomas Mann allerdings nicht allein. Der Kommentator Sefton Delmer, der am 19. Juli 1940 Dienst hatte und auf Hitlers Rede, die seine Friedensofferte - den ,Verständigungsfrieden' - an England beinhaltete, reagieren musste, wies Hitlers Angebot derbe zurück und warf ihm seinen vermeintlichen Appell in seine „übelriechende Führerfresse"120 zurück. Mann ist wohl jedoch der Einzige gewesen, der diesen Stil über Jahre entgegen der Kritik durchziehen konnte.
Bei der Gestaltung seiner Radioansprachen wurden Mann verhältnismäßig entweder von vornherein viele Freiheiten gelassen oder aber er setzte sich über die Kritik, Anweisungen oder Vorschläge, wie bereits am Beispiel der sprachlichen Gestaltung verdeutlicht, schlicht hinweg. Konsequenzen trug ein solches Verhalten keine nach sich. Der redaktionelle Einfluss der im Rundfunk agierenden emigrierten Personen, welcher gegenüber der britischen Öffentlichkeit immer heruntergespielt werden musste, gestaltete sich bei dem weltbekannten Autor wohl am umfangreichsten. Das grobe Konzept der Sendung, welches Mann vor Beginn seiner Arbeit klar kommuniziert wurde, war vorgegeben und auch nicht verhandelbar. Dasselbe galt eigentlich für die verfügbare Sendezeit und die damit einhergehende zeitliche Begrenzung der Ansprachen. Mit der Akzeptanz dieser hatte Mann kontinuierlich Schwierigkeiten, sodass es wiederholt zu internen Bemerkungen und auch zu kritischen Kommentaren gegenüber Thomas Mann kam.121 Oft sah dieser sich gezwungen seine Texte „bis zur Dürftigkeit"122 streichen zu müssen. Der Deutsche Dienst hatte feste Programmstrukturen und räumte der „Deutsche Hörer!"-Sendung anfangs fünf, später acht Minuten innerhalb eines Sendeblocks ein. Bereits eine Überschreitung von mehr als 30 Sekunden führte zu gravierenden Schwierigkeiten in der Sendestruktur, weshalb es zu Manns Leidwesen keinerlei Kompromisse gab.123 Diese Restriktionen, denen er sich fügen musste, beeinflussten folgend auch erkennbar die sprachliche und mit Abstrichen auch die inhaltliche Konzeption der Ansprachen. Thomas Mann musste kurz und kompakt seine Botschaften vermitteln und journalistischer und weniger poetisch formulieren. Dennoch können seine Rundfunksendungen keinesfalls mit den Produkten genuiner Journalisten verglichen werden, da seine sprachlichen Gestaltungen und sein persönlicher Stil trotz der Einschränkungen und Anpassungen immer noch deutlich zu erkennen gewesen sind.124 Die Verlängerung seiner Sendezeit auf acht statt der ursprünglichen fünf Minuten war der wiederholt vorgetragene Wunsch Manns, dem vonseiten der BBC schließlich auch - ohne große Begeisterung - nachgegeben wurde.125 Da sich die Sendezeit des Deutschen Dienstes der BBC durch die wachsende Zahl an Formaten und Programmen zunehmend ausdehnte, ist die zur Verfügung gestellte dreiminütige Verlängerung der „Deutsche Hörer!" Sendung jedoch wohl kein allzu großes Problem gewesen. Thomas Mann nutzte seine privilegierte Stellung und sein hohes Ansehen gewinnbringend aus, um seine Ziele und Wünsche umzusetzen. Doch auch acht Minuten blieben für den Autor, dessen Stärke und Talent mit Sicherheit nicht das Erzählen in prägnanter
Kürze gewesen ist, eine knappe Zeitspanne. Außerdem wurden die regelmäßigen Rundfunkansprachen an sich von Thomas Mann teilweise als Belastung empfunden, obwohl sie im Gegensatz zu vielen anderen Formaten nur monatlich und nicht wöchentlich ausgestrahlt wurden. Anfang 1943 schilderte er gegenüber seiner Mäzenin Agnes E. Meyer dazu in einem Brief, dass er sich unter Druck gesetzt fühle, und in seinem Tagebuch hielt Mann beispielsweise Aussagen wie „Plage mit der 10 Jahre- Message"126 fest. Verglichen mit den existentiellen Nöten der meisten anderen für die BBC arbeitenden Emigrantinnen und Emigranten (siehe Kapitel zu Adler) erscheint Manns empfundener Stress eher lapidar.
Das der BBC so vielbedeutende Wahrheitsgebot wusste Thomas Mann gelegentlich ebenfalls zu missachten. So behauptete er bereits neun Monate, bevor die USA offiziell in den Krieg eingetreten waren, dass sie sich bereits im Krieg mit dem nationalsozialistischen Deutschland befänden.127 Mit dieser falschen Verkündung wollte er den Gegner einschüchtern, seine deutsche Hörerschaft demoralisieren und dieser vor allem klar machen, wie aussichtslos ihre Lage aufgrund der alliierten Übermacht war. Die britischen Verantwortlichen der Propagandaorgane (zu diesem Zeitpunkt noch das EH) sahen über diese ,Notlüge' Manns jedoch hinweg.128 Der Zweck heiligte in diesem Fall wohl die Mittel, was trotz des hohen Stellenwertes der Strategie der Wahrheit bei Weiten keine Seltenheit darstellte, wie auch bereits im zweiten Kapitel thematisiert wurde. Thomas Mann folgte bei dieser Behauptung nicht den jeweiligen aktuellen Direktiven, sondern seiner eigenen Intention. Zu einem harten Eingreifen durch die BBC oder der PWE kam es jedoch wohl nie. Es wäre wohl anzunehmen, dass Thomas Mann eine (nachträgliche) Zensur in sein Schaffen mit Sicherheit negativ aufgefasst hätte und in seinem Tagebuch oder aber auch in seinem intensiven Briefwechsel mit Agnes E. Meyer festgehalten hätte. Seine „allzu offen zur Schau getragene Amerika- und Englandfreundlichkeit"129 gestalteten sich hierbei vermutlich als hilfreich. Das Fehlen kritischer Töne über Amerika oder England in den Reden ist nicht daraufzurückzuführen, dass es keine negativen Themen gegeben hätte, die Mann beschäftigten. Zu nennen ist hier sicherlich die Behandlung der Emigrantinnen als ,enemy aliens' in beiden Länder. Um das positive Bild der Alliierten, welches die Propaganda schließlich zu schaffen versuchte, nicht zu beschädigen und der nationalsozialistischen Presse keine Möglichkeit zur „polemischen Berichterstattung"130 zu servieren, verzichtet der Autor auf negative Äußerungen in seinen Sendungen.
3.2 Das andere Deutschland
„It [the exile] is hard to bear, but what makes it easier is the realization of the poisoned atmosphere in Germany. That makes it easier because it's actually no loss. Where I am, there is Germany. I carry my German culture in me. I have contact with the world and i do not consider myselffallen."[131]
Wo ¡ch bin, ¡st Deutschland. Neben dem durch solche Aussagen unschwer zu erkennendem Selbstvertrauen Thomas Manns132 steht diese, wie unzählige andere Bemerkungen in seinen Reden, Essays, Rundfunksendungen oder Briefen für sein ambivalentes Deutschlandbild und exemplarisch für seinen Widerstand gegen den Nationalsozialismus.133 Das ,gute' Deutschland, in der Exilpresse und Exilliteratur oft als das ,andere Deutschland' tituliert, galt es für Mann und die allermeisten deutschen Emigrantinnen hoch- und dem ,bösen', dem Nazi-Deutschland, entgegenzuhalten. Den Begriff des ,anderen Deutschland' selbst vermied er in seinen Reden an die deutsche Hörerschaft jedoch, da er kein entschiedener Verfechter dieser Idee, aber auch auf keinen Fall ein Gegner dieser war.134 Die Wandlung des ursprünglich ,guten' Deutschlands hin zum ,bösen' Nazi-Deutschland, die Entstehung des Dritten Reiches und die historische Entwicklung des Deutschtums, hat Thomas Mann intensiv in seiner Library of Congress-Rede „Deutschland und die Deutschen" behandelt.135 Die plakative Darstellung und Trennung in ,gut' und ,böse' nutzte er zur Vereinfachung und gleichzeitig diente es auch der Zuspitzung. Mann, der „Kaiser aller deutschen Emigranten, ganz besonders Schutzherr des Stamms der Schriftsteller"136 beanspruchte die Rolle der personifizierten deutschen Kultur und war anderseits jedoch nicht dazu bereit, politische Aktionen der Anhänger des „anderen Deutschlands" zu unterstützen. Für ihn war dieses in keinen Fall als ein „politisches Projekt denkbar"137, sondern nur eine „historisch-kulturelle Tradition"138. Der sich einst als unpolitisch bezeichnender Autor begrenzte den Einfluss des „anderen Deutschlands" explizit auf den kulturellen Bereich. In dem Interview vom 22. Februar 1938, aus welchem das vorangestellte Zitat ebenfalls entnommen ist, äußerte sich Mann beispielsweise folgend: „I don't work politically and I would prefer to talk about literature."139 Die Vorstellung eines doppelten Deutschlands war für Mann auch notwendig, da eine Identifizierung mit demselben Deutschland, mit dem sich auch „Hitler und seine Bande"[158] identifizierten, unmöglich erschien. Die „eigentliche deutsche Kultur"[159] sollte und wurde laut Mann durch das ,gute' Deutschland - oder eben das ,andere Deutschland' - verkörpert. Kultur definierte er als „das Menschtum selber"[160], wodurch die deutsche Kultur im Exil auch zu einer universellen Kultur wurde und als Gegenentwurf zu der von den Nationalsozialisten anerkannten Kultur fungieren sollte. „Wo ich bin, ist die deutsche Kultur" wurde so zwar nie explizit von Thomas Mann postuliert, doch genau diese Botschaft vermittelte er in seinen Rundfunksendungen.
Sein Glaube an ein anderes, an ein besseres Deutschland, das eigentlich mehr Hoffnung als überzeugter Glaube war,[161] schwand im Laufe des Krieges stetig. Spätestens 1940 waren Thomas Mann erste Zweifel gekommen, wie er in einem Brief an Agnes E. Meyer berichtete. Er sprach seinen deutschen Landsleuten die Vernunft ab und bedauerte, dass sie ihre Intelligenz und Kraft für und nicht gegen die Machthaber einsetzten.[162] Das Deutschlandbild der Mehrheit der Deutschen nach dem Krieg unterschied sich von dem Bild, welches Mann hatte und schlussendlich entscheidend für die nicht zustande kommende Heimkehr des Weltbürgers war. Er hatte sich, vielleicht mehr als die meisten anderen sich im Exil befindenden Deutschen, auf seine neue Heimat eingelassen und vor allem angefangen, Deutschland „mit den Augen der Opfer der deutschen Aggression"[163] zu betrachten.
Die Vorstellung eines doppelten Deutschlands war keinesfalls ein persönliches Thema Manns, sondern spielte für die britische Rundfunkpropaganda und für die komplette britische Deutschlandpolitik eine essenzielle Rolle. Mann befand sich mit seiner ambivalenten Haltung vermutlich innerhalb der in Großbritannien intensiv geführten Debatte dennoch eher auf der Seite, die den Deutschen positiver gesonnen gewesen sind. Seine Meinung und Einschätzung wandelten sich im Laufe der Zeit und er wurde ebenso von dem Diskurs über das doppelte Deutschland beeinflusst, wie er selbst auf diesen erheblichen Einfluss übte. Am stärksten wurde diese Debatte von dem englischen Diplomaten und Deutschlandexperten Sir Robert Gilbert Vansittart bestimmt. Vansittart, der neben Churchill einer der wenigen englischen Politiker gewesen ist, die frühzeitig vor der deutschen Gefahr warnten, machte mit seinen Thesen in den frühen 1940er Jahren enorm Stimmung und war in alliierten Diskussionskreisen über Deutschland omnipräsent.[164] Sein Erklärungsmodell und seine Thesen zur Entstehung des Nationalsozialismus, welche als Vansittartismus bezeichnet wurden, diskreditierten die meisten Historiker als disqualifiziert. Vansittarts deutschland-feindliche Ansichten, die ursprünglich in sieben propagandistischen Radioansprachen der BBC während der deutschen Luftangriffe 1940 gesendet wurden, sind vor allem als Broschüre mit dem Titel „Black Record. Germans Past and Present."140 publiziert worden. Erstmalige Erwähnung in Thomas Manns Tagebuch findet der Name Vansittart am 1. Juni 1941, nachdem Mann die Broschüre studiert hatte.141 Das erste Resümee fiel folgendermaßen aus: „Geschichtlich angreifbar, aber psychologisch wahr. Die drei deutschen Eigenschaften ,Envy, Self pity, and Cruelty' unbestreitbar."142
Innerhalb der PWE und der Regierung sind die Thesen Vansittarts umstritten gewesen und es herrschte eine stetige Debatte darüber, an der Propagandisten, Redakteure, Berater ebenso beteiligt waren wie Minister und politische Entscheidungsträger.143 Vansittart war dabei einer der extremsten Vertreter, sowohl vom Inhalt als auch vom Stil her, wodurch sich viele - selbst Churchill - von ihm teilweise distanzierten.144 Vansittart, der seine Reden propagandistisch exzellent in Szene zu setzen wusste und damit die vielen britischen Germanophilen umstimmen und die Amerikaner zur „Aufgabe ihrer Neutralität"145 bewegen wollte, vertrat grob zusammengefasst fünf zentrale Punkte. Erstens existiere nur ein Deutschland, nämlich das Nazi-Deutschland, welches das wahre Gesicht des deutschen Volkes zeige. Dieses sei, so eine weitere elementare These, von Grund auf ein kriegerisches und aggressives Volk. Weiter ginge es den Deutschen nie nur um kleinere Gebietserweiterungen, sondern immer unmittelbar um die Weltherrschaft - getrieben durch den Neid auf England mit seinem Empire - und mit dem unabdingbaren Ziel die britische Vormachtstellung abzulösen. Viertens sei Adolf Hitler das einzig logische, folgerichtige und natürliche Ergebnis der deutschen Geschichte und könne in einer Linie mit Friedrich dem Großen, Bismarck und Wilhelm II. betrachtet werden. Sie alle und der Lauf der deutschen Geschichte mündeten im Nationalsozialismus und in Hitler, der die „Kulmination der deutschen Geschichte"146 und alles andere als ein Zufallsprodukt sei. Zuletzt räumte Vansittart noch den Punkt ein, dass jedoch eine Möglichkeit existiere, wie die Deutschen durch eine völlige „geistige Neugeburt"147 und Umerziehung über „schätzungsweise zwei Generationen"148 gezähmt und zivilisiert werden könnten.149 Vansittarts Wunsch, jede Unterscheidung zwischen dem Nationalsozialismus und dem restlichen, dem alten oder dem ,guten' Deutschland aus den Köpfen der britischen Bevölkerung zu verbannen, ergab sich direkt aus seiner Interpretation der deutschen Geschichte.150
Die Kritikpunkte an Vansittarts Thesen sind vielfältig und retrospektiv schnell deutlich.151 Seinerzeit waren die Hauptvorwürfe gegenüber des Verfassers der Black Record Schrift, dass er pauschal verteufeln, polemisieren, skandalisieren und vor allem der nationalsozialistischen Propaganda mit seinen Aussagen in die Karten spielen würde.152 Gegen Kriegsende - als die britischen Propagandisten nicht mehr daran interessiert gewesen sind, an die guten Deutschen zu appellieren, sondern sich zunehmend mit der Frage befassten, wie sie das gesamte Volk umerziehen könnten - wurden durch den Fokus auf die Umerziehung die propagandistischen Grenzen Vansittarts Thesen endgültig erkannt.153
Unter den deutschsprachigen Emigrantinnen im Exil galt der Vansittartismus stets als das große Reizwort. Die teils distanzierte, teils zustimmende Haltung Thomas Manns zu den Thesen war gespalten. Der Nationalsozialismus habe „lange Wurzeln im deutschen Leben"154, bekannte er in einer Rundfunkansprache vom August 1941. Er führte jedoch ebenfalls an, wie wichtig eine Trennung zwischen dieser Geschichte und der des deutschen Geistes sei, da dieser den „längeren historischen Atem"155 haben werde. Wie bereits erwähnt, stimmte Mann mit der psychologischen Erklärung Vansittarts grundsätzlich überein, doch in der historischen Herleitung zur Entstehung des Nationalsozialismus taten sich größere Differenzen auf. Im Juni 1943 widersprach er beispielsweise in seinem Nachruf an den Widerstand der „Weißen Rose" Vansittarts These des durchweg bösen Deutschlands: „Die Lehre, dass man zwischen ihm [dem deutschen Volk] und dem Nazitum nicht unterscheiden dürfe, [...] ist unhaltbar und kann sich nicht durchsetzen."156 Da widerständisches Handel jedoch die Ausnahme blieb, fiel es Mann mit zunehmender Kriegsdauer schwerer, seine Argumente für das doppelte Deutschland öffentlich zu vertreten und die Positionen Vansittarts und Manns zeigten immer mehr Parallelen auf.157 Mann setzte sich die Zeit über intensiv mit den Black Record Thesen, die sein eigenes Deutschlandbild durch die kritische Reflexion prägten, auseinander und thematisierte diese in zahlreichen seiner Rundfunksendungen - wenn auch nicht immer direkt.
Die Direktiven für den Deutschen Dienst der BBC sind im Falle der Debatte über die Frage des doppelten Deutschlandbildes tatsächlich mehr durch eben diese und durch die verschiedenen Äußerungen Vansittarts, Manns oder auch anderer Persönlichkeiten bestimmt worden als in anderen Bereichen. Bis Juni 1943 hielt die BBC an der grundsätzlichen Trennung zwischen den Nazis und dem deutschen Volk fest, ehe dann diese Unterscheidung aufgegeben wurde.158 Thomas Mann, der im August 1943 wie bereits geschildert noch gegen die Annahme des durchweg korrumpierten Deutschlands plädierte, handelte hierbei erneut anachronistisch zur britischen Propagandastrategie. Sein Deutschlandbild wandelte sich ständig und war auch stark vom Vansittartismus beeinflusst, blieb aber von den britischen Vorgaben weitgehend unberührt - es war angepasst und beeinflusst, aber immer individuell und selbstbestimmt. Bei seinen Äußerungen und seiner Positionierung in der Deutschland-Debatte stand Thomas Mann zudem immer vor der schwierigen Herausforderung, keine der Seiten vollständig zu verprellen. Viele Deutsche sprachen ihm, besonders deutlich erst nach Ende des Krieges, beinahe das ,Deutschtum' ab und sahen in Mann einen klaren Vertreter der Ideen Vansittarts. Auf der amerikanischen und alliierten Seite musste er sich hingegen stetig vorwerfen lassen, dass er zu rücksichtsvoll mit dem (mit seinem) deutschen Volk umgehe und für einen milden Frieden stehen würde . 159 Der Deutsch-Amerikaner hat sich bemüht, den Balanceakt, den er in vielen Fällen zu vollziehen hatte, zu meistern, ohne die Unterstützung und Glaubwürdigkeit der einen oder anderen Partei vollständig zu verlieren.
3.3 Aufruf zum Widerstand und die Schuldfrage
Neben den immer wiederkehrenden Themen der drohenden deutschen Niederlage, der Vernichtung der NS-Herrschaft und ihrer Bestrafung rief Thomas Mann die Zuhörenden immer wieder zum Widerstand auf. Konkrete Anweisungen waren in seinen Rundfunkansprachen allerdings nie zu hören, es blieb bei dem grundsätzlichen Aufruf zum Widerstand, der sich an die gesamte Bevölkerung richtete . Die fehlenden Hinweise auf konkrete widerständische Aktionen und Handlungen passen zu den Vorgaben vonseiten der BBC zur psychologischen Kriegsführung.160 Die Botschaft und das erwünschte Ziel ist zumindest klar formuliert gewesen: „Fort mit den Verderbern! Fort mit den national-sozialistischen Schändern und Schindern Europas!"161
Die Deutschen forderte der Literaturnobelpreisträger auf, sich und ihre Seelen zu retten, „indem [sie ihren] Zwingherren [...] Glaube und Gehorsam kündigten]"162 und es nicht „zum Äußersten kommen"163 ließen. In der Selbstbefreiung sah Mann die beste Chance für das deutsche Volk, Frieden zu finden und Teil des Weltfriedens und der „gerechten Völkerordnung"164 zu werden. Aussagen wie „ein Volk, das frei sein will, ist es im selben Augenblick"165 mögen für viele der Hörenden beinahe provokativ, mindestens aber leichtfertig und realitätsfern gewirkt haben, da Mann mit den Lebensumständen in der NS-Diktatur nur bedingt vertraut gewesen ist. Der flächendeckende Widerstand oder gar die versuchte Selbstbefreiung vonseiten der deutschen Bevölkerung blieb bekanntermaßen aus, doch Thomas Mann predigte diese den Vorgaben folgend unablässig. Dabei stand für ihn gar nicht der praktische Erfolg, dieser war vermutlich auch aus der Sicht Manns außerordentlich vage, sondern der bloße Versuch der Selbstbefreiung an erster Stelle . Die Deutschen hätten so die Gelegenheit gehabt, der restlichen Welt zu zeigen, dass sie nicht alle Nazis sind.166 Je länger der Krieg dauerte und je länger die Passivität der Bevölkerung anhielt, desto mehr schraubte Thomas Mann seine Forderungen zurück.167 Dabei verhielt er sich wieder einmal anachronistisch zu den Direktiven, die gerade in den letzten Kriegsmonaten eine aggressivere Note einforderten, nachdem die subversiven Aufrufe erfolglos blieben.
Erreicht werden sollte der deutsche Widerstand durch das redundante Ankündigen der deutschen Niederlage und der Vorführung der vielen nationalsozialistischen Verbrechen und Lügen. Mann war darum bemüht, seine Hörerschaft davon zu überzeugen, dass die Berichterstattung in Deutschland nichts als „Blendwerk"168 und dass ein Friede mit Hitler unmöglich sei, weil dieser „des Friedens von Grund aus unfähig"169 wäre. Das Wort würde er und sein „Brandstifter-Regime"170 nur als „krankhafte Lüge"171 verwenden. Die ersten Kriegsmonate, in denen die zu bejubelnden Siege auf deutscher Seite reichlich waren, sind von Mahnungen Manns und der Frage, ob sie die von „Grauen und Ekel"172 gezeichneten Erfolge mit Stolz erfüllen würden, geprägt.173 Die komplette restliche Welt verbünde sich gegen Nazi-Deutschland und die vielen unterdrückten Völker würden sich nach Rache sehnen, welche das ganze deutsche Volk treffen würde . [199] Die Herangehensweise, welche Thomas Mann wählte, um die Kriegsmüdigkeit und den Widerstandswillen zu erhöhen, glich ebenso wie die thematische Schwerpunktsetzung den Vorgaben der PWE. In diesen Bereichen erwies er sich demnach als ein „good Propagandist"[200].
3.4 Thomas Mann im Spiegel der Direktiven
Thomas Mann kam erst nach der experimentellen Anfangsphase zum Deutschen Dienst der BBC dazu, weshalb er von Beginn an bereits weitestgehend klare Strukturen, die in erster Linie der Leitung Greenes zuzuschreiben waren, vorfand. Die in Kapitel 2.2 „Propagandastrategien und Direktiven" dargelegten Veränderungen der Vorgaben und Schwerpunktsetzungen und der Wandel der Direktiven tangierten Manns Wirken. Nachdem bereits an einigen Stellen in diesem Kapitel zu Thomas Mann und seinen Radiosendungen thematisiert wurde, wie er - salopp formuliert - seinen eigenen Weg, der oft weitestgehend unbehelligt von den Vorgaben der britischen Propaganda wirkte, ging, sollen nun noch ein etwas dezidierterer Blick auf das Spannungsfeld zwischen Manns Meinungen und Intentionen und den britischen Propaganda-Direktiven geworfen werden. Themen wie die diffamierende Sprache des Autors gegenüber der NS-Regierung, die Ignoranz der begrenzten Redezeit und die Debatte über diese, die partielle Missachtung des britischen Wahrheitsgebots und die Frage nach der Unterscheidung zwischen dem ,guten' Deutschland und dem Nationalsozialismus wurden bisweilen in dieser Arbeit beleuchtet. Besonders die ersten drei Punkte lassen Mann als unbeeinflussbaren und völlig konträr handelnden Akteur innerhalb der britischen Rundfunkpropaganda wirken. Bei dieser Annahme bedarf es jedoch einer gewissen Relativierung. Thomas Mann hat sich in den genannten Streitthematiken durchgesetzt, beziehungsweise seinen Wünschen wurde stattgegeben und seine Abweichungen und Missachtungen wurden toleriert. Einerseits hatte dies mit seiner exponierten Stellung und seinem enormen Ansehen zu tun, andererseits spielte die bereits erläuterte freiwillige Zensur und die damit verbundenen Freiheiten für die BBC-Mitarbeiter:innen eine entscheidende Rolle. Die Direktiven lagen Mann vor, doch eine Nichtachtung dieser hatte - außer Bitten, Hinweisen und schlimmstenfalls vorsichtiger Kritik vonseiten der Verantwortlichen des Deutschen Dienstes der BBC und der Vorgesetzten Manns - keine ernsthaften Folgen. Zudem handelte es sich bei den aufgeführten Themen, wie beispielsweise beim Ignorieren des Wahrheitsgebots, teilweise auch um Einzelfälle. Spannender ist hingegen Thomas Manns Haltung und Positionierung innerhalb der Debatte über das doppelte Deutschlandbild und die Trennung zwischen Nationalsozialismus und den ,guten' Deutschen, welche im vorangegangen Kapitel ausführlich erläutert wurde. Dass er eine Trennung vornahm und trotz seiner zunehmenden Annäherung an die extremen Positionen Vansittarts im Laufe des Krieges teils durchaus anachronistisch zur Schwerpunktsetzung der Direktiven agierte, wurde bereits dargelegt. Doch lässt sich in diesem Zusammenhang bei genauerem Hinsehen auch ein Beispiel für die Befolgung der Vorgaben vonseiten Manns erkennen. Die vom EH im Frühjahr 1940 verhängte Regel, die den Gebrauch des Wortes Nazi gänzlich verbot, wurde in Kapitel 2.2 „Propagandastrategien und Direktiven" erwähnt und war Teil des Versuches, die strikte Trennung zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und dem ,guten' Deutschland aus den Sendungen verschwinden zu lassen.[201] Diese Vorgabe, die noch nicht mit der durchstrukturierten Form der späteren Direktiven unter der Kontrolle der PWE zu vergleichen ist, geschah vor Manns erster Radiosendung und er hatte diese somit von Anfang an zu beachten. Es mag nun beinahe überraschend - besonders aufgrund der intensiven Differenzierung zwischen Deutschen und Nationalsozialisten in seinen Ansprachen - anmuten, dass bis zum September 1941, also die ersten elf Sendungen, nicht ein einziges Mal das Wort Nazi zu finden ist. Allein in der Ansprache vom September verwendete Thomas Mann den Begriff dafür direkt siebenmal[202] und in allen folgenden Sendungen ist ebenfalls wenig von einer Aussparung der Begrifflichkeit zu erkennen. Was zunächst wie eine weitere Missachtung des Deutsch-Amerikaners im Dienste der BBC gegenüber der Vorgaben der verantwortlichen Propagandainstitutionen wirkt, zeigt tatsächlich genau das Gegenteil. Das Verbot, an welches sich Mann elf volle Sendebeiträge hielt, hatte mit der Etablierung der PWE im August 1941 seine Gültigkeit verloren. Das EH existierte nicht mehr und eine explizite neue Regelung bezüglich der Verwendung des Wortes Nazi wurde vonseiten der PWE nicht getätigt, sodass Thomas Mann in der ersten folgenden Ansprache keine Vorgaben brechen musste, um von Nazis zu sprechen. Seiner inhaltlichen Schwerpunktsetzung tat die Einschränkung, welcher er sich zuvor hingab, ohnehin keinen Abriss. Womöglich hat sich Mann darüber schon fast belustigt, dass er der Vorgabe formal folgte und dennoch zu großen Teilen in seinen Ansprachen über genau die Sache sprach, welche die BBC damit zu unterbinden versuchte.
Der Rationalisierungsprozess, welchen die Direktiven in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 1941 durchliefen, kann in seinen Ansprachen nicht erkannt werden. Die fortan vorgegebene Distanzierung vom emotionaleren Zugang und den Appellen an die moralischen Werte und die Etablierung eines rationalen Ansatzes sollte sich vor allem als dienlich für die Glaubwürdigkeit der BBC und die Vermittlung von komplexeren Sachverhalten erweisen. Die diffamierende Sprache, die nicht endenden Appelle an die Vernunft, das ambivalente Deutschlandbild und die damit verbundene emotionale Debatte in Manns Rundfunksendungen blieben jedoch bestehen und vermittelten eher einen emotionsgeprägten Gesamteindruck. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es ihm nicht trotzdem gelang, komplexe Sachverhalte zu thematisieren, poetisch und ästhetisch zu formulieren und Glaubwürdigkeit zu verkörpern. Diese Emotionalität und die durch die Wut und Empörung, ausgelöst durch die nationalsozialistischen Verbrechen, getätigten Aussagen führten wie bereits vorherig angeführt zu einer gewissen Irritation aufseiten der BBC.174 Doch dem Autor der womöglich bekanntesten deutschsprachigen Sendung der BBC dieser Zeit wurde dieser individuelle Weg gewährt und es kam nicht zur Zensur seiner Ansprachen - lediglich zu einer vorsichtigen Aufforderung der sprachlichen Mäßigung, die jedoch wirkungslos verhallte.175 Das lag nicht zuletzt daran, dass Thomas Mann der grundsätzlichen Ausrichtung der Sendungen und den Schwerpunktsetzungen vorbildlich folgte. Das einzige dauerhafte Streitthema blieb die begrenzte Redezeit.
Das gestiegene alliierte Selbstvertrauen, deren Vermittlung in den letzten Kriegsmonaten ein fundamentaler Schwerpunkt der britischen Direktiven gewesen ist, war auch Mann anzumerken. Die letzten Ansprachen (vor allem nach der mehrmonatigen Pause zwischen Mai 1944 und Januar 1945) glichen sich untereinander relativ stark, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass die wenigen aber klar formulierten Vorgaben für die Rundfunksendungen jener letzten Phase vom Autor der „Deutsche Hörer!"-Reihe gewissenhaft erfüllt wurden. Kontinuierlich predigte Mann das nahe Kriegsende und verkündete, dass die „Tage dieser gräßlichsten und schamvollsten Episode der deutschen Geschichte gezählt sind [und der] [...] Schreckenstraum ausgeträumt sein wird."176 Er entwarf wiederholt positive Zukunftsszenarien, skizzierte den „Neubeginn des Lebens"177 und ist dabei oft schon so weit, dass er „vom Nationalsozialismus [...] gar nicht mehr"178 reden wolle, da es nur eine Zukunft ohne den Nationalsozialismus geben könne. Neben der Darstellung des „über und über verlorenen Krieges"179, setzte Mann außerdem auch die immer wichtiger gewordene Schuldfrage in seinen Reden um - was er jedoch schon die Jahre zuvor häufig tat, als die Direktiven darauf noch keinen Schwerpunkt gelegt hatten. Dabei plädierte er jedoch stark für die deutsche Verantwortlichkeit der Verbrechen und will weniger den Begriff der Schuld verwenden, doch verantwortlich seien „alle für das, was aus deutschem Wesen kam und von Deutschland als Ganzem geschichtlich verübt wurde."180 Daher musste zunächst ein breites Wissen und Bewusstsein über die Verbrechen der Nationalsozialisten hergestellt werden - zu welchem Mann zum Beispiel durch die ausführliche Schilderung der „riesenhafte[n] Mordanlage[n]" in den Konzentrationslagern beitrug - und die Deutschen sollten „Entsetzen, Scham und Reue"181 für die Gräueltaten entwickeln. Außerdem befolgte Thomas Mann auch den Direktiven zu entnehmenden Wunsch, die Alliierten als friedensbringende Autorität zu etablieren und der nationalsozialistischen Angstpropaganda entgegenzuwirken, indem er seiner Hörerschaft unter anderem versicherte, dass alles „besser sein [werde] als die gegenwärtige Hölle"[211] und „Deutschland nicht stirbt. Es ist im Begriff, eine neue Gestalt anzunehmen."[212] Die Tatsache, dass Mann nach einer mehrmonatigen Pause von der BBC gedrängt wurde, seine Arbeit wieder aufzunehmen, mag darauf zurückzuführen sein, dass man ihn für die geeignetste Person hielt, den Deutschen die wichtigen finalen Botschaften der britischen Rundfunkpropaganda zu vermitteln.[213] Er erfüllte die Erwartungen seiner Arbeitgeber am Ende genauer als zuvor und es sind keine erkennbaren Abweichungen oder Einzelgänge mehr festzustellen gewesen. Möglicherweise lag dies auch daran, dass Mann verunsichert war, welche Positionen er gegenüber den nun besiegten Deutschen einnehmen und was er weiter noch postulieren sollte. In einem Brief an Agnes E. Meyer stellte er die Frage: „Was soll man ihnen sagen?"[214]
4. BrunoAdler
Bruno Maria Adler, geboren am 14. Oktober 1888 im böhmischen Karlsbad, ist mit Sicherheit um ein Vielfaches unbekannter als Thomas Mann, doch die Tätigkeit, wegen welcher beide für meine Untersuchung relevant sind, ist jedoch die gleiche gewesen. Beide waren Teil der britischen Rundfunkpropaganda und verfassten regelmäßige Radiosendungen nach Deutschland. Das Exil und der Krieg im Äther prägten das Leben beider in vergleichbarer Weise. Dass Mann umgekehrt auch Einfluss übte, konnte im vorangegangen Kapitel dargelegt werden, doch wie sahen die Einflussmöglichkeiten Adlers aus? Welche Rolle spielte er innerhalb der BBC und der Rundfunkpropaganda? Wie versuchte er die deutsche Hörerschaft zu erreichen und wie gestalteten sich seine Sendungen unter dem Einfluss der britischen Direktiven? Diese Fragen gilt es folgend zu beantworten.
Adler, der sich selbst rückblickend als „uneigentliche[r] Deutsche[r]"[215] beschrieb, studierte Kunst- und Literaturgeschichte in München und Wien, arbeitete anschließend als Schriftsteller und Journalist, ehe er aufgrund seines jüdischen Glaubens mit einem Schreibverbot belegt und schließlich auch verfolgt wurde.[216] Er emigrierte zunächst 1933 in die Tschechoslowakei, wo er unter dem Pseudonym Urban — [211] Mann, DH, S. 139.
Roedl wirkte, und drei Jahre später floh er nach England. Dort gelangte er nach einer unterrichtenden Tätigkeit an einem Landschulheim für Kinder emigrierter Jüdinnen und Juden im Jahr 1939 zur BBC. Die folgenden 29 Jahre agierte Adler als Mitarbeiter des German Service der BBC in London.182 Obwohl sein Schwerpunkt - und auch seine Passion - in der Kunstgeschichte lag, so verfasste er mehrere Werke über Adalbert Stifter und Matthias Claudius, verbrachte Adler doch einen signifikanten Part seines Lebens, welches am 26.12.1968 endete, mit der Rundfunkarbeit. Dabei ist es ursprünglich Adler, der, nachdem der deutschsprachige Dienst im Sommer 1939 sein Programm erweiterte, mit Themenvorschlägen (zu seinen Fachgebieten) vorstellig wurde.183 Diese wurden abgelehnt, doch anschließend verdiente er seinen Unterhalt durch das Verfassen von satirischen Rundfunksendungen. Neben dem finanziellen Aspekt ist es für Adler auch eine gewisse moralische Verpflichtung gewesen, sich im Kampf gegen das faschistische Deutschland zu beteiligen.184 185 Wie bereits in einem vorherigen Kapitel dargelegt, veranlasste auch Thomas Mann - und vermutlich einen Großteil der im antideutschen Rundfunk aktiven Emigrantinnen - eben diese moralische Pflicht zur Arbeit für die BBC. Retrospektiv formulierte Adler dies folgendermaßen:
„Wessen Beruf das Schreiben ist, der konnte sich nicht im Elfenbeinturm der Ästheten und Gelehrten einschliessen, als in der Welt um ihn, und namentlich in der deutschen Welt, der Irrsinn und Schändlichkeiten an der Tages-Unordnung waren."[120]
Erfahrung mit dem noch jungen Medium Radio hatte Bruno Adler, ebenso wie die Mehrheit der Emigrantinnen und Emigranten, die für die BBC aktiv waren, noch nicht gesammelt. Dasselbe galt für das Genre der Satire, mit welchem er lediglich lose Berührungen während seiner Studienzeit hatte, als er für den Wiener Satiriker Karl Kraus eine Lesung organisierte.186 Neben Adlers beiden Satiresendungen „Frau Wernicke" und „Kurt und Willi", auf welche noch genauer eingegangen wird, verfasste er auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs mit der Sendung „Die zwei Genossen"187 bis zum Jahr 1964 weiterhin satirische Beiträge für den deutschen Dienst der BBC. Das redaktionelle Bearbeiten und teilweise auch das Konzipieren von Flugblättern fielen während des Krieges ebenfalls in Adlers Aufgabenbereich.188 Er selbst nahm sein Wirken als „unendlich viel [...] [und] allerhand Arbeit"189 wahr und hatte im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen nach dem Krieg keinerlei Interesse daran, seinen „Anteil am Sieg gegen den Faschismus [zu] proklamieren"190 und bevorzugte weiterhin die Pseudo- und Anonymität. Zu der Adler mit Sicherheit zu attestierenden Bescheidenheit gesellte sich jedoch auch eine Portion Schwermut. Das Leben im Exil und besonders die damit einhergegangene Aufgabe seiner Leidenschaft für Kunst- und Literaturgeschichte, machte ihm schwer zu schaffen.191 Die Betrachtung als ,enemy alien' (Adlers Einbürgerung erfolgte im Sommer 1947), die allgemeine Angst vor dem Krieg (Bombennächte in London), die Sorge um den Sohn in der Royal Air Force und die zeitweise finanzielle Not trugen zu diesem eher unzufriedenen Gefühl zweifelsfrei bei. Trotz der Einbürgerung in England und dem freiwilligen dauerhaften Aufenthalt, wurde es nicht seine neue Heimat. Für den uneigentlichen Deutschen bildete als einziges die deutsche Sprache eine „konstante Heimat"192. Auch hier lässt sich erneut bereits eine Parallele zwischen Bruno Adler und Thomas Mann erkennen, der die deutsche Sprache und Kultur mit sich nahm und die für ihn Heimat, auch außerhalb der deutschen Grenzen, bedeutete. In gewissen Aspekten sind sich die meisten deutschsprachigen Emigrantinnen - trotz der vermeintlichen Unterschiede - ähnlich gewesen.
4.1 Lachen über Hitler - antifaschistische Satire als Mittel des Widerstandes
Die sogenannten Features, zu Deutsch wohl am ehesten mit Spielfilmsendung beziehungsweise Hörspielsendung zu übersetzen, sind ab 1940 ein elementarer Bestandteil des deutschsprachigen Programms und der psychologischen Kriegsführung gewesen.193 Mittels Satire sollten die FeatureSendungen die nationalsozialistische Propaganda ins Lächerliche ziehen und zusätzlich die inhaltlichen Schwerpunkte der britischen Rundfunkpropaganda einbauen, um die zentralen Ziele, die schnellere Herbeiführung des Kriegsendes und die Niederlage des ,Dritten Reichs', zu erreichen. Obwohl die satirischen Sendungen nur etwa 10 Prozent des deutschsprachigen Programms der BBC ausmachten, sind sie entscheidende Träger der Propagandabotschaften gewesen.194 Die in dieser Arbeit bereits erwähnten drei Sendereihen, „Frau Wernicke" und „Kurt und Willi" von Bruno Adler und „Die Briefe des Gefreiten Adolf Hirnschal" von Robert Lucas, liefen allesamt über mehrere Jahre und galten, trotz der Ungewissheit bezüglich der Menge an Zuhörenden, als überaus erfolgreich. Die BBC schätzte ihre deutschsprachige Hörerschaft im letzten Jahr des Krieges auf circa zehn Millionen regelmäßig Hörende.195 Neben dieser einerseits mit großer Vorsicht zu betrachtenden und der andererseits nicht vorhandenen empirisch belegbaren Rezipient:innen-Daten, sprechen die diversen Gegenmaßnahmen der Nazis (z.B. Jamming', harte Verfolgung und Bestrafung für Rundfunkverbrechen) für den Erfolg der Satiresendungen und des German Service im Allgemeinen. Die satirischen Sendereihen stellten eine Blaupause dar. Als sich bei der BBC für die Ausstrahlung dieser Sendungen entschieden wurde, gab es keinerlei Erfahrungswerte, auf die sich hätte berufen werden können. Politische Satire war nichts Neues, doch die satirische Darstellungsform über das noch junge Medium Radio, noch dazu bestens integriert in die psychologische Kriegsführung, war zu diesem Zeitpunkt gänzlich neu.196 Ob dieser satirische Weg überhaupt ,richtig' und moralisch vertretbar war, wurde viel und kontrovers diskutiert. Ist das Lachen über den Zweiten Weltkrieg, das Nazi-Regime und vor allem die von diesem verübten Verbrechen überhaupt akzeptabel? Simpel gefragt, darf man das? Wie Uwe Naumann treffend formulierte, fragt sich, „ob denn irgendetwas zum Lachen gewesen ist am Faschismus, der so viele Millionen Menschen das Leben gekostet hat"197 ? Das Eröffnen einer grundlegenden Debatte über das Wesen, die Funktion und die möglichen Grenzen der Satire ist an dieser Stelle nicht erwünscht und auch nicht zielführend. Die schnelle Antwort lautet ,ja' und lässt sich im Fall der satirischen Rundfunksendungen der BBC mittels zweier Argumente bekräftigen. Die britische Satire griff ausschließlich die Täterinnen und nie die Opfergruppen an. Es sind immer die „Protagonisten und Nutznießer"198 der nationalsozialistischen Verbrechen gewesen, über welche sich lustig gemacht wurde. Das zweite Argument lieferte der erfolgreiche Beweis in der Praxis. Die Satire, „die Kunst der Verfremdung und der Montage [...] [und] Methode der Demontage"199, hat deutlich gezeigt, dass es „kaum eine wirksamere Waffe gegen Diktatoren geben kann als die Waffe der Lächerlichkeit."200
Bruno Adler arbeitete in den Räumlichkeiten des Political Intelligence Department (PID) - de facto arbeitete er auch für die PID - und saß somit unmittelbar an der Quelle der umfassenden Geheimdienstinformationen. Dies wusste er definitiv für seine beiden Sendereihen zu nutzen und verarbeitete dort das Wissen mit „großem Geschick und viel Humor."201 Adler befand sich in der „Abteilung, wo man all das wußte, von dem die Nazis nicht wußten, daß man es [...] [in England] auch wusste."202 Dabei ließen die Dialoge zwischen Kurt und Willi, die ohnehin tagesaktueller gestrickt gewesen sind, mehr dieser vom britischen Geheimdienst stammenden Informationen erkennen, als dies bei Frau Wernicke der Fall war.
4.2 Adlers Satiresendungen
Die im Regelfall wöchentlich ausgestrahlten Features sind auf wenige Minuten - erinnere an Thomas Manns Kampf mit der knappen Sendezeit - beschränkt gewesen.203 In dieser kurzen Zeit existierte nicht die Möglichkeit für ausufernde Handlungen oder Charakterbildung. Es musste eine kleine Anzahl an schnell wiederzuerkennenden Charakteren geben und die wesentlichen Inhalte mussten schnell und klar vermittelt werden können.204 Bei allen drei Sendungen ist dies der Fall gewesen. Ehe ausführlicher auf „Frau Wernicke" und „Kurt und Willi" im Spiegel der britischen Direktiven eingegangen werden kann, sollen beide Sendungen kurz und kompakt vorgestellt werden - zu „Die Briefe des Gefreiten Hirnschal" seien der Vollständigkeit halber ebenfalls noch wenige Sätze zu erwähnen.205
Die Sendung „Kurt und Willi", bei der sich die zwei langjährigen Freunde Kurt Krüger und Willi Schimanski in einem Café am Potsdamer Platz einmal die Woche treffen und über die „großen und kleinen Ereignisse der Woche"206 sprechen und diskutieren, zeichnet sich durch die Fülle an Informationen und die tagesaktuellen Themen aus. Kurt, ein idealistischer und parteigläubiger Oberstudienrat, kann als „etwas naiv und dummgescheit"207 charakterisiert werden. Sein Freund Willi arbeitet im Propagandaministerium und fungiert nach dem Vorbild Karl Kraus' Tragödie „Die letzten Tage der Menschheit" in der Rolle des Nörglers, wohingegen Kurt der Optimist ist.208 Willis Charakter kennzeichnet sich durch seine zynische Art. Er ist überaus gesprächig und plaudert reihenweise geheime Informationen aus209, womit er das sprechende Ventil für die Adler zur Verfügung stehenden Geheimdienstinformationen darstellt. Willi war dabei nicht nur das Sprachrohr für die britischen Geheimdienstinformationen, sondern durch seine „moralischen Verfehlungen und charakterlichen Unzulänglichkeiten [dazu da, um der Hörerschaft] auf einer Mikroebene zu verdeutlichen, was auch auf der Makroebene"210 falsch lief. Bruno Adler schrieb „Kurt und Willi" wohl nicht allein, sondern „hin und wieder [...] in Zusammenarbeit mit Norman Cameron"211, einem schottischen Schriftsteller, wobei das genaue Ausmaß der Zusammenarbeit nicht sicher zu bestimmen ist.212 Die Sendung hatte eine gewisse Stammtisch-Mentalität, richtete sich wohl vor allem an ein eher männliches Publikum und thematisierte häufig strategische Aspekte des Krieges, die korrupte NS-Führung oder die Rüstungsproduktion.213
Anders sah dies hingegen bei Adlers zweiter satirischen Rundfunksendung „Frau Wernicke" aus. Diese sollte in erster Linie die weibliche Hörerschaft ansprechen und war durch ,typisch weibliche' Klischees geprägt. Frau Gertrud Wernicke, die in der fiktiven Großen Frankfurter Allee in Berlin lebt, spricht mit ihrer ,Berliner Schnauze', ihrer volkstümlichen Art und dem schnellen Tempo ebenfalls über Themen wie das allgemeine Kriegsgeschehen oder die Köpfe des NS-Regimes. Doch anders als ihre Satiresendungs-Kollegen Kurt und Willi steht bei „Frau Wernicke" häufig das Kommentieren der Probleme des täglichen Lebens, dieVersorgungsengpässe und Mängel an Lebensmitteln und Kleidung im Fokus.214 Die Monologe, welche Frau Wernicke, die „Else Stratmann des Zweiten Weltkriegs"215, Woche für Woche hielt, können wohlwollend als „positive Variante eines Rollenklischees"216 bewertet werden. In der durch und durch männlich dominierten Gesellschaft, in der Frauen per se weniger (politische) Kompetenz und Urteilsvermögen attestiert wurde, gestaltete es sich für sie leichter, offen ihre Meinung kundzutun, da sie weniger ernst genommen wurde.217 Inwiefern Frau Wernicke mit ihrem Tratsch und ihren Lästereien, die sich primär gegen die Nazi-Größen richteten, wirklich bevorzugt von weiblichen Hörerinnen verfolgt wurde, kann nicht beantwortet werden. Klar zu erkennen ist dahingegen die Entwicklung ihres Charakters. In den rund dreieinhalb Jahren, die Frau Wernicke über den Äther schallte, wurde sie zunehmend direkter und offensiver in ihren verbalen Attacken auf die Nationalsozialisten.218
Die Satiresendung „Die Briefe des Gefreiten Hirnschal" von Robert Lucas prämierte sich vor allem durch das penible Beim-Wort-Nehmen der nationalsozialistischen Politik und Propaganda, wodurch diese auf drastische Weise Lügen gestraft wurde.219 Der Protagonist, der „strikt führergläubige Soldat"220 Adolf Hirnschal, berichtete in Briefen an seine Frau Amalia im heimatlichen Zwieselsdorf von seinen Erlebnissen und den Geschehnissen an der Front. Hirnschal agierte dabei als sympathische Figur und war ein „würdiger Nachfahr des braven Soldaten Schwejk aus dem Ersten Weltkrieg."221
Essenziell und unabdingbar für den Erfolg aller drei Sendungen sind die Besetzungen der Rollen gewesen. Erst die passenden Stimmen hauchten den Charakteren Leben ein und verliehen ihnen ihre Strahlkraft. Kurt und Willi wurden anfangs von stetig wechselnden Sprechern vertont, je nachdem wer gerade verfügbar war.222 Nachdem mit den beiden ehemaligen Berliner Theaterschauspielern Fritz Wendhausen als Kurt und Peter Ihle als Willi die ideale Besetzung gefunden wurde, gab es keinerlei Wechsel mehr und der Wiedererkennungswert für die Hörerschaft stieg. Zudem erhöhte sich durch die professionellen Sprecherinnen und Sprecher auch die Wirkung des Propagierten und die Charaktere konnten zu echten Sympathielieblingen wachsen. So geschehen auch bei der Besetzung Adolf Hirnschals durch den Wiener Charakterkomiker Fritz Schreck.223 Frau Wernicke, die von der bekannten Berliner Kabareffistin und Schauspielerin Annemarie Haase verkörpert wurde, profitierte wohl am drastischsten von ihrer Sprecherin. Sie passte perfekt in die Rolle der Urberlinerin Frau Wernicke, da niemand sonst „berlinerischer sein [konnte] als Annemarie Haase."224 Zudem besserte sie die vielen Fehler, welche dem süddeutsch geprägtem Böhmen Bruno Adler beim Schreiben im Berliner Dialekt zu genüge passierten, in den Manuskripten aus225 und wertete das Hörerlebnis um einiges auf. Die Regie führte bei allen drei Satiresendungen der bis 1933 als Oberspielleiter der Münchner Kammerspiele agierende Julius Gellner, womit die Produktionen durchweg, vom Schreiben der Texte, über die Regie und bis zur Vertonung, von Deutschen geprägt gewesen sind226 - die jedoch immer unter der Aufsicht und der Kontrolle von britischen Vorgesetzten agierten.
4.2.1 Frau Wernicke im Spiegel der Direktiven
Die Folgen der ersten Staffel der Satiresendung, in der es im Gegensatz zu „Kurt und Willi" um vermeintlich weniger männlich konnotierte Themen ging, sind weder als Skript noch als Audioaufnahme erhalten. Daher können diese ersten Sendungen folgend nicht berücksichtigt werden.227
Bruno Adler bekam ab Ende Juli 1940 vom EH eine wöchentliche Direktive, die ihm die Ausrichtung der kommenden „Frau Wernicke"-Sendung (folgend mit FW abgekürzt) vorgab.228 Da auch diese nicht mehr existieren, kann der Inhalt dieser persönlichen Direktiven nur mit jenem der allgemeinen Direktiven, die mindestens die Orientierung lieferten, verglichen werden oder dank des Briefwechsels zwischen Adler und seiner Vorgesetzten Christina Gibson nachvollzogen werden.229 Gibson, Leiterin des BBC- Frauenprogramms, wandte sich mit einer schieren „Armada von Vorschlägen und Wünschen"230 an Adler, der sich diesen kaum hätte verweigern können. Als „mittelloser Exilant [war er dazu] nicht in der Position"231, da er dann im Nachgang das Skript hätte überarbeiten müssen oder im schlimmsten Fall sogar um seinen Job hätte bangen müssen. Inhaltlicher Freiraum blieb Adler beim Schreiben der FW somit wenig, doch in der stilistischen Umsetzung war er ungebundener, da Gibson sich auf das Vorschlagen von (sehr konkreten) Themen fokussierte. Dennoch fällt es sichtlich schwer, solche Arbeitsbedingungen als frei und eigenständig zu bezeichnen. Die strenge Beobachtung und Kontrolle der Propagandaorgane stehen dabei im Widerspruch zum liberalen Bild der BBC und dem oft gepriesenem Wahrheitsgebot. Adler hatte sich dieser (in einem früheren Kapitel erläuterten) Selbstzensur allein schon aus finanziellen Gründen zu unterwerfen und den Anweisungen, die sicherstellten, dass die Propagandasendungen auch die erwünschte „Manipulation des Denkens"232 erzielten, Folge zu leisten. Die sich gleichenden Interessen, nämlich besonders die Beendung des NS- Regimes, halfen Adler bei dem Verzicht auf künstlerische Freiheiten. Seine Zusammenarbeit mit den britischen Propagandaorganen intensivierte sich spätestens nachdem er faktisch Teil dieser geworden war. Ab Herbst 1940 war er im EH angestellt und offiziell Mitarbeiter des PID.233 Einerseits lässt dies die Schlussfolgerung zu, dass ihm mehr vertraut wurde, anderseits fiel die Einflussnahme auf ihn und sein Schaffen nach seiner Anstellung auch um einiges leichter.
Die „passionierte Plappertasche"234 Gertrud Wernicke passte charakterlich durch ihre volkstümliche Art, ihre Sprache und ihr soziales Umfeld hervorragend zum von den Direktiven in der frühen Propagandaphase gefordertem ,human touch', bei dem viel Wert auf eine emotionale Vorgehensweise gelegt wurde. Adler kreierte die Figur vermutlich eigenständig235, aber orientierte sich an den Vorgaben der aktuellen Phase. Zu den essenziellen Satiretechniken bei FW gehörte definitiv die gewisse AntiLogik, welcher sich Adler bediente. Frau Wernicke führt „scheinbar pro-faschistische Position[en] ad absurdum"236, wenn sie beispielsweise sagt, dass es sich gar nicht zu leben lohne, wenn man nicht für den Führer und den Nationalsozialismus sterben dürfe.237 Oder ihre Aussage: „Als ob et nich besser wäre for'n Führa zu hungern und zu sterben, als for unsre Kinder zu leben."238 In den früheren Sendungen schlüpft Frau Wernicke häufiger in die Rolle der vermeintlich propagandistischen Agitatorin und verwendet NS-Vokabular und -Rhetorik, wohingegen sie später immer häufiger offen und direkt gegen Hitler und den Nationalsozialismus wettert und die Ironie zunehmend schwindet.
Durch die viel verwendete Kontrastierungstechnik deckt Frau Wernicke vor allem die Lügen und die Widersprüche der NS-Propaganda auf.239 So räsoniert sie beispielsweise im August 1942 über Hitlers Invasionspläne für das britische Festland, welche zu diesem Zeitpunkt bereits circa zwei Jahre zurückliegen. Das Ruinieren Englands und das Ausradieren der englischen Städte sei ja nicht mehr aktuell, sie erklärt, „ach, so trügerisch sind Führerworte"240 und führt den Zuhörenden folgend die Glaubwürdigkeit der Worte Hitlers und das sich wandelnde Kriegsgeschehen vor Augen: „Damals war de Invasion von England unsa Tajesjespräch, und heute, da is de Invasion von unsan Kontinent unsa Nachtjespräch im Luftschutzkella."241 In der selben Folge entblößt Frau Wernicke auch eine weitere beliebte Lüge Hitlers, den „beriehmten Satz vom Endsiech"242, welche sie singend parodiert: „Tausendneunhunderteinundvierzig wird sicher das Jahr des Endsiegs sein."243
Eine Vorgabe der Direktiven, die vor allem im Frühjahr 1941 präsent war, ist die des Angstmotivs gewesen, das in FW erkennbar eingebaut wurde. Adler lässt dabei seine Protagonisten ähnliche Argumente, die beispielsweise auch schon bei Thomas Manns Sendung zu sehen gewesen sind, bringen, wenn sie vom „Haß von de Besiechten und denen ihr Wunsch nach Revangsche"244 schwadroniert. Passend zum polemischen und emotionalen Ansatz der Angstpropaganda und der düsteren Zukunftsprophezeiungen kündigt Frau Wernicke im Luftschutzkeller während einer kleineren Bombardierung an, dass „muß und wird [noch] janz anders komm!"245 Um einiges weniger theoretisch und zudem nicht so präsent taucht die Kriegsschuldfrage in FW auf. In ihrer typischen Art spricht sie dabei vom „Vateidijungskriech jejen alle Nichtangreifer"246 und stellt so ironisch, aber dennoch klar genug dar, wer der Aggressor und Schuldträger des Kriegs und dem damit verbundenen Leiden ist. Gegen Ende der Satiresendung, die bereits Anfang 1944 ihr Ende fand, wurde der Schwerpunkt noch deutlicher auf die Darstellung des Leidens der deutschen Familien und die zerstörerische Kraft des Krieges gelegt.247 Das Motiv der unausweichlichen deutschen Niederlage, die nur noch eine Frage der Zeit sei, ist ebenfalls sehr präsent in FW. So konstatert die schrittweise rebellischer werdende Berlinerin Wernicke, dass „det Ende [...] fest"248 -steht und selbst ein „Blinder mit'n Krückstock"249 dies erkennen müsse. Der Fokussierung Adlers auf die zwei zentralen Propaganda-Richtlinien der Phase 1943/1944 - zur Erinnerung: die unausweichliche Niederlage und jeder weitere Tag Krieg bringe vor allem den Deutschen Zerstörung, Leid und Tod - werden deutlich. „Jede Stunde [...] heeßt'n paar Tausend Hitlertote mehr [und die deutschen Städte werden] eene nach de andere in Klump jeschossen."250 Die FW-Sendung machte zudem unmissverständlich klar, wer in Deutschland nach der Niederlage etwas zu befürchten hat, ebenso wie ihre fktven Satre-Kollegen Kurt und Willi und auch Thomas Mann. Die dabei vorgenommene starke Differenzierung zwischen der verbrecherischen Elite, mit der endlich „u^’eräumt"251 werden solle, und den „jewöhnlichen Deutschen"252 überrascht. Kein anderes Format, auch nicht Adlers andere Sendung, stellte zu der Phase des Krieges die deutsche Bevölkerung so deutlich in der Opferrolle dar.253 Die Propagandadirektven gaben zwar vor, den Deutschen die Gewissheit zu vermitteln, dass die einfachen und unschuldigen Bürger trotz einer bedingungslosen Kapitulaton nichts Schlimmes zu fürchten hätten und diese vielmehr eine Befreiung sei254, doch bei FW ging Bruno Adler noch weiter. Seine Darstellung des „zum Verbrechen verführten Volkes"255 und die eher der Anfangsphase zuzuschreibende Trennung zwischen der ,bösen' Elite und dem ,guten' und unschuldigen Volk decken sich nicht mit den Direktven dieser Zeit. Adler versuchte dadurch vermutlich einen Keil zwischen die „Bonzen"256 und die „Arbeeter, der ehmalje Mittelstand, de kleenen Bauern"257 zu treiben. Auch damit wich er von der allgemeinen Linie der Direktven ab.
Weitere Schwerpunkte der Propaganda-Direktven, die Adler in FW umzusetzen wusste, sind die Stärkung der Alliierten Autorität, der Auftau von Vertrauen gegenüber den Alliierten und das Entwerfen eines positven Zukunftsbild ohne den Nationalsozialismus.258 Das Fordern von Frieden und die Beseitgung der NS-Führung gehörte zwar ebenfalls zu den späteren Leitlinien und Vorgaben, doch ist auch hier ein gewisser Sonderweg Adlers zu erkennen. Neben der sehr klaren Sprache, die zunehmend eine diffamierende Note erhielt, wird Gertrud Wernicke von Folge zu Folge rebellischer und aggressiver. Zuvor mit dem Mittel der Ironie agierend, proklamiert sie später ganz offen die Rebellion und fordert „Schluß mit'n aussichtslosen Kriech, und Schluß mit det System von Jestapo und Kriegsverlängerer!"[294] Konkrete Anweisungen zur Rebellion erteilt die Berlinerin ihrer Zuhörerschaft jedoch ebenso wenig wie Thomas Mann in „Deutsche Hörer!" oder die anderen Figuren Adlers, da dies von den Propagandaorganen nicht erwünscht gewesen ist. Auf der verbalen Ebene könnte Frau Wernicke aber nicht viel deutlicher auftreten, so stellt sie unzweifelhaft klar, entweder „wa verzichten uff de Führer, oder wa verzichten uff Frieden."[295] Der nächste Schritt, eine Widerstand leistende Wernicke - was zumindest theoretisch eine Möglichkeit für die Sendung gewesen wäre - blieb aus. Die Forderungen nach Frieden und die direkten oder indirekten Aufforderungen zum Widerstand und zur Rebellion sind Teil der Endphase der Direktiven gewesen und Bestandteil in allen in dieser Arbeit erwähnten Rundfunksendungen. Aber Adler war mit seiner sehr rebellischen und aggressiven FWVersion gegen Ende 1943 / Anfang 1944 den Direktiven der Propagandaorgane und den anderen Sendungen ein paar Monate voraus.[296] Er wich hier erneut, wenn auch nur den Zeitpunkt betreffend, von den Leitlinien ab. Sowohl mit der stärkeren Opferrolle als auch mit dem früheren Fordern der Rebellion bewegte sich Adler für seine Vorgesetzten vermutlich noch in einem vertretbaren Rahmen, da eine Ausstrahlung ansonsten wohl unrealistisch gewesen wäre. Dies zeigt, dass trotz der eingangs skizzierten Vorgaben und Kontrolle Freiheiten möglich waren. Adler hatte sich über Jahre der folgsamen Propagandaarbeit und die nie zu sehr abweichenden individuellen Umsetzungen diese Einflussspähern geschaffen und so seine eigene Note stärker hinzufügen können.
Die Absetzung der Rundfunksendung Anfang 1944 ist aller Wahrscheinlichkeit nach auf die schlichte willkürliche Entscheidung der BBC-Leitung und der PWE-Entscheidungsträger zurückzuführen. Womöglich erschien FW - und ihre radikalere Entwicklung - „nicht mehr zeitgemäß oder passend für den Sendeplan"[297], es wurde vermehrt Sendezeit für Nachrichten bevorzugt und einige entscheidende Unterstützer der Serie, wie beispielsweise Richard Crossman, waren zu jenem Zeitpunkt nicht mehr verantwortlich.[298] Der Fokus in den Features sollte außerdem mehr auf militärische Ereignisse gelegt werden und die Zielgruppe der Soldaten konnte besser durch Kurt und Willi oder den Gefreiten Adolf Hirnschal erreicht werden.[299] Vielleicht war FW auch sozusagen zu Ende entwickelt, da der nächste Schritt (der aktive Widerstand) schließlich nicht folgte. In der letzten Folge verabschiedete sich Gertrud Wernicke aufs Land mit den Worten: „lebt alle wohl und Uff Wiederhören!"[300] Abschließend lässt sich festhalten, dass der Erfolg von FW in erster Linie auf ihre menschliche, nahbare, direkte, aufrichtige — [294] Adler, Frau Wernicke, S. 125. und einfache Art zurückzuführen gewesen ist. Ihr Charakter war unabhängig von den unterschiedlichen Propagandaphasen und der sich stetig ändernden Motive und Vorgaben der Direktiven das Entscheidendste. Die Figur Frau Wernicke war nicht bloß ein Sprachrohr der britischen Propaganda, sondern für viele Deutsche vor den Empfangsgeräten beim „englische Inhalation inatme[n]"259 fast eine Art fiktive Freundin, deren Schaffung Adler zu verdanken ist. Trotz der vielen inhaltlichen Vorgaben, der dauerhaften Kontrolle und der herrschenden Selbstzensur ist der Einfluss Adlers meines Erachtens dennoch spürbar und seine Person immanent für den Erfolg und die Wirkkraft der Sendung gewesen.
4.2.2 Kurt und Willi im Spiegel der Direktiven
Da die Skripte von Adlers zweiter Sendereihe zwar erhalten sind, allerdings für diese Arbeit nicht zur Verfügung stehen260, sind folgend nur noch einige wenige, der Literatur zu entnehmende, Ergänzungen zu den im vorherigen Kapitel dargelegten Erkenntnissen zu ergänzen. Die (wenn auch nicht hundertprozentig sichere) Tatsache, dass Adler die Rundfunksendung im Gegensatz zu „Frau Wernicke" nicht allein verfasste, erschwert zudem die Untersuchung unter dem Einfluss der Direktiven. Bereits durch die bloße Anwesenheit Camerons, ungeachtet der Größe seiner Rolle, muss davon ausgegangen werden, dass Adlers Gestaltungsfreiräume und Einflussmöglichkeiten geringer und die Kontrolle des EH und später PWE weitreichender war.
Die Propaganda-Vorgabe, Hitler vermehrt persönlich zu attackieren und ihm die Schuld für den Krieg, die Verantwortung für die zahlreichen (deutschen) Opfer zu geben, stammte etwa aus dem September 1941. Zuvor galt Hitler in gewisser Weise als unantastbar in der Rundfunkpropaganda, da er aus Sicht Großbritannien einen noch zu spürbaren Rückhalt in der deutschen Bevölkerung genoss. Adler setzte diese neue Richtlinie vorbildlich und vor allem schnell um. Bereits am 7. Oktober debattierten Kurt und Willi in der Folge „Kurt und Willi on Hitlers Speech" über die Rede des Diktators vom 3. Oktober 1941 und dessen Schuld für die Leiden.261 Das Aufdecken der nationalsozialistischen Lügen geschah, wie auch bei „Frau Wernicke", häufig. Willi berichtete offen und regelmäßig über die unterschiedlichen Taktiken der NS-Propaganda.262 Dabei nutzte Adler weniger den Einsatz von Ironie, sondern schöpfte des dem Dialog zugrundeliegende Potenzial aus und ließ Kurt und Willi durch ihre verschiedenen Positionen und Ansichten die eingespeisten Informationen und Themen diskutieren. Beide Charaktere hatten vor allem zu Beginn wenig bis kein Identifikationspotenzial, doch Kurt entwickelte sich zunehmend zu einer hinterfragenden und skeptischen Figur, die zum „Repräsentant des typischen Deutschen"263 und dadurch auch zu Verkörperung des britischen Deutschlandbildes und dessen Wandel im Verlauf des Kriegs mutierte.264 Kurt und Willi erinnerten die Hörerschaft fast schon redundant an Hitlers gebrochene Versprechen vom Endsieg oder nicht mehr realisierbaren Invasion Englands - die zwei zentralen Lügen, die auch bei „Frau Wernicke" entlarvt wurden. Adler inszenierte den stattdessen realen Zweifrontenkrieg und die damit einhergehende Verlängerung des Leidens und Sterbens ebenfalls als Hitlers persönliche Schuld.265 Omnipräsent verhielt sich das stetige Enthüllen der deutschen Propagandatechniken. Da die Sendung insgesamt weniger komplex konstruiert und dafür tagesaktueller gewesen ist, wurden die propagandistischen Vorgaben direkter und (im Gegensatz zu „Frau Wernicke") auch ausnahmslos umgesetzt.266 Teilweise baute Adler - vermutlich nicht unbedingt aus eigenem Antrieb - zu intensiv die vielen Geheimdienstinformationen ein, worunter die Dramaturgie zu leiden hatte.267 Ab 1944 standen besonders die Sinnlosigkeit des Fortführen des Kriegs, die Stärke der Alliierten und die subversiven Rebellionsaufrufe im Zentrum der Rundfunksendung. Dabei verhielten sich die Charaktere weniger aggressiv als Frau Wernicke, auch wenn Kurt an Deutlichkeit und teilweise an wütenden Parolen dazugewann.268 Anhand der so unterschiedlichen Figuren konnte Adler seiner Hörerschaft ebenfalls gut verdeutlichen, wer nach dem Krieg etwas zu befürchten habe und wer nicht. Kurt entwickelte sich in den letzten Monaten mehr und mehr zu einer Identifikationsfigur und einem Sympathieträger, der „stellvertretend für viele andere Deutsche"269 agieren und auch eine gewisse Vorbildfunktion für die Hörerschaft einnehmen sollte.
Auch wenn die Direktiven, welche Adler umzusetzen hatte, bei beiden Sendereihen die gleichen waren, gestalteten sich die Freiräume und die persönlichen Einflussmöglichkeiten bei „Kurt und Willi" um einiges geringer. Inhaltlich womöglich am diversesten und dank der größeren Spannbreite auch eine breite Hörerschaft generierend, ist die Satiresendung noch stärker als Spiegelbild der britischen Propaganda zu betrachten. Kristina Moorehead geht so weit zu sagen, dass die „Eckpfeiler der britischen Propaganda nach Deutschland [...] sich am Grundtenor der Kurt und Willi-Sendungen"270 erkennen lassen würden. Der Einfluss der Rundfunksendung kann sicherlich als nicht zu unterschätzen eingeordnet, doch Adlers Einfluss auf diese Wirkung muss nüchtern betrachtet wohl eher als minimal bezeichnet werden.
5. Schlussbetrachtung
Wie lässt sich schlussendlich die Frage nach dem Einfluss der deutschsprachigen Emigrantinnen und Emigranten innerhalb der britischen Rundfunkpropaganda während des Zweiten Weltkriegs beantworten? Die schnelle Antwort würde lauten: Die Einflussmöglichkeiten waren gering, aber sie waren vorhanden und das Ausmaß hing stark von diversen Faktoren ab.
In dieser Arbeit konnten mit Thomas Mann und Bruno Adler zwar nur zwei Personen, die für den deutschen Dienst der BBC arbeiteten, untersucht werden, doch decken sie gewissermaßen durch ihre Unterschiedlichkeit das Spektrum größtenteils ab. Neben der Person selbst und der damit zusammenhängenden Faktoren - Mann als weltbekannter Literaturnobelpreisträger und Adler als weitestgehend Unbekannter, der zudem auch existentielle Schwierigkeiten im Exil hatte - sind es vor allem die äußeren Einflüsse gewesen, die über die Freiheiten und Möglichkeiten der ,enemy aliens' entschieden. Die überwachenden Kontrollinstanzen (die britischen Propagandaorgane) mussten sich erst zu funktionalen und strukturierten Organen entwickeln, wodurch die anfängliche Experimentierphase der Rundfunkpropaganda den einzelnen Angestellten, so auch den Emigrantinnen und Emigranten, mehr Freiräume ließ. Die stetigen Kompetenz-Streitigkeiten, personellen Veränderungen und Machtkämpfe begünstigten das Entstehen von Machtvakua, die beispielsweise Personen wie Walter Rilla, Robert Lucas oder auch Carl Brinitzer zu nutzen wussten. In jener Anfangsphase lag auch die Geburtsstunde der britischen Satiresendungen. Erst die Etablierung der PWE im August 1941 brachte feste Strukturen und umfassende Kontrolle in die Rundfunkpropaganda. Als Mittel der Überwachung und Kontrolle - von der während des Zweiten Weltkriegs definitiv gesprochen werden kann, da die Royal Charter defacto ausgesetzt wurde - fungierten die Direktiven und die damit einhergehende Selbstzensur. Ein nachträgliches Zensieren der Beiträge gab es in England nicht, dafür jedoch regelmäßige und umfassende Vorgaben für die Mitarbeiterinnen der Propagandamaschinerie, so auch der BBC. Die Direktiven lieferten nicht bloß die aktuellen Informationen des Geheimdienstes, sondern kommunizierten die Schwerpunkte, Themen und Ziele der zu diesem Zeitpunkt herrschenden Propagandastrategie. Bezüglich der konkreten Umsetzung hielten sich die Vorgaben meist eher zurück, wodurch den Redakteurinnen und Autorinnen eine gewisse künstlerische Freiheit übriggeblieben ist. Sie alle hatten sich der Selbstzensur zu unterwerfen, sofern sie nicht mit ernsten Konsequenzen (im schlimmsten Fall dem Verlust ihrer Anstellung) konfrontiert werden wollten, und zensierten ihre eigenen Meinungen und persönlichen Themen, Schwerpunkte und Ziele durch das Befolgen der Direktiven.
Wie im Falle Thomas Manns dargelegt wurde, war ein Verweigern einiger Anweisungen, sogar ohne ernstzunehmende Konsequenzen, möglich - sofern die Person eine exponierte Stellung innehatte. Darüber hinaus existierten mehrere (teils dauerhafte) Streitthemen zwischen Mann und seinen BBC- Vorgesetzten. Dazu zählten Manns Missmut und teilweise Ignoranz gegenüber der begrenzten Sendezeit, seine partielle Missachtung des britischen Wahrheitsgebots, seine diffamierende Sprache gegenüber der NS-Führung und die Debatte über die Unterscheidung zwischen den Nationalsozialisten und den vermeintlich unschuldigen deutschen Bürgern. Bei all den untersuchten Beispielen widersetzte sich Mann nicht nur, sondern ging eigene Wege und erwirkte sich teils auch mehr Freiheiten und Einflussmöglichkeiten (beispielsweise durch das Erreichen einer längeren Sendedauer). Die Direktiven haben Mann Vorgelegen und deren Grundtenor spiegelte sich auch in seinen Sendungen wider, doch er verstand die britischen Anweisungen vielmehr als Hinweise oder als einen groben Rahmen, in welchem er sich frei zu bewegen wusste. Wie vermutlich kaum ein anderer hat Mann die als freiwillig proklamierte Selbstzensur auch genau als solche gesehen. Nichtsdestotrotz folgte er neben den Schwerpunkten und der Grundidee der Sendung auch einigen Direktiven - vor allem nach Wiederaufnahme seiner Sendung in den letzten Kriegsmonaten geschah dies besonders deutlich. Der Autor nutzte jede Möglichkeit, seinen Einfluss zu erhöhen und seine eigene Meinung, Themen oder Stil zu vermitteln. Erinnert sei hierbei beispielsweise an seine Befolgung des „Nazi"-Wortverbots (vom EH) und der dennoch vorgenommenen Differenzierung zwischen dem deutschen Volk und der nationalsozialistischen Elite, sowie der sofortigen Verwendung des Wortes, nachdem die PWE die Kontrolle über die Rundfunkpropaganda übernahm, jedoch das Verbot nicht erneuerte. Insgesamt können Mann eine große Freiheit beim Schaffen seiner Sendung „Deutsche Hörer!" und ein umfangreicher Einfluss auf den Widerstand aus dem Äther attestiert werden.
Doch dabei verkörperte der selbsternannte Weltbürger keinesfalls die durchschnittliche emigrierte Person im Dienste der britischen Rundfunkpropaganda. Bruno Adler, der auch nicht verallgemeinernd für alle ,enemy aliens' stehen kann, passte dagegen besser in das Bild. Ohne eine personenbezogene Sonderstellung, die bereits den Raum der Freiheiten vergrößerte, erwies sich das Einflussnehmen innerhalb des deutschen Dienstes der BBC als bedeutend schwieriger. Die existentiellen Probleme, mit welchen die meisten Emigrantinnen und Emigranten zu kämpfen hatten, ließen ein Verweigern der Direktiven nicht als Option erscheinen. Adler musste sich anfangs den umfangreichen und konkreten (als Wünsche deklarierten) Vorgaben seiner Vorgesetzten fügen und befand sich spätestens nach seiner Anstellung im Geheimdienst, wodurch er an der Quelle der umfassenden Geheimdienstinformationen saß, vollends unter der Kontrolle der britischen Propagandaorgane. Diese zeigte sich in seinen beiden erfolgreichen Satiresendungen „Frau Wernicke" und „Kurt und Willi". Neben den inhaltlichen Unterschieden verfügte Adler bei „Frau Wernicke" über mehr Freiheiten und es ist eine individuellere Note zu erkennen als bei „Kurt und Willi". Letztgenannte wurde aufgrund der tagesaktuelleren und wohl auch wegen der auf ein männliches Zielpublikum konzipierten Ausrichtung als die bedeutendere Propagandawaffe betrachtet. Adler bekam mit Norman Cameron eine Kontrollinstanz in persona an die Seite gestellt. Zudem war die Figur des Willis das satirische Sprachrohr der britischen Rundfunkpropaganda. Teilweise wurde dieses Sprachrohr, mit dem reihenweise britische Geheimdienstinformationen verarbeitet und an die deutsche Hörerschaft übermittelt werden konnten, zu Lasten des Unterhaltungswertes exzessiv genutzt. „Kurt und Willi" war das Spiegelbild der britischen Deutschland-Propaganda. Die vorgegebenen Themen, die gründliche Überwachung und die stilistische und charakterliche Schwäche271 ließen Adler nahezu keine gestalterischen Freiräume. Anders sah dies bei seiner zweiten Satiresendung „Frau Wernicke" aus, deren Produktion - wohl aufgrund der Konzeption für die weibliche Hörerschaft - geringer kontrolliert wurde. Alle zentralen Schwerpunkte der Direktiven (Schuldfrage, subtiles Auffordern zum Widerstand, Offenlegung der zahlreichen NS- Lügen, alliierte Autorität stärken und Hitler die Schuld an der Zerstörung und dem Leiden der Deutschen geben) existierten bei „Frau Wernicke" ebenfalls. Stilistisch anspruchsvoller und mit verschiedenen Satiretechniken ausgestattet erwies sich die Produktion der Sendung abseits der thematischen Ebene bereits als diverser und ermöglichte Adler mehr Spielraum. Doch auch beim Inhalt konnten kleinere Abweichungen von den Vorgaben in dieser Arbeit dargelegt werden. Er ließ seine Protagonistin noch laut und deutlich zwischen den ,guten' Deutschen und der ,bösen' NS-Elite differenzieren und eine klare Darstellung der Deutschen in einer Opferrolle vornehmen, als die Direktiven dies nicht (mehr) vorsahen. Neben der zu erreichen versuchten Spaltung der deutschen Gesellschaft, entwickelte sich Gertrud Wernicke zu einer immer rebellischeren und aggressiveren Figur, die nicht mehr mittels geschickter Satire, sondern offen die Nationalsozialisten attackierte und direkt zur Rebellion aufrief. Adler wandte diesen aggressiven und fordernden Stil mehrere Monate bevor die Direktiven es verlangten an und schlug damit eventuell über die Strenge. Die genauen Gründe für die Absetzung der „Frau Wernicke" Sendung konnten nicht ermittelt werden, doch da diese Anfang 1944 (zudem eher unerwartet) kurze Zeit nach Frau Wernickes Radikalisierungsprozesses geschah, könnte eben jener ein Faktor gewesen sein. Adler reizte den Rahmen bei seiner zweiten Satiresendung weitestmöglich aus und ist (positiver betrachtet) mit seiner späten Frau Wernicke Version den Direktiven schlicht voraus gewesen. Das Schaffen einer so ideal passenden und auf allen Ebenen genial funktionierenden Figur, die eine große Hörerschaft über Jahre beim ,Inhalieren der Feindsender' begleitete und bewegte, ist ein Verdienst Adlers gewesen. Dieser und auch seine anderen (dezenten) Einflussnahmen bildeten einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zum Kampf im Äther gegen den Nationalsozialismus.
Schlussendlich lässt sich konstatieren, dass es einen sowohl redaktionellen als auch inhaltlichen Einfluss der deutschsprachigen Emigrantinnen und Emigranten innerhalb des britischen Rundfunks und der Propagandamaschinerie gegeben hat. Das Ausmaß ist im Normalfall gering gewesen und - wie anhand nur zweier Personen in dieser Arbeit dargelegt wurde - aufgrund der diversen äußeren und persönlichen Faktoren von Fall zu Fall unterschiedlich. Die Untersuchungen haben versucht, die verschiedenen Bereiche der Einflussnahme zu zeigen und im Abgleich zu den propagandistischen Vorgaben den persönlichen Einfluss zu extrahieren. Da keine validen Quellen bezüglich der Resonanz der britischen Rundfunkarbeit existieren, kann kein gichtiger' Erfolg gemessen werden. Doch die Niederlage und das Ende des Nationalsozialismus in Deutschland und die folgende Etablierung einer starken und wehrhaften Demokratie sind ein Erfolg, zu welchem die Rundfunksendungen - so auch deren (deutsche) Autorinnen und Autoren, Sprecherinnen und Sprecher, Redakteurinnen und Redakteure und Produzentinnen und Produzenten - einen wertzuschätzenden Teil beigetragen haben.
6. Quellen- und Literaturverzeichnis
Quellen
Adler, Bruno: Frau Wernicke. Kommentare einer„Volksjenossin", Uwe Naumann (Hrsg.), Mannheim 1990.
Interview mit Thomas Mann: Mann Finds U.S. Sole Peace Hope, in: The New York Times, 22.02.1938, S. 13, URL: https://t'mesmachine.nyt'mes.com/t'mesmachine/1938/02/22/98100682.html?pageNumber=13, letzter Zugriff am 25.11.2023.
Mann, Thomas: Briefwechsel mit Agnes E. Meyer 1937-1955, Hans Rudolf Vaget (Hrsg.), Frankfurt am Main 1992.
Mann, Thomas: Deutsche Hörer! Radiosendungen nach Deutschland aus den Jahren 1940-1945, 5. Aufl., Frankfurtam Main 2013.
Mann, Thomas: Fort mit den Konzentrationslagern!, in: Herman Kurzke / Stephan Stachorski (Hrsg.): Achtung, Europa! 1933-1938, Bd. 4 (Thomas Mann Essays), Frankfurt am Main 1995.
Mann, Thomas: Tagebücher 1940-1943, Peter Mendelsohn (Hrsg.), Frankfurt am Main 1982.
Mann, Thomas: Zu seiner Ausbürgerung, in: Herman Kurzke / Stephan Stachorski (Hrsg.): Achtung, Europa! 1933-1938, Bd. 4 (Thomas Mann Essays), Frankfurt am Main 1995.
Literatur
Balfour, Michael: Propaganda in War 1939-1945. Organisations, Policies and Publics in Britain and Germany, London 1979.
Balfour, Michael: Der Deutsche Dienst der BBC und die britische Deutschlandpolitik. Zum Verhältnis von britischer Regierung und Propagandainstitutionen im Zweiten Weltkrieg, in: Müller, Klaus-Jürgen u. Dilks, David N. (Hrsg.): Großbritannien und derdeutscheWiderstand 1933-1945, Paderborn 1997, S. 137-160
Boes, Tobias: Thomas Manns Krieg. Literatur und Krieg im amerikanischen Exil, Göttingen 2021.
Brinitzer, Carl: Hier spricht London. Von einem der dabei war, Hamburg 1969.
Brinson, Charmian u. Dove, Richard: Working for the War Effort. German-Speaking Refugees in British Propaganda During the Second World War, Portland 2021.
Crome, Erhard: Deutsche Hörer! Die Radiosendungen von Thomas Mann, 2019, in: Berliner Debatte Initial 30/1, S. 105-114.
Eiber, Ludwig: Verschwiegene Bündnispartner. Die Union deutscher sozialistischer Organisationen in Großbritannien und die britischen Nachrichtendienste, in: Krohn, Claus-Dieter et al. (Hrsg.): Exilforschung. Ein Internationales Jahrbuch (Band 15), München 1997.
Fröschle, Ulrich: Das andere Deutschland. Zur Topik der Ermächtigung, in: Nickel, Gunther (Hrsg.): Literarische und politsche Deutschlandkonzepte 1938-1949. Göttingen 2004, S. 47-85.
Görtemarker, Manfred: Thomas Mann und die Politk, Frankfurt am Main 2005.
Graham, Kirk Robert: Britsh Subversive Propaganda Duringthe Second World War. Germany, Nato- nal Socialism and the Politcal Warfare Executve, Cham 2021.
Langels, Otto: 100Jahre BBC. Unabhängig, objektv, aber nicht ohne Fehler, Deutschlandfunk 17.10.2022, URL: https://www.deutschlandfunk.de/100-jahre-bbc-100.html, letzterZugriffam 12.11.2023.
LEMO, Volksempfänger VE 301 dyn, URL: https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/ak202881, letzter Zugriff am 20.11.2023.
Loewy, Ernst: Exil. Literarische und politsche Texte aus dem deutschen Exil 1933-1945, Stuttgart 1979.
Lucas, Robert: Über den Gefreiten Hirnschal und seine Briefe, in: Literatur und Kritk, Heft 128, September 1978.
Marcuse, Ludwig: Mein zwanzigstes Jahrhundert. Auf dem Weg zu einer Autobiographie, Zürich 1975.
Moorehead, Kristna: Satre als Kriegswaffe. Strategien der britschen Rundfunkpropaganda im Zweiten Weltkrieg, Marburg 2016.
Müller, Klaus-Jürgen u. Dilks, David N. (Hrsg.): Großbritannien und der deutsche Widerstand 19331945, Paderborn 1997.
Naumann, Uwe: Kampf auf Ätherwellen. Die deutschsprachigen Satren der BBC im Zweiten Weltkrieg, in: Keine Klage über England? Deutsche und österreichische Exilerfahrungen in Großbritannien 1933-1945, Dove, Richard et. al. (Hrsg.), München 1998, S. 31-38.
Papcke, Sven: Das Andere Deutschland. Exil und Widerstand als Verpflichtung. In: Gewerkschaftliche Monatshefte. 5. Jahrgang (1995), S. 282-295.
Pikulik, Lothar: Thomas Mann und der Faschismus. Wahrnehmung - Erkenntnisinteresse - Widerstand, Bd. 90 (Germanistsche Texte und Studien), Hildesheim/New York/Zürich 2013.
Plock, Vike Martna: The BBC German Service during the Second World War. Broadcastng to the Enemy, Cham 2021.
Pütter, Conrad: Rundfunk gegen das „Dritte Reich". Deutschsprachige Rundfunkaktvitäten im Exil 1933-45. Ein Handbuch. Rundfunkstudien Bd. 3. München 1986.
Pütter, Conrad: Hier ist England. Der Ätherkrieg gegen das „Dritte Reich", in: Paul, Gerhard u. Schock, Ralph (Hrsg.): Sound des Jahrhunderts. Geräusche, Töne, Stmmen 1889 bis heute, Bonn 2013.
Raulff, Ulrich u. Strittmatter, Ellen (Hrsg.): Thomas Mann in Amerika, Marbach am Neckar 2018.
Slattery, J. F.: Thomas Mann und die B.B.C. Die Bedingungen ihrer Zusammenarbeit 1940-1945, in: Thomas Mann Jahrbuch, Bd. 5 (1992), S. 142-170.
Später, Jörg: Vansittart. Britsche Debatten über Deutsche und Nazis 1902-1945, Göttingen 2003.
The BBCStory, URL: https://www.bbc.com/historyofthebbc/tmelines/1920s/, letzterZugriffam 12.11.2023.
Vaget, Hans Rudolf: Thomas Mann, der Amerikaner. Leben und Werk im amerikanischen Exil 19381952, Frankfurt am Main 2011.
Vaget, Hans Rudolf: Thomas Mann und der deutsche Widerstand. Zur Deutschland-Thematik im Doktor Faustus, in: Krohn, Claus-Dieter (Hrsg.): Exil und Widerstand, München 1997, S. 88-101.
Valentin, Sonja: „Steine in Hitlers Fenster". Thomas Manns Radiosendungen Deutsche Hörer! (19401945), 2. Aufl., Göffingen 2015.
Warkentin, Erwin J.: The Political Warfare Executive Syllabus Volume I. A Crash Course in Mass Deception, Cambridge 2019.
Weiskopf, Franz Carl: Unter fremden Himmeln. Ein Abriß der deutschen Literatur im Exil 1933-1947, Berlin 1948.
West, William J.: Truth Betrayed, London 1987.
Wolbold, Matthias: Reden über Deutschland. Die Rundfunkreden Thomas Manns, Paul Tillichs und Sir Robert Vansittarts aus dem Zweiten Weltkrieg, in: Schüßler, Werner u. Sturm, Erdmann (Hrsg.): Tillich- Studien (Band 17), Münster 2005.
Nachschlagewerke
Bruno Adler, In: Internationales Germanistenlexikon 1800-1950, hrsg. von Christoph König und Birgit Wägenbräu, Berlin, S. 6-9.
Bruno Maria Adler, Biographisches Handbuch deutschsprachiger Kunsthistoriker im Exil. Leben und Werk der unter dem Nationalsozialismus verfolgten und vertriebenen Wissenschaftler, hrsg. Von Ulrike Wendland. Bd. 1. A-K, München, S. 1-3.
[...]
1 Auch als die „Schicksalssinfonie" bekannt.
2 Zitiert nach: Conrad Pütter: Hier ist England. Der Ätherkrieg gegen das „Dritte Reich", in: Gerhard Paul u. Ralph Schock (Hrsg.): Sound des Jahrhunderts. Geräusche, Töne, Stimmen 1889 bis heute, Bonn 2013, S. 230.
3 Michael Balfour nennt beispielsweise für das Jahr 1944 eine Hörerzahl von 10 bis 15 Millionen, wovon viele jedoch außerhalb der Reichsgrenzen zu verorten gewesen sind, vgl. Michael Balfour: Propaganda in War 19391945. Organisations, Policies and Publics in Britain and Germany, London 1979, S. 96.
4 Vgl. Conrad Pütter: Rundfunk gegen das „Dritte Reich". Deutschsprachige Rundfunkaktivitäten im Exil 1933-45. Ein Handbuch. Rundfunkstudien Bd. 3. München 1986, S. 11.
5 Vgl. Ernst Loewy: Exil. Literarische und politische Texte aus dem deutschen Exil 1933-1945, Stuttgart 1979, S. 37.
6 Vgl. Matthias Wolbold: Reden über Deutschland. Die Rundfunkreden Thomas Manns, Paul Tillichs und Sir Robert Vansittarts aus dem Zweiten Weltkrieg, in: Werner Schüßler u. Erdmann Sturm (Hrsg.): Tillich-Studien (Band 17), Münster 2005, S. 47.
7 Vgl. Ludwig Eiber: Verschwiegene Bündnispartner. Die Union deutscher sozialistischer Organisationen in Großbritannien und die britischen Nachrichtendienste, in: Claus-Dieter Krohn et al. (Hrsg.): Exilforschung. Ein Internationales Jahrbuch (Band 15), München 1997, S. 68.
8 Wolbold, Reden über Deutschland, S. 47.
9 Franz Carl Weiskopf: Unter fremden Himmeln. Ein Abriß der deutschen Literatur im Exil 1933-1947, Berlin 1948, S. 69.
10 Franz Carl Weiskopf: Unter fremden Himmeln. Ein Abriß der deutschen Literatur im Exil 1933-1947, Berlin 1948, S. 69.
11 Die BBC setzte auf den Einsatz empfangsstarker Mittel- und Langwellen und auf verschiedene Frequenzen, sodass die deutschen Störsender kaum erfolgreich die Qualität mindern konnten, vgl. dazu Klaus-Jürgen Müller u. David N. Dilks. (Hrsg.): Großbritannien und derdeutsche Widerstand 1933-1945, Paderborn 1997, S. 112.
12 Vgl. Conrad Pütter: Rundfunk gegen das „Dritte Reich". Deutschsprachige Rundfunkaktivitäten im Exil 1933 45. Ein Handbuch. Rundfunkstudien Bd. 3. München 1986, S. 10.
13 Vgl. Pütter, Rundfunk gegen das „Dritte Reich", S. 12.
14 Die getroffene Auswahl impliziert ausschließlich Personen männlichen Geschlechts.
15 Thomas Mann: Deutsche Hörer! Radiosendungen nach Deutschland aus den Jahren 1940-1945, 5. Aufl., Frankfurt am Main 2013.
16 Siehe zur Thematik „Das andere Deutschland" u.a. Ulrich Fröschle: Das andere Deutschland. Zur Topik der Ermächtigung. In: Nickel, Gunther (Hrsg.): Literarische und politische Deutschlandkonzepte 1938-1949, Göttingen 2004, S. 47-85. und Sven Pap>
17 Bruno Adler: Frau Wernicke. Kommentare einer Volksgenossin, Uwe Naumann (Hrsg.), Mannheim 1990.
18 Vgl. Kristina Moorehead: Satire als Kriegswaffe. Strategien der britischen Rundfunkpropaganda im Zweiten Weltkrieg, Marburg 2016, S. 310 u. S. 326.
19 Kristina Moorehead: Satire als Kriegswaffe. Strategien der britischen Rundfunkpropaganda im Zweiten Weltkrieg, Marburg 2016.
20 Sonja Valentin: „Steine in Hitlers Fenster". Thomas Manns Radiosendungen Deutsche Hörer! (1940-1945), 2. Aufl., Göffingen 2015.
21 Conrad Pütter: Rundfunkgegen das „Dritte Reich". Deutschsprachige Rundfunkaktivitäten im Exil 1933-45. Ein Handbuch. Rundfunkstudien Bd. 3. München 1986
22 Matthias Wolbold: Reden über Deutschland. Die Rundfunkreden Thomas Manns, Paul Tillichs und Sir Robert Vansittarts aus dem Zweiten Weltkrieg, in: Werner Schüßler u. Erdmann Sturm (Hrsg.): Tillich-Studien (Band 17), Münster 2005.
23 Charmian Brinson und Richard Dove: Working for the War Effort. German-Speaking Refugees in British Propaganda During the Second World War, Portland 2021.
24 Kirk Robert Graham: British Subversive Propaganda During the Second World War. Germany, National Socialism and the Political Warfare Executive, Cham 2021.
25 Carl Brinitzer: Hier spricht London. Von einem der dabei war, Hamburg 1969.
26 Vgl. Brinitzer, Hier spricht London.
27 Brinitzer, Hier spricht London, S. 18.
28 Vgl. The BBC Story, URL: https://www.bbc.com/historyofthebbc/timelines/1920s/, letzter Zugriff am 12.06.2023.
29 Vgl. Otto Langels: 100 Jahre BBC. Unabhängig, objektiv, abernicht ohne Fehler, Deutschlandfunk 17.10.2022, URL: https://www.deutschlandfunk.de/100-jahre-bbc-100.html, letzterZugriff am 12.11.2023.
30 Vgl. The BBC Story.
31 Vgl. Wolbold, Reden über Deutschland, S. 48.
32 Vgl. Wolbold, Reden über Deutschland, S. 48.
33 Vgl. Pütter, Hier ist England, S. 230.
34 Vgl. Pütter, Hier ist England, S. 230.
35 Vgl. Vike Martina Plock: The BBC German Service during the Second World War. Broadcasting to the Enemy, Cham 2021, S. 8-9.
36 Vgl. William J. West: Truth Betrayed, London 1987, S. 142.
37 Brinitzer, Hier spricht London, S. 26.
38 Vgl. Wolbold, Reden über Deutschland, S. 49.
39 Vgl. Pütter, Hier ist England, S. 231.
40 Während der intensiven Bombardements wurde beispielsweise auch das Funkhaus in London im Oktober und Dezember 1940 getroffen. Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 96.
41 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 96-97.
42 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 98.
43 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 57.
44 „Über den Volksempfänger gelangte die NS-Propaganda direkt in die Wohnzimmer der Deutschen. Dieses Gerät kostete 65 Reichsmark und sollte so vor allem die ärmeren Schichten erreichen. Das Gerücht, der Volksempfänger sei so gebaut wurden, dass nur deutsche und keine "Feindsender" empfangen werden konnten, entbehrt jeder Grundlage. Die Typenbezeichnung 301 verwies auf den 30. Januar 1933, den Tag der nationalsozialistischen Machtübernahme." Siehe LEMO, Volksempfänger VE 301 dyn, URL: https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/ak202881, letzter Zugriff am 20.11.2023.
45 Vgl. Brinson/Dove, Working for the War Effort, S. 7.
46 Vgl. Pütter, Rundfunk gegen das „Dritte Reich", S. 81.
47 Vgl. Brinson/Dove, Working for the War Effort, S. 131.
48 Vgl. Pütter, Hier ist England, S. 231.
49 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 93.
50 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 102.
51 Brinitzer, Hier spricht London, S. 79.
52 Brinitzer, Hier spricht London, S. 79.
53 Brinitzer, Hier spricht London, S. 79.
54 Vgl. Brinson/Dove, Working for the War Effort, S. 84.
55 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 108.
56 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 96.
57 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 94.
58 Vgl. Graham, British Subversive Propaganda During the Second World War, S. 3.
59 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 100.
60 Vgl. Brinson/Dove, Working for the War Effort, S. 120.
61 Vgl. Brinson/Dove, Working for the War Effort, S. 117.
62 Vgl. Balfour, Der Deutsche Dienst der BBC und die britische Deutschlandpolitik, S. 140-141.
63 Vgl. Erwin J. Warkentin: The Political Warfare Executive Syllabus Volume I. A Crash Course in Mass Deception, Cambridge 2019, S. 6-7.
64 Vgl. Warkentin, The Political Warfare Executive Syllabus Volume I, S. 2-3.
65 Vgl. Graham, British Subversive Propaganda During the Second World War, S. 2.
66 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 65.
67 Vgl. Brinson/Dove, Working for the War Effort, S. 125.
68 Vgl. Brinson/Dove, Working for the War Effort, S. 125.
69 Vgl. Balfour, Der Deutsche Dienst der BBC und die britische Deutschlandpolitik, S. 140.
70 Vgl. Brinson/Dove, Working for the War Effort, S. 133.
71 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 113.
72 Vgl. Brinson/Dove, Working for the War Effort, S. 142.
73 Vgl. Brinson/Dove, Working for the War Effort, S. 143.
74 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 157.
75 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 157.
76 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 195.
77 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 234.
78 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 234.
79 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 266.
80 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 266.
81 Thomas Mann: Deutsche Hörer! Radiosendungen nach Deutschland aus den Jahren 1940-1945, 5. Aufl., Frankfurt am Main 2013, S. 22.
82 Mann,DH,S.22.
83 Mann, DH, S. 22.
84 Siehe dazu vor allem die politischen Essays Manns in: Herman Kurzke / Stephan Stachorski (Hrsg.): Achtung, Europa! 1933-1938, Bd. 4 (Thomas Mann Essays), Frankfurt am Main 1995.
85 Tobias Boes: Thomas Manns Krieg. Literatur und Krieg im amerikanischen Exil, Göffingen 2021, S. 11.
86 Thomas Mann: Fort mit den Konzentrationslagern!, in: Herman Kurzke /Stephan Stachorski (Hrsg.): Achtung, Europa! 1933-1938, Bd. 4 (Thomas Mann Essays), Frankfurt am Main 1995, S. 179.
87 Vgl. Mann, Zu seiner Ausbürgerung, in: Achtung Europa, S. 180.
88 Mann, Zu seinerAusbürgerung, in: Achtung Europa, S. 180.
89 Lothar Pikulik: Thomas Mann und der Faschismus. Wahrnehmung - Erkenntnisinteresse - Widerstand, Bd. 90 (Germanistische Texte und Studien), Hildesheim/New York/Zürich 2013, S. 168.
90 Vgl. Valentin, Steine in Hitlers Fenster, S. 22-26.
91 Vgl. J. F. Slattery: Thomas Mann und die B.B.C. Die Bedingungen ihrer Zusammenarbeit 1940-1945, in: Thomas Mann Jahrbuch, Bd. 5 (1992), S. 142-170, hier S. 146.
92 Vgl. Slattery, Thomas Mann und die BBC, S. 146.
93 Vgl. Valentin, Steine in Hitlers Fenster, S. 32.
94 Vorwort DH, S. 7.
95 Vgl. Valentin, Steine in Hitlers Fenster, S. 32.
96 Vgl. Valentin, Steine in Hitlers Fenster, S. 35.
97 Agnes E. Meyer über Thomas Mann, in: Thomas Mann: Briefwechsel mit Agnes E. Meyer 1937-1955, Hans Rudolf Vaget (Hrsg.), Frankfurt am Main 1992, S. 8.
98 Vgl. Slattery, Thomas Mann und die BBC, S. 145.
99 Vgl. Valentin, Steine in Hitlers Fenster, S. 10.
100 Vgl. Wolbold, Reden über Deutschland, S. 170.
101 Vgl. Manfred Görtemarker: Thomas Mann und die Politik, Frankfurt am Main 2005, S. 129.
102 Vgl. Erhard Crome: Deutsche Hörer! Die Radiosendungen von Thomas Mann, 2019, in: Berliner Debatte Initial 30/1, S. 109.
103 Vgl. Valentin, Steine in Hitlers Fenster, S. 94.
104 Vgl. Crome, Deutsche Hörer, S. 109.
105 Mann, DH, S. 21.
106 Mann, DH, S. 21.
107 Vgl. Mann, DH, S. 20f.
108 Mann, DH, S. 83.
109 Mann, DH, S. 94.
110 Mann, DH, S. 62.
111 Mann, DH, S. 116.
112 Mann, DH, S. 90.
113 Mann, DH, S. 91.
114 Mann, DH, S. 107.
115 Mann, DH, S. 105.
116 Mann, DH, S. 33.
117 Mann, DH, S. 33.
118 Vgl. Woldbold, Reden über Deutschland, S. 216.
119 Vgl. Woldbold, Reden über Deutschland, S. 216.
120 Brinitzer, Hier spricht London, S. 78.
121 Vgl. Valentin, Steine in Hitlers Fenster, S. 27-31.
122 Tagebuch Mann, 28.5.1941.
123 Vgl. Valentin, Steine in Hitlers Fenster, S. 29.
124 Vgl. Valentin, Steine in Hitlers Fenster, S. 37.
125 Vgl. Wolbold, Reden über Deutschland, S. 178.
126 Tagebuch Mann, 15.1.1943.
127 Vgl. Mann, DH, S. 23.
128 Vgl. Sonja Valentin, S. 50.
129 Görtemaker, Thomas Mann und die Politik, S. 131.
130 Wolbold, Reden über Deutschland, S. 80.
131 Interview mit Thomas Mann: Mann Finds U.S. Sole Peace Hope, in: The New York Times, 22.02.1938, S. 13, URL: https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1938/02/22/98100682.html?pageNumber=13, letzter Zugriff am 25.11.2023.
132 Die Aussage stieß wenig überraschend bei deutschen Schriftstellerkollegen im Exil nur bedingt aufSympathie und Manns alleiniger Repräsentationsanspruch war nicht zuletzt auch ein Faktor für die nach dem Krieg entflammende ,große Kontroverse' mit den Vertretern der sogenannten Inneren Emigration'.
133 Vgl. Ulrich Raulff und Ellen Strittmatter (Hrsg.): Thomas Mann in Amerika, Marbach am Neckar 2018, S. 95.
134 Vgl. Wolbold, Reden über Deutschland, S. 218.
135 Die Auseinandersetzung mit dieser würde den Rahmen der Arbeit sprengen, weshalb weiter auf die in seinen Rundfunksendungen getätigten Aussagen Bezug genommen werden soll.
136 Ludwig Marcuse: Mein zwanzigstes Jahrhundert. Auf dem Weg zu einer Autobiographie, Zürich 1975, S. 289.
137 Woldbold, Reden über Deutschland, S. 220.
138 Woldbold, Reden über Deutschland, S. 220.
139 Interview mit Thomas Mann: Mann Finds U.S. Sole Peace Hope, in: The New York Times, 22.02.1938, S. 13.
140 Vgl. Vaget, Thomas Mann, der Amerikaner, S. 417.
141 Vgl. Tagebuch, 01.06.1941, S. 274.
142 Tagebuch, 01.06.1941, S. 274.
143 Vgl. Graham, British Subversive Propaganda During the Second World War, S. 85.
144 Jörg Später: Vansittart. Britische Debatten über Deutsche und Nazis 1902 - 1945, Göttngen 2003, S. 136137.
145 Vaget, Thomas Mann, der Amerikaner, S. 418.
146 Vaget, Thomas Mann, der Amerikaner, S. 420.
147 Vaget, Thomas Mann, der Amerikaner, S. 421.
148 Vaget, Thomas Mann, der Amerikaner, S. 421.
149 Zu den fünf Thesen vgl. Vaget, Thomas Mann, der Amerikaner, S. 420-421.
150 Vgl. Graham, British Subversive Propaganda During the Second World War, S. 83.
151 Die Doppelmoral, beispielsweise in Bezug auf das angeprangerte deutsche Streben nach Weltherrschaft einerseits und die Glorifizierung des Empire andererseits, oder auch die eigenen Widersprüche, wie die natürliche Aggressivität der Deutschen und dennoch sprach Vansittart von einer möglichen Umerziehung und räumte auch einen Prozentsatz ,guter' Deutscher ein, sind deutlich erkennbar.
152 Vgl. Jörg Später: Vansittart. Britische Debatten über Deutsche und Nazis 1902 - 1945, Göffingen 2003, S. 136138.
153 Vgl. Graham, British Subversive Propaganda During the Second World War, S. 90.
154 Mann, DH, S. 34.
155 Mann, DH, S. 35.
156 Mann, DH, S. 102.
157 Vgl. Vaget, Thomas Mann, der Amerikaner, S. 430-433.
158 Vgl. Valentin, Steine in Hitlers Fenster, S. 92.
159 Vgl. Vaget, Thomas Mann, der Amerikaner, S. 427.
160 Vgl. Valentin, Steine in Hitlers Fenster, S. 232.
161 Mann, DH, S. 15.
162 Mann, DH, S. 18f.
163 Mann, DH, S. 37.
164 Mann, DH, S. 38.
165 Mann, DH, S. 62.
166 Hans Rudolf Vaget: Thomas Mann und der deutsche Widerstand. Zur Deutschland-Thematik im Doktor Faustus, in: Krohn, Claus-Dieter (Hrsg.): Exil und Widerstand, München 1997, S. 90.
167 Vgl. Vaget, Thomas Mann und der dt. Widerstand, S. 92.
168 Mann, DH, S. 23.
169 Mann, DH, S. 24.
170 Mann, DH, S. 24.
171 Mann, DH, S. 24.
172 Mann, DH, S. 25.
173 Vgl. Mann, DH, S. 25.
174 Vgl. Valentin, Steine in Hitlers Fenster, S. 233.
175 Vgl. Valentin, Steine in Hitlers Fenster, S. 233.
176 Mann, DH, S. 133.
177 Mann, DH, S. 132.
178 Mann, DH, S. 142.
179 Mann, DH, S. 136.
180 Mann, DH, S. 135.
181 Mann, DH, S. 134.
182 Vgl. Bruno Maria Adler, Biographisches Handbuch deutschsprachiger Kunsthistoriker im Exil. Leben und Werk der unter dem Nationalsozialismus verfolgten und vertriebenen Wissenschaftler, hrsg. Von Ulrike Wendland. Bd. 1. A-K, München, S. 1-3.
183 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 305.
184 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 305.
185 DLA Alder, 20.03.1968, zitiert nach: Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 306.
186 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 300.
187 Die Satiresendung „Die zwei Genossen" war mehr oder weniger ein Abziehbild von „Kurt und Willi", nur diesmal im Kontext des geteilten Deutschlands und der drohenden kommunistischen Gefahr.
188 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 306.
189 DLA Adler, Ostern 1947, zitiert nach: Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 307.
190 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 307.
191 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 308.
192 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 312.
193 Vgl. Brinson/Dove, Working fort the War Effort, S. 133.
194 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 11.
195 Vgl. Robert Lucas: Über den Gefreiten Hirnschal und seine Briefe, in: Literatur und Kritik, Heft 128, September 1978, S. 454.
196 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 13.
197 Uwe Naumann: KampfaufÄtherwellen. Die deutschsprachigen Satiren der BBC im Zweiten Weltkrieg, in: Keine Klage über England? Deutsche und österreichische Exilerfahrungen in Großbritannien 1933-1945, Richard Dove et. al. (Hrsg.), München 1998, S. 37.
198 Naumann, KampfaufÄtherwellen, S. 38.
199 Naumann, KampfaufÄtherwellen, S. 38.
200 Brinitzer, Hier spricht London, S. 121.
201 Brinitzer, Hier spricht London, S. 113.
202 Brinitzer, Hier spricht London, S. 113.
203 Vgl. Brinson/Dove, Working fort the War Effort, S. 133.
204 Vgl. Brinson/Dove, Working fort the War Effort, S. 133.
205 Die Satiresendung von Robert Lucas sollte ursprünglich ausführlich in dieser Arbeit untersucht werden. Das Vorhaben erwies sich jedoch als zu umfangreich, weshalb eine Entscheidung zwischen Adler und Lucas gefällt werden musste, wobei die Wahl auf den stilleren und zurückhaltenden Charakter gefallen ist.
206 Brinitzer, Hier spricht London, S. 116.
207 Brinitzer, Hier spricht London, S. 115.
208 Vgl. Naumann, Kampf auf Ätherwellen, S. 35.
209 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 158.
210 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 169.
211 Brinitzer, Hier spricht London, S. 115.
212 Vgl. Brinson/Dove, Working fort the War Effort, S. 133.
213 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 158.
214 Vgl. Brinson/Dove, Working fort the War Effort, S. 135.
215 Nachwort von Uwe Naumann in: Adler, Bruno: Frau Wernicke. Kommentar einer „Volksjenossin", Uwe Naumann (Hrsg.), Mannheim 1990, S. 159.
216 Ebd., S. 168.
217 Vgl. ebd., S. 168.
218 Vgl. ebd., S. 166.
219 Vgl. Naumann, Kampf auf Ätherwellen, S. 32.
220 Naumann, KampfaufÄtherwellen, S. 32.
221 Naumann, KampfaufÄtherwellen, S. 31.
222 Vgl. Brinitzer, Hier spricht London, S. 116.
223 Vgl. Brinitzer, Hier spricht London, S. 118.
224 Brinitzer, Hier spricht London, S. 114.
225 Vgl. Brinitzer, Hier spricht London, S. 114.
226 Vgl. Naumann, Kampf auf Ätherwellen, S. 33.
227 Kristina Moorehead hat in ihrer Arbeit anhand der (von ihr in Erfahrung gebrachten) Titel dennoch eine abstrahierte Darstellung der ersten Staffel gewagt. Ihre Schlussfolgerungen sind überwiegend plausibel und schlüssig, erscheinen mir dennoch zu spekulativ und deren Verzicht ist aufgrund des Potentials der übrigen (und erhaltenden) Sendungen auch für meine Arbeit verzichtbar, da hier keine Darstellung der Entwicklung von Frau Wernicke anvisiert ist. Siehe dazu Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 115-118.
228 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 118.
229 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 118.
230 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 119.
231 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 120.
232 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 121.
233 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 122.
234 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 125.
235 Dabei handelt es sich lediglich um eine Annahme, die mit Vorsicht zu genießen ist. Das Gegenteil könnte ebenso der Fall sein, doch da bei der Untersuchung für keine Seite etwaige Hinweise gefunden wurden, liegt die Theorie der freien Schaffung des Charakters durch Adler näher, da die Direktiven i.d.R. (wie mehrfach dargelegt) die Themen und den Rahmen vorgaben, nicht aber konkrete Handlungsstränge oder Charakterentwicklungen oder Charaktereigenschaften.
236 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 132.
237 Vgl. Adler, Frau Wernicke, S. 24.
238 Adler, Frau Wernicke, S. 27.
239 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 240.
240 Adler, Frau Wernicke, S. 76.
241 Adler, Frau Wernicke, S. 76.
242 Adler, Frau Wernicke, S. 77.
243 Adler, Frau Wernicke, S. 77.
244 Adler, Frau Wernicke, S. 13.
245 Adler, Frau Wernicke, S. 26.
246 Adler, Frau Wernicke, S. 21.
247 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 235.
248 Adler, Frau Wernicke, S. 150.
249 Adler, Frau Wernicke, S. 95.
250 Adler, Frau Wernicke, S. 96.
251 Adler, Frau Wernicke, S. 109.
252 Adler, Frau Wernicke, S. 150.
253 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 236-237.
254 Womit ein Gegengewicht zu der nationalsozialistischen Angstpropaganda (für die Folgen einer deutschen Niederlage) gebildet werden sollte.
255 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 237.
256 Adler, Frau Wernicke, S. 106.
257 Adler, Frau Wernicke, S. 104.
258 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 240-241.
259 Adler, Frau Wernicke, S. 80.
260 Die meisten der Originalskripte können im Written Archives Centre der BBC eingesehen werden.
261 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 164-168.
262 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 171-172.
263 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 171.
264 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 171.
265 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 173.
266 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 175-176.
267 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 285.
268 Vgl. Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 285-288.
269 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 289.
270 Moorehead, Satire als Kriegswaffe, S. 172.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments "Inhaltsverzeichnis"?
Das Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schwerpunktthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält.
Was sind die Hauptabschnitte des Inhaltsverzeichnisses?
Die Hauptabschnitte sind: 1. Einleitung, 2. Die British Broadcasting Corporation und die britische Rundfunkpropaganda, 3. Thomas Mann, 4. Bruno Adler, 5. Schlussbetrachtung und 6. Quellen- und Literaturverzeichnis.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung behandelt die Fragestellung, Vorgehensweise und Methoden, das Quellenkorpus und den Forschungsstand im Zusammenhang mit der deutschsprachigen Rundfunkpropaganda der BBC während des Zweiten Weltkriegs.
Welche Themen werden im Abschnitt über die BBC und die britische Rundfunkpropaganda behandelt?
Dieser Abschnitt behandelt den deutschsprachigen Dienst der BBC ("Hier spricht London") sowie Propagandastrategien und Direktiven.
Worauf konzentriert sich der Abschnitt über Thomas Mann?
Der Abschnitt konzentriert sich auf Thomas Manns Zusammenarbeit mit der BBC, sein Konzept des "anderen Deutschlands", seinen Aufruf zum Widerstand, die Schuldfrage und wie Thomas Mann die Direktiven der BBC umsetzte.
Was wird im Abschnitt über Bruno Adler behandelt?
Der Abschnitt über Bruno Adler konzentriert sich auf die antifaschistische Satire als Mittel des Widerstands, Adlers Satiresendungen ("Frau Wernicke" und "Kurt und Willi") und wie diese Sendungen die Direktiven der BBC widerspiegelten.
Was wird in der Schlussbetrachtung zusammengefasst?
Die Schlussbetrachtung fasst die Haupterkenntnisse der Arbeit zusammen, insbesondere den Einfluss deutschsprachiger Emigranten auf das deutschsprachige Programm der BBC während des Zweiten Weltkriegs.
Welche Quellen werden im Quellen- und Literaturverzeichnis aufgeführt?
Das Verzeichnis listet sowohl Primärquellen (z.B. Sendemanuskripte, Tagebücher, Briefe) als auch Sekundärliteratur (wissenschaftliche Arbeiten, Bücher, Artikel) auf, die für die Arbeit verwendet wurden.
Welche Fragestellung wird in der Arbeit primär behandelt?
Die primäre Frage ist, inwiefern die ausgewählten Emigranten innerhalb des britischen Rundfunks die Möglichkeit hatten, Einfluss auf das deutschsprachige Programm der BBC während des Zweiten Weltkrieges zu nehmen und welche Rolle sie im Kampf gegen den Nationalsozialismus spielten.
Welche Vorgehensweise und Methoden werden in der Arbeit angewandt?
Die Arbeit kombiniert eine Analyse der administrativen Prozesse und Propagandadirektiven mit einer induktiven Analyse von Sendemanuskripten, Tagebucheinträgen und Briefen. Die Erkenntnisse werden in den Gesamtkontext der britischen Rundfunkpropaganda und des Exils eingeordnet.
Wer waren Hugh Carlton Greene und Bruce Lockhart?
Hugh Carlton Greene war Chefredakteur und Leiter des deutschen Dienstes der BBC. Bruce Lockhart war Leiter der Political Warfare Executive, der die Verantwortung für alle Rundfunkaktivitäten im Ausland trug.
Was war das Political Intelligence Department (PID)?
Das PID war das Political Intelligence Department und arbeitete offiziell unter dem Deckmantel der Special Operations Executive (SOE).
Was war die Aufgabe des Department for Propaganda in Enemy Countries (EH)?
Die Aufgabe des Department for Propaganda in Enemy Countries (EH) war es, die Propagandastrategie im Feindesland zu koordinieren.
Details
- Titel
- Die Rolle deutschsprachiger Emigranten innerhalb der britischen Rundfunkpropaganda gegen das nationalsozialistische Deutschland während des Zweiten Weltkrieges
- Hochschule
- Universität Kassel
- Note
- 1,5
- Autor
- Y. Walter-Lanzenberger (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2023
- Seiten
- 54
- Katalognummer
- V1477228
- ISBN (Buch)
- 9783389026717
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Nationalsozialismus Thomas Mann Bruno Adler Rundfunk Propaganda Widerstand Exil Radio Satire BBC Widerstand aus dem Exil Rundfunkpropaganda Emigranten Zweiter Weltkrieg
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Y. Walter-Lanzenberger (Autor:in), 2023, Die Rolle deutschsprachiger Emigranten innerhalb der britischen Rundfunkpropaganda gegen das nationalsozialistische Deutschland während des Zweiten Weltkrieges, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1477228
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









