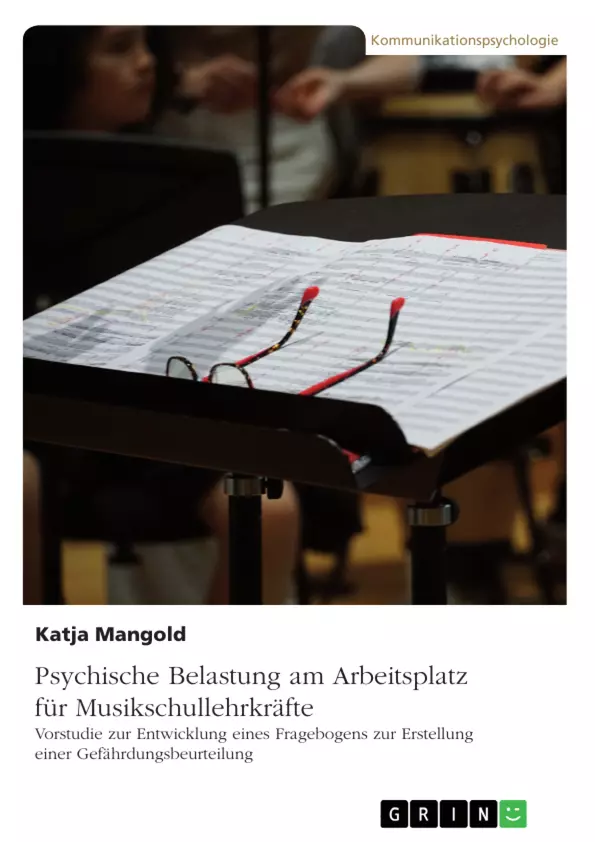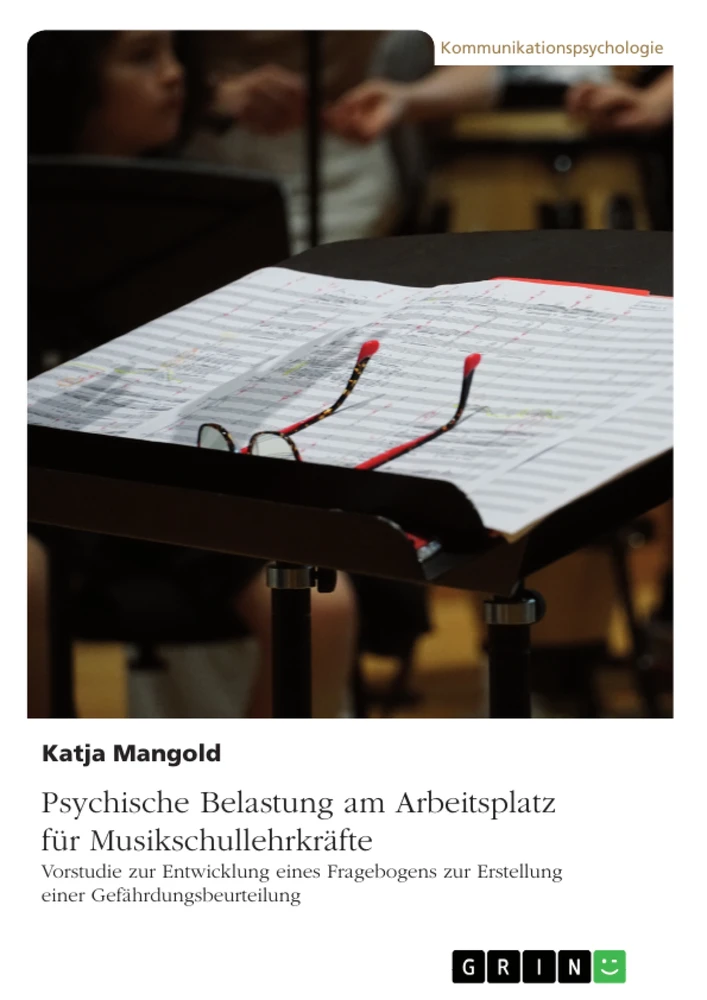
Psychische Belastung am Arbeitsplatz für Musikschullehrkräfte
Masterarbeit, 2023
128 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhalt
Inhalt...II
Danksagung...V
Widmung...V
Abstract...VI
Verzeichnisse...IX
Abbildungsverzeichnis...IX
Tabellenverzeichnis...XI
Verzeichnis der Abkürzungen...XI
1 Einleitung...1
1.1 Herleitung der Forschungsfrage...2
2 Hintergründe - Situationsanalyse...3
2.1 Berufsbild Musikschullehrkraft im Wandel...3
2.2 Musikschule als Arbeitsort...5
2.2.1 Organisation -Trägerschaft...7
2.2.2 Arbeitsort...7
2.2.3 Arbeitszeit...8
3 Psychische Belastungen in der Arbeitswelt...10
3.1 Begriffliche Abgrenzung...10
3.2 Theoretische Grundlagen...12
3.2.1 Anforderungs-Kontroll-Modell – Robert Karasek...12
3.2.2 Modell beruflicher Gratifikationskrisen (effort-reward imbalance model) – Johannes Siegrist...12
3.2.3 Transaktionales Stressmodell - Lazarus & Folkman...13
3.2.4 Konzept psychische Belastungen durch Regulationsbehinderungen...14
3.2.5 Salutogenese – Antonovsky...15
3.2.6 Systemisches Anforderungs-Ressourcen-Modell (SAR-Modell) der Gesundheit – Peter Becker...16
3.3 Arbeitsschutzrechtliche Anforderungen: die Gefährdungs- beurteilung...18
3.3.1 Gesetzliche Grundlagen: § 5 Arbeitsschutzgesetz...18
3.3.2 Der Prozess der Gefährdungsbeurteilung „psychische Belastung“...19
3.3.3 Situation an Musikschulen...20
4 Vorstudie zur Fragebogenentwicklung...21
4.1 Methodik...21
4.2 Datenerhebung...23
4.2.1 Beschreibung der Stichprobe allgemein...23
4.2.2 Erhebungsprozess...24
4.3 Allgemeine Anmerkungen zur Auswertung...25
4.4 Analyse der Ergebnisse...27
4.4.1 Persönliche Angaben und beruflicher Kontext...27
4.4.2 Merkmalsbereich 1: Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe...33
4.4.3 Merkmalsbereich 2: Arbeitsorganisation...39
4.4.4 Merkmalsbereich 3: Soziale Beziehungen...49
4.4.5 Merkmalsbereich 4: Arbeitsumgebung...54
4.4.6 Merkmalsbereich 5: Neue Arbeitsformen und zusätzlich belastende Faktoren...63
5 Fazit...72
5.1 Ergebnis und Handlungsempfehlungen...78
6 Perspektiven...79
6.1 Ansatzpunkt Studienprofil - ein Beispiel...79
6.2 Politische Entwicklungen...79
6.3 Das „Herrenberg-Urteil“...80
6.4 Praxisbeispiele bereits existierender Werkzeuge...83
7 Fragebogenitems - weiterer Forschungsweg...85
7.1 Persönliche Angaben...86
7.1.1 Berufliche Rahmenbedingungen...86
7.1.2 Bindung/Commitment...87
7.2 Merkmalsbereich 1: Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe...88
7.2.1 Selbstbestimmtheit...88
7.2.2 Qualifikation...89
7.2.3 Emotionale Involviertheit...90
7.3 Merkmalsbereich 2: Arbeitsorganisation...91
7.3.1 Arbeitszeit...91
7.3.2 Kommunikation...93
7.4 Merkmalsbereich 3: Soziale Beziehungen...94
7.4.1 Verhältnis zu Kolleginnen und Kollegen...94
7.4.2 Verhältnis zu Vorgesetzten (direkter Vorgesetzter)...94
7.4.3 Verhältnis zu Schülern und deren Eltern...95
7.5 Merkmalsbereich 4: Arbeitsumgebung...96
7.5.1 Arbeitsort...96
7.5.2 Körperliche Tätigkeit...98
7.5.3 Arbeitsmittel...99
7.6 Merkmalsbereich 5: Neue Arbeitsformen und zusätzlich belastende Faktoren...100
7.6.1 Digitalisierung...100
7.6.2 Zusätzlich belastende Faktoren...102
8 Literaturverzeichnis...XI
9 Anhang...XVII
9.1 Hilfreiche Links...XVII
9.2 Grafiken, Word Clouds, Tabellen...XVIII
Danksagung
Ich möchte mich bei meinen beiden Gutachtern Herrn Prof. Dr. Wolfgang Frindte sowie Herrn Dr. Volker Didier für die fachliche Unterstützung und Betreuung meiner Masterarbeit bedanken. Frau Prof. Dr. Petra Kemter- Hofmann danke ich für die Anregungen zur Weiterentwicklung und Standardisierung der vorliegenden Fragebogenitems.
Ich danke meinen zahlreichen Gesprächspartnern für ihre Zeit, Offenheit und sämtliche Gedankenanstöße.
Besonders bedanke ich mich bei Friederike Hübner, die mich durch ihre Forschungsarbeit im Bereich berufliche Gesundheitsförderung in deutschen Berufsorchestern zu diesem Projekt inspirierte.
Darüber hinaus danke ich dem Personalrat am Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden sowie der Fachgruppe Musik der Gewerkschaft Ver.di. Durch die Mitarbeit in den Gremien erhielt ich den entscheidenden Impuls für mein Thema.
Ein besonderer Dank gilt meinem Mann Andreas Mangold für die umfassende Unterstützung und alle wertvollen Impulse.
Widmung
Allen Musikschullehrern und Musikschullehrerinnen gewidmet, die täglich einen gewichtigen Beitrag zur musikalischen Bildung leisten und deren Einfluss auf das gesellschaftliche Miteinander nicht hoch genug geschätzt werden kann.
Abstract
Wird Arbeit heute als anstrengend und belastend bezeichnet, so sind damit weniger körperlich schwere Arbeiten, sondern zunehmend psychische Anforderungen gemeint, die den Einzelnen fordern bzw. überfordern. [1] Seit 2013 besteht laut Arbeitsschutzgesetz die gesetzliche Pflicht des Arbeitgebers, psychische Belastungen am Arbeitsplatz für Beschäftigte im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu erfassen. [2]
Auch am Arbeitsplatz von Musikschullehrkräften treffen eine Vielzahl psychischer Belastungen zu, die zu einem erhöhten Gesundheitsrisiko führen. Allein die Definition desselben stellt schon die erste Herausforderung dar, denn in der Regel gibt es mehrere. Mangelnde Wertschätzung durch Gesellschaft, Politik, Vorgesetzte, durch Schüler und Eltern, mangelnde Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit, mangelnde Anerkennung des Berufsstandes belasten einen Großteil stark. Hinzu kommt die mangelhafte finanzielle Ausstattung von Musikschulen. Personalmangel im pädagogischen Bereich, in der Verwaltung und im technischen Bereich, eine unzufriedenstellende Vergütungssituation für Angestellte, prekäre Beschäftigungsverhältnisse für freie Mitarbeiter und eine mangelhafte Ausstattung mit benötigten Arbeitsmitteln sind das Ergebnis. Arbeitsplatzalternativen sind kaum vorhanden,Entwicklungsmöglichkeiten rar. Viele finden letztere eher außerhalb der Musikschule.
Eine wesentliche Eigenschaft von Musikschularbeit besteht darin, dass die Verteilung der Arbeitszeit extremen Schwankungen unterliegt und besonders in Stoßzeiten die zur Verfügung stehende Regenerationszeit nicht ausreicht. Überdies wird nur ein Teil der Arbeitszeit, i.d.R. die Unterrichtstätigkeit erfasst, jedoch nicht oder nur teilweise Tätigkeiten, die damit im Zusammenhang stehen. Die Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit verschwimmen zunehmend. Die Lage der Arbeitszeit erschwert eine Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben überdies.
Zunehmende Digitalisierung im Musikschulbereich führen zu Arbeitsverdichtung, Beschleunigung, hohem Erwartungs- und Flexibilitätsdruck, Aktualitätszwang sowie einer beständig wachsenden Fülle an zu verarbeitenden Informationen. Zusätzlich findet eine weitere Entgrenzung der Arbeitszeit statt.
Aufgrund schwieriger Rahmenbedingungen wird die Tätigkeit in Kooperationen mit Schulen und Kindertagesstätten als besonders belastend erlebt, zumal eine Ausweitung in Anbetracht des gesetzliches Anspruchs auf Ganztagesbetreuung ab 2026 zu erwarten ist.
An keiner der Musikschulen, an der die Befragten arbeiten, wurde eine Gefährdungsbeurteilung zur psychischen Belastung erstellt. Unterweisungen dazu fanden ebenfalls nicht statt.
In 23 leitfadenbasierten Experteninterviews habe ich zum einen die jeweiligen psychischen Belastungen in den verschiedenen Merkmalsbereichen nach „GDA-Checkliste“ [3] sowie zusätzliche Belastungen ermittelt, die bisher noch keine Berücksichtigung finden. Zum anderen wurde erforscht, wie Fragestellungen formuliert sein müssen, um das Tätigkeitsfeld von Musikschullehrkräften umfassend abzubilden und vom Großteil der Zielgruppe beantwortet werden zu können. Die Auswertung der Interviews erfolgte nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse von Experteninterviews nach Gläser und Laudel.
Im Ergebnis meiner Vorstudie habe ich Fragebogenitems für die einzelnen Merkmalsbereiche konstruiert, die in jeweils adaptierter Form für Musikschulen bei der Erstellung einer passgenauen Gefährdungsbeurteilung hilfreich sein können.
Die Aufgabe der einzelnen Institutionen besteht nun darin, im Anschluss Maßnahmen gezielter betrieblicher Gesundheitsförderung abzuleiten und dabei besonders interne und externe Ressourcen in den Blick zu nehmen.
Anmerkungen:
Im Sinne einer gendersensiblen Sprache verwende ich neutrale Begriffe (z.B. Lehrkräfte) bzw. nur die weibliche oder die männliche Form. Inbegriffen sind jeweils beide Formen.
Verweise sind zur besseren digitalen Lesbarkeit jeweils mit Links hinterlegt.
Die Interviewprotokolle der offenen Fragen, die Links zu den Interview - Mitschnitten und Excel-Auswertungen sowie sonstige Protokolle befinden sich im Anhang Teil II, der nur den Gutachtern aus Datenschutzgründen zur Verfügung gestellt wurde.
Die Originalfassung dieser Masterarbeit ist auf www.qucosa.de veröffentlicht. [4]
In der hier vorliegenden Fassung werden zur besseren Verständlichkeit aufgrund formeller Vorgaben ursprünglich im Anhang befindliche Erläuterungen sowie Grafiken an die entsprechenden Stellen im Text eingefügt.
Über aktuelle Entwicklungen wird im Punkt 6 „Perspektiven“ berichtet.
Verzeichnisse
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Strukturplan des VdM...6
Abbildung 2: Schritte der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung...20
Abbildung 3: Verteilung der Befragten nach Lage der Musikschule...23
Abbildung 4: Dauer Beschäftigungsverhältnis in Jahren...27
Abbildung 5: Beschäftigungsumfang in Unterrichtseinheiten pro Woche...28
Abbildung 6: Anteil Musikschularbeit am Gesamteinkommen...28
Abbildung 7: Beschäftigungsverhältnis...28
Abbildung 8: Unterrichtsfächer...29
Abbildung 9: Sonderfunktionen...29
Abbildung 10: Gründe starke Verbundenheit mit der Musikschule...30
Abbildung 11: Musikschullehrer als ursprünglicher Berufswunsch...31
Abbildung 12: Die Tätigkeit als Musikschullehrkraft ist für mich...31
Abbildung 13: Gedanken zur beruflichen Veränderung...31
Abbildung 14: Entscheidungsspielraum wöchentliches Arbeitspensum...34
Abbildung 15: Inhaltlich/fachlicher Entscheidungsspielraum...34
Abbildung 16: Beeinflussbarkeit der Arbeitsergebnisse...35
Abbildung 17: Entscheidungsspielraum Auswahl Methodik und Didaktik...35
Abbildung 18: Abwechslungsreichtum der Tätigkeit...36
Abbildung 19: Unterforderung in manchen Tätigkeitsbereichen...36
Abbildung 20: Überforderung in manchen Tätigkeitsbereichen...37
Abbildung 21: Situationen, die emotional stark berühren...37
Abbildung 22: Definition Grenze privat/ dienstlich...39
Abbildung 23: Gefühl, jederzeit verfügbar sein zu müssen...40
Abbildung 24: Belastung durch Entgrenzung der Arbeitszeit...40
Abbildung 25: Strategien zum eignen Schutz vor Entgrenzung der Arbeitszeit...41
Abbildung 26: Nicht zur Zusammenhangstätigkeit gehörig...41
Abbildung 27: Word Cloud Ferienüberhang...42
Abbildung 28: Regenerationszeit...43
Abbildung 29: Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zeit für individuelle Weiterbildung...44
Abbildung 30: Kommunikationsweg...45
Abbildung 31: Bereitstehen notwendiger Informationen...45
Abbildung 32: Ansprechpartner bei Informationslücken bekannt...46
Abbildung 33: Bestehende Kommunikationsdefizite...46
Abbildung 34: Vorschläge, um Kommunikationsdefizite zu beheben...46
Abbildung 35: Mitarbeitergespräche mit Vorgesetzten...50
Abbildung 36: Soziale Unterstützung im Bedarfsfall...51
Abbildung 37: Verhältnis zu meinen Schülern...51
Abbildung 38: Art des Einflusses beruflicher Kontakte auf Sozialleben...52
Abbildung 39: Anzahl Unterrichtsorte...54
Abbildung 40: Tage mit mehreren Orten...55
Abbildung 41: Belastungsfaktoren Arbeitsort...55
Abbildung 42: Schwere körperliche Tätigkeit...56
Abbildung 43: Vorhandene Arbeitsmittel...57
Abbildung 44: Bereitstellung/ Zufriedenheit mit elektronischen Arbeitsmitteln...57
Abbildung 45: Bereitstellung/ Zufriedenheit mit Instrumentarium...58
Abbildung 46: Bereitstellung/ Zufriedenheit mit weiteren Arbeitsmitteln...58
Abbildung 47: Bereitstellung/ Zufriedenheit mit digitalen Arbeitsmitteln...59
Abbildung 48: Benötigte Arbeitsmittel...59
Abbildung 49: Neue Belastungen im Zusammenhang mit Digitalisierung...63
Abbildung 50: Angemessene Vergütung...65
Abbildung 51: Verhältnismäßigkeit Verdienst zu Ausbildungsdauer/ Ausbildungsniveau...66
Abbildung 52: Verteilung der Befragten nach Bundesländern...XVIII
Abbildung 53: Verteilung der Befragten nach Geschlecht...XVIII
Abbildung 54: Alter der Interviewpartner...XVIII
Abbildung 55: Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder...XIX
Abbildung 56: Familienstand...XIX
Abbildung 57: Klare Definition von Verantwortlichkeiten innerhalb der Musikschule...XIX
Abbildung 58: Bewusstheit eigene Zuständigkeit/Verantwortung...XX
Abbildung 59: Vom Verdienst meiner Arbeit könnte ich allein leben...XX
Abbildung 60: Öffentliche Wahrnehmung der Musikschule am Ort...XXI
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Bedürfnisse des Menschen sowie zugeordnete Emotionen bei Bedürfnisbefriedigung bzw. Deprivation...17
Tabelle 2: Erfahrungen Erteilung Onlineunterricht...64
Tabelle 3: Psychische Belastungen in Folge gesellschaftlicher Umbrüche...67
Tabelle 4 : Zusammenfassung (1) wichtigste Faktoren psychischer Belastung...73
Tabelle 5: Zusammenfassung (2) wichtigste Faktoren psychischer Belastung...73
Verzeichnis der Abkürzungen
Abb. Abbildung
BAT Bundesangestellten Tarif
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BSG Bundessozialgericht
GDA Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie
E Erläuterungen und Ergänzungen im Anhang
EG Entgeltgruppe
EMP Elementare Musikpädagogik
EU Europäische Union
EUGH Europäischer Gerichtshof
FB Fachbereich
FBL Fachbereichsleiter
FÜ Ferienüberhang
GBU Gefährdungsbeurteilung
GTA Ganztagesangebote
HSKD Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden
HfM Hochschule für Musik
IP Interviewpartner/Interviewpartnerin
KAV Kommunale Arbeitgeberverbände
KiTa Kindertagesstätte
MAG Mitarbeitergespräch
MSL Musikschulleitung
NRW Nordrhein-Westfalen
ÖPNV Öffentlicher Personen Nahverkehr
SAR-Modell Systemisches Anforderung-Ressourcen-Modell
SBV Schwerbehindertenvertretung
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschland
TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst
TU Technische Universität
UE Unterrichtseinheit
VdM Verband deutscher Musikschulen
WHO World Health Organization
World Health Organization
1 Einleitung
„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann, worüber zu schweigen aber unmöglich ist .“ (Victor Hugo 1802 -1885)
Der Psychologe Eric Maisel spricht von drei Arten von Sinn, die Menschen in ihrem Leben erfahren: „Eine ist der empfangende Sinn, wie er von der Familie und der kulturellen Umgebung gestiftet wird. Eine weitere ist der gesuchte Sinn, der daraus entsteht, dass man sich außerhalb von sich selbst umsieht. Die dritte und für ihre musikalische Vision wichtigste Art ist der geschaffene Sinn, ihr eigener persönlicher Sinn .“ [5]
Musizieren - sich ausdrücken, mit anderen auf diese ganz besondere Weise kommunizieren können, das ist meine Leidenschaft. Meinen persönlichen Sinn sehe ich als Musikpädagogin darin, Kinder, Jugendliche oder Erwachsene zum eigenen Musizieren zu befähigen und sich die Welt der Musik und ihrer Möglichkeiten zu erschließen. Darüber hinaus möchte ich mich für gute Rahmenbedingungen einsetzen, so dass es auch in der nächsten Generation Menschen gibt, die ihr Leben in den musikpädagogischen Dienst stellen, davon und damit leben können.
Bei Berufsunfähigkeitsversicherungen werden Musikschullehrer, ebenso wie Dachdecker und Piloten in eine der höchsten Risikogruppen eingeordnet. [6] „Grund hierfür ist das sehr häufige Auftreten beruflich bedingter Erkrankungen.“ [7] Um langfristig den Anforderungen des Berufes Stand halten zu können, muss die Basis der Berufsausübung, nämlich physische und psychische Gesundheit gewährleistet sein. [8]
„Ich würde mir sehr wünschen, dass man grundsätzlich die Bedingungen für Musikschullehrkräfte verbesserte. Die Lobby ist zu klein und das Verständnis für die Belastungen in dieser Tätigkeit nahezu nicht vorhanden.“ (Zitat einer Geigenlehrerin, die inzwischen ihre Stelle an einer Musikschule gekündigt hat.)
Mit dieser Masterarbeit möchte ich genau dazu beitragen.
1.1. Herleitung der Forschungsfrage
Seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn als Instrumentalpädagogin am Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden (HSKD) im Jahr 1996 habe ich in den verschiedensten Bereichen gearbeitet (Einzelunterricht, Gruppenunterricht, Klassenunterricht, Ensemble- und Orchesterleitung, Elementare Musikpädagogik, Betriebsrat, Personalrat) sowie verschiedene Beschäftigungsverhältnisse (Honorarlehrkraft 1996-1998, Anstellungsverhältnis ab 1998) erlebt.
Während meiner Personalratstätigkeit im Arbeitssicherheitsausschuss kam ich in Kontakt mit dem Themenfeld Gefährdungsbeurteilung „Psychische Belastung“.
Auch andere Personalräte im Land wurden aktiv und regten einen diesbezüglichen Erfahrungsaustausch an, der mich zum Thema dieser Arbeit führte. Ich fand heraus, dass seit 2013 im Arbeitsschutzgesetz die psychische Belastung bei der Arbeit ausdrücklich als ein Gefährdungsfaktor benannt wird, der bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen zu berücksichtigen ist. [9] Die Beschäftigung damit „ist momentan noch ein Pionierfeld, in dem auf unterschiedlichen Ebenen – betrieblicher Praxis, Politik und Wissenschaft – Verständnisweisen und Erfahrungen ausgetauscht und Sichtweisen und Anforderungen abgestimmt werden.“ [10]
Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass es speziell für Musikschullehrkräfte noch keine adaptierten Fragebögen gibt. Aus meiner beruflichen Erfahrung weiß ich, dass bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen an Musikschulen auf Fragebögen, die für Schulen oder den Verwaltungsbereich konzipiert sind, zurückgegriffen werden muss.
Daher lautet meine Forschungsfrage:
Welches sind die wichtigsten Faktoren psychischer Belastungen bei Musikschullehrkräften?
2 Hintergründe - Situationsanalyse
2.1. Berufsbild Musikschullehrkraft im Wandel
Angehende Musikschullehrkräfte, die in den neuen Bundesländern vor 1989 studiert haben, sind bei Aufnahme des Studiums von einem Beruf ausgegangen, dessen Ziele in instrumentenspezifischen Lehrplänen wie folgt formuliert wurden:
„Die Ausbildung der Schüler […] konzentriert sich auf folgende Schwerpunkte:
- Sicherung des Berufsnachwuchses für das Studium an den Hochschulen für Musik
- Vorbereitung auf Studienrichtungen, bei denen das Fach Musik [….] wesentlicher Bestandteil ist, z.B. Musikerzieher an Oberschulen, Kindergärtnerinnen, Unterstufenlehrer usw.
- Musikerzieher im Nebenberuf
- zielgerichtete Vorbereitung auf ein aktives Wirksamwerden im kulturell-künstlerischen Bereich“[11].
Damit wurde der Schwerpunkt neben der beruflichen Qualifikation auf die Befähigung zu „qualifiziertem Laienmusizieren“ gelegt. Dem Instrumental- und Gesangsunterricht und damit dem Beruf des Musikschullehrers wurde ein hoher gesellschaftlicher Stellenwert beigemessen. Die Bedeutung des Unterrichts für die Persönlichkeitsentwicklung im Hinblick auf die Ausbildung bestimmter Verhaltensweisen und Eigenschaften wie z.B. Selbstdisziplin, Selbstkontrolle, Selbständigkeit, Selbstbewusstsein, Konzentrationsvermögen, psychische und physische Belastbarkeit sowie die „Entwicklung der ästhetischen Erlebnis- und Urteilsfähigkeit“ [12] war im allgemeinen Bewusstsein verankert.
War „Musikschullehrer“ bis dahin ein hochangesehener Beruf, den Lehrern an allgemeinbildenden Schulen gleichgestellt (auch finanziell), erlebten sich Absolventinnen ab den 90ern zunehmend als Dienstleister, abhängig von der Zahlungskraft der Schüler bzw. deren Eltern. In vielen Bundesländern - so auch in Sachsen - sind Musikschulen den Kommunen unterstellt und damit den sogenannten „freiwilligen Aufgaben“ zugeordnet, die den „Pflichtaufgaben“, wie z.B. Müllabfuhr, öffentlicher Nahverkehr, Bau-/Instandhaltung von Schulen und Kindertagesstätten, gegenüberstehen. Das bedeutet, je nach kommunaler Finanzlage werden finanzielle Mittel für die Musikschule gewährt oder gestrichen, die Musikschulgebühren in Folge beständig erhöht.
Seit Jahren verschlechtern sich die Arbeitsbedingungen. Ein Großteil des Unterrichts wurde und wird durch Honorarkräfte erteilt (siehe 6.3.), die in ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Wurden Honorarverträge ursprünglich an Musikhochschulen für den Zweck erschaffen, dass ein festangestellter Profi-Musiker (z.B. in einem Orchester) im geringen Stundenumfang den professionellen Nachwuchs unterrichtet und so die Verbindung zwischen Ausbildung und Praxis sicherstellt, wird sowohl an Musikhochschulen, als auch an Musikschulen ein großer, wenn nicht sogar der größte Teil der Lehre auf diese Weise abgedeckt, um Personalkosten zu sparen. Der Arbeitgeber spart sämtliche Sozialabgaben. Vergütet wird lediglich die Unterrichtstätigkeit. Alle Aufgaben, die damit zusammenhängen und zum Berufsbild des Musikpädagogen gehören (z.B. Unterrichtsvor- und Nachbereitung, Wegezeiten zwischen verschiedenen Unterrichtsorten, Schülerbetreuung bei Auftritten/ Wettbewerben, etc.) werden aus intrinsischer Motivation auf eigene Kosten erbracht. Es besteht weder eine Absicherung im Krankheitsfall, noch ein Anspruch auf bezahlten Urlaub. Infolge des sogenannten „Herrenberg – Urteil“ vom 28.06.2022 (siehe 6.3.) könnte sich das in naher Zukunft ändern.
Für angestellte Lehrkräfte „ist ein tariflicher Aufstieg [..] grundsätzlich nicht möglich. Lediglich eine überschaubare Zahl an Funktionsstellen ist mit anderen Entgeltgruppen versehen. Auch angesichts der erheblichen Vorleistungen bereits vor dem Eintritt in das Studium durch die notwendige langjährige Instrumental- bzw. Vokalausbildung, die mit hohen Kosten einhergeht (welche durch die Anschaffung von Instrumenten noch erhöht werden) und angesichts des erheblich fordernden Studiums selbst ist die tarifliche Eingruppierung nicht angemessen. Gleichzeitig haben sich bereits seit vielen Jahren die Anforderungen an den Beruf von Musikschul-Lehrkräften deutlich verändert und sind komplexer geworden: Die Felder von Kooperationen mit Schulen und Kindertageseinrichtungen, Großgruppen-Unterrichten, Inklusionsangeboten, digitalen Angeboten, Programmen aufsuchender pädagogischer Arbeit u. v. m. haben sich bisher in den Tarifstrukturen nicht niedergeschlagen! […] Die Tarifmerkmale für Musikschullehrkräfte sind seit dem BAT-Urteil 1987 unverändert geblieben [,…] gehen von Tätigkeiten aus, die vor 35 Jahren Gültigkeit hatten und das Berufsbild heute nicht mehr angemessen abbilden.“ [13] Hinzu kommt, dass sich mit Einführung des Ganztagsanspruches 2026 die Musikschulwelt noch einmal deutlich verändern wird. [14]
Das Berufsbild von Musikschullehrkräften ist unattraktiv geworden: inzwischen wird ein „Mangel an Fachkräften“ beklagt, der sich längst nicht mehr nur auf den ländlichen Raum bezieht und bereits jetzt zu deutlichen Problemen in der Unterrichtsversorgung führt. [15]
2.2. Musikschule als Arbeitsort
„Öffentliche Musikschulen sind Bildungseinrichtungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in einer diversen Gesellschaft. Sie sind kommunal verantwortete Einrichtungen mit bildungs-, kultur-, jugend- und sozialpolitischen Aufgaben. Musikschulen sind Orte des Musizierens, der Musikerziehung und der Musikpflege, Orte der Kunst und der Kultur und Orte für Bildung und Begegnung. In der Musikschule kommen Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsbereichen, allen Generationen und verschiedenen kulturellen Hintergründen zusammen, lernen voneinander und erleben Vielfalt als Reichtum.“ [16]
Musikschulen in Deutschland können auf eine Tradition zurückblicken, diebis in das 19. Jahrhundert zurückreicht. [17] Während sich in Westdeutschland „die Kommunen und der 1952 gegründete Verband deutscher Musikschulen e. V. (VdM) […] um den kontinuierlichen Aufbau eines Musikschulnetzes bemühte (und erst) Anfang der 70er Jahre die Musikschule zu einem wichtigen Bestandteil der kulturellen Grundversorgung entwickelt“ [18] wurde, gründeten sich auf dem Gebiet der neuen Bundesländer bereits kurz nach dem Krieg (ab 1947) die ersten Musikschulen. Umgehend wurden Richtlinien zur Arbeitsweise der Musikschulen erstellt, Lehrpläne entwickelt und die Musikschullehrer den Lehrern an allgemeinbildenden Schulen gleichgestellt. Anders als in den alten Bundesländern wurden die Musikschulen staatlich finanziert. Nach der deutschen Wiedervereinigung sind die Träger der Musikschulen in den neuen Ländern ebenfalls dem VdM beigetreten. [19]
„Musikschulen haben gegenüber den Kindertagesstätten und den allgemeinbildenden Schulen eine eigenständige pädagogische und kulturelle Aufgabe, […] sind [jedoch] wesentliche Kooperationspartner (derselben und müssen in ihrer) Angebotsstruktur […] die zunehmend ganztägige Bildung“ [20] berücksichtigen. Zielgruppe sind neben Kindern und Jugendlichen in Anbetracht des demografischen Wandels auch Erwachsene und Senioren. Mit öffentlichen Veranstaltungen bzw. eigenen Beiträgen eingebettet in Veranstaltungen anderer, tragen sie zum kulturellen Gesamtangebot der Kommune bei. [21]
Musikschulen werden gern als Bildungseinrichtungen bezeichnet, nicht aber als solche behandelt, [22] was sich z.B. auch in den Öffnungsdebatten während der Corona-Krise zeigte (Bildungseinrichtung vs. Freizeiteinrichtung).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung1: Strukturplan des VdM [23]
Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Struktur einer Musikschule im VdM.
2.2.1. Organisation - Trägerschaft
Der Träger einer „Musikschule ist entweder [..] die Kommune (Gemeinde, Stadt, Landkreis, Zweckverband, Verwaltungsgemeinschaft) in geeigneter organisatorischer oder rechtlicher Ausgestaltung (Amt, Dienststelle, Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH, AöR, Stiftung öffentlichen Rechts) oder eine als gemeinnützig anerkannte privatrechtliche Einrichtung, in der die Kommune/Kommunen als Gewährträger wesentliche Verantwortung übernimmt/übernehmen, in der Regel ein eingetragener Verein, möglich auch eine gemeinnützige GmbH oder eine Stiftung des privaten Rechts. Die Verantwortung der Länder für Bildung und Kultur im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Zuständigkeit bleibt hiervon unberührt. Dies betrifft insbesondere die rechtliche Rahmensetzung, die Beförderung eines landesweiten Musikschulnetzes, die finanzielle Ausstattung der Musikschulen und die Heranbildung des musikpädagogischen Fachpersonals.“ [24]
Wenige Musikschulen sind dem Land zugeordnet. Beispiele sind das Konservatorium Halle oder auch die Jugendmusikschule Hamburg, die somit als Bildungseinrichtungen anerkannt und ebenso wie Schulen dem Kultusministerium zugeordnet sind.
2.2.2. Arbeitsort
Je nach Größe und Lage der Musikschulen gibt es neben einem zentralen Gebäude häufig auch dezentrale Angebote, jeweils in Abhängigkeit von der Struktur der jeweiligen Gebietskörperschaft vor Ort. Musikschulen ab einer bestimmten Größe sind in der Regel inhaltlich in Fachbereiche (Fachgruppen) und räumlich in Zweigstellen (Bezirke) gegliedert. [25] Somit ergibt sich eine unterschiedliche Anzahl an Standorten und Gebäuden. Der Unterricht findet im Hauptgebäude oder/und in eigenen Zweigstellen bzw. in den Räumen der Kooperationspartner statt. Manche Musikschule verfügt über keine eigenen Räume bzw. nur über Verwaltungsräume innerhalb eines Amtsgebäudes. In der Jugendmusikschule Hamburg zählt beispielsweise die gesamte Stadt als Dienstort.
Manche Musikschullehrerin arbeitet an jedem Wochentag an einem anderen Arbeitsort. Andere unterrichten täglich im selben Raum.
2.2.3. Arbeitszeit
In meinen Interviews habe ich festgestellt, dass jede der befragten Musikschulen eine andere Lösung zu Berechnung und Nachweis der zu erbringenden Arbeitszeit gefunden hat. Der Tarifvertrag besagt lediglich unter „Nr. 2 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit -“, dass M usikschullehrerinnen und Musikschullehrer vollbeschäftigt sind, „wenn die arbeitsvertraglich vereinbarte durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 30 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten (= 1350 Unterrichtsminuten) beträgt“. [26]
Das bedeutet, dass nur ein Teil der erbrachten Arbeitszeit (in der Regel die Unterrichtszeit) erfasst wird, anders, als der EuGH in seinem Urteil vom 14.5.2019 verfügt hat. Darin wurde entschieden, „ dass die Mitgliedstaaten der EU die Arbeitgeber verpflichten müssen, ein objektives, verlässliches und zugängliches System einzurichten, mit dem die täglich geleistete Arbeitszeit der Beschäftigten gemessen werden kann.“ [27]
2.2.3.1. Besonderheiten an Musikschulen
Daraus ergibt sich eine Unterteilung der Arbeitszeit in Unterrichtstätigkeit und Tätigkeiten, die damit im Zusammenhang stehen. Eine offizielle Definition von „Zusammenhangstätigkeit“ findet sich im TVöD § 52 Beschäftigte als Lehrkräfte an Musikschulen, Protokoll erklärung zu Absatz 1:
„Vor- und Nachbereitung des Unterrichts (Vorbereitungszeiten),
· Abhaltung von Sprechstunden,
· Teilnahme an Schulkonferenzen und Elternabenden,
· Teilnahme am Vorspiel der Schülerinnen und Schüler, soweit dieses außerhalb des Unterrichts stattfindet
· Mitwirkung an Veranstaltungen der Musikschule sowie Mitwirkung im Rahmen der Beteiligung der Musikschule an musikalischen Veranstaltungen
(z. B. Orchesteraufführungen, Musikwochen und ähnliche Veranstaltungen), die der Arbeitgeber, einer seiner wirtschaftlichen Träger oder ein Dritter, dessen wirtschaftlicher Träger der Arbeitgeber ist, durchführt
· Mitwirkung an Musikwettbewerben und ähnlichen Veranstaltungen,
· Teilnahme an Musikschulfreizeiten an Wochenenden und in den Ferien.
Durch Nebenabrede kann vereinbart werden, dass Musikschullehrerinnen und Musikschullehrern Aufgaben übertragen werden, die nicht durch diese Protokollerklärung erfasst sind.“ [28]
Eine weitere Besonderheit in der Arbeitszeitgestaltung, die bei vielen Musikschullehrkräften für Unmut sorgt, ist der sogenannte „Ferienüberhang“. Genau wie an allgemeinbildenden Schulen gelten an Musikschulen die regulären Ferienzeiten. Im Schnitt handelt es sich dabeium 12 Wochen, denen durchschnittlich sechs Wochen Urlaub gegenüberstehen. Rüdiger Lühr schreibt dazu:„Der Ferienüberhang wird fast schon traditionell dazu genutzt, die eigentlich eindeutige Arbeitszeitregelung im Tarifvertrag auszuhebeln. Mit der Begründung, die während der ferienbedingten Schließungszeiten über den Tarifurlaub hinaus ausfallenden Stunden (Ferienüberhang) müssten zu anderen Zeiten nachgearbeitet werden, verlangen Musikschulen[…] ihren Beschäftigten zusätzliche Unterrichtsstunden ab. Das ist nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts möglich, sofern dabei weder das Gehalt gekürzt noch die tarifliche Arbeitszeit von 30 Stunden à 45 Minuten Unterricht im Durchschnitt des tariflichen Ausgleichszeitraumes überschritten wird. Als Folge sind nur wenige TVöD - gebundene Musikschulen bei 30 Stunden geblieben. Manche verlangen heute von den Lehrkräften die Anwesenheit während eines Teils der Ferien, etwa zur Stundenplangestaltung oder zur Lehrplanentwicklung. Viele Musikschulen aber haben das tatsächliche Stundensoll auf 32, 33 und sogar auf über 35 Stunden pro Woche heraufgesetzt.“ [29]
3 Psychische Belastungen in der Arbeitswelt
3.1. Begriffliche Abgrenzung
Der Begriff „psychische Belastung“ wird laut internationaler Norm DIN EN ISO 10075-1 „definiert als ‚die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken‘. Mit ‚psychisch‘ sind kognitive, informationsverarbeitende und emotionale Vorgänge im Menschen gemeint. Psychische Belastung bei der Arbeit […] bezieht sich damit auf die Arbeitsbedingungen und nicht etwa auf Personen, psychische Störungen oder andere Beanspruchungsfolgen.“ [30]
Die Definition „psychischer Beanspruchung“ gemäß DIN EN ISO 10075-1 lautet: „‘die unmittelbare […] Auswirkung der psychischen Belastung im Individuum in Abhängigkeit von seinen jeweiligen überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen, einschließlich der individuellen Bewältigungsstrategien‘. Unmittelbare Auswirkungen psychischer Belastung können gemäß der DIN-Norm sowohl sogenannte ‚Anregungseffekte‘ (Aufwärmeffekt, Aktivierung) als auch beeinträchtigende Effekte sein [..]. Anhaltende beeinträchtigende psychische Beanspruchung birgt längerfristig Gesundheitsrisiken.“ [31]
„Psychische Fehlbeanspruchung“ ist die Folge einer dauernden Fehlbelastung. Das bedeutet, dass psychische Belastungen dann als Fehlbelastungen bezeichnet werden, wenn sie zu negativen Beanspruchungen und Folgen führen. Erst aufgrund der Belastungsfolgen ist feststellbar, ob eine Belastung auch eine Fehlbelastung ist. Diese zeigen sich häufig in gesundheitlichen Beschwerden und Krankheiten, wie z.B. Muskel- und Skeletterkrankungen, psychische Störungen, einem schwachen Immunsystem, Kopf- und Migräneattacken sowie Rückenschmerzen. [32]
Der Begriff „Gefährdung“ meint „die Möglichkeit eines Schadens oder einer gesundheitlichen Beeinträchtigung […] ohne bestimmte Anforderungen an ihr Ausmaß oder ihre Eintrittswahrscheinlichkeit.“ [33]
Das Ziel einer Gefährdungsbeurteilung ist, „Gefährdungen bei der Arbeit frühzeitig zu erkennen und diesen präventiv entgegenzuwirken, das heißt bevor gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Unfälle auftreten. Dies geschieht in einem systematischen Prozess, in dem auf der Basis einer Beurteilung der Arbeitsbedingungen ggf. erforderliche Maßnahmen festgestellt, umgesetzt und im Hinblick auf ihre Wirksamkeit kontrolliert werden .“ [34]
Als „Anforderungen“ werden Einflüsse bezeichnet, „die von Beschäftigten zu bewältigen sind (z.B. emotional, kognitiv). Anforderungen können über- oder unterfordern [,...] aber auch anregend, lernrelevant oder sinnstiftend sein. Anforderungen, die bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung eine Rolle spielen, sind zum Beispiel die Arbeitsintensität, Verantwortung oder Kommunikationsanforderungen. Die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelten Anforderungen der Arbeit können bei kritischer Ausprägung, Dauer und je nach Zusammenspiel mit anderen Belastungsfaktoren zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, eine ‚Gefährdung‘ darstellen und Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich machen“. . [35]
Ressourcen: „Als ‚Ressourcen’ werden in der Gesundheitspsychologie solche Faktoren bezeichnet, die geeignet sind, die psychische, physische und soziale Gesundheit eines Menschen zu fördern, vor allem bei einer Gefährdung der Gesundheit durch Belastungen und Krankheit.“(Weber, 2002, zitiert nach Becker, S. 131) [36]
Stressmeint „eine mögliche Form psychischer Beanspruchung. Arbeitsbedingter Stress kann als ein Prozess der emotionalen, kognitiven, verhaltensmäßigen und physiologischen Reaktion auf widrige Aspekte des Arbeitsinhalts, der Arbeitsorganisation und Arbeitsumgebung definiert werden. Bestandteil dieses Prozesses sind starke Emotionen und ein Gefühl des Überfordert-Seins " (Hasselhorn & Portuné, 2010, zitiert nach BAuA, 2014, S. 22). [37]
Nach C. Wustmann ist unterResilienz„ die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, zitiert nach Hübner 2018, S. 8) [38] zu verstehen. Der Begriff ist lateinischen Ursprungs und bedeutet „resilire – abprallen, zurückspringen“. Es handelt sich dabei um einen lebenslangen „dynamischen Anpassungs- und Entwicklungsprozess“ .[39]. Faktoren, die ein entsprechendes Verhalten unterstützen, sollten bei der Ableitung geeigneter Maßnahmen im Anschluss an eine entsprechende GBU eine wichtige Rolle spielen. In der Vorstudie selbst ist Resilienz eher nachgeordnet.
3.2. Theoretische Grundlagen
3.2.1. Anforderungs-Kontroll-Modell – Robert Karasek
Im Anforderungs-Kontroll- Modell, auch als Job-Demand/ Control -Modell bezeichnet, wird zwischen „für die Gesundheit positiv zu wertendem Entscheidungsspielraum und negativ zu wertender psychischer Belastung unterschieden[…] (Es enthält) Aussagen zu besonderen Wirkungen bestimmter Kombinationen von Entscheidungsspielraum und Belastung.“ [40] Robert Karasek hat in mehreren empirischen Untersuchungen Zusammenhänge zwischen psychischen Merkmalen der Arbeitstätigkeit und Gesundheit untersucht. [41]
In meiner Befragung beschäftigte ich mich mit der Erfassung von Entscheidungsspielräumen im Bereich Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe (Selbstbestimmtheit) und Arbeitsorganisation (Arbeitszeit). Fragen zu sozialer Unterstützung im Bereich „Soziale Beziehungen“ (Verhältnis zu Kolleginnen, Vorgesetzten/Schülern und Eltern) werden untersucht. Laut Aussagen aus Befunden seiner Forschungstätigkeit ist belegt, dass u.a.
- ein höherer Entscheidungsspielraum in der Arbeit ein aktiveres Freizeitverhalten begünstigt
- höhere psychische Belastungen in der Arbeit ein höheres Risiko für die Gesundheit darstellen
- das Gesundheitsrisiko besonders hoch ist, wenn mit hoher psychischer Arbeitsbelastung zugleich der Entscheidungsspielraum in der Arbeit gering ist ("high strain job")
- soziale Unterstützung in der Arbeit die negativen Wirkungen der arbeitsbedingten psychischen Belastungen vermindert. [42]
3.2.2. Modell beruflicher Gratifikationskrisen (effort-reward imbalance model) – Johannes Siegrist
„Im Mittelpunkt des austauschtheoretischen Modells der Gratifikationskrisen [..] steht das Missverhältnis von hoher Verausgabung im Beruf und niedrigen gewährten Belohnungen.Zu den wichtigsten beruflichen Belohnungen zählen Lohn bzw. Gehalt, Arbeitsplatzgarantien und Karrierechancen sowie Anerkennung und Lob (insbesondere durch Vorgesetzte). Personen, die sich immer wieder stark verausgaben, ohne im Vergleich hierzu angemessene Belohnungen zu erhalten, sind beruflichen Gratifikationskrisen ausgesetzt, da in diesem Missverhältnis eine gesellschaftlich verankerte Reziprozitätserwartung enttäuscht wird. Mit dieser Enttäuschung gehen starke Stressreaktionen (chronifizierte Gefühle von Enttäuschung und Verärgerung, von Benachteiligung, Kränkung und negativem Selbstwerterleben) einher.“ [43]
In den geführten Interviews spielten Fragen zu möglichen beruflichen Veränderungsoptionen (Wünsche und tatsächliche Alternativen) eine Rolle, Einschätzungen im Bereich angemessener Vergütung (in Bezug auf Ausbildungsdauer, Ausbildungsniveau, im Vergleich zu Lehrern an allgemeinbildenden Schulen) wurden erfragt. Diese stehen im direkten sowie weitergefassten Bezug zu den drei Bedingungen, unter denen laut Siegrist ein fortgesetztes Ungleichgewicht zu erwarten ist (fehlende Arbeitsplatzalternative; ungünstige Arbeitsverträge, Vorliegen eines hinderlichen Bewältigungsmusters angesichts von Leistungssituationen). [44]
3.2.3. Transaktionales Stressmodell - Lazarus & Folkman
Diese Konzept geht davon aus, dass bei Stress ein Ungleichgewicht zwischen Person und Umwelt vorliegt, d.h. die Anforderungen der Umwelt übersteigen die Ressourcen einer Person, was zu Stress(reaktionen) führt, so es als subjektiv bedeutsam und aversiv erlebt wird. [45] „Dementsprechend sind Stressoren oder Belastungen Ereignisse in der Umwelt, die die Auftretenswahrscheinlichkeit von Stressreaktionen oder Stresszuständen erhöhen. Im transaktionalen Stresskonzept von Lazarus und Mitarbeitern [..] wird insbesondere die Bedeutung der psychischen Verarbeitung von Stressoren thematisiert . Ob ein Ereignis zu einem Stressor wird, hängt (u.a.) von psychischen Bewertungsprozessen ab. Dies erklärt auch, warum Ereignisse oder Belastungen sich nicht auf alle Menschen gleich auswirken.“ [46] Die individuelle psychische Verarbeitung entscheidet demnach, ob ein Mensch Stress empfindet bzw. wie er mit Stressoren umgeht. Sind Situationen oder Ereignisse beeinflussbar, die höchstwahrscheinlich für eine bestimmte Personengruppe zu Stressempfinden führen und die nicht oder nur schwer aktiv bewältigt werden können, sollten diese identifiziert und geändert werden (Lazarus, 1995, zitiert nach Steffgen, S. 42 f.). [47]
Mittels meiner Interviews wollte ich die Faktoren identifizieren, die bei der Mehrzahl der Musikschullehrkräfte zu erhöhtem Stressempfinden führen und dabei besonders Fragen im Bereich der Arbeitsorganisation in den Blick nehmen, wie z.B. ex-treme Schwankungen/Verdichtung der Arbeitszeit aufgrund der Schuljahresstruktur, Entgrenzung der Arbeitszeit sowie Faktoren im Zusammenhang mit dem Merkmalsbereich Arbeitsumgebung, z.B. hinsichtlich der Arbeitswege, schwerer körperlicher Arbeit und neuer Arbeitsformen (im Zusammenhang mit Digitalisierung).
3.2.4. Konzept psychische Belastungen durch Regulationsbehinderungen
Für die Entwicklung menschlicher Handlungsfähigkeit ist die Erwerbsarbeit von besonderer Bedeutung: ein großer Teil der Lebenszeit wird hier verbracht. Lernprozesse für und durch die Erwerbsarbeit spielen für die individuelle Entwicklung eine wichtige Rolle. [48] Maßgeblich für diesen Bereich ist, dass „Handlungsforderungen in Form von Arbeitsaufgaben gestellt sind, die sich aus der gesellschaftlichen und betrieblichen Arbeitsteilung ergeben“. [49] Psychische Belastungen ergeben sich dann, wenn bestimmte Bedingungen das Arbeitshandeln behindern, wie z.B. ungünstige Umgebungsbedingungen, Zeitdruck, ständige Unterbrechungen, unvollständige oder widersprüchliche Informationen, unzureichende oder fehlende Arbeitsmittel. [50] „Aufgabenbezogene psychische Belastungen entstehen somit dann, wenn die konkreten Arbeitsbedingungen die Arbeitsausführung behindern, ohne dass die arbeitende Person diesen Bedingungen effizient begegnen kann. Da diese Behinderungen in das Handeln – genauer in die Regulation des Handelns – eingreifen, werden sie Regulationsbehinderungen genannt.“ [51]
Während meiner Befragungen wurde oft von Situationen oder Umständen berichtet, die die Arbeitsausführung behindern. Diese erfasste ich systematisch im Bereich Arbeitsumgebung (Arbeitsort, körperliche Tätigkeit, Arbeitsmittel) sowie unter „Neue Arbeitsformen“ (z.B. Digitalisierung).
3.2.5. Salutogenese – Antonovsky
Aaron Antonovsky „beschreibt mit seinem Salutogenese-Modell einen Blickwinkel, der sich mit der Entstehung von Gesundheit befasst.[…] Gesundheit hat hier etwas mit Lebensqualität bzw. Lebensgefühl zu tun“. [52] Er empfiehlt, „Gesundheit nicht nur als Zustand, sondern als einen Wechselwirkungsprozess zwischen zwei Polen zu verstehen. Der Mensch bewegt sich demnach auf einem permanenten Gesundheits-Krankheitskontinuum. (Antonovsky 1997, zitiert nach Hübner, 2018, S. 6 ff.). Das Erreichen der Pole (völlige) Gesundheit oder (völlige) Krankheit ist im Leben unwahrscheinlich (Schneider, 2018, zitiert nach Hübner, 2018, S. 6 ff.). […] Entscheidend ist die Frage, wo man sich auf dem Kontinuum gerade befindet und welche Faktoren daran beteiligt sind, dass man seine Position auf dem Kontinuum beibehalten bzw. sich auf den gesunden Pol hinbewegen kann. Als Kernantwort formulierte Antonovsky das Konzept des Kohärenzgefühls. Wichtige Bestandteile hierbei sind Verstehbarkeit und Erklärbarkeit von Veränderungen im Umfeld eines Menschen. Hinzu kommt das Gefühl von Bedeutsamkeit in Form von Partizipation an Prozessen im Leben sowie die Handhabbarkeit, gut mit Aufgaben und Veränderungen im Leben umgehen zu können. Ein ausgewogenes Verhältnis aller Elemente führt zu einem inneren Zusammenhang und äußeren Zusammenhalt.“ [53]
„Das Saluto-Genese-Modell ist angelehnt an Ansätze aus der Stressforschung (Lazarus & Folkman, 1984, zitiert nach Steffgen, 2004, S.173) und beschreibt Gesundheit als das Ergebnis der dynamischen Balance von Risikofaktoren und Schutzfaktoren. “ [54]
In meiner qualitativen Befragung wurde die Partizipation an Prozessen im Bereich der sozialen Beziehungen - vor allem hinsichtlich des Verhältnisses zu Vorgesetzten - untersucht: es sollten Einschätzungen zum (gefühlten) Grad der Mitbestimmung innerhalb der Fachgruppe beziehungsweise gesamtschulisch getroffen werden.
Im Bereich „Qualifikation“ wurde erfasst, ob es zu Situationen fachlicher/ emotionaler Über-/ Unterforderung kommt. Einen großen Raum nahmen Fragen danach ein, in wieweit die Arbeit (Unterrichtstätigkeit) und deren Ergebnisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln als sinnhaft erlebt werden sowie zum diesbezüglichen Selbstgestaltungsgrad.
3.2.6. Systemisches Anforderungs-Ressourcen-Modell (SAR-Modell) der Gesundheit – Peter Becker [55]
„Ausgehend von einigen Grundannahmen der Systemtheorie, insbesondere der Leitidee einer Hierarchie von Systemen, wird Gesundheit mit der Bewältigung externer und interner psychosozialer und physischer Anforderungen mithilfe interner und externer psychosozialer und physischer Ressourcen in Verbindung gebracht.“ [56] Eine der motivationspsychologischen Grundannahmen lautet: „Nicht nur als Reaktion auf (veränderte) äußere Umstände und fremdbestimmte Anforderungen oder zum Zweck der Befriedigung physiologischer Bedürfnisse werden Menschen aktiv, sondern sie suchen sich selbst Probleme und Aufgaben [..], die sie herausfordern, ihrem Handeln Ziele setzen und einen Prozess der Diskrepanzreduktion einleiten bzw. aufrechterhalten.“ [57] Interne Anforderungen „beziehen sich zum einen auf Bedürfnisse und zum anderen auf erworbene Sollwerte“. [58] Der Mensch ist mit vielen Bedürfnissen ausgestattet, die nur mit Ressourcen der Umwelt befriedigt und vor allem von anderen Menschen bereitgestellt werden. [59] Becker hat folgende sehr stimmige Übersicht menschlicher Bedürfnisse sowie zugeordneter Emotionen bei Bedürfnisbefriedigung/-deprivation erstellt und schreibt die Maslowsche Bedürfnispyramide insofern fort, als er die Hierarchie der Motive im Sinne der Wichtigkeit der Bedürfnisse (Priorität bei Befriedigung) interpretiert und von der Universalhierarchie der Motive abweicht. Aus seiner Sicht unterscheidet sich die Rangfolge bei verschiedenen Menschen bzw. sogar bei demselben zu verschiedenen Zeitpunkten, ganz abgesehen von der Übertragbarkeit auf andere Kulturen. [60]
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Tabelle 1: Bedürfnisse des Menschen sowie zugeordnete Emotionen bei Bedürfnisbefriedigung bzw. Deprivation [61]
„Menschen stellen Anforderungen aneinander und treten in einen Austausch von Ressourcen. Im Falle befriedigender sozialer Interaktionen kommt es zur Bewältigung wechselseitiger Anforderungen durch gegenseitige Bereitstellung von Ressourcen.“ [62] Das gesundheitsförderliche Prinzip nach dem SAR - Modell lautet also: „Verbesserung der Voraussetzungen für die Bewältigung externer und interner Anforderungen mithilfe interner und externer Ressourcen“[63].
In meiner Befragung nahm ich die gestellten Anforderungen bzw. solche, die sich aus spezifischen Umständen ergeben in den Blick und versuchte herauszufinden, in welchen Bereichen diese als besonders hoch empfunden werden. In allen untersuchten Bereichen spielten externe und/ oder interne Anforderungen mehr oder weniger eine Rolle. Nun gilt es nach dem gesundheitsförderlichen SAR - Prinzip interne und externe Ressourcen zur Bewältigung der Anforderungen herauszufinden, was perspektivisch einen wesentlichen Bestandteil gezielter betrieblicher Gesundheitsförderung darstellen sollte.
3.3. Arbeitsschutzrechtliche Anforderungen: die Gefährdungsbeurteilung
3.3.1. Gesetzliche Grundlagen: § 5 Arbeitsschutzgesetz
Die Pflicht zur Ermittlung von Gefährdungen am Arbeitsplatz durch den Arbeitgeber, um erforderliche Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit abzuleiten, ergibt sich aus § 5 des Arbeitsschutzgesetzes, in dem unter Punkt 3 eine Reihe möglicher relevanter Gefährdungen aufgezählt sind, darunter im sechsten Absatz „psychische Belastungen bei der Arbeit“. [64] Bereits seit dem Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 1996 wurde vom ganzheitlichen Gesundheitsbegriff der WHO [65] ausgegangen. In der konkretisierten Fassungwird ab 2013 explizit die Berücksichtigung psychischer Belastungen bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen durch den Arbeitgeber gefordert, um dem schwierigen Umgang mit dem Phänomen der psychischen Fehlbelastungen in der betrieblichen Praxis sowie dem gesellschaftlichen Druck aufgrund steigender Erkrankungen Rechnung zu tragen. [66]
Besondere Beachtung ist in diesem Zusammenhang dem Arbeitsprogramm „Schutz und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingten psychischen Belastungen“ der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) zu widmen. Hierin werden Empfehlungen zur Erstellung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung entwickelt, weitere Instrumente und Handlungshilfen erarbeitet und zusammengestellt sowie Informations- und Qualifizierungsmaßnahmen für betriebliche Adressatengruppen und Aufsichtspersonen konzipiert und durchgeführt. [67]
3.3.2. Der Prozess der Gefährdungsbeurteilung „psychische Belastung“
Wie unter Punkt3.1 beschrieben, wird eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt, um Gefährdungen bei der Arbeit frühzeitig zu erkennen und diesen vorzubeugen. [68] Arbeitsaufgaben, Arbeitsorganisation, soziale Beziehungen sowie Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen sollen systematisch überprüft und bei festgestellten Mängeln so gestaltet werden, dass Risiken für gesundheitliche Beeinträchtigungen und Unfälle gemindert und Potenziale humaner Arbeitsbedingungen aufgezeigt und genutzt werden. Diese wiederum haben einen wichtigen Einfluss auf die Motivation, die Arbeitszufriedenheit und die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten. [69]
Aus folgender Grafik wird ersichtlich, dass es sich dabei um einen strukturierten, roulierenden Prozess handelt mit dem Ziel über Verbesserungen der Arbeitssituation nachzudenken sowie diese einzuleiten bevor gesundheitliche Folgen oder Arbeitsunfälle auftreten (Abb. 2). Bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, stehen mögliche Störungen des Arbeitsablaufs oder der Kommunikation im Fokus, nicht psychische Besonderheiten einzelner. Durch den Aufbau von Kompetenzen sowohl zu Analyse und Reflektion als auch zum Umgang mit psychischer Belastung [70] in der Organisation wird aus meiner Sicht die Unternehmenskultur beständig verbessert und im Idealfall eine hilfreiche Feedback-Kultur etabliert.
Die Träger der GDA kommen zum Schluss, dass es bei der Wahl der Methoden zur Ermittlung der psychischen Belastung nicht den „einen richtigen Weg“ gibt. Folgende drei methodische Ansätze werden benannt, die bisher in der betrieblichen Praxis einzeln oder in Kombination zum Einsatz kommen - je nach Gegebenheiten, Erfahrungen und Präferenzen im Betrieb:
- Beobachtung/Beobachtungsinterviews
- Standardisierte schriftliche Mitarbeiterbefragungen
- Moderierte Analyseworkshops [71]
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung2: Schritte der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung [72]
3.3.3. Situation an Musikschulen
Keinem der Befragten waren Unterweisungen zur psychischen Belastung an der jeweiligen Institution bekannt. Ich erfuhr über mein berufliches Netzwerk lediglich davon, dass an der Musikschule Bochum im Auftrag der Stadt durch die Sicherheitsbeauftragte eine „Psychische Belastungsgruppe“ eingerichtet wurde. Eine Mitarbeiterbefragung zu Zufriedenheit und Arbeitsklima im Jahr 2010 hatte erhebliche Kommunikationsdefizite aufgedeckt.
4 Vorstudie zur Fragebogenentwicklung
4.1. Methodik
Zur Beantwortung meiner Forschungsfrage und um ein geeignetes Messinstrument zur Erstellung einer entsprechenden Gefährdungsbeurteilung für Musikschullehrkräfte zu entwerfen, führte ich 23 leitfadenbasierte Experteninterviews im persönlichen Gespräch durch. Insbesondere bei offenen Fragestellungen wurde vorwiegend partnerzentriert kommuniziert [73] Das Konzept dieser Kommunikationsform steht in enger Verbindung mit der personenzentrierten Gesprächsführung von C. R. Rogers und dem Vier-Seiten-Modell der Kommunikation[74]: „Sie lässt sich in drei Stufen beschreiben: (1) passiv aufmerksames Zuhören: Die Aufmerksamkeit wird so ungeteilt wie möglich auf die verbalen und nicht verbalen Mitteilungen des Gegenübers gerichtet.[…] (2) aktives Zuhören, Paraphrasieren: Das, was die Wahrnehmung und Dekodierung einer Aussage beim Empfänger ergeben hat, wird mit eigenen Worten wiedergegeben; (3) empathisches Kommunizieren (Empathie) [..] richtet sich [..] auf das, was nur angedeutet wird oder unausgesprochen mitschwingt. Neben der Verstehens - Funktion richtet sich diese Stufe der Gesprächsführung auch auf die Ebene der Beziehung zw. den Gesprächspartnern.“[75].
Als methodische Grundlage zur Auswertung der Interviews nutzte ich die qualitative Inhaltsanalyse von Experteninterviews nach Gläser und Laudel.Diese wertet Texte aus, indem sie ihnen in einem systematischen Verfahren Informationen entnimmt. Die wichtigsten Informationen werden aus den Aussagen der Protokolle anhand eines Suchrasters herausgefiltert und relativ unabhängig davonweiterverarbeitet.[76] Damit unterscheidet sie sich von den dominierenden qualitativen Verfahren vor allem in zwei wesentlichen Punkten: erstens bleibt sie also „nicht dem Ursprungstext verhaftet, sondern extrahiert Informationen und verarbeitet diese Informationen getrennt vom Text weiter.“[77] Zweitens ist ein wesentliches Kennzeichen die Offenheit des Kategoriensystems. Merkmalsausprägungen werden frei verbal beschrieben. Die nominalskalierte Skala entsteht im Prozess der Extraktion. Sie wird an die Eigenart der theoretischen Variablen angepasst, komplexe Zustände zu beschreiben und kann um nicht antizipierte Merkmalsausprägungen ergänzt werden. Das Kategoriensystem kann somit im gesamten Verlauf der Auswertung an die Besonderheiten des Materials angepasst werden. Ein Probedurchlauf durch einen größeren Teil des Materials erübrigt sich. [78]
Diese beiden Kennzeichen stellen einen wesentlichen Unterschied, quasi eine Erweiterung zu anderen bewährten Verfahren, allen voran beispielsweise der qualitativen Inhaltsanalyse nach P. Mayring, dar.Die Grundformen des Interpretierens werden hier vor allem in der Zusammenfassung (Material so reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben), Explikation (zu einzelnen fraglichen Textteilen zusätzliches Material herantragen, um das Verständnis zu erweitern) und Strukturierung (Aspekte aus dem Material herausfiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material legen oder es aufgrund bestimmter Kriterien einschätzen) gesehen. [79]
Bereits die Extraktion stellt laut Gläser und Laudel einen entscheidenden Interpretationsschritt dar, denn das Herausfiltern relevanter Informationen aus dem Text setzt Interpretation desselben voraus. [80]
Die Quelle der vorliegenden Inhaltsanalyse sind die Interviewprotokolle der offenen Fragen auf Grundlage der Interviewmitschnitte im Anhang Teil II.
Aufgrund des standardisierten Aufbaus des Leitfadens ließ sich ein Teil der Informationen anhand von Diagrammen veranschaulichen. Zuvor wurden die erforderlichen, bereinigten Daten in Excel-Tabellen erfasst und über Pivot-Tabellen ausgewertet. Ein großer Teil der Antworten im Bereich der offenen Fragen konnte kategorisiert und somit sortiert, verglichen, zusammengefasst und ausgewertet werden. Dabei erfolgten Extraktion, Zusammenfassung und Auswertung der Informationen auf Grundlage nachvollziehbarer Interpretation der gewonnenen Daten. [81]
Es handelt sich somit um einen Mixed-Methods-Ansatz. Dieserkombiniert qualitative und quantitative Vorgehensweisen. [82] Im Zuge empirischer Sozialforschung ist es laut Döring und Bortz oft sinnvoll, „qualitative und quantitative Daten - und somit auch qualitative und quantitative Datenerhebungsmethoden (z.B. Leitfaden-Interview sowie standardisierte Fragebogenerhebung) zu nutzen .“ [83]
4.2. Datenerhebung
4.2.1. Beschreibung der Stichprobe allgemein
In meiner 27-jährigen Berufspraxis als Musikschulpädagogin und besonders während meiner Tätigkeit als Betriebs-/Personalrätin sind mir zahlreiche Experten begegnet, die zum einen langjährige intensive Erfahrungen als Musikschullehrkräfte gesammelt haben oder/ und sich zum anderen darüber hinaus in verschiedenen Gremien (Gewerkschaft, Berufsverbände, Sächsischer Musikrat e.V. etc.) u.a. für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen einsetzen. Viele von ihnen können daher als Multiplikatoren angesehen werden. Teilweise habe ich mit ihnen zusammengearbeitet. Die vorwiegend erfahrenen Lehrkräfte arbeiten ausnahmslos an öffentlichen Musikschulen, die im Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM) organisiert sind.
Um möglichst das gesamte Spektrum des Arbeitsfeldes einer Musikschullehrkraft abzubilden, habe ich Lehrkräfte verschiedener Instrumente in unterschiedlichen Bereichen (Einzel-/Gruppenunterricht, Elementarerziehung in Kindergärten und Schulen, Orchester/Ensembleleitung, Tanzunterricht) sowie solche mit verschiedenen Sonderfunktionen ausgewählt.
Die Befragung fand überwiegend im mitteldeutschen Raum (Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt), aber auch mit einzelnen Vertretern aus Bayern, Hamburg sowie Mecklenburg- Vorpommern statt (Abbildung 5252 im Anhang).
Wichtig war mir, Lehrkräfte an Musikschulen sowohl in Städten (z.B. Hamburg, Halle, Dresden, Jena, Stralsund) als auch im ländlichen Raum (z.B. im Dreiländereck, Tirschenreuth, Landkreis Zwickau, Zeulenroda-Triebis) zu befragen (Abb. 3).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung3: Verteilung der Befragten nach Lage der Musikschule
Dieser Vorstudie liegt keine repräsentative Stichprobe zu Grunde.
4.2.2. Erhebungsprozess
Das Leitfadeninterview wurde zunächst mehreren Pretests mit Kolleginnen, einer Kommunikationspsychologin und einem Psychologen unterzogen und anschließend modifiziert.
Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte in der Weise, dass alle notwendigen Informationen potentiell verfügbar gemacht werden können und letztlich die Zeit als limitierender Faktor beeinflusst, wie viele zusätzliche Partnerinnen einbezogen werden, um die empirische Absicherung der Rekonstruktion zu verbessern. Sie stand demnach nicht vor Beginn der Erhebung fest, sondern wurde im Verlauf um wichtige Interviewpartner erweitert. [84]
Die Interviews erstreckten sich über einen Zeitraum von drei Monaten und fanden im Zeitraum Februar bis Anfang Mai 2023 statt. Die Termine dazu wurden vorab im persönlichen Gespräch bzw. per Mail vereinbart, anschließend via Microsoft -Teams (mit einer Ausnahme) durchgeführt. Dadurch eröffnete sich die Möglichkeit, im persönlichen Kontakt Erläuterungen zu Begrifflichkeiten zu geben bzw. Unklarheiten zu beseitigen, durch Nachfragen ein umfassendes Bild zu Kontext und individuellen Erfahrungenund zusätzlich unmittelbares Feedback zu Verständlichkeit von Fragestellungen, passendem Skalenniveau sowie fehlenden Aspekten zu erhalten. Durch diese Form der aktiven Datenerhebung sind einerseits Intention und Verständlichkeit sichergestellt, andererseits wird ein aussagekräftiges Ergebnis gewährleistet. [85] Anhand der Aufzeichnungen konnten die Aussagen detailliert protokolliert und somit nachvollziehbar gemacht werden. Im gesamten Untersuchungsablauf wurde der Leitfaden selbst an die jeweilige Interviewpartnerin und die individuelle Interviewsituation angepasst, um dem Prinzip der Offenheit und des größtmöglichen Verständnisses des Untersuchungsgegenstandes sowie der Konkretisierung abstrakter theoretischer Vorüberlegungen Rechnung zu tragen. [86]
Zunächst wurden allgemeine Angaben zu Person, Institution und beruflichem Kontext erfasst. Danach folgten speziell auf die Situation von Musikschullehrkräften angepasste Fragen zu Arbeitsinhalt/ Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation, Sozialen Beziehungen, Arbeitsumgebung und Neuen Arbeitsformen, orientiert an den fünf Merkmalsbereichen und Inhalten der Gefährdungsbeurteilung nach „GDA-Checkliste“. [87]
Während des Interviews fertigte ich erste Mitschriften an und hielt direkt im Anschluss an das Interview erste Eindrücke von Interviewpartnerin und Gesprächsatmosphäre fest. Antworten auf Fragen, die in allen Interviews unverändert geblieben und die damit quantifizierbar sind, übertrug ich in Exceltabellen. Durch Nachhören jedes einzelnen Interviews wurden die Aussagen der qualitativen Teile des Interviews protokolliert, zusammengefasst und überwiegend Kategorien (Merkmalsbereiche eins – vier) zugeordnet, wobei anzumerken ist, dass die Struktur der GDA-Checkliste im Grunde genommen bereits ein Kategoriengrundgerüst bildet, erweitert um einige musikschulspezifische Kategorien. Hier handelt es sich um eine deduktive Vorgehensweise. Vor allem im fünften Merkmalsbereich – „Neue Arbeitsformen/Zusätzlich belastende Faktoren“ – herrscht der erkundende Charakter der Studie vor. Der Anteil offener Fragestellungen ist hier am höchsten. Manche davon wurden ausschließlich deskriptiv ausgewertet. Weiterhin erstellte ich Zusammenfassungen und Übersichten zu den Faktoren mit den höchsten Belastungsgraden im Arbeitsalltag und bildete induktiv neue Kategorien.
Schließlich protokollierte ich alle Anmerkungen zu den einzelnen Merkmalsbereichen sowie zum Interview selbst. In 15 Fällen wurde der Interviewleitfaden direkt nach dem Interview modifiziert bzw. erweitert und teilweise Erläuterungen zu einzelnen Fragen mit dem Ziel der besseren Verständlichkeit angepasst.
Die Auswertung erfolgt in Übereinstimmung mit der Struktur des Interviewleitfadens.
4.3. Allgemeine Anmerkungen zur Auswertung
Die Länge der Interviews betrug zwischen einer Stunde (in einem Fall), anderthalb bis zwei (in den meisten) und sogar drei Stunden (in drei Fällen.).
Oft wurde bereits im Laufe des Interviews auf weitere bzw. größte psychische Belastungen verwiesen oder auch ausführliche Begründungen zu gegebenen (quantitativen) Einschätzungen geliefert. Diese erfasste ich quasi „laufend“ unter „Zusätzliche Faktoren“, „Größte psychische Belastung“ oder „Neue psychische Belastungen aufgrund gesellschaftlicher Umbrüche bzw. Digitalisierung“. Im Gegensatz zum neutralen Begriffsverständnis „psychische Belastung“ laut DIN Norm erfolgte die Verwendung des Begriffes während der Interviews eher alltagssprachlich, d.h. im Sinne von „Fehlbeanspruchung“ (siehe Punkt 3.1).
Ich nutzte für Einschätzungsfragen (z.B. trifft voll zu – trifft überhaupt nicht zu, gar nicht zufrieden – voll zufrieden) eine Sechserskala, um die sogenannte „Tendenz zur Mitte“ [88] zu vermeiden und Entscheidungen entweder zum positiven oder negativen Ausschlag der Skala bei den Befragten zu erwirken. Da die Einschätzungen mündlich gegeben wurden, kam es dennoch ab und zu vor, dass als Wert „3,5“ angegeben wurde.
Aufgrund der digitalen Durchführung der Interviews bot sich mir im Nachgang die Möglichkeit, zugleich Beobachterin zu sein und „von außen“ Interview und Interviewsituation kritisch zu reflektieren. Die Qualität der Übertragung war in wenigen Fällen instabil und es kam dadurch teilweise zu Unterbrechungen oder Aussetzern, was inhaltlich der Untersuchung aber keinen Abbruch tat.
An dieser Stelle möchte ich kurz darauf eingehen, dass es einen Unterschied machte, ob mich der Interviewpartner kannte (z.T. sehr gut durch langjährige Zusammenarbeit) oder nicht. Es kam durchaus vor, dass Antworten quasi in Halb-sätzen erfolgten, davon ausgehend, dass mir der Sachverhalt bewusst ist bzw. explizit Antworten mit „Du weißt ja selbst…..“ eingeleitet wurden. Zur besseren Verständlichkeit wurden daher in den Protokollen manche Aussagen leicht modifiziert. Trotz der „Bias“ - Gefahr aufgrund der persönlichen Beziehung habe ich versucht, in methodologischer Hinsicht die geeignetsten Gesprächspartner auszuwählen. [89]
Allerdings bot gerade die Tatsache der langjährigen Verbundenheit gleich mehrere Chancen: im Interview wurden zum Teil sehr persönliche Details preisgegeben, was nur auf dieser Vertrauensbasis möglich war und wiederum zum tiefgreifenden Verständnis der Gesamtsituation beitrug. In einem Fall ähnelte das Interview eher einer Therapiestunde: alles, was die Seele belastete, durfte ausgesprochen werden. In anderen Fällen fanden die Interviews vor allem auf der Metaebene, dem „Interview über das Interview“ statt. Es handelte sich dann quasi um ein Gespräch unter Experten, in dem auf Seiten der Fragenden fachliches Hintergrundwissen vorausgesetzt wurde. Vor allem im rechtlichen Kontext sowie bezüglich von Regelungen in den einzelnen Bundesländern ergaben sich dadurch neue Erkenntnisse. Außerdem waren diese Gespräche hinsichtlich der beabsichtigen Fragebogenkonstruktion sowie bezüglich der Empfehlungen für weitere Interviewpartner bzw. Ansprechpartnerinnen zu einzelnen Themen sehr hilfreich.
Ein Einfluss vorangegangener auf folgende Interviews über die dokumentierte Modifikation der Fragen hinaus, lässt sich bei der Formulierung von Fragehilfen feststellen, z.B. bei der Wahl der Beispiele als Antworthilfe.
Da es sich lediglich um eine Vorstudie mit wenigen Teilnehmer handelt, sind umfassende Interpretationen der Ergebnisse (abgesehen von der Extraktion als Interpretationsschritt[90]) erst nach Durchführung der eigentlichen Befragung sinnvoll. In den Punkten „Diskussion, Feedback und weiterführende Fragestellungen“ nach jedem Merkmalsbereich habe ich mich daher auf das Feedback der Teilnehmer und sich abzeichnende Schwerpunkte psychischer Belastung beschränkt sowie teilweise auf weitere Forschungsfragen verwiesen.
4.4. Analyse der Ergebnisse
4.4.1. Persönliche Angaben und beruflicher Kontext
Der überwiegende Teil der Interviewpartnerinnen war weiblich (Abbildung 53 im Anhang), 40 Jahre und älter (Abbildung 54 im Anhang). Bei nur sechs Teilnehmern lebten noch Kinder im Haushalt (55 im Anhang), was sicher mit dem Alter der Befragten korreliert: bei vielen sind die Kinder bereits ausgezogen. Zu pflegende Angehörige gab es in (noch) keinem Haushalt. Die meisten leben in fester Partnerschaft (Abbildung 56 im Anhang).
Der Großteil der Befragten ist bereits seit 15 Jahren und länger beschäftigt (Abbildung 4) und arbeitet mehr als 15 Unterrichtseinheiten pro Woche (Abbildung 5).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 4: Dauer Beschäftigungsverhältnis in Jahren
. Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 5: Beschäftigungsumfang in Unterrichtseinheiten pro Woche
Bei den meisten Befragten umfasst die Arbeit an der Musikschule den größten Teil ihrer gesamten Erwerbstätigkeit (Abbildung 6).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 6: Anteil Musikschularbeit am Gesamteinkommen
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 7: Beschäftigungsverhältnis
Der überwiegende Teil arbeitet im festangestellten Verhältnis, zwei sogar in beiden Beschäftigungsverhältnissen zugleich (Abbildung 7).
Die Lehrkräfte unterrichten in folgenden Fächern (Abbildung 8):
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 8: Unterrichtsfächer
Ein großer Teil unterrichtet in mehreren Fächern: Hauptinstrument(e) und Elementarstufe oder Hauptinstrument(e) und Orchester/Ensemble/Registerprobenleitung. Folgende Sonderfunktionen begleiten 14 Interviewpartner (Abbildung 9):
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 9: Sonderfunktionen
Von den Befragten unterrichteten fünf ausschließlich große Gruppen (Elementarstufe, Tanz, Chor-/Orchesterleitung), zwei erteilten ausschließlich Einzelunterricht. Bei allen anderen setzte sich die Unterrichtstätigkeit aus verschiedenen Kombinationen von Einzel-/Partner-/Gruppenunterricht, Ensemble-/Orchesterleitung und teilweise Klassenunterricht zusammen. Die Vielfalt bei der vergleichsweise geringen Anzahl der Befragten ist so hoch, dass sie grafisch nicht darstellbar ist.
Gefragt nach der gefühlten Verbundenheit zur Musikschule gaben manche zwei Werte an, die sich auf unterschiedliche Aspekte bezogen, z.B. auf die hohe Identifikation mit der Tätigkeit als solche (sehr stark verbunden) und auf den konkreten Umgang mit der Person (gar nicht verbunden). Diese Werte sind daher nicht darstellbar. Die Gründe für die Verbundenheit/ Nicht-Verbundenheit variieren sehr stark. Wie folgt lassen sich „Gründe dafür“ kategorisieren (Abbildung 10):
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 10: Gründe starke Verbundenheit mit der Musikschule
Unter „Sonstige Gründe“ (dafür) wurden jeweils einmal genannt: gute Kommunikation, ein gutes Arbeitsklima, die Möglichkeit zur Mitgestaltung und damit Selbstwirksamkeit, die Möglichkeiten, die eine öffentliche Musikschule in der Großstadt bietet (Erreichbarkeit der Angebote, Dezentralisierung, Sozialermäßigung, Zielgruppenorientierung), sich zugehörig fühlen wollen, dass „es Spaß macht“ sowie die Vielfalt der Tätigkeit.
Die Gründe, die tendenziell zu Nichtverbundenheit führen, waren sehr individuell. „Defizitäre Führung“ sowie „konkreter Umgang mit mir/persönliche Erlebnisse“ wurden jeweils dreimal genannt, die folgenden jeweils einmal: schlechte Vergütung, freies Beschäftigungsverhältnis, strukturelle Defizite, mangelnde Wertschätzung, Kommunikationsdefizite, innere Kündigung, lange Fahrtwege, Situation Außenstelle in einer Schule, Berufsanfänger, Einzelkämpfer sowie das Gefühl, austauschbar zu sein.
Rückmeldungen aus den Pretests im Vorfeld ergaben, dass es für die Identifikation mit der Tätigkeit wichtig ist, zusätzlich zu erfassen, ob es sich beim Beruf der Musikschullehrkraft um den ursprünglichen Berufswunsch handelt, was in etwa bei der Hälfte zutraf (Abbildung 11):
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 11: Musikschullehrer als ursprünglicher Berufswunsch
Auf die Frage, was die Tätigkeit für alle diejenigen ist, deren ursprünglicher Berufswunsch ein anderer war, erhielt ich folgende Antworten (Abbildung 12):
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 12: Die Tätigkeit als Musikschullehrkraft ist für mich:
Bei etwa der Hälfte der Befragten bestehen Gedanken zur beruflichen Veränderung (Abbildung 13):
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 13: Gedanken zur beruflichen Veränderung
Die Gründe, die dazu bewegen, über berufliche Veränderung nachzudenken sind sehr individuell, und zwar:
· Hohe Arbeitsbelastung (zweimal)
· Veränderung im Tätigkeitsfeld generell, Midlife-Crisis (zweimal)
· Tätigkeit entspricht nicht meiner Berufung, anderer ursprünglicher Berufwunsch (zweimal)
· Differenzen mit dem Vorgesetzten
· Schlechte Arbeitsbedingungen als Honorarkraft
· Schlechte Bezahlung (zweimal)
· Angebote von außen (zweimal)
· Hohe psychische Belastung während der Coronazeit
· Belastendes Wohnumfeld
Die Schlüsselfrage dieser Studie „Werden an Ihrer Musikschule Unterweisungen zur psychischen Belastung durchgeführt?“ verneinten alle Befragten ausnahmslos. Das Thema „psychische Belastung“ spielt lediglich im weitesten Sinne in wenigen städtischen Einrichtungen eine Rolle. Hier wurden Fortbildungen mit den Schwerpunkten „Achtsamkeit“, „Pilates“, „Körperarbeit“ (IP 10), Gesundheitskurse im städtischen Kontext (IP 19) oder über den Landesverband (IP 21) angeboten. Initiiert von einer übergeordneten Dachorganisation hatte eine Befragung zur psychischen Belastung stattgefunden, deren Fragen aber auf den Musikschulbereich nicht zutrafen (IP 7).
4.4.1.1. Diskussion, Feedback, weiterführende Fragestellungen
Ursprünglich war geplant, neben der Schülerzahl auch das Verhältnis zwischen Festangestellten und freien Mitarbeitern an den Musikschulen zu erheben, um den institutionellen Kontext genauer und gegebenenfalls daraus folgende Korrelationen zwischen Beschäftigungsverhältnissen und Verortung (Stadt/Land) abzubilden. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl und der Art der Befragung war das in diesem Rahmen nicht aussagekräftig darstellbar. In einer weiterführenden quantitativen Befragung könnte eine Erhebung dieser Daten durchaus interessante Ergebnisse bringen, wobei diese Frage i.d.R. nur von der Leitungsebene zu beantworten ist. Ebenso war die genaue Schülerzahl nicht ausschlaggebend, sondern lediglich ein Richtwert für die Größe der Institution. Erfasst wurde letztlich nur, ob es sich um eine städtische oder um eine Musikschule im ländlichen Raum handelt.
Als Einstieg ins Thema bat ich, einen „typischen“ Musikschultag zu beschreiben, wohlwissend, dass es diesen in den meisten Fällen gar nicht gibt, sondern jeder Wochentag seine eigene Spezifik hat. In vielen Fällen kristallisierten sich hierbei erste Belastungsfaktoren heraus. Bereits an dieser Stelle war beabsichtigt, die größten psychischen Belastungen zu erfragen, ohne dass der Interviewte durch die Beantwortung der Fragen voreingestellt war, was sich allerdings schon im ersten Durchlauf als ungünstig erwies. Dieses Interview drohte den zeitlichen Rahmen zu sprengen. In der Folge schloss diese Frage den inhaltlichen Teil ab.
Bei der Erfassung der Tätigkeit an Schulen stellte sich heraus, dass eine Vielzahl von Unterrichtsformen existiert und zum Teil den Befragten die genaue Abgrenzung der unterschiedlichen Formen nicht bewusst ist. In folgenden Varianten findet der Unterricht statt:
· Die Schule ist eine Außenstelle der Musikschule, es findet „traditioneller“, kostenpflichtiger Musikschulunterricht statt.
· Der Unterricht findet im Rahmen der Ganztagesangebote der Schulen im Nachmittagsbereich oder als Klassenunterricht, teilweise mit geteilten Klassen kostenlos statt.
· In bestimmten Programmen unterrichtet die Musikschullehrerin im Tandem mit dem Musiklehrer im regulären Schulunterricht.
Eine Frage, die sich nicht mit Sicherheit beantworten lässt, bezieht sich darauf, ob die Erfassung inklusiven Unterrichts mit seinen individuellen zusätzlichen Herausforderungen nötig ist oder nicht, wird doch in einigen Fällen ein solcher erteilt, ohne dass er diese Bezeichnung trägt. In meiner Befragung wurde nur einmal inklusiver Unterricht explizit angegeben. Dazu bedarf es einer größeren Stichprobe.
4.4.2. Merkmalsbereich 1: Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe
Bereich Selbstbestimmtheit
Die Formulierung der Fragen im ersten Teil dieses Merkmalsbereiches stellte die größte Herausforderung dar und wurde immer wieder modifiziert, daher sind die Antworten, die sich auf Entscheidungsspielräume in den Bereichen Reihenfolge und Umfang der Tätigkeiten beziehen, grafisch nicht darstellbar.
Knapp die Hälfte der Befragten (11) empfindet den Entscheidungsspielraum bezogen auf das wöchentliche Arbeitspensum insgesamt hoch - sehr hoch (Abb.14).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 14: Entscheidungsspielraum wöchentliches Arbeitspensum
Der Entscheidungsspielraum als Musikschullehrkraft insgesamt wird sogar von der überwiegenden Mehrheit als hoch – sehr hoch eingeschätzt (Abbildung 15).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 15: Inhaltlich/fachlicher Entscheidungsspielraum
Sehr weit gingen die Einschätzungen im Bereich der Beeinflussbarkeit der Arbeitsergebnisse auseinander (Abbildung 16).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 16: Beeinflussbarkeit der Arbeitsergebnisse
Einig waren sich die Interviewpartner, dass der Entscheidungsspielraum bezogen auf die Auswahl von Methodik und Didaktik im oberen, für die meisten sogar im höchsten Bereich lag (Abbildung 17).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 17: Entscheidungsspielraum Auswahl Methodik und Didaktik
Ebenso empfanden die meisten Befragten ihre Tätigkeit tendenziell abwechslungsreich bis sehr abwechslungsreich.
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 18: Abwechslungsreichtum der Tätigkeit
Die Definition von Verantwortlichkeiten und Kompetenzen innerhalb der Musikschule lässt sich unter „Überwiegend – vollkommen klar“ subsummieren (Abbildung 57 im Anhang). Wie weit die eigene Zuständigkeit/Verantwortung reicht, ist den meisten bewusst (Abbildung 58 im Anhang).
Bereich Qualifikation
Viele der Fragen im Bereich der Qualifikation wurden im Verlauf des Interviews immer wieder verändert. Konstant geblieben ist die Frage nach der gefühlten Unterforderung, die die meisten verneinten (Abbildung 19).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 19: Unterforderung in manchen Tätigkeitsbereichen
Die folgende Aussage wurde sofort nach dem zweiten Interview geteilt in fachlich und sozial/emotional, sind hier doch Unterschiede ablesbar (Abbildung 20):
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 20: Überforderung in manchen Tätigkeitsbereichen
Bereich Emotionale Involviertheit
Aufgrund der oft langjährigen Arbeit mit den Schülern von klein auf (besonders intensiv im Einzelunterricht) werden in diesem Zusammenhang am häufigsten emotional berührende Situationen beschrieben (Abbildung 21), gefolgt von herausfordernden Gruppensituationen bzw. starken Gruppenerlebnissen z.B. durch Orchesterkonzerte/ Projekte, Schuljahreshöhepunkte oder einfach nur gemeinsames Musizieren.
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung21: Situationen, die emotional stark berühren
Unter dem Punkt „Sonstiges“ (einfache Nennung) wurden Kollegenschicksale, innere Kündigung, Desinteresse seitens des Schülers, Konkurrenz mit anderen Freizeitaktivitäten, Personalauswahlentscheidungen, hoher Termindruck oder Schülerabmeldung begabter Schülerinnen genannt.
4.4.2.1. Diskussion, Feedback, weiterführende Fragestellungen
Selbstbestimmtheit
An dieser Stelle ist anzumerken, dass natürlich bei freien Mitarbeitern der Entscheidungsspielraum wesentlich höher, gar „völlig frei“ ist, denn hier liegt keine Weisungsgebundenheit vor.
Hinsichtlich der Beeinflussbarkeit der Arbeitsergebnisse ergaben sich meist sehr interessante Gespräche darüber, ob sich eine allgemeingültige Definition zu „Ergebnis von Musikschultätigkeit“ finden lässt: Sind es erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen bei „Jugend musiziert“? Ist es eine gelungene Stunde mit einer großen Gruppe, wenn eine Kollegin stolz erzählt: „Ich habe die Kinder mit jeder Faser ihres Körpers während der gesamten Stunde gehabt.“? Ist vielleicht das Erlebnis das Ergebnis? Genauso kontrovers wurde die Frage an sich diskutiert, inwieweit die Arbeitsergebnisse beeinflussbar sind: „Kann ich mit meinem Handeln jederzeit den Stundenverlauf und somit das erwünschte Ergebnis beeinflussen oder nicht?“ IP 15 erklärte, nach systemischem Ansatz zu unterrichten: die Lehrperson könne sich in Gruppen nicht herausnehmen, es gäbe aber Parameter, die bedingen, dass Ergebnisse auf eine bestimmte Weise Gestalt gewinnen. Es handele sich also stets um eine sich gegenseitig beeinflussende Interaktion zwischen Lehrkraft und Schülern.
Mehrere Gesprächspartnerinnen (IP 4, 7, 15, 17, 22) wiesen darauf hin, dass der Abwechslungsreichtum der Tätigkeit vor allem dadurch entstehe, dass an der Musikschule nur ein Teilzeitarbeitsverhältnis besteht und so auch in anderen Tätigkeitsfeldern (z.B. meist eigene künstlerische Betätigung vielfältigster Art, ehrenamtliche Gremienarbeit, o.ä.) gearbeitet wird. Das Motto lautet „Die Vielfalt macht’s“ (IP 22).
Qualifikation
An dieser Stelle sei ein Zitat (IP 19) eingefügt, der auf die Frage nach der Qualifikation für die auszuführende Tätigkeit antwortete: "Unsere Ausbildung war doch wohl ein Treppenwitz! Sie hat mit Musikschularbeit nichts zu tun.“ Er verwies damit auf die für ihn unzureichende pädagogische Ausbildung im Studium.
Da viele der Interviewpartner in mindestens zwei Bereichen/ Fächern tätig sind, müssten die Fragen zur Qualifikation entsprechend für die jeweiligen Bereiche getrennt erfasst werden. Darüber hinaus wäre auch hier die Trennung in Unterrichtstätigkeit – Zusammenhangstätigkeit sinnvoll. Ein Teilnehmer (17) merkte an, dass er sich in der Regel in Konferenzen und der Art, wie sie abgehalten werden, unterfordert fühle, niemals jedoch bei der Ausführung seiner professionellen Tätigkeit.
Ein Problem, was von vielen Befragten bemängelt wird, sind unzureichende oder gar fehlende Prozessdefinitionen, Unklarheit hinsichtlich der Zuständigkeiten, Ansprechpartner (Organigramm) etc.. Die sogenannte „Onboarding-Phase“ ist an vielen Institutionen daher für neue Mitarbeiter sehr beschwerlich (IP 4, 15, 21).
4.4.3. Merkmalsbereich 2: Arbeitsorganisation
Arbeitszeit
Genau wie im ersten Merkmalsbereich unterlagen manche Fragen einer ständigen Modifikation und sind daher grafisch nicht darstellbar. Ein wesentliches Merkmal von Musikschularbeit ist die Zersplitterung (IP 8), da ein großer Teil der Zusammenhangstätigkeiten im häuslichen Bereich, am privaten Schreibtisch erbracht wird. Oft ist nicht klar definierbar, wo der dienstliche Teil endet und der private beginnt oder umgekehrt (Abbildung 22).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 22: Definition Grenze privat/ dienstlich
Festzustellen ist, dass sich die Angaben beim Gefühl, jederzeit verfügbar sein zu müssen (Abbildung 23) sowie beim Belastungsgrad durch Entgrenzung der Arbeitszeit (Abbildung 24) ungefähr hälftig verhalten.
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 23: Gefühl, jederzeit verfügbar sein zu müssen
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 24: Belastung durch Entgrenzung der Arbeitszeit
Musikschultätigkeit findet selbstredend in der Freizeit der Schülerschaft statt. Die Wochenplanung der Familien erfolgt oft , wenn diese versammelt ist, d.h. vorzugsweise abends oder am Wochenende. Daraus ergeben sich oftmals organisatorische Anfragen (Unterrichtsverlegungswünsche, Absagen etc.) in dieser Zeit. Ungefähr die Hälfte der Befragten hat diese Besonderheit der Tätigkeit akzeptiert und empfindet sie als tendenziell nicht belastend.
Die allermeisten Befragten haben Strategien, um sich vor der Entgrenzung der Arbeitszeit zu schützen (Abbildung 25). „Freizeit“ beim unteren Punkt („Keine Antwort/ kurze Rückmeldung während der Freizeit“) bezieht sich auf die Zeit spät abends, am Wochenende und während der Ferien. „Selbstregulierend“ bedeutet Begrenzung aufgrund zeitlich limitierter Ressourcen.
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 25: Strategien zum eignen Schutz vor Entgrenzung der Arbeitszeit
Wie unter Punkt 2.2.3.1 beschrieben, ist eine Besonderheit an Musikschulen die Unterteilung der Arbeitszeit in Unterrichtstätigkeit und die sogenannte Zusammenhangstätigkeit.
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 26: Nicht zur Zusammenhangstätigkeit gehörig:
Abbildung 26 zeigt, welche Aufgaben die Befragten übernehmen, obwohl sie weit über den Rahmen der definierten Zusammenhangstätigkeiten hinausgehen.
„Verwaltungstätigkeit“ bedeutet z.B. das Erstellen von Finanzplänen für Projekte, Schülerabsagen im Falle eigener Krankheit, Teilnehmerbeiträge für Orchesterprojekte eintreiben. Unter „Hausmeistertätigkeiten“ wurden weiterreichende Reparaturarbeiten und Räumarbeiten für Unterricht oder Konzertdurchführung subsummiert. „Sonstiges“ beinhaltet
· im Falle von Baumaßnahmen innerhalb der Musikschule/ Außenstelle Instrumente ein- und auspacken
· Trösten eines gemobbten Kindes in der Schule
· LKW ausleihen und fahren, um damit Instrumente für Probenlager/Konzerte zu transportieren
· Schüler in Schulen beaufsichtigen
· Vorstellung meines Unterrichtsfachs auf einem Elternabend der EMP
- Konzertreisen
o Notenarrangements
· Organisation des Caterings für Jurys (Wettbewerb, Fördervorspiele)
Die Assoziationen zum Thema Ferienüberhang (Abbildung 27) der meisten waren (mit Ausnahme von vier Teilnehmern), dass dieser als tendenziell ungerecht empfunden wird - vor allem im Vergleich mit Lehrern an Allgemeinbildenden Schulen - und abgeschafft gehört.
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 27: Word Cloud Ferienüberhang
Manche Teilnehmer hatten sich noch nie darüber Gedanken gemacht und die Erbringung desselben als „zur Musikschultätigkeit“ gehörig wahrgenommen. Es gab zum Teil sehr deutliche Worte, wie „Missachtung meiner Lehrtätigkeit, unentgeltliche Mehrarbeit, Normierung durch Realität“ (IP 8), „hoch ungerecht, schlichtweg unverschämt“ (IP 3) oder „Sauerei, Idee um Geld zu sparen“ (IP 19). Es wurde auf die Entstehungsgeschichte des „Ferienüberhangs“ verwiesen (IP 3): aus einem Einzelfall (Urteil) wird eine generelle Regelung abgeleitet. Musikschulen würden als Bildungseinrichtungen bezeichnet, nicht aber als solche behandelt, vor allem im Hinblick auf die Mitarbeiter (IP 13). Ein Gesprächspartner rechnete vor, dass er zwei Stunden pro Woche und damit einen Tag pro Monat quasi „umsonst“ arbeite. In zwei Fällen ist eine Art „Schuldgefühl“ in Anbetracht von 12 Ferienwochen und damit verbundener Freizeit gegenüber anderen Arbeitnehmern in anderen Branchen, was aus dem individuellen Kontext erklärbar ist. Drei Teilnehmer verwiesen darauf, dass sie durchaus bereit wären, in den Ferien auch andere Arbeiten (z.B. Reinigungsarbeiten, Instrumentenwartung) in der Musikschule selbst zu erledigen. Die Realität bei vielen Befragten sieht so aus, dass die Zeit in den Ferien z.B. zu konzeptionellen Überlegungen, umfangreicher Literaturrecherche, Schuljahresvorbereitung, zum Üben bzw. zur individuellen Weiterbildung genutzt wird, demnach „gearbeitet“ wird. Ein Ferienüberhang ist von freien Mitarbeitern nicht zu leisten, da nur die tatsächlich gehaltene Unterrichtsstunde vergütet wird.
Ein weiteres Merkmal von Musikschullehrtätigkeit besteht darin, dass die Arbeitszeitbelastung stark schwankt. Es gibt Wochen mit „durchschnittlicher“ zeitlicher Belastung sowie Wochen mit hoher zeitlicher Belastung, in der Regel die Adventszeit/ Weihnachtszeit, der Jahresbeginn mit den Regionalwettbewerben „Jugend musiziert“ sowie am Schuljahresende die Wochen mit Präsentationen der Jahresergebnisse (Konzerte, Vorstellungen, große Musizierstunden).
Abbildung 28 zeigt, wie die Befragten die jeweils zur Verfügung stehende Regenerationszeit einschätzen:
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 28: Regenerationszeit
Erwartungsgemäß findet ca. zwei Drittel in Wochen mit hoher zeitlicher Belastung nicht genügend Regenerationszeit. Genauso so hoch ist in etwa der Anteil, der genügend Regenerationszeit in Wochen mit durchschnittlicher zeitlicher Belastung findet.
Befragt nach der Einschätzung in Bezug auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der Zeit für individuelle Weiterbildung ergibt sich folgende Grafik (Abb.29):
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 29: Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zeit für individuelle Weiterbildung
Nur die Hälfte der Befragten machte Angaben im Bereich „Vorschläge, eine bessere Vereinbarkeit zu erzielen“. Fünf Teilnehmer (IP 6, 9, 11, 12, 20) haben sich mit dieser Eigenschaft von Musikschularbeit (mangelnde bis fehlende Vereinbarkeit) arrangiert. Die Vorschläge lauteten: Reduzierung der Stunden bei gleichbleibender Vergütung (achtmal), Teilzeitvertrag („auf eigene Kosten“ - zweimal), bessere personelle Ausstattung der Musikschulen (zweimal), Reduktion von Fahrtzeiten/ weniger Standorte (einmal), Integration der Musikschultätigkeit in die Regelschulzeit (zweimal), weniger Ferienüberhang (einmal). Ein stellvertretender Musikschulleiter hatte sich mit dieser Intention dafür eingesetzt, dass allen Mitarbeitern ein Dienstgerät zur Verfügung gestellt wird.
Kommunikation
Zunächst wurden die Teilnehmerinnen gebeten zu beschreiben, wie an der jeweiligen Musikschule vorwiegend kommuniziert wird und im zweiten Schritt eine Auswahl aus vorgegebenen Möglichkeiten zu treffen. Hierbei spielen verschiedene Einflussfaktoren, wie z.B. die Größe der Musikschule eine Rolle. Eine Interviewpartnerin berichtete, dass an manchen Tagen im Anschluss an eine Konferenz gekocht wird (IP 9). Ein anderer gab an, dass die Fachgruppenkonferenzen als Fachgruppenfrühstücke stattfinden und in zwangloser Atmosphäre formell und informell kommuniziert wird (IP 7). In Musikschulen im ländlichen Raum, wo der Unterricht in Schulen stattfindet, gibt es kein eigenes Lehrerzimmer für Musikschullehrkräfte bzw. einen Ort, wo Informationen ausgehängt werden könnten (IP 4 und 12). Darüber hinaus werden Aushänge im Lehrerzimmer oftmals überlesen, so nur einmal pro Woche in der Hauptgeschäftsstelle unterrichtet wird. Die Form offener Beschreibung war für einige Teilnehmer unpassend.
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 30: Kommunikationsweg
In diesen Fällen wurde sofort zum nächsten Punkt (Abbildung 30) übergegangen (Mehrfachnennungen möglich). Ablesbar ist, dass bis auf eine Ausnahme alle Befragten die Informationen (auch) auf digitalem Weg erhalten.
Grob zwei Drittel der Befragten stehen die zur Ausübung ihrer Tätigkeit notwendigen Informationen zur Verfügung (Abbildung 31):
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 31: Bereitstehen notwendiger Informationen
Ebenfalls sind die Ansprechpartner bei Kommunikationslücken überwiegend bekannt (Abbildung 32).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 32: Ansprechpartner bei Informationslücken bekannt
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 33: Bestehende Kommunikationsdefizite
Bereits bei der Frage nach den Kommunikationsdefiziten zeichnete sich ab, dass die Beantwortung von der Größe (bezogen auf Schüler- und Mitarbeiterzahl) der Musikschule abhängt: bei größeren Musikschulen ist eine Unterteilung in „Fachgruppe“ und „Gesamtschulisch“ sinnvoll, bei kleineren nicht. Daher sind auch Angaben im Bereich „keine Angabe“ dargestellt (Abbildung 33).
Vorschläge, die Kommunikationsdefizite zu beheben, lassen sich wie folgt kategorisieren (Abbildung 34):
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 34: Vorschläge, um Kommunikationsdefizite zu beheben
Unter „Sonstiges“ wurden weiterhin genannt: Kommunikationsworkshops, die Einhaltung von Regeln, eine bessere personelle Ausstattung, flachere Hierarchien oder eine regelmäßige schriftliche Information der Fachgruppe zu aktuellen Themen.
4.4.3.1. Diskussion, Feedback, weiterführende Fragestellungen
Arbeitszeit
Die Aussage „Meine tägliche Arbeitszeit kann ich selbstbestimmt gestalten“ wurde nach ausführlicher Diskussion mit IP 8 geändert in „Die Lage meiner täglichen Arbeitszeit kann ich selbstbestimmt gestalten.“ Allerdings wurde die so veränderte Aussage für einige der folgenden Interviewpartner unverständlicher. Manche Anregungen ergaben, dass die Frage in „zu Schuljahresbeginn“/„im laufenden Schuljahr“ unterteilt werden müsste, was wiederum ebenfalls nicht für alle Befragten passte.
Eine Befragte (IP13) gab zu bedenken, dass der Beruf das ist, was man lebt, somit die Grenze nicht definierbar sei.
Beispielsweise ist die Definition in Gesprächen mit Eltern schwer, die man auch im privaten Kontext kennt: Wo beginnt der private Teil? In welchen Bereich fallen Telefonate mit Schülereltern, die auf dem Spielplatz bei der Betreuung der eigenen Kinder geführt werden? Hier könnte eine interessante Diskussion darüber entstehen, ob das ausgewogene Verhältnis zwischen „Arbeit“ und „Leben“ (die sogenannte „Work-Life- Balance“) nicht impliziert, das „Arbeit“ demzufolge kein „Leben“ ist. Aus meiner Sicht wäre es schlüssiger, das Leben in verschiedene Lebens-/Tätigkeitsbereiche (bezahlte - unbezahlte) zu unterteilen. Somit würden sich Diskussionen erübrigen, was als „Arbeit“ zählt: Ausschließlich vergütete Arbeit? Familienarbeit? Sogenannte „Care-Arbeit“? Ehrenamtliche Arbeit?
Bei den Angaben zur Zersplitterung müsste auch der persönliche Hintergrund (allein lebend/ in fester Partnerschaft, mit/ohne Kinder) berücksichtigt werden. Korrelationen sind aufgrund der geringen Teilnehmerzahl der Stichprobe nicht darstellbar, in einer weiterführenden Untersuchung aber zu empfehlen.
Ähnlich verhält es sich bei den Angaben, ob man das Gefühl hat, jederzeit verfügbar sein zu müssen. Eine Rückmeldung ergab, dass dieses Gefühl personenabhängig ist und vor allem auf den direkten Vorgesetzten zutrifft. Soll der Service den Eltern gegenüber stimmen, „muss“ ich verfügbar sein, bin also quasi „ausgeliefert“ (= belastend). Andererseits stecke natürlich auch der Aspekt des „Gebrauchtwerdens“, des „Verfügbar – Sein – Dürfens“ darin, was nicht belastend ist (IP 3).
Die Antworten auf die Fragen zu Entlastungs-/Ausgleichszeiten, die ja nur auf Festangestellte zutreffen, lassen sich nicht darstellen.
Zum Thema Zusammenhangstätigkeit merkte IP 8 an, dass die gefühlte pädagogische Verantwortung oft der einzige Maßstab ist und viele Musikschullehrkräfte all das tun, was sie für sinnvoll und notwendig erachten, was also im weitesten Sinne dazugehört. Der inhaltliche Arbeitsumfang sei somit komplett „entgrenzt“, so nicht jeder selbst diesbezüglich Grenzen setzt (und das i.d.R. mit schlechtem Gewissen). Diese Grenzen werden nicht offiziell kommuniziert, was einen zentralen Punkt psychischer Belastung darstellt. In dem Moment, wo die Lehrkraft festangestellt ist, sei hier auf die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers verwiesen - ein allerdings zweischneidiges Schwert, denn es könnte dazu führen, dass Tätigkeiten, die die Lehrkraft für wichtig erachtet, untersagt werden und eine Diskussion über entbehrliche/unentbehrliche Zusammenhangstätigkeiten in Gang gesetzt wird.
Sowohl im Hinblick auf die Regenerationszeit, als auch auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Zeit für individuelle Weiterbildung, wäre in einer weiterführenden Befragung zu untersuchen, welchen Einfluss die individuelle Familiensituation auf die Angaben hat.
Kommunikation
Auf die Frage „Wie wird kommuniziert?“ antwortete ein Teilnehmer (IP 2) „Dieses Haus hat so viele Regeln, dass es (die Kommunikation) nur informell funktioniert, weil die Regeln einfach kaum jemand kennt.“ Interviewpartnerin 3 berichtetet, dass objektiv eine gute Kommunikation in der Fachgruppe vorhanden sei, allerdings bei Anfragen von den sieben Angesprochenen zwei stets nicht antworten und diese Form der Nichtreaktion „etwas mit der betroffenen Person macht“. Die Kommunikation sei also gut und wiederum nicht gut. Dabei stellt sich die Frage, welchen Einfluss eine Minderheit auf das jeweilige Befinden hat. Eine zusätzliche psychische Belastung erwächst bei derselben Partnerin aus der Kommunikation mit dem Vorgesetzten, die als unstrukturiert, unzuverlässig, zufällig beschrieben wird und hier somit keine Sicherheit besteht, ob alle Informationen gegeben wurden.
In mehreren Fällen (IP 4, 10, 12, 13, 16) wird auf das Problem verwiesen, dass man in Außenstellen (Musikschulunterricht in Schulgebäuden) allein vor Ort ist. Da jede Kollegin die Pausen individuell festlegt und gemeinsame Pausen aktiv angestrebt werden müss(t)en, findet eine Begegnung untereinander nur zufällig statt. Es kann also auch in Hauptgebäuden vorkommen, dass man sich im Arbeitsalltag nicht begegnet (IP 22), selbst wenn man sich i. d. R. hört.
Eine Gesprächspartnerin in Honorarbeschäftigung kritisierte, dass eine Einweisung in Prozesse (z.B. Theorieunterricht, Prüfungen, Leihinstrumente) nicht automatisch stattfindet und nur durch aktives Nachfragen Informationen gegeben werden. Aufgrund der Tatsache, dass die dazu benötigte Zeit nicht vergütet wird, besteht hier der berechtige Wunsch, umfassend informiert zu werden. Eine weitere bemerkte: „Wenn man weiß, wonach man fragen muss, weiß man meistens auch wen“ (IP 15). In diesen Antworten klingt wiederholt die Kritik an fehlenden Leitfäden bzw. Prozessdefinitionen an.
Eine Gesprächspartnerin (IP 4) gab an, dass Kommunikationsprobleme hauptsächlich in der Kommunikation mit dem Kooperationspartner Schule auftreten und ein Gefühl des Nachgeordnet-Seins („Musikschule als Anhängsel“) entsteht.
Bezüglich der Kommunikationsdefizite gelte es, die Perspektive zu berücksichtigen, ob es sich um die Sicht der Mitarbeiter oder die Sicht der Führungsebene handele (IP 19).
Der Bereich „Kommunikation“ tangiert selbstredend den dritten Merkmalsbereich „Soziale Beziehung“, da diese stets im sozialen Kontext stattfindet. Manche Rückmeldungen der Teilnehmerinnen lassen sich daher in beiden Merkmalsbereichen darstellen.
4.4.4. Merkmalsbereich 3: Soziale Beziehungen
Verhältnis zu Kolleg/-innen und Vorgesetzten
Wie bereits unter Punkt 4.4.3 zu Kommunikation (S. 48) beschrieben, bestehen deutliche Unterschiede in der Zusammenarbeit zwischen Musikschulen mit größerer Schülerzahl und denen mit kleinerer Schülerzahl sowie zwischen Musikschulen in der Stadt und Musikschulen im ländlichen Raum. Die Bewertung der Aussagen zum Verhältnis zu Kollegen wurde im ersten Fall tendenziell sowohl auf die Fachgruppe, als auch gesamtschulisch bezogen getroffen. Teilweise beschränkten sich die Angaben ausschließlich auf die Fachgruppe. Im zweiten Fall erfolgte die Einschätzung nur gesamtschulisch in Ermangelung von Fachgruppen. Teilweise waren Befragte einzige Vertreterinnen eines Instruments. Eine quantitative Auswertung der Aussagen zu Vernetzung, Unterstützung und Zusammenarbeit ist daher in dieser Vorstudie grafisch nicht sinnvoll darstellbar.
Das Verhältnis zu Vorgesetzten unterschied sich ebenfalls: in größeren Musikschulen wurden die Einschätzungen vorwiegend in Bezug auf den direkten Vorgesetzten getroffen (mit Ausnahme der drei IP, die die Position der Stellvertretung der Musikschulleitung inne hatten), in kleineren auf die Musikschulleitung, da teilweise eine mittlere Leitungsebene fehlt. Nur zwei Punkte sind grafisch darstellbar: das Stattfinden von entwicklungsorientierten Mitarbeitergespräche mit Vorgesetzten (Abbildung 35), wobei „direkte Vorgesetzte“ und Musikschulleitung zusammengefasst wurden sowie die soziale Unterstützung seitens des Vorgesetzten im Bedarfsfall.
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 35: Mitarbeitergespräche mit Vorgesetzten
Mehr als zwei Drittel der Befragten ist demnach im Gespräch mit der Leitungsebene. Zwei Anmerkungen ergaben, dass diese nur bei Bedarf stattfinden. An einer Institution werden regelmäßig zu Schuljahresbeginn Mitarbeitergespräche durchgeführt, in denen Schuljahresziele festgelegt werden, deren Erreichen am Schuljahresende prämiert werden (IP 12). Ergänzend zur zunächst freien Beschreibung der Gesprächskultur sollten die Befragten eine Auswahl zur Atmosphäre aus folgenden Items wählen: „wohlwollend“, „angespannt“, „auf Augenhöhe“, „hierarchiebetont“ und Abstufungen zwischen „trifft voll zu (1) – trifft überhaupt nicht zu (6)“ vornehmen. Diese sind allerdings grafisch nicht darstellbar. Festzustellen ist, dass der überwiegende Teil die Mitarbeitergespräche „wohlwollend“ sowie „auf Augenhöhe“ wahrnimmt.
Ebenfalls knapp zwei Drittel erfahren soziale Unterstützung im Bedarfsfall, z.B. in einer Notsituation im Zusammenhang mit der Familie (Abbildung 36).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 36: Soziale Unterstützung im Bedarfsfall
Verhältnis zu Schüler/-innen und deren Eltern
Die folgende Grafik zeigt, dass sich fast alle als Vertrauensperson sehen, die aufgrund der langjährigen Verbindung ein enges Verhältnis zu ihren Schülern entwickelt (Abb.37). Beschreibungen der Besonderheiten in der Beziehung zu den Schülern reichen bis hin zu: „Ich ‚gehöre‘ zu 20 Familien, sitze jeden Tag am Tisch und gestalte deren Familienkalender.“ (IP 3) Auch Chor-/Orchesterleiter beschreiben diese enge Verbundenheit. Unter dem Punkt „sonstige“ wurde die Beziehung zu den Schülern als verantwortungsvoll, liebevoll, positiv beschrieben. Zwei Teilnehmer sahen sich zweitweise als Mediator bzw. Coach (IP 1 und 2).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 37: Verhältnis zu meinen Schülern
Eine weitere Rückmeldung zielte auf den Aspekt der Gleichberechtigung ab: „Ich nehme sie (die Kinder) voll ernst und erwarte, dass sie mich auch voll ernst nehmen“ (IP 22).
Gebeten um die Beschreibung der Besonderheiten in der Beziehung zu den Eltern der Schülerinnen, gaben drei Teilnehmer an, diese teilweise gar nicht zu kennen. Neun Befragte bezeichneten das Verhältnis als „professionell: freundlich distanziert“, weitere sieben als „unproblematisch und gut“. Zwei nahmen sich teilweise in der Beraterrolle der Eltern wahr (im Elementarbereich). Wiederum zwei beschrieben die Beziehung als „sehr herzlich“. Zwei stellten eine Ähnlichkeit zur Beziehung mit den Schülern fest. In Ausnahmen sei das Verhältnis konfliktbehaftet, wobei hier anzumerken ist, dass oft ein einziges problematisches Elternteil für eine übermäßig hohe psychische Beanspruchung sorgt, auch wenn die Beziehung zu den übrigen 99% unkompliziert ist (IP 11). In einem Fall ist diese Beziehung sogar angstbesetzt (IP 16).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 38: Art des Einflusses beruflicher Kontakte auf Sozialleben
Festzustellen in Abbildung 38, dass etwas mehr als die Hälfte der Aussage zustimmt, die beruflichen Kontakte stellten eine Bereicherung und eine noch größere Mehrheit, sie stellten keine Belastung für das Sozialleben dar.
4.4.4.1. Diskussion, Feedback, weiterführende Fragestellungen
Verhältnis zu Kolleg/-innen und Vorgesetzten
Bei der Frage nach der Unterstützung seitens der Kollegen müsse das Problem der Organisation von Arbeitszeit in Musikschulen berücksichtigt werden. Aufgrund der ausschließlichen Definition über ein erfülltes wöchentliches Stundendeputat (i.d.R. samt Ferienüberhang) entstehe das Gefühl, dass ja bereits 100% der vereinbarten Leistung erbracht wurde und alles, was zusätzlich angefragt wird, „on top“, also freiwillig ist und demnach nicht erbracht werden muss (IP 3).
Mehrere Interviewpartnerinnen wiesen darauf hin, dass sie nie mit allen gleichermaßen gut zusammenarbeiten bzw. vernetzt sind. „Ich arbeite nicht mit Kollegen zusammen, mit denen es konfliktbehaftet wäre“ (IP 5).
Ein Interviewpartner (IP2) merkte an, dass es im Mitarbeitergespräch ja zwei Richtungen zu beachten gilt: Wie nimmt es der Mitarbeiter, wie der Vorgesetzte wahr?
Bei Zugehörigkeit zu zwei Fachbereichen in großen Musikschulen müssten nach Aussagen von zwei Teilnehmerinnen die Fragen zu Zusammenarbeit, Vernetzung und Unterstützung im Verhältnis zu den Kollegen getrennt beantwortet werden, denn diese Punkte sähen in den jeweiligen Fachbereichen völlig verschieden aus.
Die Aussage „Meiner Führungskraft gelingt es, gleichzeitig die Ziele der Organisation (Musikschule) voranzutreiben und mir dabei zu helfen, mein Potential zu entfalten“ zielt auf die Qualifikation der Führungskraft ab. Aus meiner Sicht sollte diese eine gute Balance zwischen beiden Polen herstellen. Hier gab es mehrere Rückmeldungen, dass diese Aussage nur in ihren einzelnen Teilen zu bewerten sei. „Wenn ich die Ziele der Musikschule erreichen will, mache ich mich im Kollegium u.U. reichlich unbeliebt“ (IP 19). Ein Interviewpartner merkte an, dass sich Ausschreibungen für Führungskräfte an Musikschulen vor allem auf die Fachlichkeit (abgeschlossenes Hochschulstudium) und nur unzureichend auf die Leitungsqualifikation beziehen (IP 8). Eine weitere Partnerin fand sehr drastische Worte: die Leitung sei sehr darauf bedacht, eine gute Reputation bei der Stadt zu erzielen, in der Öffentlichkeit gut dazustehen, der Einzelne sei egal (IP 11). Ähnlich äußerte sich eine andere: „Es geht nicht um mich, mein Vorgesetzter empfindet keine Fürsorgepflicht für mich. Ich fühle mich als gut ausgelastetes ‚Rennpferd’ in seinem ‚Stall‘“ (IP 10).
Die Rückmeldungen zur Feedbackkultur ergaben, dass diese an Musikschulen mindestens ausbaufähig, oft nicht vorhanden ist. Zu bedenken ist, dass wieder in Abhängigkeit von der Größe der Institution in den seltensten Fällen ein inhaltliches Feedback nur dort möglich ist, wo mehrere Kollegen das gleiche Fach unterrichten. Ansonsten kann es sich nur auf die Art der Zusammenarbeit beziehen bzw. nur allgemein gegeben werden, z.B. zu Projekten, Konzerten, etc. (IP 17).
Eine Rückmeldung zum Grad der Mitgestaltung ergab, dass oft nicht klar ist, ob die Idee überhaupt gewollt ist, Mitgestaltung zum Teil sogar behindert wird (IP 3). Ein anderer Gesprächspartner nahm die Beteiligung als „pro Forma, mit Alibifunktion“ wahr (IP 5). An einer Musikschule wurde der Grad der Mitgestaltung als sehr hoch angegeben (IP 7). Beispielsweise findet dort der Unterricht in festgelegten Wochen in alternativer Form nach dem Motto „Was Du schon immer mal machen wolltest“ statt.
Verhältnis zu Schüler/-innen und deren Eltern
Besonders der Einzelunterricht unterscheidet sich durch die 1/1 Situation deutlich vom Schulunterricht. Im Gegensatz zu letzterem bleibt diese Verbindung während der gesamten Schulzeit, oft darüber hinaus bestehen. „Wir sind neben den Eltern diejenigen, die das Kind über die gesamte Jugend begleiten, wir sind die Konstante.“ (IP 8). Dass die Lehrerin darauf angewiesen sei, in die Beziehung zu den Kindern hineingelassen zu werden, damit diese enge Vertrauensbasis entstehen kann, merkte eine Teilnehmerin (IP 3) dazu an.
Ein Befragter (IP 1) verwies auf die Herausforderung, sogenannten „Helikoptermüttern“, die sich nur schwer von ihren Kindern lösen, Grenzen zu setzen.
Nach dem zweiten Interview wurde die ursprüngliche Frage, ob die beruflichen Kontakte das Sozialleben bereichern, ergänzt um die zweite im Hinblick auf den belastenden Aspekt. Ein Interviewpartner hatte festgestellt, dass diese das Leben auf jeden Fall abwechslungsreicher machen, jedoch anzweifelte, ob diese stets das Sozialleben bereichern. Wiederum meldete eine Interviewpartnerin zurück: „Aufgrund dessen, dass ich so viel arbeite, habe ich gar keine Zeit für andere Kontakte, diese sind meine Sozialkontakte“ (ist alleinstehend).
4.4.5. Merkmalsbereich 4: Arbeitsumgebung
Arbeitsort
Befragt nach der Definition des Hauptarbeitsortes lauteten die Antworten „Schreibtisch zu Hause“ (zweimal), „Dirigentenpult“ (einmal), „Büro“ (einmal), Tanzsaal (einmal), mehrfach die Angabe des Hauptgebäudes der Musikschule, Nennung der Außenstelle, wo am meisten unterrichtet wird bis hin zum „eigenen“ Unterrichtsraum (viermal).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 39: Anzahl Unterrichtsorte
Etwas weniger als die Hälfte der Befragten unterrichtet „nur“ an einem Ort, die übrigen arbeiten an zwei bis fünf verschiedenen Orten (Abbildung 39).
Von denjenigen, die an mehreren Unterrichtsorten tätig sind, arbeiten 43% am gleichen Tag an mehreren Orten (Abbildung 4040).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 40: Tage mit mehreren Orten
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 41: Belastungsfaktoren Arbeitsort
Aus Abbildung 41 wird ersichtlich, welche äußeren Faktoren am jeweiligen Ort das Arbeiten beeinflussen. Unter „Sonstige Faktoren“ wurden genannt: „kein eigener Umkleideraum“ (für Tanzunterricht), „abends allein unterrichten in einer großen Schule“ (zweimal), „Suche nach dem Hausmeister in Schulen“, „Unsicherheit der Schlüsselübergabe“, Schlüsselverantwortung sowie „nichtabschließbarer Raum“.
Körperliche Tätigkeit
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 42: Schwere körperliche Tätigkeit
Die Antworten auf die Frage nach der Häufigkeit von Situationen im Arbeitsalltag, in denen schwere körperliche Arbeit zu verrichten ist, sind in Abbildung 42 dargestellt. Festzustellen ist, dass Interviewpartnerinnen, die mit Gruppen arbeiten (Tanz-Unterricht, Unterricht in der Elementarstufe, Orchesterleitung), besonders häufig schwere körperliche Tätigkeit (beim Einrichten des Raumes oder beim Instrumententransport) verrichten. Nur vier Befragte gaben an, dass sie nie körperlich schwer arbeiten müssen. In der Regel fällt schwere körperliche Arbeit (Instrumententransport, Räum-/Aufbauarbeiten etc.) im Zusammenhang mit Konzerten, Schuljahresendpräsentationen oder auch Musizierstunden an. Hierbei besteht natürlich auch ein instrumentenspezifischer Unterschied z.B. zwischen Schlagzeugunterricht und Gesangs-/Instrumentalunterricht mit Streich-, Blas- oder Bundinstrumenten etc..
Arbeitsmittel
Abbildung 43 verdeutlicht, wie viele Befragte über welche Arbeitsmittel verfügen bzw. unkomplizierten Zugang dazu haben. Die überwiegende Mehrheit hat eine eigene Dienstmailadresse, verfügt über einen unkomplizierten Zugang zum Kopierer, über Notenständer sowie zusätzliches Instrumentarium (Klavier als Begleitinstrument, Orff-Instrumente etc.). Die reichliche Hälfte hat einen Schreibtisch am Arbeitsplatz sowie Zugriff auf technisches Equipment (Abspielgerät, Lautsprecher etc.).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 43: Vorhandene Arbeitsmittel
Nur vier Befragte (ausnahmelos in Führungspositionen) haben ein Diensthandy.
Fünf Befragten wird Büromaterial zur Verfügung gestellt. Ein knappes Drittel verfügt über einen Laptop/Computer oder ein Tablet/I-Pad, wobei drei davon über beides verfügen. Das Hauptinstrument wird ebenfalls einem Drittel der Befragten zur Verfügung gestellt.
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 44: Bereitstellung/ Zufriedenheit mit elektronischen Arbeitsmitteln
Befragt nach der Zufriedenheit mit den zur Verfügung gestellten Arbeitsmitteln, ergibt sich folgendes Bild: die Zufriedenheit mit einem elektronischen Arbeitsmittel ist bei den wenigen, die es zur Verfügung gestellt bekommen, überwiegend hoch (Abb. 44). Nur drei Angaben wurden tendenziell im negativen Bereich gemacht.
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 45: Bereitstellung/ Zufriedenheit mit Instrumentarium
Die Mehrheit der Befragten unterrichtet auf dem eigenen Instrument. Eine überwiegende Zufriedenheit bei vorhandenen Schüler-Leihinstrumenten sowie zusätzlichem Instrumentarium ist ablesbar (Abbildung 45).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 46: Bereitstellung/ Zufriedenheit mit weiteren Arbeitsmitteln
Die knappe Mehrheit hat Zugang zu einem Kopiergerät und ist damit überwiegend zufrieden. Die Zufriedenheit beim technischen Equipment ist dagegen eher geteilt: fünf sind eher nicht zufrieden, sieben eher bis voll zufrieden, die andere reichliche Hälfte verfügt über kein technisches Equipment. Auf Büromaterial können nur fünf Befragte, die in Führungspositionen arbeiten, unkompliziert zugreifen (Abb. 46).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 47: Bereitstellung/ Zufriedenheit mit digitalen Arbeitsmitteln
Cloudlösungen an den befragten Musikschulen stellen eher die Ausnahme dar. Diejenigen, die darüber verfügen, sind überwiegend bis voll damit zufrieden. Zwei Drittel haben ein eigenes E-Mail Konto und sind mit zwei Ausnahmen ebenfalls überwiegend bis voll zufrieden. An weniger als der Hälfte der befragten Musikschulen kommt eine entsprechende Musikschulsoftware zum Einsatz. Bei zwei Dritteln ist diesbezüglich eine Zufriedenheit mit der Software festzustellen (Abbildung 47).
Befragt nach den Wünschen bezüglich der Arbeitsmittel (Abbildung 48) wurde Grundausstattung bzw. am Bedarf ausgerichtete Ausstattung des Raumes genannt, d.h. in jedem Raum sind die für den dort stattfindenden Unterricht benötigten Arbeitsmaterialien vorhanden.
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 48: Benötigte Arbeitsmittel
Weitere Wünsche sind: Dienst Tablet (dreimal), Diensthandy (zweimal), Anschaffung von Noten, die Einrichtung einer digitalen Notenbibliothek, auf die alle Kollegen Zugriff haben (zweimal), Archivschränke für eine Notenbibliothek, ein abschließbarer Schrank, WLAN in allen Bereichen der Musikschule, Anschaffung von Musik für den Tanzunterricht, Cloudlösung, Farbkopierer, Gehörschutz sowie Lautsprecher. Darüber hinaus wurden Wünsche nach „Fortbildung im Bereich Digitalisierung“ bzw. im Umgang mit Musikschulsoftware (zweimal) sowie „modernisieren“ bzw. eine hochwertige Ausstattung geäußert.
4.4.5.1. Diskussion, Feedback, weiterführende Fragestellungen
Arbeitsort
Bereits die Vielzahl der Antworten auf die Frage nach dem Hauptarbeitsplatz offenbarte ein potentielles Feld hoher psychischer Belastungen, da eine eindeutige Definition nicht immer möglich ist. Ein Interviewpartner stellte die Gegenfrage: „Meinst Du jetzt einen Ort?“. Diese Musikschule verfügt über kein eignes Gebäude, sondern lediglich über drei Verwaltungsräume in einem Landratsamt. Der Unterricht findet ansonsten ausschließlich in Schulgebäuden statt, in denen die Musikschule eingemietet ist. Zu beobachten ist diese Situation oft an Musikschulen im ländlichen Raum. Eine Interviewpartnerin antwortete auf die Eingangsfrage: „Das ist der Witz des Lebens: ich habe überhaupt keinen Arbeitsplatz. Ich hätte gerne einen, wo ich hingehen und entsprechend auch die Tür hinter mir schließen kann.“ (IP 22)
Eine Tendenz zeichnet sich schon in dieser geringen Stichprobe ab: je älter und erfahrener die Befragten sind, desto weniger findet ein Ortswechsel am selben Tag statt. In manchen Fällen wird generell die Anzahl der Arbeitsorte reduziert (IP 13, 14, 16, 18). Man ist im Laufe der Jahre bestrebt, die Arbeitsbedingungen für sich so zu gestalten, dass der hohe Anteil der zu erbringenden Unterrichtsleistung bei Festanstellung auch leistbar ist, wie z.B. Unterrichtsorte, die nun näher beieinander liegen, Ausstieg aus bestimmten Unterrichtsformen (Klassenunterricht), Unterrichtszeitenoptimierung, Unterricht in musikschuleignen Gebäuden/Hauptstellen (IP 3, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 21).
Die berechnete Arbeitszeit für den Wechsel des Arbeitsortes steht in der Regel in keinem Verhältnis zur tatsächlich aufgewendeten Zeit (IP 15 und 16) oder wird erst gar nicht angerechnet. Eine Interviewpartnerin wies darauf hin, dass die Belastung oftmals daraus entsteht, dass zwei Arbeitsblöcke an einem Tag liegen und eine zu lange Pause dazwischen besteht, die aufgrund der langen Wege nicht effektiv genutzt werden könne. In diesem Fall handelte es sich um Unterricht im Elementarbereich, wo oftmals die Zeiten durch die Kooperationspartner (Kindertagesstätten, Schulen) gesetzt sind.
Bei der Erfassung der Belastungsfaktoren am Arbeitsort wurde gleichzeitig der daraus resultierende Belastungsgrad erfasst. Aufgrund des geringen Stichprobenumfangs lassen sich diese Angaben jedoch nicht sinnvoll grafisch darstellen. Festzustellen ist, dass beispielsweise ein unsauberer Raum oder ein hoher Geräuschpegel nicht zwangsläufig als beeinträchtigend wahrgenommen werden.
Zwei Interviewpartner (IP 21 und 22) gaben an, in Räumen ohne Tageslicht zu unterrichten. Dieser Tatbestand kann als Impuls für eine Diskussion darüber genutzt werden, ob es sich bei einer Musikschule um eine Bildungseinrichtung handelt oder nicht. Laut Arbeitsstättenverordnung ist (Schul-)Unterricht in Räumen ohne Tageslicht nicht vorgesehen. [91] Im Laufe der Befragung wurden zusätzliche Faktoren wie unsaubere Räume (ab dem 7. Interview) oder unangemessene Temperatur ergänzt. Beim Unterricht in Schulen stellt in einigen Fällen die Schlüsselfrage eine besondere Herausforderung dar: Ist es rein rechtlich überhaupt zulässig, dass die Verantwortung für das Abschließen einer allgemeinbildenden Schule beim Musikschullehrer liegt, der als letzter das Gebäude verlässt?
Arbeitsmittel
Eine Interviewpartnerin (IP 3) merkte an, dass es wichtig sei zu definieren, ab wann man von „Bereitstellung“ sprechen kann. Am Beispiel des Kopierers ließe sich das gut verdeutlichen: die meisten (17 Befragte) haben Zugang zu einem solchen. Einsatzbereit heißt, es steht genügend Papier in den entsprechenden Formaten bereit, der Toner ist voll, usw.. Haupteinsatzzeit des Kopierers sind der Nachmittag und Abend. Die Verwaltung ist in der Regel nur bis zum Nachmittag besetzt. Für alle diejenigen, die in Außenstellen oder Schulen unterrichten, ist der Gang zum Kopierer mit einem zusätzlichen Weg verbunden (IP 16).
Zwei Befragte gaben sinngemäß an, dass die bereitgestellten Arbeitsmitteln nur „mittelmäßig“ seien und eher einem Stückwerk glichen (IP 5 und 8).
Eine große psychische Belastung entstehe daraus, dass die wirklich benötigten Arbeitsmittel eben nicht bereitgestellt werden und sich die Lehrkraft diese quasi „erbetteln“ muss (IP 3) oder privat zur Verfügung stellt. Für viele ist letzteres selbstverständlich und wird nicht hinterfragt (IP 12).
Berufsanfängerinnen, vor allem im Elementarbereich investieren u.U. einen großen Teil ihres Gehalts in die Anschaffung von Arbeitsmitteln, z.B. Triangeln, Trommeln, Tücher etc.(IP 16), um für den Unterricht, der nicht im Haupthaus stattfindet, adäquat ausgestattet zu sein. Hinsichtlich des zur Verfügung gestellten Instrumentariums besteht nämlich oft ein großer Unterschied zwischen dem Unterricht in musikschuleigenen Gebäuden und dem Unterricht in der Außenstelle/beim Kooperationspartner (Kindergärten, Schulen). Teilweise muss die Unterrichtskonzeption auf die vor Ort zur Verfügung stehenden Arbeitsmittel (z.B. Anzahl der vorhandenen Xylophone) angepasst werden. Alternativ muss das umfangreiche Instrumentarium für jede Stunde aus dem Hauptgebäude zum Einsatzort und zurück transportiert werden.
Ein Gesprächspartner wies auf das Problem praxisbezogener Musikschulsoftware hin. Die Entwicklung einer solchen durch große Firmen wäre finanziell nicht leistbar, so dass man auf kleinere, preisgünstigere Firmen angewiesen sei, deren Lösungen jedoch oft kompromissbehaftet sind. Die dazugehörigen Apps seien rudimentär (IP 19).
Zur Vereinfachung der Darstellung habe ich bei den Angaben zur Zufriedenheit mit bestimmten Arbeitsmitteln Angaben mit X,5 aufgerundet (z.B. 3,5 = 4). Eine Interviewpartnerin, die jeden Tag in einem anderen Raum unterrichtet, gab beim Hauptinstrument (Klavier) drei Rückmeldungen. Hier habe ich den Durchschnitt gebildet.
4.4.6. Merkmalsbereich 5: Neue Arbeitsformen und zusätzlich belastende Faktoren
Neue Belastungen im Zusammenhang mit Digitalisierung und Erfahrungen mit Onlineunterricht
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung49: Neue Belastungen im Zusammenhang mit Digitalisierung
Ein Ziel dieser Arbeit besteht darin herauszufinden, ob es noch weitere psychische Belastungen gibt, die in einer standardisierten Gefährdungsbeurteilung bisher zu wenig Berücksichtigung fanden. Daher habe ich die Teilnehmerinnen zunächst nach neuen psychischen Belastungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Arbeitsalltags gefragt (Abbildung 49). Unter „sonstige“ Belastungen wurden subsummiert: Informationsflut, Anonymität, Kommunikationsprobleme zwischen den Generationen, eine gewisse Überforderung/Unübersichtlichkeit in Anbetracht einer Vielzahl an nutzbaren bzw. von Eltern/Schülern genutzten Kommunikationskanälen, die Vielfalt fächerspezifischer Bedürfnisse hinsichtlich Nutzung und Equipment, begrenzte zeitliche und finanzielle Ressourcen, die zunehmende Bequemlichkeit der Schüler sowie die Verlagerung von Verantwortlichkeiten.
Die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Erteilung von Onlineunterricht während der Coronazeit waren gemischt, wenngleich die negativen überwogen:
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Tabelle 2: Erfahrungen Erteilung Onlineunterricht
Die positiven Rückmeldungen verwiesen auf den Aspekt, dass gerade in dieser Zeit der Strukturierung des Alltags eine große Bedeutung zukam. Für manche Familien stellte der Unterricht einen Höhepunkt im Alltag dar. Die Lehrkraft erhielt teilweise wiederum einen kleinen Einblick in das private Umfeld des Schülers: z.B. auf welchem Stuhl dieser saß (und sich daraus u.U. Haltungsbesonderheiten erklärten). Der Onlineunterricht bot die Möglichkeit, den sozialen Kontakt zu halten (vier Nennungen). Ein Interviewpartner sprach von „Sozialarbeit, die die maximale Isolation durchbricht“ (IP 6). Als „spannende Herausforderung“ betrachtet, waren manche Dinge deutlicher ins Bewusstsein gerückt, somit methodische Lernerfahrungen möglich (IP 3). Schwerpunkte verlagerten sich: es war plötzlich Zeit, auch theoretische Inhalte ausführlich zu besprechen oder reine Bewegungsabläufe zu trainieren.
Viele litten allerdings darunter, dass vor allem Klangarbeit nicht möglich war und sich in der Folge die Klangqualität des Musizierens verschlechtert hat. Man war gezwungen, die Unterrichtsinhalte zu reduzieren, weil nur ein Bruchteil der Information übertragen wurde und der Schüler teilweise schlecht oder nur zum Teil zu sehen war. Eine Erweiterung der Fähigkeiten wäre nicht möglich gewesen, sondern nur deren Erhaltung. Ein Bläser berichtete, dass sich manche klangliche Einbußen beim Musizieren erst im Nachhinein herausstellten. Aus Angst z.B. im Mehrfamilienhaus die Mitbewohner zu stören oder aufgrund der Tatsache, dass nur ein kleines überhalliges Zimmer zum häuslichen Üben zur Verfügung steht, hatte sich mancher Schüler mit einem verhaltenen Klang arrangiert, der mühsam wieder entfaltet werden musste. Für Unterricht im Elementarbereich sei diese Form des Unterrichts gänzlich ungeeignet, auch wenn „kleine Videos im Sandmännchen -Format“ erstellt wurden (IP 13). Ebenso verwiesen drei Teilnehmer darauf, dass ein Anfangsunterricht, in dem das Erlernen der richtigen Spielhaltung im Vordergrund steht und die unmittelbare Korrektur seitens der Lehrkraft notwendig ist (i.d.R. auf schnellstem Weg über Körperkontakt), per Videoübertragung nicht möglich ist. Natürlich gab es Versuche, gemeinschaftliches Musizieren mit entsprechender Software zu ermöglichen, um Orchester-/Register-/Chor-/Ensembleproben in einer alternativen Form abzuhalten. Also besonders innovativ stellte sich die Software „Jamulus“ heraus. Eine Teilnehmerin verwies darauf, dass es sich bei allen Varianten dennoch um die Produktion einer Tonaufnahme handele: „Die Gleichzeitigkeit, aus der meine Arbeit besteht, d.h. dass sich alle gleichzeitig singen hören, ist nicht möglich“ (IP 22). Darüber hinaus bedarf es der entsprechenden technischen Ausstattung sowohl seitens des Lehrers, als auch des Schülers jeweils auf eigene Kosten. Als besonders belastend wurden die z.T. schlechte Übertragungsqualität, Verzögerung in Bild und Ton, Latenzen, mangelhafte WLAN- Verbindung und Leitungsstörungen generell genannt. Ein Teilnehmer merkte an, dass damit die „Barrierefreiheit“ nicht gewährleistet sei (IP 8). Manche Teilnehmer litten unter körperlichen Symptomen: Tinnitus (IP 11) und große körperliche Erschöpfung (zwei Nennungen). Zwei Teilnehmer berichteten von Schülerverlusten im Ensemble/Orchester. Die Erfahrung, dass der Unterricht quasi „entbehrlich“ sei, hätte immer noch Nachwirkungen und die Reaktivierung sei beschwerlich. Auch jetzt gäbe es hin und wieder die Anfrage, ob Onlineunterricht möglich sei, um z.B. eine Freistunde in der Schule zu überbrücken oder aus Bequemlichkeitsgründen nicht das Haus verlassen zu müssen (IP 21).
Zusätzlich belastende Faktoren: Verdienst
Etwas mehr als die Hälfte (13 Befragte) ist der Meinung, dass die Tätigkeit nicht angemessen vergütet wird (Abbildung 50).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 50: Angemessene Vergütung
Ebenfalls geben 13 Befragte (reichliche Hälfte) an, allein vom Verdienst der Arbeit leben zu können (Abbildung 59 im Anhang).
Die größte Einigkeit bestand bei der Aussage, dass Verdienst und Ausbildungsdauer/Ausbildungsniveau in keinem Verhältnis stehen. Nur drei Befragte waren anderer Meinung (Abbildung 51).
Auf die Frage „Ich empfinde meine Arbeit im Vergleich mit Lehrern an allgemeinbildenden Schulen nicht gerecht vergütet.“ gab es geteilte Rückmeldungen.
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 51: Verhältnismäßigkeit Verdienst zu Ausbildungsdauer/ Ausbildungsniveau
Fünf Teilnehmerinnen enthielten sich der Stimme und waren der Meinung, dass die Tätigkeiten nicht zu vergleichen sind. Die knappe Hälfte (10 Teilnehmer) stimmten der Aussage voll zu, der Rest tendenziell auch (Werte 2 und 3).
Zusätzlich belastende Faktoren: Diskriminierung und Benachteiligung
Fast allen Befragten waren keine Fälle von Diskriminierung oder Benachteiligung bekannt. Nur zwei Ausnahmen benannten die „Spaltung“ der Musikschulbelegschaft in freie und festangestellte Mitarbeiter als Benachteiligung ersterer.
Zusätzlich belastende Faktoren: Psychische Belastungen infolge gesellschaftlicher Umbrüche
Danach gefragt kristallisierten sich drei Schwerpunkte heraus (Tabelle 3). Die Regellosigkeit sahen zwei Teilnehmer als Belastung, darüber hinaus die Haltlosigkeit. Außerdem wurde „hoher Individualismus“ von drei Befragten als problematisch eingestuft. Die zu beobachtende Spaltung der Gesellschaft ginge auch durch die Familien (IP 4) und belaste das Verhältnis zur Musikschullehrerin. Ein Gesprächspartner verwies überdies auf abnehmende Konzentrationsfähigkeit, körperliche, physische und mentale Voraussetzungen der Schüler und mangelnde Unterstützung seitens der Eltern (IP 8). Aufgrund der Dominanz von Social Media unterliege man einem Aktualitätszwang, schätzte ein weiterer Gesprächspartner ein, überdies sei eine gewisse Rastlosigkeit zu beobachten (IP17).
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Tabelle 3: Psychische Belastungen in Folge gesellschaftlicher Umbrüche
Im Nachgang der Corona-Krise finde die Aufarbeitung der Reglementierungen und die Bewältigung der damit verbundenen Konsequenzen, wie z.B. die Gemeinschaftsentwöhnung, nicht in erforderlichem Maße statt. Der Stellenwert von Kultur und Gemeinschaft müsse erst wieder neu etabliert werden (IP 22).
Zusätzlich belastende Faktoren: Öffentliche Wahrnehmung der Musikschule
Bezüglich der öffentlichen Wahrnehmung der Musikschulen vor Ort bestehen große Unterschiede (Abbildung 60 im Anhang). Manche Musikschulen werden eher wie „ein lästiges Anhängsel“ (IP 11) behandelt, andere erfahren eine hohe Wertschätzung.
Die öffentliche Musikschule wird von den Eltern als qualitativ hochwertige Bildungseinrichtung sehr geschätzt und bewusst ausgewählt. Allerdings scheint es hinsichtlich des Stellenwertes einen Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung durch die Stadt zu geben. Die Musikschule würde durch letztere als eine von vielen anderen Einrichtungen musikalischer Bildung ohne besonderen Stellenwert angesehen (IP 13).
Ein Gesprächspartner in Leitungsfunktion sah sich in die Rolle einer Veranstaltungsagentur gedrängt, die auf Zuruf die musikalische Ausgestaltung von Veranstaltungen organisiert. Die Musikschule würde zudem in „ein Korsett“ gezwängt (Verwaltungsapparat), was überhaupt nicht passt (IP 19).
Eine weitere Gesprächspartnerin sah die unzureichende Öffentlichkeitsarbeit aufgrund schlechter Veranstaltungswerbung als Ursache mangelnder öffentlicher Wahrnehmung und Wertschätzung (22).
Weitere belastende Faktoren
Bereits im Verlauf der Interviews kamen immer wieder Verweise darauf, welche weiteren Faktoren für den einzelnen Befragten eine Belastung darstellen. Diese fließen neben den Rückmeldungen am Ende ebenfalls in die Übersicht im Fazit ein (Punkt 5, Tabelle 2 und 3).
Drei Teilnehmer (IP 1, 5, 6 ) wünschten sich mehr Beteiligung und Informationen hinsichtlich der Entwicklung von Visionen zukünftig konzeptioneller Ausrichtung der Musikschule. Ein Gesprächspartner warf der Schulleitung diesbezügliche „Feigenblattpolitik“ sowie „Pseudodemokratie“ vor (IP 1). Außerdem verwies er darauf, dass das festangestellte Kollegium inzwischen zusammen gealtert sei und sich aufgrund der langen Zusammenarbeit verfestigte „Claims“ entwickelt hätten, die den (kommunikativen) „Durchfluss verhindern“.
Ein anderer Gesprächspartner sah sich dem Druck gegenüber, in der Öffentlichkeit zu bestehen bei Orchesterauftritten, Wettbewerbsteilnahme von Schülern/Ensembles, bei denen indirekt die Lehrkraft mitgewertet wird (IP 2).
Drei Teilnehmer sorgten sich darum, dass die Erteilung von Musikschulunterricht aufgrund der zunehmenden Ausdehnung des regulären Schulunterrichts in den Nachmittagsbereich in sich beständig verkleinernden Zeitfenstern möglich ist (IP 8, 11, 14). Die Sorge um die Zukunft des Berufes treibe IP 8 an, politische Aufklärungsarbeit zu leisten, was Kraft und Zeit koste.
Übergriffige Eltern, die die persönlichen Grenzen bzw. die Privatsphäre nicht respektierten, seien sehr belastend (IP 11).
Ein Gesprächspartner, der sowohl an der Musikschule, als auch an Schulen unterrichtet und hier wie dort Orchester leitet bzw. aufgebaut hat, beklagte, dass die sich durch die Kooperationen bietenden Synergien und Chancen nur unzureichend genutzt würden, z.B. die Vernetzung von Schulorchester und Musikschulorchester oder die Nachwuchsgewinnung begabter Musikschüler (IP 18).
Zwei Führungskräfte beklagten den Fachkräftemangel, zumal auch Schulen händeringend Quereinsteiger suchten, die nach einer deutlich höheren Gehaltsgruppe entlohnt werden (IP 19). Zukunftssorgen in Anbetracht von Personalstopp bei Festanstellung, nicht erfolgender Nachbesetzung bei Verrentung und ständiger Mittelknappheit machte sich auch IP 22.
IP 23 beklagte den geringeren gesellschaftlichen Stellenwert der Tätigkeit im Vergleich zu Lehrern an allgemeinbildenden Schulen (IP 23).
4.4.6.1. Diskussion, Feedback, weiterführende Fragestellungen
Neue Belastungen im Zusammenhang mit Digitalisierung und Erfahrungen mit Onlineunterricht
IP 3 konstatierte, alles sei eine Frage der Umsetzung. Die Digitalisierung biete die Möglichkeit, dass alles sehr gut würde, bei schlechter Umsetzung aber zu zusätzlichen Belastungen führe. Da es kein Bestandteil der Ausbildung sei, bestehe hier ein hoher Fortbildungsbedarf (IP 7). In den seltensten Fällen erfährt der zusätzliche Aufwand (z.B. Einrichtung und updaten der Geräte, selbstständige Einarbeitung/ Weiterbildung etc.) eine arbeitszeitliche Anerkennung. Im Tätigkeitskatalog einer Musikschullehrkraft sind keine derartigen Aufgaben aufgeführt.
Ein Interviewpartner sah die Gefahr der Arbeitsverdichtung. Effizienteres Arbeiten würde dazu führen, dass noch mehr Arbeit übertragen wird, die Arbeit sich zusätzlich entgrenzt und aufgrund der Möglichkeit des Onlineunterrichts nun auch im beiderseitigen Krankheitsfall unterrichtet werden könnte (IP 8). Musikschullehrkräfte sind hinsichtlich der Abgrenzung auf sich allein gestellt und müssten dem Erwartungsdruck standhalten, z.B. auf eine noch schnell geschriebene Anfrage ebenso schnell zu antworten.
Zusätzlich belastende Faktoren -psychische Belastung als Ergebnis gesellschaftlicher Umbrüche
Ein Interviewpartner (IP 1) gab zu bedenken, dass die Rolle als orientierungsgebender Ansprechpartner wichtiger wird und zugleich die Unsicherheit bezüglich der Befugnisse zunimmt: „Was darf ich sagen und was nicht?“. Bei klarer Positionierung mache man sich angreifbar. Wir würden uns selbst aufgrund unserer Sprachregulierungen einschränken, beklagt ein anderer (IP 2).
„Wer bezahlt, hat Recht und fertig“ formulierte eine Teilnehmerin (IP 16). Hierin klingt die Diskrepanz zwischen dem Selbstverständnis vieler Musikschullehrkräfte an, die sich dem musikalischen Bildungsauftrag verpflichtet, aber als Dienstleister behandelt fühlen.
Zusätzlich belastende Faktoren - Verdienst
Bei der Aussage, vom Verdienst allein leben zu können, muss natürlich mit beachtet werden, dass 78% der Befragten in fester Partnerschaft leben und die Aussage u.U. hypothetischen Charakter hat.
Ein Familienvater kann nur durch zusätzlichen Verdienst in einem anderen Berufszweig das Einkommen seiner Familie sicherstellen: „Wenn der Musikschulverdienst reichen soll, müsste ich allein leben“ (IP 23).
Die Frage nach dem Vergleich mit Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen hatte ich mit aufgenommen, da Musikschullehrkräfte besonders im Bereich Kooperationen mit Schulen durchaus mit großen Gruppen arbeiten, jedoch in einer anderen Entgeltgruppe (EG 9) als Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen (EG 13) vergütet werden.
Zusätzlich belastende Faktoren - öffentliche Wahrnehmung
Ein Teilnehmer beklagte, dass im Gegensatz zur musikalischen Bildung der Sport in der Stadt stark hofiert und sogar ein „Sportler des Jahres“ ausgelobt wird. Könnte nicht die gleiche Ehre einem „Musikschullehrer des Jahres“ zuteilwerden (IP 1)? Im ländlichen Raum, in dem Musikschulen oft den Rang eines Kulturzentrums einnehmen, kommt der Institution ein ganz anderer Stellenwert zu, als in Städten, wo Musikschulveranstaltungen mit einem reichhaltigen Angebot der Theater, Opernhäuser etc. konkurrieren (IP 12). Im günstigsten Fall kooperieren Kultureinrichtungen und Musikschule miteinander, wie es IP 20 beschreibt.
Zu untersuchen wäre nun, inwieweit die öffentliche Wahrnehmung der Musikschule tatsächlich mit der Verortung korreliert. Das war in dieser Studie so nicht möglich, da nur 11 Aussagen in die Auswertung eingeflossen sind.
Weitere belastende Faktoren
Mit der Frage „Was machen sie eigentlich hauptberuflich?“ wurde IP 3 während der Durchführung eines Orchester-Probenlagers am Wochenende konfrontiert und litt unter der offensichtlichen Nichtanerkennung des Berufes.
Ein Gesprächspartner merkte an, dass aufgrund der Einstufung als „freiwillige Leistung“ der Kommune die Tätigkeit beständig unter Vorbehalt stehe. „Durch die intensive Art und Weise, wie wir uns mit unserer Tätigkeit identifizieren, wird es existenzbedrohend, wenn diese in Frage gestellt wird“. Er konstatierte, dass die Rahmenbedingungen belastender sind, als das, was täglich vor Ort passiert (IP 8).
Als eine Musikschule im Zuge des städtischen Haushaltsicherungskonzeptes Gefahr lief, geschlossen zu werden, sah sich das Kollegium plötzlich mit dem Satz konfrontiert: „Sie müssen sich rechnen.“, der jeder Wertschätzung seitens der Stadt entbehrte (IP 9).
Eine ausgewogene Energiebilanz sei wichtig, um gesund zu bleiben und oft nicht gewährleistet (IP 12).
5 Fazit
Ausgehend von meiner Forschungsfrage habe ich als Ergebnis meiner Arbeit die wichtigsten Faktoren psychischer Belastungen bei Musikschullehrkräften in Tabelle 4 (Merkmalsbereiche 1 bis 4) und Tabelle 5 (Merkmalsbereich 5 und zusätzliche Faktoren im Zusammenhang mit musikalischer Bildung/dem Berufsstand Musikschullehrkraft allgemein sowie der Institution Musikschule) zusammengefasst.
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Tabelle 4: Zusammenfassung (1) wichtigste Faktoren psychischer Belastung
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Tabelle 5: Zusammenfassung (2) wichtigste Faktoren psychischer Belastung
Im Ergebnis der Analyse des inhaltlichen Teils meiner Vorstudie verdeutlicht die Übersicht auf einen Blick, dass am Arbeitsplatz von Musikschullehrkräften eine Vielzahl von Faktoren psychischer Belastung zutreffen. Damit ist festzustellen, dass nach Karasek [92] von einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgegangen werden kann.
Im Hinblick auf den Entscheidungsspielraum in der Arbeit ist festzustellen, dass dieser im Bereich der Unterrichtstätigkeit eher hoch, allerdings im Hinblick auf administrative Zusammenhangstätigkeiten eher niedrig eingeschätzt wird. Betrachtet man die Gesamtheit des inhaltlich/fachlichen Entscheidungsspielraumes einer Musikschullehrkraft, wird dieser jedoch von der überwiegenden Mehrheit als hoch – sehr hoch eingeschätzt. Demnach würde in diesem Punkt kein erhöhtes Gesundheitsrisiko bestehen. Allerdings gab es mehrfach die Aussage, dass aufgrund des daraus entstehenden „Kreativitätsdrucks“, alles allein entscheiden, gestalten und durchführen zu müssen, eine psychische Belastung entsteht. Der überwiegende Teil der Befragten ist sich der sozialen Unterstützung seitens des Vorgesetzten im Bedarfsfall gewiss. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass überwiegend auf die Unterstützung im Kollegium zurückgegriffen werden kann, was die psychischen Belastungen nach diesem Modell mindert.
Aus Tabelle 4 ist ersichtlich, dass eine große Unzufriedenheit im Hinblick auf die Vergütungssituation besteht. Festangestellte klagen über zu niedrige Eingruppierung und sind sich einige, dass Verdienst und Ausbildungsdauer/Ausbildungsniveau in keinem Verhältnis stehen. Honorarkräfte sind prekär beschäftigt und nehmen z.T. zur Sicherung ihres Lebensunterhalts mehrere Arbeitsverhältnisse auf. Auch wenn durchaus bei der Hälfte der Befragten Gedanken zur beruflichen Veränderung auftreten bzw. aufgetreten sind, muss konstatiert werden, dass es keine wirkliche Arbeitsplatzalternative gibt, abgesehen von einem generellen Wechsel des Berufes. Feste Stellen sind rar. Für Honorarbeschäftigte sind die Bedingungen institutionsunabhängig vergleichbar schlecht. Karrierechancen bestehen im administrativen Bereich so gut wie gar nicht, da es nur an großen Musikschulen neben der Musikschulleitung eine mittlere Leitungsebene gibt. Es bestehen eher vertikale Entwicklungsmöglichkeiten (Fachkarriere). Auch hier sehen einige Befragte reelle Entwicklungschancen eher außerhalb der Institution. Die Gefahr beruflicher Gratifikationskrisen [93] sehe ich somit sehr deutlich durch diese Befragung bestätigt.
In der Vorstudie konnten zahlreiche Stressoren identifiziert werden, die nach dem transaktionalen Stressmodell zu einem Ungleichgewicht zwischen Person und Umwelt führen[94]:
Die unregelmäßige Verteilung der Arbeitszeit während eines Schuljahres führt in Hauptbelastungszeiten zu unzureichender Regenerationszeit. Hinzu kommen verschwommene Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit sowie Entgrenzung der Arbeitszeit bis in die späten Abend- und Nachtstunden sowie Arbeit am Wochenende. Eine Ursache dafür ist der nicht erfasste und damit unsichtbare Teil der Arbeitszeit im Bereich Zusammenhangstätigkeit. Mancher Lehrkraft fällt die Abgrenzung aufgrund einer gefühlten Verantwortung schwer. Insgesamt wird die hohe arbeitszeitliche Belastung bei Vollbeschäftigung sowie die knapp bemessene Unterrichtszeit für einzelne Schüler vor allem im instrumentalen Anfangsunterricht beklagt, die zu erhöhtem Zeitdruck führt.
Im elementaren Bereich sind die Arbeitsbedingungen so kraftzehrend, dass tendenziell hauptsächlich jüngere Lehrkräfte den Anforderungen gewachsen sind und nach einer bestimmten Zeit der Unterrichtsschwerpunkt in den Vokal-/Instrumentalunterricht verlagert wird. Schwere körperliche Tätigkeit bei Instrumententransport, Einrichtung des Raumes und im Unterricht selbst sind hier an der Tagesordnung. Hinzu kommen lange Fahrtwege zwischen den einzelnen Unterrichtsorten, im ländlichen Raum eine schlechte Anbindung an den ÖPNV sowie die unzureichende Anrechnung von Fahrtzeiten.
Im Hinblick auf die Leistungsvoraussetzungen/Ressourcen der Person übersteigende Anforderungen wurden mangelnde Qualifikation für die Arbeit mit Migranten/Flüchtlingen Sprachbarrieren, kultureller Hintergrund und Inklusion genannt, darüber hinaus belastet die fehlende Einarbeitung.
Zahlreiche Stressoren im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Musikschulunterrichts sind in der Tabelle 5 aufgeführt.
Aufgrund von Personalmangel im pädagogischen Bereich werden die Gruppen im Elementarbereich immer größer, in der Orchester- und Chorarbeit fehlen Assistenz und Aufsichtspersonal, so dass die Lehrkräfte in Alleinverantwortung agieren müssen, in der Hoffnung, dass nichts Unvorhergesehenes passiert. Personalmangel in der Verwaltung führt dazu, dass Lehrkräfte Tätigkeiten zusätzlich zur hohen Unterrichtsbelastung übernehmen müssen. Die Übernahme von Hausmeistertätigkeiten durch Lehrpersonal aufgrund von Outsourcing scheint die Regel.
Besonders zahlreiche stressfördernde Faktoren werden von Lehrkräften benannt, die in Kooperationen tätig sind (siehe Tabelle 44).
Situationen oder Bedingungen, die die Arbeitsausführung behindern oder erschweren, wie im Konzept psychische Belastungen durch Regulationsbehinderungen [95] definiert, begegnen den Befragten häufig in ihrem Arbeitsalltag. Am deutlichsten treten sie im Zusammenhang mit Arbeitsmitteln auf (siehe 4.4.5).
Regulationsbehinderungen ergeben sich schon allein aufgrund der Tatsache, dass die Arbeitszeiten von Verwaltung/technischem Personal und Lehrkräften nicht aufeinander abgestimmt sind. Überdies behindern an vielen befragten Musikschulen Kommunikationsdefizite sowie Unklarheit im Hinblick auf Zuständigkeiten und fehlende Prozessdefinition das Arbeitshandeln. Eine unklare Aufgabenverteilung führt zu inneren und äußeren Konflikten und damit zu beeinträchtigendem mentalen Stress.
Die dynamische Balance von Risiko- und Schutzfaktoren, damit laut Antonovsky die Gesundheit selbst[96], ist im Hinblick auf die Tatsache, dass die Mehrheit in Wochen hoher zeitlicher Belastung nicht genügend Regenerationszeit findet, gefährdet. Hinzu kommt eine schwere Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben aufgrund der Lage der Arbeitszeit.
Fast alle sehen sich als Vertrauensperson und langjährige Begleiter. Damit sind sie neben den Eltern diejenigen, die oft einen prägenden Einfluss auf die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen haben, was zur Entwicklung eines starken Kohärenzgefühls beiträgt. Das Gefühl, die Arbeitsergebnisse beeinflussen zu können sowie der hohe bis sehr hohe Entscheidungsspielraum hinsichtlich des wöchentlichen Arbeitspensums tragen bei ungefähr der Hälfte der Befragten ebenfalls stark dazu bei. Zuträglich zur Stärkung des Kohärenzgefühls ist überdies, dass sich alle Befragten frei in der Auswahl der Methodik und Didaktik fühlen und die Tätigkeit überwiegend abwechslungsreich empfunden wird. Werden Beschäftigte in verantwortlichen Positionen nicht an der konzeptionellen Weiterentwicklung der Musikschule beteiligt, wirkt sich das negativ auf das Gefühl von Bedeutsamkeit bzw. Partizipation an Prozessen aus. Das Kohärenzgefühl wird vermindert.
Ausgehend vom SAR – Modell der Gesundheit wurden im ersten Schritt verstärkt externe Anforderungen in den Blick genommen. In Form eines angepassten bzw. anpassbaren Werkzeugs wäre die Erfassung an den Institutionen mit dem Ergebnis dieser Vorstudie möglich. Interne Anforderungen (Bedürfnisse, erworbene Sollwerte) schwingen an vielen Stellen der Vorstudie mit. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, auf sämtliche Bedürfnisse bzw. deren Befriedigung/Deprivation einzugehen. Dem Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung ist jedoch besondere Beachtung zu schenken, denn hier werden besonders hohe psychische Belastungen erlebt. Mangelnde Wertschätzung durch Gesellschaft, Politik, Vorgesetzte, aber auch durch Schüler und Eltern, mangelnde Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit, mangelnde Anerkennung des Berufes als solches belastet einen Großteil der Befragten sehr stark.
Das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit (interne Anforderung) wird in vielen Bereichen der Tätigkeit gestillt, wie die Auswertungen unter dem Punkt 4.4.2, Bereich Selbstbestimmtheit zeigen.
Die überschaubaren Entwicklungsmöglichkeiten liegen eher im fachlichen Bereich oder außerhalb des Berufes. An dieser Stelle ist zu vermuten, dass das „Selbstaktualisierungsbedürfnis“ [97] innerhalb der Tätigkeit nur stark begrenzt erfüllt wird. Eine Deprivation entsteht auch, wenn es nicht gelingt, die eigene Begeisterung für die Musik auf die Kinder zu übertragen, wie mehrfach beschrieben.
Aufgrund der unzureichenden Erfassung der Arbeitszeit arbeitet manche Lehrkraft eher zu viel als zu wenig, um nichts „schuldig zu bleiben“ Hier wird ein weiterer erworbener Sollwert ersichtlich.
Manche fühlen sich aus Sorge um den Arbeitsplatz oder aufgrund finanzieller Sorgen in ihrem Bedürfnis nach Sicherheit erschüttert.
Das Bedürfnis nach Bindung wird einerseits gestillt, da die Unterrichtstätigkeit im direkten Kontakt mit Menschen stattfindet. Es bleibt die Frage, ob dadurch das vielfach geschilderte Einzelkämpfertum auf der anderen Seite ausgeglichen wird.
Der Schlüssel zur Ableitung hilfreicher Maßnahmen liegt nun in der Ermittlung/Stärkung bereits vorhandener bzw. noch benötigter/ auszubauender/ zu stärkender Ressourcen.
5.1. Ergebnis und Handlungsempfehlungen
Die im Interviewleitfaden verwendeten Fragebogenitems habe ich modifiziert bzw. weiter entwickelt, ergänzt und besonders im Merkmalsbereich 5 zahlreiche neue auf Grundlage der genannten zusätzlichen Belastungen entwickelt. Das für die Praxis relevante Ergebnis dieser Vorstudie sind die unter Punkt 7 entwickelten Fragebogenitems, die der Erstellung einer „Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung an Musikschulen“ dienen sollen und passgenau adaptiert werden können.
Betriebsintern wäre aus meiner Sicht sinnvoll, an die Befragung moderierte Analyseworkshops [98] mit allen Beteiligten in unterschiedlicher Konstellation anzuschließen, um externe Ressourcen zu ermitteln und Strategien zu ihrer Entwicklung, Etablierung, Stärkung festzulegen, um eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die von allen getragen wird, sicherzustellen.
Zur Stärkung der internen Ressourcen gilt es Faktoren, die die Resilienz unterstützen zu ermitteln und anschließend auf- bzw. auszubauen.
Andere Brennpunkte psychischer Belastung im Zusammenhang mit dem Berufsstand sowie dem System Musikschule als solches können weder betriebsintern noch individuell, sondern nur durch gezielte Aufklärungsarbeit ins politische Bewusstsein gerückt und auf dieser Ebene diskutiert, im besten Fall aufgelöst werden. Damit musikalische Bildung nachhaltig fruchtet und nicht zu Lasten der Ausführenden geht, braucht es ein funktionierendes Zusammenspiel aller Akteure. Die gelebte Praxis bestehender Kooperationen zwischen Schule und Musikschule gehört auf den Prüfstand und muss meines Erachtens neu gedacht, anders verwoben und durchlässiger werden. Eine Musikschullehrkraft darf nicht der kostengünstige Ersatz für fehlende Musikpädagogen an allgemeinbildenden Schulen sein. Würde musikalische Bildung institutionsunabhängig tatsächlich als „Bildung“, d.h. Pflichtaufgabe der Länder anerkannt, würde die gesellschaftliche Wertschätzung des Berufsstandes deutlich verbessert sowie die Bereitstellung öffentlicher Gelder zur Selbstverständlichkeit. Instrumental-/Gesangspädagogen könnten, den Lehrkräften allgemeinbildender Schulen (wieder) gleichgestellt (siehe Punkt 2.2.), beim Land in der entsprechenden Gehaltsgruppe angestellt und flexibel direkt an Schulen und/oder an Musikschulen eingesetzt werden.
6 Perspektiven
6.1 Ansatzpunkt Studienprofil - ein Beispiel
Die Ausbildung angehender Pädagogen im musischen Bereich zu verbinden ist an der Dresdner Musikhochschule im Studiengang Bachelor Lehramt Doppelfach Musik möglich. In diesem Fach werden drei Fächer gleichzeitig studiert: Schulfach Musik, Bildungswissenschaften und ein zweites musikalisches Fach. [99] Somit wären erste Schritte sowohl hinsichtlich der Anerkennung des Berufsbildes als auch hin zu einer tariflichen Neubewertung der Tätigkeit getan (bisher Musiklehrer EG 13 – Musikschullehrer EG 9b).
6.2 Politische Entwicklungen
In der Studie zum Musikleben während der Corona-Krise 2021 findet sich folgende Absichtserklärung:„Die Wahrnehmung der musikalischen Vielfalt und ihre Bedeutung für den Einzelnen, wie für die Gesellschaft als Teil individueller wie gesellschaftlicher Identifikations- und Aushandlungsprozesse gilt es systemisch stärker zu verankern. Die Verpflichtungen, die sich aus der vom Deutschen Bundestag und der Europäischen Union als Staatengemeinschaft ratifizierten UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen ergeben, müssen im Alltagserleben von Kultur der Menschen vor Ort deutlich spürbarer wirksam werden. Dies erfordert kulturelle Teilhabe – von Anfang an und ein Leben lang. Dazu gehört auch das Staatsziel ‚Kultur‘, das im Grundgesetz mit dem Satz ‚Der Staat schützt und fördert die Kultur‘ verankert werden muss“. [100] Anhand der Ergebnisse dieser Studie sollen Defizite identifiziert und anschließend entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um das Musikleben in Zukunft sicherer aufzustellen. Genannt werden u.a. Rahmenbedingungen durch stabile Kulturfinanzierung zu schaffen sowie die Relevanz der Musik in der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu stärken. [101]
Der Städte- und Gemeindebund formulierte bereits 2010, dass eine W eiterentwicklung der Leitlinien zur Musikschule unbedingt angezeigt sei aufgrund der Tatsache, dass es „bundesweit eine breite Tendenz zu mehr ganztägiger Bildung, Betreuung und Erziehung (gibt). Musikschulen müssen demzufolge auf veränderte Zeitstrukturen der Schüler/-innen reagieren und diese dort aufsuchen, wo sie einen Großteil ihres Tages verbringen. Dem zunehmend ausdifferenzierten Angebot für die Bereiche frühkindlicher und vorschulischer Bildung wird besondere Bedeutung attestiert.“ [102]
Ein Gesamtkonzept „Kulturelle Bildung“ scheint angezeigt, verbunden mit einer Aufhebung des Kooperationsverbotes zwischen Bund, Ländern und Kommunen, um die zu etablierenden Strukturen dauerhaft und finanziell auskömmlich absichern zu können. Vor dem Hintergrund des ab 2026 bestehenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung werdenSchulen noch mehr auf Pädagogen aus verschiedenen Kultursparten angewiesen sein. [103] „Musikschulen können die Anforderungen dieser Entwicklung nur mit angemessener Personalausstattung und ausreichend qualifiziertem Personal bewältigen. […] Vor allem im Elementarbereich und in ländlichen Räumen führt der Personalmangel bereits jetzt zu akuten Einschränkungen in der Musikschularbeit.“ [104] Wird nicht gegengesteuert, wird er „zu drastischen Schwierigkeiten bei den Musikschulstrukturen und vor allem bei der Aufrechterhaltung des Unterrichtsangebotes führen – und damit die Gewährleistung des Auftrags der Musikschulen […] in Frage stellen!“ [105] Der VdM fordert daher z.B. eine Überprüfung des Tarifgefüges für Musikschul-Lehrkräfte. [106]
Schon 2019 wurde in einem Positionspapier für die regierungsbildenden Koalitionsparteien in Sachsen formuliert: „Wir benötigen 100% Festanstellung an Musikschulen mit einer den Lehrergehältern gleichgestellten Vergütung, welche auch die Abwanderung von hochqualifizierten Musikpädagog*innen in den Schuldienst stoppt und diesen […] Berufsstand wieder attraktiv macht.“ [107]
Die sächsische SPD plädierte 2021 mit einem umfangreichen Forderungskatalog für das „Ende des MusiklehrerInnenprekariats.“ [108]
6.3 Das „Herrenberg-Urteil“
Am 28.06.2022 wurde vom Bundessozialgericht im Fall einer bis dahin als Honorarkraft an der Musikschule der Stadt Herrenberg beschäftigten Lehrkraft ein Urteil gesprochen, was weitreichende Auswirkungen hinsichtlich der Verbesserung der beruflichen Situation von Musikschullehrkräften, möglicherweise sogar für sämtliche Lehrbeauftrage an Bildungseinrichtungen (Musikhochschulen, Universitäten, Volkshochschulen, etc.) in Deutschland zur Folge hat. Pressemitteilungen berichten von einem massiven Umbruch in der deutschen Musikschullandschaft, der unmittelbar bevorsteht. [109]
„Im ‚Herrenberg-Urteil‘ (B 12 R 3/20 R) [110] hat das Bundessozialgericht 2022 neue Maßstäbe für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Lehrberufen definiert. Im genannten Fall musste die Stadt Herrenberg für eine Lehrkraft an ihrer städtischen Musikschule rückwirkend Sozialabgaben abführen - für einen Zeitraum von fast fünfzehn Jahren. Die Honorarkraft erteilte Unterricht in den Räumen der Musikschule, trat aber als Unternehmerin nicht nach außen auf. Die Sozialversicherungen weisen darauf hin, dass in solchen Fällen von einem Beschäftigungsverhältnis auszugehen ist. Der Verband deutscher Musikschulen empfahl in seinem Rundschreiben vom 1. Dezember 2023 allen Verbandsmusikschulen, den Einsatz von Honorarkräften nicht fortzusetzen und die Verträge in Anstellungsverhältnisse zu überführen.“ [111] Vorausgegangen war ein Rundschreiben zu Honorarkräften im Mai 2023, in dem sich die Kommunalen Arbeitgeberverbände (KAV) zur versicherungsrechtlichen Beurteilung von Lehrern und Dozenten folgendermaßen positionieren: „Das BSG hat in seiner jüngeren Rechtsprechung [...] das Kriterium der betrieblichen Eingliederung geschärft und dessen maßgebende Bedeutung für die Statusbeurteilung herausgestellt. In zahlreichen Urteilen [...] wurde aufgrund des Umfangs der betrieblichen Eingliederung und der damit einhergehenden Einschränkung der für Selbständige typischen freien Gestaltung der Erwerbstätigkeit ein Beschäftigungsverhältnis festgestellt.“ [112]
Der Landesverband der Musikschulen in Schleswig-Holstein schlussfolgert, „dass an öffentlichen Musikschulen unter Berücksichtigung der vom BSG angelegten Kriterien nun keine Rechtssicherheit mehr für Honorarverträge und Honorartätigkeiten im regulären Unterrichtsbetrieb gegeben ist.“ [113] Dies kann nur durch eine massive Verbesserung der finanziellen Ausstattung gelingen. Dabei entstünden Übergangszeiträume, um politische Prozesse in Gang zu setzen und Umstrukturierungen in den Musikschulen vorzunehmen. [114]
Franz Sodann, kulturpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Sächsischen Landtag weist dringend darauf hin, dass dieses Urteil Auswirkungen generell auf kulturelle Bildungseinrichtungen, allen voran Musikhochschulen haben wird und fordert ein Soforthilfeprogramm der sächsischen Regierung, das „den betroffenen Einrichtungen ermöglicht, Honorarverträge in tarifliche Beschäftigung zu überführen und Nachzahlungen zur Sozialversicherung zu leisten.“ [115] Auch Sebastian Haas konstatiert in seinem Gutachten zur Betrachtung der gelebten Arbeitssituation der Lehrbeauftragten der HfM Dresden vor dem Hintergrund des gefällten Urteils: „Eine freischaffende Tätigkeit in Lehrberufen wird in Zukunft nicht mehr möglich sein.“ [116] „Die jetzige Situation zeigt das große finanzielle Defizit in der kulturellen Bildung,“ [117] welches nicht allein von den Kommunen, sondern nur im Schulterschluss mit Land und Bund bewältigt werden kann. Das Bewusstsein dafür muss allerdings noch wachsen. Zunächst hatte die sächsische Landesregierung einen Antrag zur Rettung der kulturellen Bildungseinrichtungen abgelehnt. [118]
„Wir erleben aktuell eine Zeitenwende des öffentlichen Musikschulsystems. Eine solche Dimension bedingt fast schon gesetzmäßig, dass das nicht ohne Probleme und Konflikte geschehen kann.“ Gabor Scheinpflug sieht in solchen Umbrüchen und den damit verbundenen Problemstellungen auch eine Chance. [119]
Erste Entwicklungen an Musikschulen in der gesamten Bundesrepublik weisen in die richtige Richtung. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien folgende Beispiele genannt: Im Mai 2023 wurde bekanntgegeben, dass die Stadt Leipzig ihre Strategie der Personalplanung an der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ ändert und künftig Honorarlehrkräfte die Ausnahme bilden, Festanstellung der Normalfall werden soll. [120] Die Stadt Bielefeld wandelte an der Musik- und Kunstschule alle Honorarbeschäftigungsverhältnisse in Anstellungsverhältnisse. [121] Seit August 2024 beschäftigt die Stadt Sankt Augustin ihre Lehrkräfte nur noch in Festanstellung,[122]am Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden wird der Unterricht nur noch von festangestellten Lehrkräften erteilt. Die Kreisverwaltung Oder-Spree gab bekannt, das Urteil an den vier Standorten der Kreismusikschule umzusetzen. [123] Die Stadt Köln unterbreitete ebenfalls allen Honorarkräften der Rheinischen Musikschule ein Angebot auf Festanstellung . [124]
Auch das Präsidium des Landesmusikrates Berlin „fordert die schnellstmögliche und faire Umwandlung der Honorarverträge der Berliner Musikschullehrkräfte an öffentlichen Musikschulen in Festanstellungsverträge.“ [125]
"Wer fest angestellt werden will, soll fest angestellt werden. Wer frei bleiben will, soll frei bleiben", versprach Kultursenator Joe Chialo den Lehrkräften der Berliner Musikschulen im Sommer 2024 und bat um Zeit. [126]
Ein Urteil bahnt somit den Weg für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Musikschullehrkräften. Der Bundesvorsitzende der Fachgruppe Musik, Martin Ehrhardt, betont, „dass nicht nur das BSG-Urteil, sondern vor allem der unermüdliche Einsatz der Lehrkräfte an vielen Musikschulen, die schon über Jahre auf die Missstände der Honorarbeschäftigung aufmerksam gemacht hatten, zu dieser positiven Entscheidung geführt hat. Dadurch werden sich die Arbeitsbedingungen für viele Lehrkräfte verändern – die Musikschullandschaft insgesamt wird sich auf große Veränderungen einlassen müssen. Das bedeutet aber auch, dass nun die Politik handeln und für die ausreichende Finanzierung sorgen muss! “ [127]
Abschließend möchte ich Albert Scharf, den ehemaligen Intendanten des Bayrischen Rundfunks, zitieren: „Kultur rechnet sich nicht, aber sie zahlt sich aus!" [128]
6.4 Praxisbeispiele bereits existierender Werkzeuge
Während meiner Recherchen zu bereits existierenden Werkzeugen nahm ich „JobPsy“, einen sehr aussichtsreichen Online-Fragebogen-Konfigurator besonders in den Blick, dervon der Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern entwickelt wurde und durch die Universität Greifswald (Lehrstuhl Gesundheit und Prävention) wissenschaftlich begleitet wird. Bisher gibt es kein für alle Unternehmen passendes Instrument zur Erfassung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz. Der praxisbezogene Konfigurator bietet die Möglichkeit, einen eigenen passgenauen Fragebogen zu erstellen, zunächst für die Zielgruppe „öffentliche Verwaltung“ mit deren unterschiedlichen Berufszweigen. [129] Laut Marc Irmer (Telefonat vom 21.11.2022) wird im Moment ein solcher Konfigurator für Schulen in Zusammenarbeit mit Schulleitungen unterschiedlicher Schulformen und dem Bildungsministerium des Bundeslandes Mecklenburg Vorpommern entwickelt, der 2024 fertigstellt werden soll. Die Berücksichtigung von Musikschulen ist bisher leider nicht geplant.
Ein Instrument, das zur Messung beruflicher Gratifikationskrisen eingesetzt werden kann, ist der sogenannte ERI-Fragebogen. Auf Grundlage seines Modells entwickelte Johannes Siegrist 2012 den Effort-Reward-Imbalance (ERI) – Fragebogen. [130]
Als weiteres Werkzeug zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung sei auf das BASA IV-Verfahren zur psychologischen Bewertung von Arbeitsbedingungen verwiesen. Das Ausgangsverfahren, die „ Psychologische Bewertung von Arbeitsbedingungen, Screening für Arbeitsplatzinhaber“ (BASA-Verfahren) wurde ursprünglich 2001 an der BAuA von Richter & Schatte mit dem Ziel entwickelt, psychische Belastungen besser zu erkennen, die zugrundeliegenden Ursachen zu identifizieren und Wege aufzuzeigen, diese zu beheben. Ein Fokus war dabei auf die Prävention gerichtet. Das Verfahren wurde seither inhaltlich und methodisch weiterentwickelt. Hinzuweisen ist auf die digitale Form, die seit 2022 auf der „ACOMERA-Plattform“ zur Verfügung steht, die auf den aktuell gültigen Gesetzen, Verordnungen und Vorgaben beruht. Mit BASA IV ist es gelungen, gleichermaßen arbeitswissenschaftlich als auch arbeitspsychologisch zu wirken . [131]
Hinweisen möchte ich außerdem auf „psy.Res®“, ein sehr bemerkenswertes Werkzeug zur Beurteilung von psychischen Belastungen und Beanspruchungen. Die Autorin Dr. Ulla Nagel beschreibt es wie folgt: „ Der Instrumentenkoffer psy.Res®-Gesamtbilanz ist eine modulare Toolbox, die Wissen, Anleitung und Instrumente zur Prävention psychischer Fehlbelastungen und zum Aufbau von Ressourcen am Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Die psy.Res® - Gesamtbilanz besteht aus dem psy.Risk®-10-Faktorentest zur Erfassung psychischer Belastungsquellen in der Arbeit und dem psy.Res®-Gesundheitstests zur Überprüfung der eigenen Gesundheit.“Die Gesamtbilanz „eignet sich als Screening-Instrument zur Analyse, Feindiagnose, Beurteilung und Prävention bei ganzheitlichen Fehlbelastungen und Fehlbeanspruchungen in der Arbeit[…und] kann somit auf die jeweiligen Gegebenheiten und Möglichkeiten im Unternehmen zugeschnitten […] werden.“ [132] Es wurde in Zusammenarbeit zwischen der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse Köln und der TU Dresden entwickelt.
Neben Links zu den hier vorgestellten Werkzeugen finden sich weitere hilfreiche Links im Anhang unter Punkt 9.1.
7 Fragebogenitems - weiterer Forschungsweg
Ein ausführliche Dokumentation über Veränderungen im Interviewleitfaden, die erste und letzte Fassung der in den geführten Interviews verwendeten Leitfäden, Feedbacks zu den geführten Interviews sowie Anregungen für den standardisierten Fragebogen sind bei Interesse in der veröffentlichten Originalfassung der Masterarbeit im Anhang unter den Punkten 7.3. und 7.4.nachzulesen. [133]
Die folgenden Fragebogenitems repräsentieren den Forschungsstand zum Zeitpunkt der Abgabe der Arbeit. Sie werden nun in Zusammenarbeit mit einem Forschungsteam bestehend aus Musikschullehrkräften und Fachleuten verschiedener Institutionen (Unfallkassen, Universitäten) weiter standardisiert, nachgeschärft, ggf. bereinigt und anschließend in der Musikschulpraxis erprobt. Ziel ist, zunächst ein Grobscreening zu entwickeln, welches den detaillierten Fragebogenitems voranzustellen ist. Je nach Ergebnissen des Grobscreenings sollen letztere zur vertiefenden GBU genutzt werden. Die detaillierte Befragung wird sich aus Pflicht-Items und freiwilligen Items zusammensetzen, was im Vorfeld festzulegen ist. Realisierbarkeit und Effizienz werden dabei im Fokus stehen.
Möchten Sie sich in diesen Forschungsprozess einbringen und/oder mir Anregungen geben, freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme unter katja@mangold.org.
7.1 Persönliche Angaben
Geschlecht: ◻ m ◻ w◻ d
Alter:
Familiensituation: ◻ Alleinlebend ◻In fester Partnerschaft lebend
Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder:___
- Alter
Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu?:
"Die Kinderbetreuungszeiten in der KiTa/im Hort decken meinen/unseren Bedarf an Betreuungszeit außerhalb der Ferien vollumfänglich ab."
· Stimme voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 stimme überhaupt nicht zu
- Wunschbetreuungszeit:_______
Anzahl der zu pflegenden Angehörigen:___
Inwieweit trifft für Sie folgende Aussage zu?:
„Für die im Haushalt lebenden Kinder/ die/den zu pflegende(n) Angehörige(n) bin ich allein zuständig.“
- Trifft voll zu1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
7.1.1. Berufliche Rahmenbedingungen
Seit wann arbeiten Sie an der Musikschule?___
In welchem Gesamt-Stundenumfang (inkl. FÜ) sind sie beschäftigt? ___
Beschäftigungsverhältnis:
◻ frei ◻ fest
Abschluss:
◻ Pädagogischer Abschluss
◻ Künstlerischer Abschluss
Hauptfachinstrument(e):
· Anzahl Gesamtunterrichtseinheiten: ___
· davon Anzahl Einzelunterricht:
o 30min ___
o 45min und mehr___
o davon Studienvorbereitung___
· davon Partner/ Kleingruppen-Unterricht:___
Unterricht im Elementarbereich
· Anzahl Unterrichtseinheiten___
o Davon Unterricht in Kindertagesstätten:___
· Unterricht in Schulen
o Davon im Rahmen der Ganztagesbetreuung___
o Klassenunterricht: ___
Unterricht im Fach Tanz
· Anzahl Unterrichtseinheit ___
Inklusiver Unterricht
· Anzahl Unterrichtseinheit ___
Kammermusik
· Anzahl Unterrichtseinheit ___
Chor/Orchester/Ensemble/Register-/Stimmproben
· Anzahl Unterrichtseinheit: __
Sonderfunktion
◻ Nein
◻ Ja, im Bereich ______
· Zeitlicher Umfang: ___
Welchen zeitlichen Umfang Ihrer gesamten Erwerbstätigkeit umfasst die Arbeit an der Musikschule (ca. in %)?___
7.1.2. Bindung/Commitment
Inwieweit fühlen Sie sich der Idee/dem System Musikschule verbunden?
· gar nicht 1◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Inwieweit fühlen Sie sich „Ihrer“ Musikschule verbunden?
· gar nicht 1◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Inwieweit spielen Sie aktuell mit dem Gedanken, sich beruflich zu verändern?
· gar nicht 1◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr oft
7.2. Merkmalsbereich 1: Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe
7.2.1. Selbstbestimmtheit
Die folgenden Fragen beziehen sich auf den Ablauf eines typischen Unterrichtstages.
Wie hoch schätzen Sie Ihren Entscheidungs-/Handlungsspielraum ein?
- Bezogen auf die Reihenfolge der Tätigkeiten in derUnterrichtszeit
o sehr gering 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr hoch*
- Bezogen auf die Reihenfolge in der angewiesenen Arbeitszeit/im administrativen Bereich (direkte Zusammenhangstätigkeit, Konferenzen, Sonderfunktionen etc.)
o sehr gering 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr hoch*
· Bezogen auf die Reihenfolge der Tätigkeiten im Zusammenhang mit Unterricht/Proben etc.
o sehr gering 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr hoch*
· Bezogen auf den Umfang der einzelnen Tätigkeiten in der Unterrichtszeit/ der angewiesenen Arbeitszeit/im administrativen Bereich:
o sehr gering 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr hoch*
- Bezogen auf den Umfangin der angewiesenen Arbeitszeit/im administrativen Bereich (z.B. direkte Zusammenhangstätigkeit, Konferenzen, Sonderfunktionen)
o sehr gering 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr hoch*
- Bezogen auf den Umfang der einzelnen Tätigkeiten im Zusammenhang mit Unterricht/Proben
o sehr gering 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr hoch*
· Bezogen auf das wöchentlicheArbeitspensum insgesamt:
o sehr gering 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr hoch*
· Bezogen auf die Auswahl von Methodik/Didaktik:
o sehr gering 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr hoch*
Wie hoch schätzen Sie die inhaltlich/fachlichen Entscheidungsspielräume als Musikschullehrkraft insgesamt ein ?:
· sehr gering 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr hoch*
* Ev. empfiehlt sich folgendes Skalenformat: ◻Sehr gering ◻gering ◻eher gering ◻eher hoch ◻hoch ◻sehr hoch, ev. ergänzt um Option ◻weiß nicht
· Wie belastend ist das für Sie?
o Gar nicht 1◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr belastend
Inwieweit können Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit beeinflussen?
· gar nicht 1◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 vollumfänglich*
Wie abwechslungsreich ist Ihre Tätigkeit?
· gar nicht 1◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 vollumfänglich*
Sind Verantwortlichkeiten/Kompetenzen im System Musikschule klar definiert (wer wofür zuständig ist)?
· gar nicht 1◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 vollkommen klar**
Ist Ihnen bewusst, bis zu welchem Punkt Ihre Zuständigkeit/ Verantwortung reicht?
· gar nicht 1◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 vollkommen klar**
*Ev. empfiehlt sich folgendes Skalenformat: ◻gar nicht ◻eher nicht ◻selten ◻teilweise ◻überwiegend ◻vollumfänglich, ergänzt um ◻weiß nicht
**Ev. empfiehlt sich folgendes Skalenformat: : ◻gar nicht ◻eher nicht ◻punktuell klar ◻einigermaßen klar ◻überwiegend klar ◻vollkommen klar , ergänzt um ◻weiß nicht
7.2.2. Qualifikation
Inwieweit fühlen Sie sich aufgrund Ihrer Hochschulausbildung für ihre pädagogische Tätigkeit qualifiziert?
· gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 hochqualifiziert
Inwieweit fühlen Sie sich aufgrund Ihrer Erfahrung für ihre pädagogische Tätigkeit qualifiziert?
· gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 hochqualifiziert
Wurden Sie seitens der Musikschule bei Aufnahme Ihrer Tätigkeit unterstützt („Onboarding“, Erklärung der Abläufe/Prozesse, Zuständigkeiten, Anschaffung benötigter Arbeitsmittel)?
· gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr gut unterstützt
Inwieweit trifft für Sie folgende Aussage zu: „Ich fühle mich in manchen Tätigkeitsbereichen fachlich unterfordert“.
· Trifft voll zu1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
Inwieweit trifft fürSie folgende Aussage zu: „Ich fühle mich in manchen Tätigkeitsbereichen/Situationen fachlich überfordert.“
· Trifft voll zu1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
Inwieweit trifft für Sie folgende Aussage zu: „Ich fühle mich in manchen Tätigkeitsbereichen/ Situationen sozial/emotional überfordert.“
· Trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
Inwieweit haben Sie Zugang zu Fortbildungen, die für Ihre tägliche Berufspraxis bzw. Ihre berufliche (Weiter-) Qualifikation notwendig sind (z.B. im Bereich Digitalisierung, neue Lehr- bzw. Lernmethoden, usw.)?
· ◻ gar nicht ◻teilweise ◻umständlich, kompliziertes Verfahren ◻vollumfänglich
Inwieweit trifft für Sie folgende Aussagen zu?:
„Die Tätigkeit als Musikschullehrkraft entspricht meinem ursprünglichen Berufswunsch.“
· Trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
Gründe:
Sehen Sie für sich Karriere-/ Aufstiegsmöglichkeiten (administrativ)?
· gar keine1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr viele
Inwieweit streben Sie diese an?
o gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark (◻nicht planbar)
Sehen Sie für sich reizvolle Entwicklungsmöglichkeiten (Fachkarriere)?
· gar keine 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr viele
Inwieweit streben Sie diese an?
o gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark (◻nicht planbar)
Was wünschen Sie sich diesbezüglich?__________
7.2.3. Emotionale Involviertheit
Inwieweit erleben Sie Ihre Unterrichtstätigkeit als sinnstiftend?
· überhaupt nicht 1◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Inwieweit erleben Sie die Ergebnisse derselben für sich als sinnstiftend?
· überhaupt nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Inwieweit erleben Sie Ihre Unterrichtstätigkeit für sich als befriedigend?
· überhaupt nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Inwieweit erleben Sie die Ergebnisse Ihrer Unterrichtstätigkeit für sich als befriedigend?
· überhaupt nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Inwieweit erleben Sie Ihre Unterrichtstätigkeit für Ihre Schüler/Schülerinnen als sinnstiftend?
· überhaupt nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Inwieweit erleben Sie die Ergebnisse Ihrer Unterrichtstätigkeit für Ihre Schüler/Schülerinnen als sinnstiftend?
· überhaupt nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Gibt es Situationen in Ihrem Berufsalltag, die Sie emotional stark berühren/fordern? Bitte beschreiben Sie diese!
7.3. Merkmalsbereich 2: Arbeitsorganisation
7.3.1. Arbeitszeit
Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu?:
„Die Lage meiner täglichen Arbeitszeit kann ich selbstbestimmt gestalten.“
· Trifft voll zu1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu:
„Die Unterrichtseinheiten finden in enger Taktung nacheinander statt.“
· Stimme voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 stimme nicht zu
· Wie belastend ist das für Sie?
o Gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr belastend
Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu?:
„Die Pausenzeiten während der Unterrichtszeiten kann ich für mich passend gestalten.“
· Trifft voll zu1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu, ◻ ich habe keine Pause
Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu?:
„Die Pausenzeiten während der übrigen Arbeitszeit kann ich für mich passend gestalten.“
· Trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu, ◻ ich habe keine Pause
Für Festangestellte:
In welchem Bereich(en) werden Ihnen Entlastungs-/Ausgleichszeiten gewährt?
Bereich (e): Entlastung UE:
Inwieweit stimmen Sie der Aussage zu?:
„Die Entlastungs-/Ausgleichszeiten für den Bereich………stehen in einem guten Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand.“
· Trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
Für alle:
Inwieweit können Sie für sich definieren, wo die Grenze zwischen privat (Freizeit/ Familienzeit) und dienstlich (Arbeit) verläuft?
· sehr ungenau 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr genau
· Wenn Antwort im Bereich 1: Inwieweit empfinden Sie das als belastend?
o Nicht belastend1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark belastend
Inwieweit ist ihre Arbeitszeit im häuslichen Bereich zersplittert?
· Gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 stark zersplittert
· Inwieweit empfinden Sie das als belastend?
o Nicht belastend 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark belastend
Wie belastend ist in diesem Zusammenhang für Sie das Thema Ausdehnung/Entgrenzung der Arbeitszeit (z.B. Schüler-/Elternanfragen am Wochenende)?
· Nicht belastend 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark belastend
Inwieweit stimmen Sie der Aussage zu:
„Ich habe das Gefühl, jederzeit verfügbar sein zu müssen.“
· ◻ ja ◻ eher ja ◻ eher nein ◻ nein
· Wie belastend ist das für Sie?
o Gar nicht 1◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Welche Strategien haben Sie, um sich davor zu schützen (Bsp. Schüler/Elternanfragen am Wochenende)?
Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?:
„Die Erfassung der kompletten Arbeitszeit einer Musikschullehrkraft würde mir dabei helfen, die Grenzen der zu erbringenden Arbeitsleistung zu definieren und Entgrenzung vorzubeugen.“
· Stimme voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 stimme überhaupt nicht zu
„Die Erfassung der kompletten Arbeitszeit einer Musikschullehrkraft macht den tatsächlichen Arbeitszeitumfang sichtbar.“
· Stimme voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 stimme überhaupt nicht zu
„Die Erfassung der kompletten Arbeitszeit einer Musikschullehrkraft bietet die Chance, Gerechtigkeit im Hinblick auf den zeitlichen Umfang von Zusammenhangstätigkeiten sowie Ausgleichsmehrarbeit (Ferienüberhang) herzustellen.“
· Stimme voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 stimme überhaupt nicht zu
„Die Erfassung der kompletten Arbeitszeit einer Musikschullehrkraft schränkt diese in ihrem Handlungsspielraum ein und verkompliziert Arbeitsroutinen.“
· Stimme voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 stimme überhaupt nicht zu
Finden Sie in Wochen mit hoher zeitlicher Belastung infolge von Arbeitsverdichtung aufgrund besonderer Anforderungen (z.B. zusätzliche Veranstaltungen an Wochenenden, Prüfungsvorbereitung, Wettbewerbsbetreuung, (Groß-)Veranstaltungen) ausreichend Regenerationszeit?
· Gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 völlig ausreichend
Inwieweit empfinden Sie diese Eigenschaft von Musikschularbeit als belastend?
· Gar nicht 1◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Inwieweit finden Sie in Wochen mit „durchschnittlicher“ Arbeitszeit genügend Regenerationszeit?
· Gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 völlig ausreichend
Inwieweit belasten Sie die Schwankungen in der Arbeitszeit (extrem hohe Belastung – sehr niedrige Belastung in den Ferienzeiten)?
· Gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Inwieweit treffen für Sie folgende Aussagen zu?:
„Für meine individuelle Weiterbildung finde ich genügend Zeit.“
· Trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻6 trifft überhaupt nicht zu
„Ich schaffe es gut, sowohl den Anforderungen meiner Familie als auch denen meines Berufes gerecht zu werden.“
· Trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
7.3.2. Kommunikation:
Auf welchem Weg erhalten Sie vorwiegend die zur Ausübung Ihrer Tätigkeit notwendigen Informationen?
◻ Digital (E-Mail/ Intranet/ Chat/ Homepage)
◻ Konferenz
◻ Lehrerzimmer (Aushang/ Nachricht im Fach)
◻ Persönliches Gespräch/ Telefonat
◻ anderer Weg, und zwar:
Inwieweit stehen Ihnen alle für die Ausübung Ihrer Tätigkeit notwendigen (Sach-) Informationen zur Verfügung?
· gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 komplett
Sind Ihnen bei Informationslücken die entsprechenden Ansprechpartner bekannt?
- ◻Ja ◻eher ja◻ eher nein ◻nein
Können Sie bei Bedarf unkompliziert auf Leitfäden/Prozessdefinitionen zur Ausübung Ihre Tätigkeit zugreifen?
· ◻ gar nicht/nicht vorhanden ◻ teilweise ◻ vollumfänglich ◻ weiß nicht
Inwieweit bestehen aus Ihrer Sicht Kommunikationsdefizite?
· Zwischen den Lehrkräften in der Fachgruppe:
o gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 zahlreiche
· Zwischen den Lehrkräften in der gesamten Musikschule:
o gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 zahlreiche
· Zwischen der Leitung und dem Kollegium:
o gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 zahlreiche
· Zwischen Verwaltung und Lehrkräften
o gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 zahlreiche
Was könnte man aus Ihrer Sicht tun, um diese zu beheben?
7.4. Merkmalsbereich 3: Soziale Beziehungen
7.4.1. Verhältnis zu Kolleginnen und Kollegen
Inwieweit treffen folgende Aussagen bezüglich der Zusammenarbeit zu?:
„Ich habe Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gut vernetzt bin und die mir in der täglichen Arbeit bei Bedarf helfen können.“
· trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
„Es besteht eine konstruktive Feedbackkultur untereinander.“
· trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
„Die Zusammenarbeit ist mit den meisten konfliktbehaftet.“
· trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
„Ich fühle mich isoliert/als Einzelkämpfer.“
· trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
· Das belastet mich:
§ gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark ◻ nicht mehr
„Es herrscht hoher Konkurrenzdruck.“
· trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
7.4.2. Verhältnis zu Vorgesetzten (direkter Vorgesetzter)
Finden Mitarbeitergespräche (Personalentwicklungsgespräche) statt?
◻Ja ◻ Nein
Inwieweit charakterisieren folgende Items die Atmosphäre/das Klima der MAG?
Wohlwollend: ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Angespannt: ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Auf Augenhöhe: ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Hierarchiebetont:◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Freundschaftlich: ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Zeitverschwendung: ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Andere, und zwar: _________________________
Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?:
„Meiner Führungskraft gelingt es, gleichzeitig die Ziele der Organisation (Musikschule) voranzutreiben und mir dabei zu helfen, mein Potential zu entfalten.“:
· trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu◻ weiß nicht
Meine Arbeit wird von meiner Führungskraft anerkannt und wertgeschätzt::
· trifft voll zu1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu ◻ weiß nicht
Meine Führungskraft gibt mir regelmäßig hilfreiches Feedback.
· trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu ◻ weiß nicht
Ich fühle mich durch meine Führungskraft fachlich ausreichend unterstützt.
· trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu ◻ weiß nicht
Von meiner Führungskraft erfahre ich soziale Unterstützung im Bedarfsfall.
· trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu ◻ weiß nicht
Wie hoch schätzen Sie den Grad der Mitgestaltung/ Mitbestimmung ein?
· Nicht vorhanden 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr hoch ◻ weiß nicht
7.4.3. Verhältnis zu Schülern und deren Eltern
Inwieweit charakterisieren folgende Items die Besonderheiten in der Beziehung zu Ihren Schülern?
Langjährige Vertrauensperson ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Mediator/ Coach ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Professionell: freundlich distanziert ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Individuell verschieden ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Freundschaftlich, auf Augenhöhe ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Demokratisch geführt ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Andere, und zwar ___________
Inwieweit charakterisieren folgende Items die Besonderheiten in der Beziehung zu den Eltern Ihrer Schüler?
Anonym ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Hilfreich ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Individuell verschieden ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Freundschaftlich, auf Augenhöhe ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Unproblematisch, gut ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
professionell: freundlich distanziert ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Übergriffig ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Konfliktbehaftet ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Beraterrolle ◻ trifft zu ◻trifft nicht zu
Andere, und zwar______________
Inwieweit stimmen Sie der Aussage zu?:
„Meine beruflichen Kontakte bereichern mein Sozialleben“
· trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
Inwieweit stimmen Sie der Aussage zu?:
„Meine beruflichen Kontakte belasten eher mein Sozialleben.“
· trifft voll zu 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
7.5. Merkmalsbereich 4: Arbeitsumgebung
7.5.1. Arbeitsort
Bezogen auf Ihre Musikschultätigkeit: Welchen Ort würden Sie als Ihren Hauptarbeitsplatz definieren?________________
Unterrichten Sie an mehreren Orten?
◻Ja, Anzahl:___ ◻Nein
Welche der folgenden Faktoren treffen auf (mind. einen) Ihrer/n Arbeitsort/e zu und wie belastend ist das für Sie?
◻ Räume ohne Tageslicht
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ unangemessene Beleuchtung Belastung
gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Hoher Geräuschpegel (z.B. eigne(r) Unterricht/Probe, Unterricht/Probe im Nachbarraum, Umgebungslärm)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Geruchsbelästigung
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ unpassende Größe des Unterrichtsraums (zu groß/zu klein)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Unzweckmäßigkeit des Unterrichtsraums (z.B. umgeräumter Klassenraum, Gemeindesaal etc.)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ unästhetische Gestaltung
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ unsaubere Räume
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ unangemessene Temperatur (Hitze im Sommer, Kälte im Winter)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Ergänzung:
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Gibt es (einen) Tag(e), an dem (denen) Sie an mehreren Unterrichtsorten unterrichten? ◻Ja ◻ Nein
Bei Ja:
In welchem zeitlichen Abstand finden die Unterrichtsblöcke an den verschiedenen Unterrichtsorten statt?
◻ passend (ausreichend für Arbeitsweg und Unterrichtsvorbereitung )
◻ zu knapp (nicht ausreichend für Arbeitsweg und Unterrichtsvorbereitung)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ große Pause dazwischen (mehrere Stunden)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Bitte treffen Sie eine Einschätzung bezüglich Ihrer Einsatzortwechseltätigkeit!
Der Arbeitsweg ist :
◻ kurz und unkompliziert
◻ neutral
◻ beschwerlich und unvorhersehbar (z.B. regelmäßige Verkehrsbehinderungen) ◻ stressig und anstrengend
Die dafür angerechnete Arbeitszeit ist:
◻ völlig unzureichend ◻ unzureichend ◻ neutral ◻ ausreichend ◻ völlig ausreichend ◻ wird nicht angerechnet
Welches Transportmittel nutzen Sie überwiegend?
◻ Bus und Bahn
◻ Eigenen PKW
◻ Dienstwagen
◻ Fahrrad
◻ Zu Fuß
◻ Anderes, und zwar:_____
7.5.2. Körperliche Tätigkeit
Wie oft müssen Sie bei der Vorbereitung/Durchführung/Nachbereitung von Unterricht/Proben/Konzerten/Aufführungen schwere körperliche Tätigkeit verrichten?
Beim Einrichten des Raumes:
◻ nie
◻ einmal im Jahr
◻ mehrmals im Jahr
◻ einmal im Monat
◻ mehrmals im Monat
◻ einmal pro Woche
◻ mehrmals pro Woche
Beim Transport von Instrumenten, Notenständern, Unterrichtsmaterial, Technik, etc:
◻ nie
◻ einmal im Jahr
◻ mehrmals im Jahr
◻ einmal im Monat
◻ mehrmals im Monat
◻ einmal pro Woche
◻ mehrmals pro Woche
Beim Unterrichten selbst:
◻ nie
◻ einmal im Jahr
◻ mehrmals im Jahr
◻ einmal im Monat
◻ mehrmals im Monat
◻ einmal pro Woche
◻ mehrmals pro Woche
Gibt es Situationen darüber hinaus, in denen Sie schwere körperliche Tätigkeit verrichten müssen, um ihrem eignen (pädagogischen) Anspruch gerecht werden zu können, die aber nicht explizit zu ihrem Tätigkeitskatalog gehören?
◻nie
◻ einmal im Jahr
◻ mehrmals im Jahr
◻ einmal im Monat
◻ mehrmals im Monat
◻ einmal pro Woche
◻ mehrmals pro Woche
Inwieweit leiden Sie unter Schmerzen/Einschränkungen im Bewegungsapparat/ Haltungsschäden aufgrund des Spielens Ihres Instruments?
Gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
7.5.3. Arbeitsmittel
Welche der folgenden Arbeitsmittel werden für Sie seitens der Musikschule unkompliziert (Zugang, Verfügbarkeit, Einsatzbereitschaft) bereitgestellt und wie zufrieden sind Sie damit?
◻ Laptop/Computer
◻ unzufrieden ◻ eher unzufrieden ◻ eher zufrieden ◻ voll zufrieden
◻ Tablet/I-Pad
◻ unzufrieden ◻ eher unzufrieden ◻ eher zufrieden ◻ voll zufrieden
◻ Diensthandy
◻ unzufrieden ◻ eher unzufrieden ◻ eher zufrieden ◻ voll zufrieden
◻ (Haupt)Instrument (Bitte bilden Sie bei mehreren Instrumenten, z.B. Klavier einen Schnitt)
◻unzufrieden ◻ eher unzufrieden ◻ eher zufrieden ◻ voll zufrieden
◻ zusätzliches Instrumentarium (Orff, Klavier) in Musikschulräumen
◻ unzufrieden ◻ eher unzufrieden ◻ eher zufrieden ◻ voll zufrieden
◻ zusätzliches Instrumentarium (Orff, Klavier) in Außenstellen/Schulen/KiTa
(Bitte bilden Sie bei mehreren Orten einen Schnitt)
◻ unzufrieden ◻ eher unzufrieden ◻ eher zufrieden ◻ voll zufrieden
◻ Technisches Equipment (Lautsprecher, Verstärker, Beamer etc.)
◻ unzufrieden ◻ eher unzufrieden ◻ eher zufrieden ◻ voll zufrieden
◻ Büromaterial
◻ unzufrieden ◻ eher unzufrieden ◻ eher zufrieden ◻ voll zufrieden
◻ Kopierer
◻ unzufrieden ◻ eher unzufrieden ◻ eher zufrieden ◻ voll zufrieden
◻ E-Mail - Konto
◻ unzufrieden ◻ eher unzufrieden ◻ eher zufrieden ◻ voll zufrieden
◻ Musikschulsoftware
◻ unzufrieden ◻ eher unzufrieden ◻ eher zufrieden ◻ voll zufrieden
◻ Cloudlösungen
◻ unzufrieden ◻ eher unzufrieden ◻ eher zufrieden ◻ voll zufrieden
◻ Notenständer
◻ unzufrieden ◻ eher unzufrieden ◻ eher zufrieden ◻ voll zufrieden
◻ Schreibtisch
◻ unzufrieden ◻ eher unzufrieden ◻ eher zufrieden ◻ voll zufrieden
◻ anderes, und zwar:
◻ unzufrieden ◻ eher unzufrieden ◻ eher zufrieden ◻ voll zufrieden
Welchen konkreten Wunsch haben Sie diesbezüglich?
7.6. Merkmalsbereich 5: Neue Arbeitsformen und zusätzlich belastende Faktoren
7.6.1. Digitalisierung
Mit welchen der folgenden Faktoren im Zusammenhang mit Digitalisierung sehen Sie sich /Ihre Schüler konfrontiert und wie belastend ist das für Sie?
◻ Verkümmerung zentraler Fähigkeiten (Feinmotorik, Stimme)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Arbeitsverdichtung
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Entgrenzung der Arbeitszeit
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ hoher Erwartungsdruck
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Flexibilitätsdruck
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Schnelllebigkeit
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Informationsflut, Vielzahl an Kommunikationskanälen
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Dominanz von Social Media: Aktualitätszwang
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Anonymität
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ mangelnde eigene digitale Kompetenz
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ mangelnder technischer Support
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ technische Mängel (Arbeitsmittel, WLAN Stabilität)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ unzureichende Softwarelösungen
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ rechtliche Unsicherheit (Datenschutz, Urheberrecht)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ zusätzliche (nicht anerkannte) Arbeitszeit
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ zunehmende Bequemlichkeit der Schüler
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ andere, und zwar:____________
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Welche der folgenden Faktoren im Zusammenhang mit Onlineunterricht treffen auf Sie /Ihre Schüler zu und wie belastend ist das für Sie?
◻ körperliche Symptome (z.B. Schmerzen Bewegungsapparat, Sehstörungen)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Erschöpfungszustände
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ technische Probleme (z.B. Übertragungsqualität, Latenzen)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ mangelhaftes technisches Equipment (Arbeitsmittel)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ mangelhaftes technisches Equipment seitens des Schülers
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Notlösung, keine Weiterentwicklung des Schülers
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ zunehmende Bequemlichkeit der Schüler
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Vereinsamung, Verlust an Sozialkompetenz
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ andere, und zwar_______________________
Belastung: gar nicht ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
7.6.2. Zusätzlich belastende Faktoren
Einkommenssituation
Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?
„Meine Arbeit wird angemessen bezahlt.“
· trifft voll zu 1 ◻ ◻◻◻◻◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
„Vom Verdienst meiner Arbeit kann/könnte ich allein leben.“
· trifft voll zu 1 ◻ ◻◻◻◻◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
„Der Verdienst einer Musikschullehrkraft steht in keinem Verhältnis zu Ausbildungsdauer und Ausbildungsniveau.“
· trifft voll zu 1 ◻ ◻◻◻◻◻ 6 trifft überhaupt nicht zu
Belasten Sie finanzielle Sorgen, z.B. hinsichtlich der Sicherung Ihres (Familien-) Unterhalts?
· Gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Beruf Musikschullehrkraft
Mit welchen der folgenden Faktoren im Zusammenhang mit der Anerkennung des Berufsstandes in der Gesellschaft sehen Sie sich konfrontiert und wie belastend ist das für Sie?
◻ fehlende Wertschätzung der Lehrkraft (Schüler, Eltern, Gesellschaft) gegenüber
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Unkenntnis des Berufes
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Sorge um die Zukunft des Berufsstandes
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Arbeitsplatzunsicherheit
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Konkurrenz mit anderen Freizeitbeschäftigungen der Schüler
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Zwiespalt zwischen Eigenwahrnehmung als Lehrkraft mit Bildungsauftrag und Fremdwahrnehmung als bezahltem Dienstleister (beliebiges Freizeitangebot)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Druck, in der Öffentlichkeit zu bestehen (Wettbewerbe, Schüler-/Orchesterauftritte) Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Rollenirritation (Rolle als orientierungsgebender Ansprechpartner/Coach/Berater, Unklarheit der Befugnisse, Angreifbarkeit bei klarer Positionierung)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ andere, und zwar_______________________
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Institution Musikschule
Welche der folgenden Faktoren treffen für Ihre Musikschule zu und wie belastend ist das für Sie persönlich?
◻ Fachkräfte/Personalmangel im pädagogischen Bereich
Belastung: gar nicht ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Fachkräfte/Personalmangel im Verwaltungsbereich
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Fachkräfte/Personalmangel im technischen Bereich
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ mangelnde Unterstützung seitens Verwaltung
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ mangelnde Unterstützung seitens des technischen Bereiches
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ kein Ineinandergreifen der einzelnen Komponenten der Organisation
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Mittelkürzung im Musikschulhaushalt bei Bedarf
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ unzureichende finanzielle Ausstattung hinsichtlich benötigter Arbeitsmittel
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ unzureichende finanzielle Ausstattung hinsichtlich Veranstaltungsdurchführung
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ unzureichende finanzielle Ausstattung hinsichtlich Öffentlichkeitsarbeit
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ hohe Gebühren für Musikschulnutzer
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ fehlende/mangelhafte Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ mangelhafte öffentliche Wahrnehmung und Wertschätzung vor Ort
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ andere, und zwar_______________________
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
Kooperationen
Sollten Sie in Kooperationen (vor allem KiTa, Schulen) unterrichten:
Welche der folgenden Faktoren treffen für Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit zu und wie belastend ist das für Sie persönlich?
◻ Widerspruch zwischen schriftlichen Vereinbarungen und gelebter Praxis
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Vielzahl von Standorten
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Isolation, Einzelkämpfertum am Standort
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Musikschule als nachgeordneter Dienstleister
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ unklare Ansprechpartner
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ ungeeignete Räume für Musikschulunterricht
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Sorgen im Zusammenhang mit Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Nebeneinander statt Miteinander von Musikschule und Schule (Chancen und Synergien bleiben ungenutzt, z.B. bessere Vernetzung/Nachwuchsgewinnung)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ andere, und zwar_______________________
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Ich unterrichte nicht in Kooperationen.
Sonstige
Mit welchen der folgenden sonstigen Faktoren wurden Sie konfrontiert und wie belastend ist das für Sie?
◻ Erfahrungen von Diskriminierungen/Benachteiligungen wegen Alter, Behinderungen, Geschlecht, sexueller Orientierung, Nationalität (eigene bzw. im Musikschulkontext)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Sprachbarrieren im Unterricht mit Geflüchteten/Migranten
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Unsicherheit im Umgang mit anderen Kulturen im Unterricht
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Unsicherheit in Zusammenhang mit inklusivem Unterricht bzw. Unterricht mit verhaltensauffälligen Schülern
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Unsicherheit korrekte Sprach-/ und Themenwahl in Unterricht und Konzert (im Hinblick auf Gendern und Nationalitäten)
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ Spaltung der Gesellschaft, Radikalisierung, Positionierungszwang
Belastung: gar nicht 1 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
◻ andere, und zwar_______________________
Belastung: gar nicht ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 6 sehr stark
8 Literaturverzeichnis
Arbeitsstättenverordnung§ 3 (1), Anhang Abschnitt 3.4 ASR A3.4 "Beleuchtung" DIN EN 12464-1 „Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen “ [Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement in Schulen und Studienseminaren]. (04/2017). https://www.arbeitsschutz-schulen-nds.de/fileadmin/Dateien/Uebergreifende_Themen/Raumklima/Dokumente/Raumklima_info.pdf
Arens, C. (5. März 2024). Deutschlands Musikschulen vor massivem Umbruch. Westfälische Nachrichten,2024. https://www.wn.de/wn-kna/deutschlands-musikschulen-vor-massivem-umbruch-2932801
Beck, David, Schuller, Katja. (2020). Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung in der betrieblichen Praxis: Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus einem Forschungsprojekt . BAuA Forschungsprojekt F 2358, Projektlaufzeit 03/2015 - 12/ 2019. baua:berichtkompakt20200115 .
Becker, P. (2006). Gesundheit durch Bedürfnisbefriedigung. Hogrefe. http://elibrary.hogrefe.de/9783840920295/1
Bortz, Jürgen, Döring, Nicola. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften (5. Aufl.). Springer.
Bossen, A. (2022). Traumjob Arbeit in der kulturellen Bildung. Neue Musikzeitung (nmz), 71. Jahrgang(10). https://www.nmz.de/artikel/traumjob-arbeit-in-der-kulturellen-bildung
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Hrsg.). (2014). Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung: Erfahrungen und Empfehlungen . Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG.
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. (2020). Stressreport Deutschland 2019.https://doi.org/10.21934/BAUA:BERICHT20191007
BAG: Pflicht zur Arbeitszeiterfassung folgt aus Arbeitsschutzgesetz (2023 & i.d.F.v. Beschluss vom 13.9.2022, Az. 1 ABR 22/21). www.hartmannbund.de/berufspolitik/news/bag-pflicht-zur-arbeitszeiterfassung-folgt-aus-arbeitsschutzgesetz/
Bundesministerium des Innern, Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften. (2019). Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD): Besonderer Teil Verwaltung . www.personalrat-online.de/media/pdf/tv_tvoed-bt-v_20190830.pdf
Bundesversammlung des VdM. (2023). Kasseler Erklärung: Bedrohlichem Mangel an Fachkräften entgegenwirken! [Berufsbild und Beschäftigungsverhältnisse von Lehrkräften an Musikschulen verbessern!]. Verband deutscher Musikschulen. https://www.musikschulen.de/medien/doks/Positionen_Erklaerungen/kasseler-erklaerung-2023.pdf
Clausen, P. (13. März 2024). Honorarkräfte erhalten richtige Arbeitsverträge. Neue Westfälische, Bielefelder Tageblatt(Bielefeld Ost). https://www.pressreader.com/germany/neue-westfalische-bielefelder-tageblatt-bielefeld-ost/20240313/282351159749028
denkebene marketing & consulting Limited. (2023). Berufe und ihr Berufsunfähigkeitsrisiko. https://www.online-vergleich-versicherung.de/berufsunfaehigkeitsversicherung/bu-berufsgruppen/
Arbeitsschutzgesetz § 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen, www.gesetze-im-internet.de (1996 & i.d.F.v. 31.05.2023). https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/ArbSchG.pdf
Gläser, J. & Laudel, G. (2010). Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen (4. Auflage). Lehrbuch. VS Verlag. http://www.lehmanns.de/midvox/bib/9783531172385
Gutschmidt, N. (24. Juni 2024). Demonstranten fordern Absicherung für Lehrkräfte an Berliner Musikschulen. rbb24 Fritz. https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/2024/06/berlin-musikschulen-protest-kulturausschuss-abgeordnetenhaus.html
Haas, S. (2024). Gutachten zur Betrachtung der gelebten Arbeitssituation im Kontext der Bewertungskriterien durch die DRV der Lehrbeauftragten an der Hochschule für Musik Dresden .
Haselbach, D., Betzler, D. & Kobler-Ringler, N. (April 2021). Eiszeit? Studie zum Musikleben vor und in der Corona-zeit. https://www.musikrat.de/fileadmin/files/DMR_Musikpolitik/DMR_Corona/DMR_Eiszeit_Studie.pdf
Haufe.de (Hrsg.). TVöD-BT-V/ § 52 Beschäftigte als Lehrkräfte an Musikschulen. Haufe. https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/tvoed-bt-v-52-beschaeftigte-als-lehrkraefte-an-musikschulen_idesk_PI42323_HI1413541.html
Herrenberg-Urteil, Az.: B 12 R 3/20 R 2 (Bundessozialgericht 28. Juni 2022). https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Entscheidungen/2022/2022_06_28_B_12_R_03_20_R.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Hrsg.). Bachelor Lehramt Doppelfach Musik. https://www.hfmdd.de/studium/bachelor-lehramt-doppelfach-musik
Hübner, F. (2018). Betriebliche Gesundheitsförderung von Berufsmusikern in den deutschen Kulturorchestern: Situationsanalyse und Handlungsempfehlungen . GRIN.
Irmer, M. (2021). JobPsy – Online-Konfigurator zur Erfassung und Beurteilung psychischer Belastungen . https://forum.dguv.de/ausgabe/11-2021/artikel/jobpsy-online-konfigurator-zur-erfassung-und-beurteilung-psychischer-belastungen
Jäkel, I. & Stein, G. (2016). Unternehmen(s)gesundheit: Betriebliches Gesundheitsmanagement in der Praxis . EHP-Praxis. EHP - Verlag Andreas Kohlhage. https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=6721191
Jennicke, S. (2023). Personalplanung an Musikschule neu ausgerichtet [Pressemitteilung].
Klickstein, G. (2011). Beruf Musiker: Ein Handbuch für die Praxis. Schott Music.
Landesmusikrat Berlin. (2024). Absicherung und Ausbau des Angebots der öffentlichen Musikschulen – Faire Umwandlung von Honorarverträgen jetzt! https://www.landesmusikrat-berlin.de/absicherung-und-ausbau-des-angebots-der-offentlichen-musikschulen-faire-umwandlung-von-honorarvertragen-jetzt-28-06-2024/
(8. April 2021). Beschluss Beschluss A04.
Landesverband Musikschulen Schleswig Holstein. (2024). Öffentliche Musikschulen in Schleswig-Holstein nur mit Festanstellungen: Die schleswig-holsteinische Musikschullandschaft rechtssicher aufstellen und die Zukunft der musikalischen Bildung auf der kommunalen und der Landesebene sichern. Landesverband der Musikschulen in Schleswig Holstein e.V. https://musikschulen-sh.de/fileadmin/Positionspapier_Festanstellungen_LVdMSH.pdf
Landkreis Oder-Spree. (2024, 4. Juli). Kreisverwaltung Oder-Spree setzt Herrenberg-Urteil zum Beschäftigungsverältnis an Musikschulen um [Pressemitteilung]. https://www.landkreis-oder-spree.de/index.php?object=tx,3410.5&ModID=7&FID=2689.7537.1&NavID=2689.203.1
Lühr, R. (2011). Ratgeber Musikschullehrkräfte. Fata Morgana Verlag.
Mangold, K. (2024). Psychische Belastung am Arbeitsplatz für Musikschullehrkräfte: Vorstudie zur Entwicklung eines Fragebogens zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung [Masterarbeit]. Dresden International University, Dresden. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-882335
Mangold, K., Pfarr, B., Roth, A. & Kowallik, H. (2019, 25. September). Musikschule - Schule für Musk: Zukunft der Musikschulen-offener Brief an die Teilnehmer der Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung in Sachsen . Facebook. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=396714344595537&set=pb.100027709239654.-2207520000.&type=3
Mattele, D. & Oetzel, L. (1. Februar 2024). Nach „Herrenberg-Urteil“:: Umbruch in der Musikschullandschaft steht bevor. Verbände: Ver.di Fachgruppe Musik. Neue Musikzeitung (nmz),73.(3/2024), S. 31. https://www.nmz.de/nmz-verbaende/verdi-fachgruppe-musik/nach-herrenberg-urteil
Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken (12. Aufl.). Beltz Verlag.
Ministerium für Kultur, Abteilung Musik. (1977). Lehrplan für die Musikschulen in der DDR: Gitarre Grund- und Oberstufe.
Nagel, U. (2012). psy.Res® - ein Instrumentarium zur Analyse, Feindiagnostik, Beurteilung und Prävention psychischer Gesundheitsgefahren in der Arbeit. BG ETEM, Technische Universität Dresden. https://www.psyres-online.de/media/downloads/psyres_datenblatt.pdf
Oesterreich, R. (Hrsg.). (1999). Schriften zur Arbeitspsychologie: Bd. 59. Psychologie gesundheitsgerechter Arbeitsbedingungen: Konzepte, Ergebnisse und Werkzeuge zur Arbeitsgestaltung (1. Aufl.). Huber.
Präsidium des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. (2010). Die Musikschule: Leitlinien und Hinweise.
Scharf, A. Über uns . https://www.kms-tir.de/musikschule/ueber-uns
Scheinpflug, G. (24. Juni 2024). Von der Schwierigkeit, das Richtige zu tun: Arbeiten an Musikschulen: alles anders – aber wie? Neue Musikzeitung (nmz),73(07_08/2024). https://www.nmz.de/nmz-verbaende/verdi-fachgruppe-musik/von-der-schwierigkeit-das-richtige-zu-tun
Schmidt, M. (2022). Psychologische Bewertung von Arbeitsbedingungen: Screening für Arbeitsplatzinhaber . https://basa.hszg.de/
Schulz von Thun, F. (2022). Miteinander reden(60. Ausgabe, Originalausgabe). Rororo: Bd. 17489 . Rowohlt Taschenbuch Verlag.
Siegrist, J. (2012). Effort-Reward-Imbalance – Fragebogen zur Messung beruflicher Gratifikationskrisen . https://psydix.org/psychologische-testverfahren/eri/
Die Linke Fraktion im Sächsischen Landtag. (2024a, 5. März). Scheinselbständigkeit von Honorarkräften wird teuer für die kulturelle Bildung - Staatsregierung muss den Kollaps der Einrichtungen verhindern [Pressemitteilung]. https://www.linksfraktionsachsen.de/presse/detail/franz-sodann-scheinselbstaendigkeit-von-honorarkraeften-wird-teuer-fuer-die-kulturelle-bildung-staatsregierung-muss-den-kollaps-der-einrichtungen-verhindern/
Die Linke Fraktion im Sächsischen Landtag. (2024b, 27. Mai). Kollaps der kulturellen Bildungseinrichtungen nicht abgewendet - Ungewissheit für Honorarkräfte und Einrichtungen [Pressemitteilung]. https://www.linksfraktionsachsen.de/presse/detail/franz-sodann-kollaps-der-kulturellen-bildungseinrichtungen-nicht-abgewendet-ungewissheit-fuer-honorarkraefte-und-einrichtungen/
Steffgen, G. (Hrsg.). (2004). Betriebliche Gesundheitsförderung (1. Auflage). Hogrefe Verlag.
ver.di. (2024, 1. Juli). ver.di begrüßt umfassende Festanstellungen an der Rheinischen Musikschule: Ein gutes Zeichen für die bisher auf Honorarbasis tätigen Musiklehrkräfte und auch für die kulturelle Bildung! [Pressemitteilung]. https://kunst-kultur.verdi.de/musik/unterrichten/honorarbasis/++co++5b70dcec-353a-11ef-863b-634e4bc83ed2
Verband deutscher Musikschulen. (2009). Strukturplan des VdM: Die öffentliche Musikschule: Konzept, Aufbau, Struktur . https://www.musikschule.de/musikschulen/strukturplan2009/index.html
Verband deutscher Musikschulen. (2023a). Anlage KAV Rundschreiben zu Honorarkräften: Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs . https://www.musikschulen.de/medien/doks/recht/anlage-kav-rundschreiben-zu-honorarkraeften.pdf
Verband deutscher Musikschulen. (2023b). Strukturplan des VdM Die öffentliche Musikschule: Konzept, Aufbau, Struktur: Strukturplangrafik . Strukturplan des VdM: Die öffentliche Musikschule: Konzept, Aufbau, Struktur
WHO. (1986). Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung .
Wirtz, M. A. & Dorsch, F. (Hrsg.). (2020). Dorsch - Lexikon der Psychologie (19., überarbeitete Auflage). Hogrefe. https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/kommunikation-partnerzentrierte
9 Anhang
9.1. Hilfreiche Links
Fragebogen Konfigurator „JobPsy“:
https://forum.dguv.de/ausgabe/11-2021/artikel/jobpsy-online-konfigurator-zur-erfassung-und-beurteilung-psychischer-belastungen
Unfallkasse Hessen:
https://www.ukh.de/unternehmen-und-beschaeftigte/arbeitsschutz-und-gesundheit/belastungen-ermitteln-mit-der-gb-psyche
Unfallkasse Sachsen:
https://www.uksachsen.de/sicherheit-gesundheit/psyche-und-gesundheit
COPSOQ – Befragung zu psychischen Belastungen am Arbeitsplatz:
https://www.copsoq.de/copsoq-fragebogen/
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin:
BAuA - Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung - Grundlegende Aufgaben und Schritte zur Umsetzung - Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BASA psychologische Bewertung von Arbeitsbedingungen:
BASA IV Screening Arbeitsplatzanalyse für Arbeitsplatzinhaber (hszg.de)
ERI – Effort-Reward-Imbalance-Fragebogen zur Messung beruflicher Gratifikationskrisen:
ERI - Effort-Reward-Imbalance – Fragebogen zur Messung beruflicher Gratifikationskrisen (psydix.org)
Instrument zur Beurteilung von psychischen Belastungen und Beanspruchungen der Dr. Ulla Nagel GmbH:
psy.Res® - Portal zur Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz (psyres-online.de)
9.2. Grafiken, Word Clouds, Tabellen
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung52: Verteilung der Befragten nach Bundesländern
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung53: Verteilung der Befragten nach Geschlecht
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung54: Alter der Interviewpartner
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung55: Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung56: Familienstand
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung57: Klare Definition von Verantwortlichkeiten innerhalb der Musikschule
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung58: Bewusstheit eigene Zuständigkeit/ Verantwortung
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung59: Vom Verdienst meiner Arbeit könnte ich allein leben.
Abb. in der Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung60: Öffentliche Wahrnehmung der Musikschule am Ort
[1] Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2014, S. 22)
[2] Ebenda, S. 18
[3] Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2014, S. 30)
[4] Mangold (2024)
[5] Klickstein (2011, S. 329)
[6] denkebene marketing & consulting Limited (2023)
[7] Hübner (2018, S. 4)
[8] Ebenda
[9] Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2020, S. 18)
[10] Beck, David, Schuller, Katja (2020, vgl. S.12)
[11] Ministerium für Kultur, Abteilung Musik (1977, S. 4)
[12] Ebenda
[13] Bundesversammlung des VdM (2023, S. 1)
[14] Ebenda
[15] Ebenda
[16] Verband deutscher Musikschulen (2023b)
[17] Präsidium des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (2010, S. 4)
[18] Verband deutscher Musikschulen (2009, S. 1)
[19] Präsidium des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (2010, S. 4)
[20] Präsidium des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (2010, 6 f)
[21] Ebenda
[22] Mangold et al. (2019, S. 1)
[23] Verband deutscher Musikschulen (2023b)
[24] Verband deutscher Musikschulen (2009, S. 1)
[25] Präsidium des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes(2010, 10 f)
[26] Haufe.de (S. 1)
[27] BAG: Pflicht zur Arbeitszeiterfassung folgt aus Arbeitsschutzgesetz (2023, S. 1)
[28] Bundesministerium des Innern, Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften (2019, S. 47 f.)
[29] Lühr (2011, S. 53)
[30] Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2014, S. 20)
[31] Ebenda 21 f.
[31] Jäkel und Stein (2016, S. 20)
[32] Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2014, S. 21)
[33] Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2014, S. 21)
[34] Ebenda
[35] Becker (2006, S.131)
[36] Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2014, vgl. S. 22)
[37] Hübner (2018, S. 8–9)
[38] Ebenda
[39] Oesterreich (1999, nach S.155ff)
[40] Ebenda, S. 156
[41] Ebenda, S. 157
[42] Becker (2006, S.85)
[43] Ebenda, S. 85 f.
[44] Steffgen (2004, S. 42)
[45] Ebenda
[46] Steffgen (2004, S.42 f.)
[47] Ebenda, S.44 f.
[48] Ebenda
[49] Ebenda
[50] Ebenda
[51] Hübner (2018, S. 6 ff.)
[52] Ebenda
[53] Steffgen (2004, S. 173)
[54] Becker (2006, S. 104)
[55] Ebenda
[56] Ebenda, S. 121
[57] Ebenda, S. 111
[58] Ebenda, S.183 f.
[59] Ebenda, S.114
[60] Becker (2006, S.114)
[61] Ebenda, S. 184
[62] Ebenda, S. 284
[63] Arbeitsschutzgesetz § 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen (2023, S. 3)
[64] WHO (1986, S. 1)
[65] Jäkel und Stein (2016, S. 40)
[66] Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2014, S. 14)
[67] Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2014, S. 13)
[68] Ebenda, S. 41
[69] Ebenda, S. 43 f.
[70] Ebenda, S. 55 f.
[71] Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2014, 45 f)
[72] Wirtz und Dorsch (2020)
[73] Schulz von Thun (2022, S. 33)
[74] Wirtz und Dorsch (2020)
[75] Gläser und Laudel (2010, S. 46)
[76] Ebenda
[77] Gläser und Laudel (2010, S. 201)
[78] Mayring (2015, S. 65 ff.)
[79] Gläser und Laudel (2010, S. 201)
[80] Hübner (2018, S. 42)
[81] Bortz, Jürgen, Döring, Nicola (2016, S. 184)
[82] Ebenda, S. 72
[83] Gläser und Laudel (2010, S. 118)
[84] Hübner (2018, S. 39)
[85] Gläser und Laudel (2010, S. 149 f.)
[86] Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2014, S. 30)
[87] Bortz, Jürgen, Döring, Nicola (2016, S. 253)
[88] Gläser und Laudel (2010, S. 118)
[89] Gläser und Laudel (2010, S. 201)
[90] Arbeitsstättenverordnung§ 3 (1), Anhang Abschnitt 3.4 ASR A3.4 "Beleuchtung" DIN EN 12464-1 „Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen“ ( 2017)
[91] Oesterreich (1999, S. 157)
[92] Becker (2006, S. 85 f.)
[93] Steffgen (2004, S. 42 f.)
[94] Steffgen (2004, S. 44 f.)
[95] Ebenda, S. 173
[96] Becker (2006, S.114)
[97] Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2014, S. 55 f)
[98] Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
[99] Haselbach et al. (2021, S. 13)
[100] Ebenda, S. 12 ff.
[101] Präsidium des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (2010, 5 f)
[102] Bossen (2022, S. 1)
[103] Präsidium des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (2010, 5 f)
[104] Ebenda
[105] Bundesversammlung des VdM (2023, S. 1)
[106] Mangold et al. (2019)
[107] Landesparteitag der SPD Sachsen 2021 (2021, S. 2 f.)
[108] Arens (2024)
[109] Herrenberg-Urteil,28.06.2022
[110] Sodann (2024a)
[111] Verband deutscher Musikschulen (2023a, S. 29 ff.)
[112] Landesverband Musikschulen Schleswig Holstein (2024)
[113] Landesverband Musikschulen Schleswig Holstein (2024)
[114] Sodann (2024a)
[115] Haas (2024)
[116] Sodann (2024b)
[117] Ebenda
[118] Scheinpflug (2024)
[119] Jennicke (2023)
[120] Clausen (2024, B15)
[121] Mattele und Oetzel (2024)
[122] Landkreis Oder-Spree (2024)
[123] ver.di (2024)
[124] Landesmusikrat Berlin (2024)
[125] Gutschmidt (2024)
[126] Mattele und Oetzel (2024)
[127] Scharf
[128] Irmer (2021, S. 25)
[129] Siegrist (2012)
[130] Schmidt (2022)
[131] Nagel (2012)
[132] Mangold (2024)
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses HTML-Dokuments?
Dieses HTML-Dokument enthält eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter einer Masterarbeit mit dem Titel "Psychische Belastung am Arbeitsplatz für Musikschullehrkräfte: Vorstudie zur Entwicklung eines Fragebogens zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung" umfasst. Es handelt sich um OCR-Daten aus einem Verlag, die ausschließlich für akademische Zwecke zur Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Form bestimmt sind.
Welche Themen werden in der Masterarbeit behandelt?
Die Masterarbeit behandelt die psychische Belastung von Musikschullehrkräften, die gesetzliche Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz, die Situation an Musikschulen, die Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung psychischer Belastungen und Handlungsempfehlungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung.
Welche theoretischen Grundlagen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene theoretische Modelle wie das Anforderungs-Kontroll-Modell von Robert Karasek, das Modell beruflicher Gratifikationskrisen von Johannes Siegrist, das Transaktionale Stressmodell von Lazarus & Folkman, das Konzept psychischer Belastungen durch Regulationsbehinderungen, die Salutogenese von Antonovsky und das Systemische Anforderungs-Ressourcen-Modell (SAR-Modell) der Gesundheit von Peter Becker.
Was ist das Ziel der Vorstudie?
Das Ziel der Vorstudie ist die Entwicklung eines geeigneten Messinstruments zur Erstellung einer passgenauen Gefährdungsbeurteilung für Musikschullehrkräfte. Dazu wurden leitfadenbasierte Experteninterviews geführt und qualitativ ausgewertet.
Welche Bereiche werden im Fragebogen zur psychischen Belastung erfasst?
Der Fragebogen erfasst die Merkmalsbereiche Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe (Selbstbestimmtheit, Qualifikation, Emotionale Involviertheit), Arbeitsorganisation (Arbeitszeit, Kommunikation), Soziale Beziehungen (Verhältnis zu Kollegen, Vorgesetzten, Schülern und Eltern) und Arbeitsumgebung (Arbeitsort, Körperliche Tätigkeit, Arbeitsmittel) sowie Neue Arbeitsformen und zusätzlich belastende Faktoren (Digitalisierung, Verdienst, Diskriminierung, gesellschaftliche Umbrüche).
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Vorstudie?
Die Vorstudie identifiziert zahlreiche Faktoren psychischer Belastung bei Musikschullehrkräften, darunter hohe Arbeitsbelastung, geringe Wertschätzung, unzureichende Vergütung, begrenzte Entwicklungsmöglichkeiten, Entgrenzung der Arbeitszeit, schwierige Arbeitsbedingungen in Kooperationen und fehlende Gefährdungsbeurteilungen zur psychischen Belastung.
Welche Handlungsempfehlungen werden in der Arbeit gegeben?
Die Arbeit empfiehlt die Erstellung einer passgenauen Gefährdungsbeurteilung für Musikschullehrkräfte, die Ableitung gezielter Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung, die Stärkung interner und externer Ressourcen und die politische Aufklärungsarbeit zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Musikschullehrkräfte.
Was ist das "Herrenberg-Urteil" und welche Bedeutung hat es für Musikschullehrkräfte?
Das "Herrenberg-Urteil" des Bundessozialgerichts vom 28.06.2022 betrifft die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Honorarlehrkräften. Es könnte zu einer Umwandlung von Honorarverträgen in feste Anstellungsverhältnisse führen und somit die Arbeitsbedingungen von Musikschullehrkräften verbessern.
Welche Werkzeuge zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Werkzeuge vor, darunter "JobPsy" (ein Online-Fragebogen-Konfigurator), den ERI-Fragebogen (zur Messung beruflicher Gratifikationskrisen), das BASA IV-Verfahren (zur psychologischen Bewertung von Arbeitsbedingungen) und "psy.Res®" (ein Instrument zur Analyse und Prävention psychischer Fehlbelastungen).
Details
- Titel
- Psychische Belastung am Arbeitsplatz für Musikschullehrkräfte
- Untertitel
- Vorstudie zur Entwicklung eines Fragebogens zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung
- Hochschule
- Dresden International University
- Note
- 1,3
- Autor
- Katja Mangold (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2023
- Seiten
- 128
- Katalognummer
- V1501712
- ISBN (Buch)
- 9783389085011
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Psychische Belastung Musikschule Musikschullehrkräfte Gefährdungsbeurteilung Betriebliche Gesundheitsförderung Musikpädagogik
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 30,99
- Arbeit zitieren
- Katja Mangold (Autor:in), 2023, Psychische Belastung am Arbeitsplatz für Musikschullehrkräfte, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1501712
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-