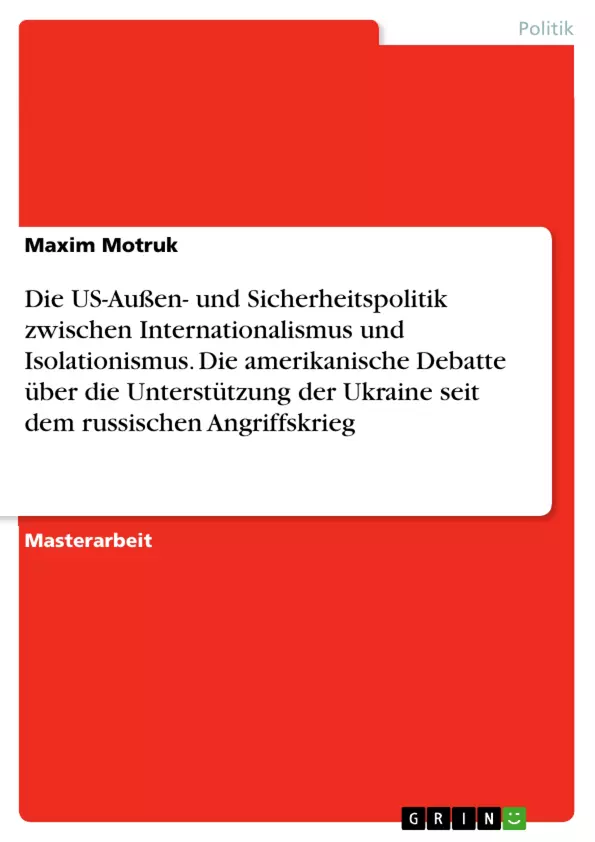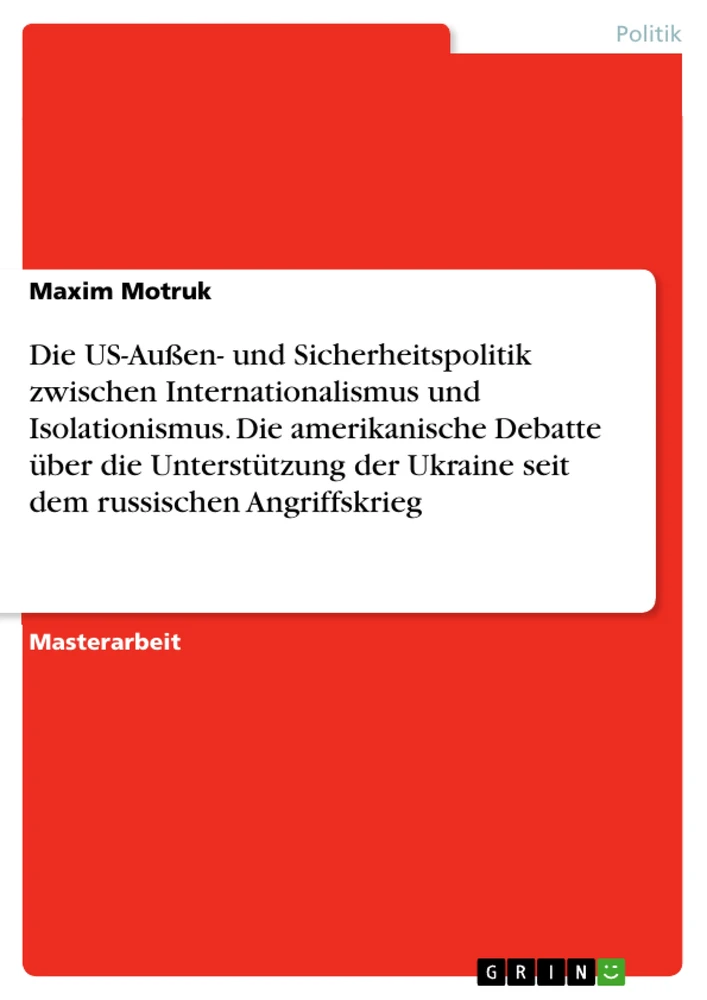
Die US-Außen- und Sicherheitspolitik zwischen Internationalismus und Isolationismus. Die amerikanische Debatte über die Unterstützung der Ukraine seit dem russischen Angriffskrieg
Masterarbeit, 2024
101 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Forschungsstand
2.1 Identität im Zusammenspiel mit der US-Außen- und Sicherheitspolitik
2.2 US-Auslandshilfe als Außen- und Sicherheitspolitik
2.3 Die Relevanz der Verbindung von Identität und Auslandshilfe
3 Theoretischer Hintergrund
3.1 Diskurstheorie nach Laclau/Mouffe
3.1.1 Grundbegriffe: Bedeutung und Diskurs
3.1.2 Die Rolle der Sprache und der Materialität
3.1.3 Hegemoniale Kämpfe und sozialer Antagonismus
3.2 Identität und außenpolitischer Diskurs
3.2.1 Das Konzept der Identität nach Hansen
3.2.2 Subjekt und Subjektpositionen
3.2.3 Identitätskonstruktion
3.2.4 Legitimität außenpolitischer Entscheidungen
3.2.5 Diskursive Stabilität und intertextuelle Verbindungen
3.3 Diskursanalyse
3.3.1 Das Konzept der Diskursanalyse
3.3.2 Diskursanalyse im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik
4 Methodologie
4.1 Leitfaden zur Entwicklung diskursanalytischer Forschungsdesigns
4.2 Entwickeltes Forschungsdesign zur (Nicht-)Unterstützung der Ukraine
4.3 Datenkorpus
5 Diskursanalyse: Rechtfertigungsmuster und Identitäten
5.1 Biden-Diskurs
5.1.1 Friedensorientierung
5.1.2 Wirksamkeit und Erfolg
5.1.3 Demokratische Werte und internationale Normen
5.1.4 Ukrainischer Heroismus
5.1.5 Amerikanisches Verantwortungsbewusstsein
5.1.6 Rechenschaft für die Taten
5.1.7 Identitätskonstruktion im Biden-Diskurs
5.2 Pro-ukrainischer Unterdiskurs
5.2.1 Bedrohung nationaler Sicherheit
5.2.2 Frieden durch Stärke
5.2.3 Investition in die nationale Sicherheit
5.2.4 Demokratische Werte
5.2.5 Internationale Normen und Ordnung
5.2.6 Ukrainischer Heroismus
5.2.7 Identitätskonstruktion unter den republikanischen Unterstützern
5.3 Anti-ukrainischer Unterdiskurs
5.3.1 Innenpolitische Prioritäten
5.3.2 Die ,korrupte Ukraine’ als ,Geldwäscheparadies‘
5.3.3 (Fehlende) Sicherheitsbedrohung
5.3.4 Gefahren aufgrund der Unterstützung
5.3.5 Verantwortungsloses Handeln der amerikanischen Politik
5.3.6 Verhandlungen statt Unterstützung
5.3.7 Identitätskonstruktion unter den republikanischen Unterstützungsgegnern
5.4 Bedeutungskampf im Vergleich: Inhärente Spannungen und Diskursmacht
6 Fazit und Ausblick
7 Quellenverzeichnis
Primärquellen
Sekundärquellen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Idealtypische Darstellung verschiedener Identitätskonstruktionen
Abbildung 2: Zusammenfassung der Identitäts-Außenpolitik-Konstellationen
1 Einleitung
In den Morgenstunden des 24. Februars 2022 entfesselte Russland einen grausamen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Land ist seitdem stärker als je zuvor auf Soforthilfen aus dem Ausland angewiesen, um sich angesichts des Krieges gegen die militärische Übermacht Russlands wehren und seine Wirtschaft vor einem Kollaps retten zu können. Seit Beginn des Krieges erweisen sich die USA durch ihre präzedenzlose Unterstützung als wichtigster Beschützer der Ukraine, vor allem im Bereich der militärischen Hilfen. Ihre Unterstützung beeinflusst allerdings nicht nur die Lage in der Ukraine, sondern auch die Lage im eigenen Land, das über die zukünftige außen- und sicherheitspolitische Orientierung diskutiert.
Die Debatte um die Unterstützung lässt zwei grundlegende außenpolitische Traditionen aufeinanderprallen, wodurch die US-Außenpolitik vor einer Zerreißprobe steht. Zum einen handelt es sich um die internationalistische Haltung, in deren Zentrum die Überzeugung steht, sich an internationalen Konfliktlösungen beteiligen zu müssen, und zum anderen um die isolationistische Haltung, die innenpolitische Angelegenheiten priorisiert und Einmischungen in ausländische Angelegenheiten strikt ablehnt (vgl. Sirakov 2023). Innerhalb der Debatte steht die de- mokratische1 Biden-Administration vor der Herausforderung, die im Kongress verabschiedeten Maßnahmen für die Ukraine effektiv umzusetzen. Gleichzeitig sieht sie sich jedoch einer republikanischen Opposition gegenüber, die uneins in der Frage der Unterstützung ist. Für einige geht die Unterstützung nicht weit genug, andere lehnen sie hingegen gänzlich ab, wie es im Fall von Trump-treuen Republikanern deutlich wird. Wie diese Masterarbeit noch zeigen wird, greifen die Diskursträger2 dabei nicht nur auf sachliche, sondern auch auf identitätsbasierte Argumente zurück, um ihre Haltung zu rechtfertigen.
Diese Masterarbeit führt eine Diskursanalyse der US-Debatte über die Unterstützung der Ukraine seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs durch. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der Bedeutung von sprachlich-diskursiven Identitätselementen im Zusammenspiel mit der politischen Rechtfertigungsgrundlage (für und gegen die Unterstützung). Es wird nicht nur die US-Identität untersucht, sondern auch die Identitätskonstruktion für die relevanten Fremdbilder (Ukraine und Russland) betrachtet. Um eine umfassende Analyse durchzuführen, wird die Debatte in vier markante Zeitabschnitte unterteilt, die jeweils einen Monat umfassen und durch intensive Diskursaktivitäten zum Thema geprägt waren.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Rechtfertigung der Unterstützung aus einer diskursanalytischen Sicht zu rekonstruieren und zugleich inhärente Spannungen innerhalb des diskursiven Kampfes aufzudecken. Dies betrifft interdiskursive Uneinigkeiten bezüglich der Rechtfertigungsgründe, ob identitär oder nicht-identitär ausgerichtet. Die zentralen Fragestellungen dieser Arbeit lauten dabei wie folgt:
1. Wie wird die (Nicht-)Unterstützung der Ukraine in den zentralen politischen US-Dis- kursen gerechtfertigt und welche Rolle spielt dabei die nationale Identität?
2. Inwiefern wird der Biden-Diskurs im diskursiven Kampf um die Unterstützung herausgefordert?
Diese Arbeit kommt zum Schluss, dass es unter den Befürwortern der Unterstützung zwar Überschneidungen gibt. Durch die Einbeziehung des Diskurses der Unterstützungsgegner wird aber deutlich, dass die Argumentation der Biden-Administration in nahezu allen Aspekten herausgefordert wird. Das betrifft sowohl die identitäre als auch nicht-identitäre Bedeutungsstruktur. Einzig die weitverbreitete Zuschreibung, dass es sich um heldenhafte Ukrainer handelt, die aufgrund ihres Heroismus Unterstützung verdienen, verleiht dem offiziellen Diskurs der Biden- Administration eine gewisse Diskursmacht.
Das gewählte Forschungskonzept basiert auf dem poststrukturalistischen Ansatz, der die Konzepte Diskurs, Außenpolitik und Identität verknüpft. Der Fokus auf das Zusammenspiel dieser drei Komponenten beruht auf der Annahme, dass Identitäten und außenpolitische Entscheidungen ontologisch untrennbar sind. Identitäten werden einerseits durch den außenpolitischen Diskurs (re-)produziert und dienen andererseits selbst als Rechtfertigungsgrundlage für die Politik (vgl. Hansen 2006: 26 f.). Diese Grundidee entstammt aus Lene Hansens Werk, das sowohl eine fundierte poststrukturalistische Identitätstheorie als auch einen dazugehörigen Leitfaden zur Entwicklung diskursanalytischer Forschungsdesign bietet, weshalb sich die vorliegende Masterarbeit daran orientiert. Weitere wichtige Grundlagen für diese Arbeit sind sowohl die Diskurstheorie nach Laclau und Mouffe (2001), welche die angewandte poststrukturalistische Forschungslogik verdeutlichen soll, als auch der Begriff des Argumentationsmusters nach Stahl und Harnisch (2009), der es erleichtert, methodisch inhaltliche Strukturen verschiedener Rechtfertigungsgründe zu erfassen.
Abgesehen davon muss zunächst geklärt werden, was unter Unterstützung für die Ukraine zu verstehen ist. Die hierfür maßgebliche Definition stammt aus dem Ukraine Support Tracker des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), das verschiedene Unterstützungsleistungen für die Ukraine erfasst. Sie beinhalten militärische Hilfen (z. B. Waffen und Ausrüstungsgegenstände), humanitäre Beiträge (lebenswichtige Hilfsgüter) und finanzielle Unterstützung (z. B. Zuschüsse und Kredite) (vgl. Trebesch et al. 2023: 5).
Die Arbeit folgt dem Prinzip, den Diskurs nicht über Sekundärquellen, sondern direkt aus den Primärquellen sprechen zu lassen und ihn auf dieser Grundlage zu analysieren. Zu diesem Zweck wurde eine breite Palette an einschlägigen Primärquellen als Untersuchungsgegenstand ausgewählt, worunter sich Reden, Parlamentsdebatten im Kongress, Interviews (bei FoxNews, CNN, ABC News), Meinungsbeiträge, Beiträge auf Twitter sowie Vodcasts befinden. Alle diese Quellen sollen möglichst breit gelesen und beachtet werden („ [w]idely read and attended to “ (Hansen 2006: 87)), um die politischen Diskurse möglichst genau erfassen zu können.
Die Struktur der Masterarbeit gliedert sich wie folgt: Der erste Teil behandelt den Forschungsstand zum Thema Identität im Zusammenspiel mit der US-Außen- und Sicherheitspolitik. Im Fokus stehen dabei zwei Forschungsstränge, der sozialkonstruktivistische nach Wendt und der poststrukturalistische nach Campbell, wobei sich die vorliegende Arbeit in theoretischer Sicht dem letzteren anschließt. Das Kapitel fährt mit der US-Auslandshilfe als einem Teilbereich der Außen- und Sicherheitspolitik fort und verdeutlicht die wissenschaftliche Relevanz der Verbindung zwischen Identität und Auslandshilfe.
Im zweiten Teil werden wichtige Grundbegriffe der poststrukturalistischen Forschungslogik nach Laclau und Mouffe (2001) beschrieben, gefolgt vom Kern der theoretischen Grundlagen nach Hansen (2006): Identität, Außenpolitik und Diskursanalyse. Der dritte Teil erläutert die methodologischen Grundlagen der Arbeit, was die Entwicklung eines diskursanalytischen Forschungsdesigns sowie dessen Anwendung umfasst. Insbesondere wird erklärt, nach welchen Kriterien das Material ausgewählt wurde, wobei insgesamt drei zu untersuchende Diskurse zugrunde gelegt wurden: der offizielle Biden-Diskurs sowie zwei oppositionelle Diskurse, nämlich derjenige der republikanischen Unterstützer und derjenige der republikanischen Unterstützungsgegner.
Im vierten Teil wird die Diskursanalyse behandelt, strukturiert in rechtfertigende Argumentationsmuster und jeweils ein Unterkapitel zur Identitätskonstruktion, das sich mit dem Selbst- und Fremdbild befasst und die diskursive Stabilität der jeweiligen Identitäten beleuchtet. Abschließend wird der offizielle Biden-Diskurs mit den oppositionellen Diskursen verglichen, um präziser zu erfassen, inwiefern der Biden-Diskurs herausgefordert wird oder Diskursmacht erreicht hat. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und bietet am Ende eine kurze kritische Würdigung mit einem Ausblick auf die künftige Forschung.
2 Forschungsstand
2.1 Identität im Zusammenspiel mit der US-Außen- und Sicherheitspolitik
Die bisherige Forschung zur Rolle der Identität in der amerikanischen Politik lässt sich im Wesentlichen in ein Wendt‘sches und ein Campbell‘sches Lager unterteilen.3 Das erstere folgt der sozialkonstruktivistischen Tradition nach Wendt (1992; 1999), der Identität als eine von der Politik unabhängige Variable versteht, die dazu dient, politische Phänomene zu erklären. Das letztere folgt hingegen dem Poststrukturalisten Campbell (1998), der den Identitätsbegriff als diskursiv und nicht-essentialistisch konzeptualisiert. Seine diesbezügliche Grundthese lautet, dass sich eine nationale Identität (Self) durch Abgrenzung von einem als bedrohlich empfundenen Fremdbild (Other) konstruiert.4
Innerhalb des Wendt’schen Lagers liegt der Fokus häufig auf der Anwendung eines sozialkonstruktivistischen Ansatzes zur Erklärung der Politikgestaltung (Rowley/Weldes 2012) sowie der zugehörigen Strategie (Nau 2002). Die Ergebnisse dieser Forschung zeigen, dass Identität eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der US-Interessen spielte und als Grundlage für die Entwicklung politischer Maßnahmen diente (Rowley/Weldes 2012). Was die US-Strategien betrifft, behauptet Nau (2002), dass die USA ihre demokratische und multilaterale Identität in der Welt fördern wollen und ihre militärischen Interventionen (wie in Afghanistan oder im Kosovo) mit moralischen Gründen gerechtfertigt haben. Im Gegensatz dazu legt das Campbell’sche Lager weniger Wert auf empirische Erklärungen, sondern vielmehr darauf, den diskursiven Zusammenhang zwischen Politik und Identität zu verstehen. Eine Studie von Lock (2008), die dieses Erkenntnisinteresse verfolgte, hat gezeigt, dass auf den ersten Blick widersprüchliche Identitätselemente im sicherheitspolitischen Diskurs kongruieren können. Demnach ist das amerikanische Selbstbild in der Lage, gleichzeitig zwei gegensätzliche Rollen einzunehmen: als autonomieausgerichteter Akteur, der sich bewusst auf Sicherheit und militärische Überlegenheit konzentriert, und als wertebasierter Akteur, der sich in der globalen Staatengemeinschaft engagiert (ebd.). Eine diskursanalytische Untersuchung beschränkt sich jedoch nicht nur auf bereits bekannte Identitätselemente, sondern kann auch, wie im Fall von Brunner (2013), verborgene Aspekte aufdecken. Durch eine gründliche Diskursanalyse der amerikanischen Doktrin und Praxis des militärischen Wahrnehmungsmanagements arbeitete sie heraus, dass die identitären Elemente durch die Ideologien des Neoliberalismus und Maskulinismus geprägt waren (vgl. ebd.: 173).
Ein weiterer beliebter Forschungsgegenstand sind Studien über einschneidende Ereignisse wie Krisen, Konflikte oder Kriege. Hierbei zeigt Weldes (1999) in ihrer Diskursanalyse, wie der US-Außenpolitikdiskurs die Kubakrise als ein für die USA bedrohliches Ereignis konstruierte und sich dafür auf maskulinistische Identitätsmerkmale wie das Bild von den USA als Anführer des Westens und der freien Welt stützte. Neben Krisen können aber auch Siege, etwa der US-amerikanische im Kalten Krieg, von Bedeutung sein und zur Entstehung neuer identitätsdefinierender Narrative führen (Johnson 2008). Am häufigsten ziehen Forscher jedoch Kriege als Forschungsgegenstand heran. Als eines der wichtigsten Werke ist Hansens (2006) Security as Practice zu nennen, in dem sie auf Campbells (1998) Writing Security aufbaut, sein Identitätskonzept revidiert und eine umfassende Diskursanalyse zum Thema Bosnienkrieg durchführt. Anhand von amerikanischen und britischen Diskursen zeichnet sie an diesem Beispiel nach, wie sich Identitätskonstruktionen verändern und wie sie politische Handlungsoptionen rechtfertigen. In den 2000ern stieß das Thema Krieg gegen den Terror auf großes Forschungsinteresse. Sozialkonstruktivistische Arbeiten wie die von Schonberg (2009) gingen dabei der Frage nach, worin die Ursachen für die amerikanische Politik nach dem 11. September lagen. Er vertritt die These, dass sozial konstruierte Vorstellungen von Identität sowie Freunden und Feinden für die Bush-Regierung eine entscheidende Rolle spielten, in den Krieg gegen den Irak einzutreten (ebd). Mehrere Campbell-orientierte Studien wie die von Nabers (2009) befassten sich hingegen vor allem mit der Legitimitätsgrundlage der Politik Bushs. Nabers zentrales Ergebnis besagt, dass die Regierung bewusst diskursive Lücken ausnutzte, um neue Identitätsmerkmale zu konstruieren, die eine Politik gegen ihre Feinde rechtfertigte. Steele (2008) beschäftigte sich nicht mit der Regierungsebene, sondern mit der Frage, wie Inhaftierte im Zuge der Anti-Terror-Politik behandelt wurden und wie diese Behandlung mit der amerikanischen Identität und dem Konzept der Ehre verbunden war. Er kommt zu dem Schluss, dass die Kombination aus nationaler Identität und Wahrung der Ehre Disziplinierungsmechanismen rechtfertigte, die den Einsatz von Folter begünstigten (ebd).
Andere Campbell-orientierte Studien rückten vom Thema Krieg ab, um sich stärker auf die gegenseitigen identitätsbezogenen Wahrnehmungsmuster von Staaten zu konzentrieren. Als einer der ersten zeigte Zevelev (2002) anhand der USA und Russland auf, dass beide Staaten nach dem Kalten Krieg unterschiedliche Selbstwahrnehmungen und Visionen mitbrachten und vom jeweils anderen Staat erwarteten, dass er sich nach Regeln verhält, die in den eigenen nationalen Diskursen als universell galten. Duncombe (2016) schlussfolgert unter Bezug auf die iranischamerikanischen Beziehungen im Rahmen der Verhandlungen über iranische Urananreicherungsaktivitäten, dass feindselig konstruierte Identitäten des jeweils anderen Staates zu einem Gefühl der Missachtung beitragen und Spannungen verschärfen (vgl. ebd.: 622-624).
Das Campbell‘sche Lager hat auch untersucht, wie sich Identität und Politik aus einer historischen Perspektive über einen längeren Zeitraum hinweg verändert haben. So widmete sich Turner (2014) der Frage, wie amerikanische China-Bilder (American Images of China) seit der Gründung Amerikas5 bis zur Präsidentschaft Obamas Identitäten über den Staat und seine Bürger konstruierten. Seine Bildanalysen veranschaulichen, dass ältere Bilder das Verständnis für die Bedeutung gegenwärtig kursierender Bilder ermöglichen, und dass sie untrennbar mit der Gestaltung und Legitimation der US-China-Politik verbunden sind (ebd.). Eine ähnliche (Re- )Konstruktion führte zur Erkenntnis, dass sich die US-Identität in Differenz zu den europäischen Imperien und den amerikanischen Ureinwohnern konstruierte, woraus zwei außenpolitische Traditionen hervorgingen: der liberale Internationalismus (Jefferson‘sche Tradition) und der Isolationismus (Jackson‘sche Tradition) (Taesuh 2015). Diese beiden Traditionen sind auch Gegenstand in Pedersens (2008) historischer Diskursanalyse, in der er sie miteinander vergleicht. Er beobachtet, dass sich die internationalistische Tradition in der Konstruktion einer amerikanischen Identität als dominanter durchsetzen konnte, weshalb er für die Zukunft das Verschwinden der isolationistischen Wir-gegen-die-Anderen-Weltanschauung prognostiziert.6
Ein letztes Forschungsfeld umfasst Analysen amerikanischer Eliten und ihrer Diskurse. Die argumentative Forschung7 widmet sich hier insbesondere der Religion und ihren Akteuren, wie etwa der Beziehung zwischen evangelikalen Fundamentalisten und der US-Außenpolitik. Auf Basis ihrer religiösen Überzeugungen hat diese Gruppe es geschafft, die US-Identität religiös auszurichten (Stewart 2008) und von Gründungsmythen geprägte religiöse Identitätsmerkmale zur Legitimationsgrundlage in Barack Obamas Agenda zu erheben (Marsden 2011). Eine weitere elitäre Gruppe, die sowohl argumentativ (Parmar 2008) als auch diskursanalytisch (Pan/Turner 2017) erforscht wurde, sind sogenannte Neokonservative. Parmar (2008) prüft, ob der Einfluss von Neokonservativen für eine imperial-expansionistische US-Politik seit dem 11. September 2001 verantwortlich ist. Sein Hauptargument lautet, dass die Neuausrichtung der US-Politik weniger auf die Macht der Neokonservativen, sondern vielmehr auf Veränderungen in der Identitätskonstruktion und den Einstellungen des gesamten politischen Establishments zurückzuführen sei (vgl. Parmar 2008: 49). Eine neuere Studie, die sich mit den ideengeschichtlichen Mustern der Neokonservativen auseinandersetzt, stellt fest, dass die Idee des Neokonservativismus aus der Verschmelzung zweier mächtiger und historisch andauernder Diskurse über amerikanische Tugenden und Macht entstanden ist (vgl. Pan/Turner 2017).
In jüngster Zeit hat Donald Trumps Präsidentschaft an Aufmerksamkeit gewonnen, wobei seine Außenpolitik entweder im Zusammenhang mit einem neu aufkommenden Nationalismus (Restad 2020) oder in Kombination mit seiner Rhetorik und seinem Diskurs untersucht wurde (Fermor/Holland 2020; 2021). Trumps America-First-Agenda wandte sich radikal von der vorherrschenden amerikanischen Identitäts-Außenpolitik-Konstellation ab, die seit der Ära nach dem Kalten Krieg bestand. Es dominierte nicht mehr ein bürgerlicher Nationalismus, der die liberale Weltordnung förderte, sondern ein Ethnonationalismus, der die Rivalität mit China hervorhob und liberale Ideale ablehnte (vgl. Restad 2020: 1 f.). Auf der Rhetorik- und Diskursebene stellen Fermor und Holland (2020) außerdem einen intensiven diskursiven Kampf zwischen dem republikanischen Trump-Lager und dem oppositionellen demokratischen Lager fest, in dem beide Lager versucht haben, das jeweils andere als eine Bedrohung für die nationale Identität darzustellen. Aus Sicht des Trump-Lagers ginge die Bedrohung von Einwanderern und Regierungskritikern aus, die das „weiße Amerika“ gefährdeten (Fermor/Holland 2020: 55 f.). Die Demokraten sähen hingegen in Trumps Rassismus und Diskriminierung die eigentliche Bedrohung, weil sie das multikulturelle und wertebasierte Amerika aufzulösen drohten (ebd.). In einer weiteren Studie charakterisieren dieselben Autoren Trumps Regierungsstil als Jackson‘schen Populismus, der rhetorisch auf Emotionalität und Übertreibungen setzte und inhaltlich die „weiße (männliche) Arbeiterklasse“ in den Mittelpunkt der nationalen Identität rücke (Holland/Fermor 2021: 64-66).
2.2 US-Auslandshilfe als Außen- und Sicherheitspolitik
In der Forschung zum Thema US-Auslandshilfe gibt es bislang nur eine kürzlich veröffentlichte Studie von Sandlin (2022), die sich mit der Interaktion zwischen Außen- und Sicherheitspolitik und identitätsbasierten Werten auseinandergesetzt hat. Darin nimmt Sandlin eine sozialkonstruktivistische Perspektive auf Identität ein und konzentriert sich auf Werte wie Demokratie, Menschenrechte und Unternehmertum, die er als identitäre Bestandteile Amerikas konzeptua- lisiert. Seine Studie kommt zu dem Schluss, dass materielle Interessen des Staates statistisch gesehenen einen deutlich größeren Einfluss auf die Vergabe von Militärhilfen an Drittstaaten haben als Werte (vgl. ebd.: 1-4).
Andere Studien, die sich mit amerikanischen Auslandshilfe befassen, beleuchten hingegen nicht die identitätsbezogene Seite, sondern entweder die Ursachen oder die Auswirkungen der Hilfsvergabe auf die jeweiligen Empfängerstaaten. Mit Ausnahme der jüngsten Studien von Regilme (2018; 2023), der einen diskursanalytischen Ansatz verfolgt, wählen sie zudem alle die Statistik als Methode. Regilme selbst konnte in seiner 2018 veröffentlichten Studie verdeutlichen, dass George W. Bushs Diskurs über den Terror in Kombination mit US-Hilfszahlungen einen militaristischen Antiterror-Diskurs in Thailand begünstigte. Dort diente der neu aufgetauchte Diskurs als staatliche Rechtfertigungsgrundlage für Repressionen gegenüber der eigenen Bevölkerung. 2023 konnte er dann veranschaulichen, wie die USA durch Donald Trumps ausgrenzende und globalisierungsfeindliche Diskurse an Glaubwürdigkeit und Legitimität als Geber von Auslandshilfe im Vergleich zu China einbüßten (vgl. Regilme 2023: 45-47). Insgesamt sind somit diskursanalytische Studien im Vergleich zu den vielen statistischen Auswertungen, die an dieser Stelle nicht genauerer aufgelistet werden sollen, in der Unterzahl.
Was die Ursachen anbelangt, so gibt es eine große Bandbreite statistischer Studien, die entweder ideellen Faktoren wie Demokratie und Menschenrechten (Blanton 2000; 2005) oder materiell-strategischen Faktoren (Ali 2009; Kiyani 2022) eine größere Erklärungskraft für die Vergabe von Auslandshilfen zuschreiben. Ideelle und materiell-strategische Faktoren müssen jedoch nicht unbedingt in Konkurrenz zueinander stehen, sondern können sich auch ergänzen. Aus früheren Arbeiten geht beispielweise hervor, dass strategische Eigeninteressen oft mit einer moralischen Verpflichtung, bedürftigen Staaten helfen zu wollen, harmonieren (Capie 2015; Kevlihan et al. 2014). Die Ursachen für Auslandshilfen wurden jedoch nicht nur isoliert, sondern auch unter Berücksichtigung der Sitzverteilung im Kongress erforscht. Hierbei stellten Askarov et al. (2022) fest, dass ein höherer Anteil von Demokraten im Repräsentantenhaus zu einer verstärkten Gewährung demokratiefördernder Hilfen führt, um die Demokratiebilanz des Empfängerstaates aufzubessern. Basierend auf einer ähnlichen Untersuchung konstatierten Fleck und Kilby (2006) außerdem, dass bei liberalen Regierungen die Entwicklungshilfe stark durch entwicklungspolitische Ziele motiviert ist, während bei konservativen Regierungen wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen.
Viele andere Studien legen ihren Schwerpunkt hingegen auf das Verständnis der Auswirkungen der Auslandshilfe auf das Empfängerland. Positive Auswirkungen lassen sich überraschenderweise nur selten beobachten und treten eher dann auf, wenn eine Demokratie die Hilfen erhält (Tokdemir 2017). Handelt es sich beim Empfänger hingegen um eine Autokratie, so begünstigen die Hilfen sogar antiamerikanische Einstellungen im jeweiligen Land (ebd.). Negative Auswirkungen treten vor allem im Fall von militärischer Unterstützung auf. Allerdings hat diese, in Form der Ausbildung ausländischer Streitkräfte, auch das Potenzial, die Affinität zu den USA zu fördern und somit letztendlich zu pro-amerikanischem Stimmverhalten in der Generalversammlung der UNO zu führen (Martinez 2021). Eine Studie von Sullivan et al. (2011) konnte dagegen nachweisen, dass Militärhilfen in Form von Rüstungsgütern das kooperative Verhalten gegenüber den USA reduzieren. Dimant et al. (2020) wiederum kommen zum Ergebnis, dass starke Rüstungsaktivitäten zum Anstieg der Wahrscheinlichkeit eines antiamerikanischen Terrorismus vor Ort führen. Im Fall Kolumbiens zeigte sich, dass in Wahlkreisen nahe von Militärstützpunkten ein Anstieg politisch motivierter Gewalt durch paramilitärische Gruppierungen zu verzeichnen war, wenn in Wahljahren Rüstungsgüter dorthin geliefert wurden (Dube/Naidu 2015).
2.3 Die Relevanz der Verbindung von Identität und Auslandshilfe
Aktuell bleibt die Forschung zur amerikanischen Identität und Auslandshilfe in der Untersuchung der Amtszeit Trumps stehen (Fermor/Holland 2020; 2021; Regilme 2023; Restad 2020), während die Biden-Administration bislang unerforscht ist. Angesichts des russischen Angriffskriegs ist aber eine neue intensive Debatte darüber entflammt, ob Amerika eher eine internationalistische oder isolationistische Haltung einnehmen sollte (vgl. Sirakov 2023). Hinzu kommt, dass das Zusammenspiel zwischen Identität, Auslandshilfe und Politik bisher nur einmal untersucht wurde (Sandlin 2022), jedoch noch nicht aus einer diskursanalytischen Perspektive. Im Licht der aktuellen Ereignisse bietet es sich somit an, die Forschung zur Amtszeit Bidens weiterzuführen, zumal sich heute die Frage stellt, welche Identitäten vor dem Hintergrund der (Nicht-)Unterstützung der Ukraine in den wichtigsten Diskursen (re-)konstruiert werden. Zur US-Unterstützung der Ukraine gibt es inzwischen zwar zahlreiche Policy Briefs, Berichte verschiedener Denkfabriken und tabellarische Überblicke über geleistete Hilfen, nicht aber wissenschaftliche Analysen, die genauer auf die Unterstützung eingehen. Insofern geht es in der vorliegenden Masterarbeit darum, die hier bestehenden Forschungslücken zur US-Außen- und Sicherheitspolitik im Zusammenspiel mit Identität und Auslandshilfen zu füllen.
3 Theoretischer Hintergrund
3.1 Diskurstheorie nach Laclau/Mouffe
Die Entstehung moderner Diskurstheorien geht auf den interdisziplinären Versuch zurück, Erkenntnisse aus der Linguistik und der Hermeneutik mit zentralen Ideen der Sozial- und Politikwissenschaft zu verbinden. Seitdem entwickelten sich viele Arten von Diskurstheorien, die sich sowohl im Verständnis von Diskursen als auch in der Verflechtung von Sprache und politischen Machtkämpfen unterscheiden (vgl. Torfing 2005: 5). Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie ontologisch die Vorstellung ablehnen, es existiere eine übergreifende Essenz wie Natur oder Vernunft, welche die soziale Realität bestimmt. Vielmehr ist die soziale Realität für sie eine durch Diskurse erzeugte und stabilisierte soziale Konstruktion. Ähnlich dazu nehmen sie epistemologisch an, dass die Wahrheit diskursiv bedingt ist und sich nicht durch wissenschaftliche Methoden entdecken oder fixieren lässt (vgl. Herschinger/Renner 2017: 323). In dieses Gefüge ist die heute weithin anerkannte Theorie von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe (2001) einzuordnen, die sich dadurch von anderen hervorhebt, dass die beiden Theoretiker sowohl auf den Diskurstheorien früherer Generation aufbauen als auch diejenigen der aktuellen (dritten Generation) zu einer kohärenten und synthetisierten poststrukturalistischen Theorie zusammenführen (vgl. Torfing 2005: 8 f.). Im Kern besagt sie, dass das gesamte soziale Feld als ein Netz von Prozessen verstanden werden kann, in denen Bedeutung entsteht (vgl. J0rgensen/Phillips 2002: 25). Ihr theoretisches Gerüst bietet somit wichtige Eckpfeiler dafür, Diskurse verstehen, identifizieren und analysieren zu können, weshalb im Folgenden die Kernbegriffe ihrer Theorie zusammen mit anderen diskurstheoretischen Kernthemen erklärt werden.
3.1.1 Grundbegriffe: Bedeutung und Diskurs
Zunächst stellt sich die Frage, wie Bedeutung im sozialen Feld überhaupt entsteht. Zur Erklärung greifen J0rgensen und Phillips (2002) auf eine Metapher zurück: In einem Fischernetz fungieren sprachliche Zeichen als Knoten mit eigenen Positionen. Dabei leiten die Zeichen ihre Bedeutung nicht aus sich heraus, sondern durch ihre Differenz zueinander ab (vgl. ebd.). Bedeutung konstruiert sich jedoch nicht nur in Form von Differenz, sondern auch durch Äquivalenz. Die Zeichen generieren ihre Bedeutung, indem sie sich mit anderen Zeichen zu Äquivalenzketten verknüpfen (vgl. Laclau/Mouffe 2001: 127-134). Ein sozial konstruierter Raum wie „der Westen“ kann beispielswiese geografische Teile der Welt mit Elementen wie Zivilisation, christliche Kirche und liberal-demokratische Institutionen verbinden (Logik der Äquivalenz). Umgekehrt etabliert „der Westen“ seine Bedeutung auch darüber, was er nicht ist, und kann beispielsweise den Rest der Welt als unzivilisiert abgrenzen (Logik der Differenz) (vgl. J0rgen- sen/Phillips 2002: 50).
Wichtig ist, nicht nur die Entstehung von Bedeutung nachzuvollziehen, sondern auch zu verstehen, in welchem Zusammenhang sie mit dem Begriff des Diskurses steht. Ein Diskurs kann nämlich als „Fixierung von Bedeutung“ in einem bestimmten Bereich verstanden werden, in dem sich jedes Zeichen durch seine Beziehung zu anderen Zeichen zum sogenannten Moment fixiert (vgl. ebd. 26 f.). Genauer gesagt, versuchen Diskurse verschiedene sprachliche Zeichen mit mehreren möglichen Bedeutungen (polysemantische Zeichen) in Momente umzuwandeln, um ihre Polysemie auf eine festgelegte Bedeutung zu reduzieren. Alle anderen möglichen Bedeutungen, welche die Zeichen hätten haben können bzw. wie sie zueinander in Beziehung stehen könnten, versucht der Diskurs hingegen auszuschließen (vgl. ebd. 27 f.). Wie der Begriff Moment schon sagt, ist die Fixierung von Bedeutung durch Zeichen nicht dauerhaft, sondern temporär, weil jede konkrete Fixierung kontingent ist, das heißt, sie ist zwar möglich, aber nicht notwendig (vgl. ebd. 37 f.). Hinzukommend gibt es bestimmte Elemente, die eine Bedeutungsfixierung besonders erschweren, weil sie für unterschiedliche Zuschreibungen weit offen sind.8 Sie führen dazu, dass konkurrierende Diskurse fortwährend darum kämpfen, sie mit ihrer eigenen Bedeutung zu versehen (vgl. ebd. 28).
Um ein Beispiel von J0rgensen und Phillips aufzugreifen, kann der menschliche Körper als ein solches Element verstanden werden. Auf der einen Seite versucht der vorherrschende Diskurs der westlichen Medizin, den Körper auf einen Moment zu reduzieren, indem er ihn auf eine eindeutige und spezifische Weise definiert. Auf der anderen Seite zielen der Diskurs der Alternativmedizin oder der des Christentums ebenfalls darauf ab, den Körper auf einen Moment zu reduzieren, allerdings auf eine andere Art und Weise. Die Alternativmedizin betrachtet den Körper als ein ganzheitliches Gebilde, das auf verschiedenen Wegen durch Energien durchdrungen ist, während das Christentum ihn mit einer Seele in Verbindung bringt (vgl. ebd.: 28 f.).
Ergänzend dazu sind einzelne Elemente wie ein Körper nicht nur polysemantisch, sondern gleichzeitig auch diskursive Knotenpunkte („ nodal points “), um die herum Diskurse partiell fixiert sind (vgl. Laclau/Mouffe 2001: 112). Unter Knotenpunkten sind sowohl privilegierte als auch jeglicher Bedeutung entleerte Elemente zu verstehen, um die sich andere Elemente gruppieren. Sie alle erhalten ihre Bedeutung nur durch ihre Beziehung zum Knotenpunkt. So kann wiederum der Körper in medizinischen Diskursen als ein Knotenpunkt fungieren. Die um ihn herum organisierten Elemente wie Symptom, Gewebe und Skalpell entfalten ihre volle Bedeutung nur in Beziehung zum Körper. Im politischen Kontext wäre beispielsweise die Demokratie ein Knotenpunkt, um den herum sich verschiedenste Elemente des politischen Systems anordnen (vgl. ebd.: 26).
Die Prozesse der Bedeutungsfixierung laufen jedoch nicht von selbst, sondern durch die Praxis der Artikulation ab. Diese steuert die diskursive Struktur, indem sie verschiedene Elemente zum Ausdruck bringt und zueinander in Beziehung setzt, sodass sie ihre Identität verändern (vgl. Laclau/Mouffe 2001: 105). Bezogen auf das Beispiel des Körpers muss die Artikulation den Körper erst mit anderen Elementen in Beziehung setzen, um ihm Bedeutung zu verleihen; andernfalls sagt der Körper nicht viel über sich aus (vgl. J0rgensen/Phillips 2002: 28).
3.1.2 Die Rolle der Sprache und der Materialität
Nachdem skizziert wurde, wie Diskurse theoretisch zu verstehen sind und wie sie entstehen, bleibt die Frage offen, was ihr Fundament ist. Im Poststrukturalismus ist es die Sprache, da sie bei der Bedeutungsproduktion eine zentrale Rolle spielt (vgl. Baumann 2022: 3). Im weiteren Sinne sind darunter auch Zeichensysteme wie Bilder und Symbole gemeint, die Zugang zu Informationen ermöglichen (vgl. Belsey 2013: 9). Als ein System existiert die Sprache nicht nur durch das Wesen ihrer Sache selbst, sondern indem sich ihre Zeichen verknüpft und voneinander abgrenzt: „ [No] real element of the language has an absolute situation, only a differential one “ (Derrida 1997: 217). Insofern bedienen sich Diskurse selbst der Sprache, die darin als eine Gruppe von Aussagen in Form von Wissen vorliegt und es ermöglicht, über bestimmte Themen zu sprechen. Wenn innerhalb eines Diskurses Aussagen zu einem bestimmten Thema gemacht werden, ermöglicht es Sprache, dem Thema eine eigene Bedeutung zu verleihen und alternative Interpretationen auszulassen. Mit anderen Worten produzieren Diskurse Wissen durch Sprache, wobei sie selbst sprachlich erzeugt sind (vgl. Hall 2018: 155).
In diesem Sinne ist Sprache sowohl sozial als auch politisch. Jedes Individuum muss eine Reihe kollektiver Codes und Konventionen anwenden, um sich mit anderen zu verständigen. Zusammen mit nonverbalen Kommunikationsformen variieren diese aber je nach Kultur, was den kollektiven Charakter der Sprache verdeutlicht. Sprache ist insofern politisch, als sie der Ort ist, an dem Subjektivität und Identität sowohl (re-)produziert als auch ausgeschlossen werden (vgl. Hansen 2006: 18). Im Europa des 19. Jahrhunderts wurde zum Beispiel Frauen eine politische Identität zugeschrieben, die sich stark von derjenigen der Männer unterschied und sich im Diskurs immer wieder durch sprachliche Praktiken reproduzierte. Frauen galten als unfähig zum Verständnis komplexer politischer und finanzieller Fragen, was auf die objektive Darstellung der „Natur der Frau“ und nicht auf eine konstruierte Identität zurückgeführt wurde (vgl. ebd.: 18). Erst mit der Frauenbewegung wurde diese sprachliche Darstellung angefochten, die sich von einer „objektiven Darstellung“ zu einer von Männern politisch umkämpften Konstruktion wandelte (vgl. ebd.: 18 f.). Im weiteren Sinne erzeugt Sprache sogar Politik, etwa wenn sie soziale Gruppen mobilisiert; umgekehrt muss Politik Sprache enthalten, um überhaupt betrieben werden zu können (vgl. Chilton/Schaffner 1997: 206).
Der Poststrukturalismus geht sogar so weit, dass er die Sprache als Zugang zur Realität begreift (vgl. J0rgensen/Phillips 2002: 8). Für Hansen erhalten die Dinge - Objekte, Subjekte, Staaten, Lebewesen und materielle Strukturen - erst durch die Konstruktion in der Sprache ihre eigene Bedeutung und Identität (vgl. Hansen 2006: 18). Wird jedoch davon ausgegangen, dass es jenseits der sprachlich konstruierten Wirklichkeit keine objektive Bedeutung und Identität gibt, dann stellt sich die Frage, wie viel von der materiellen Welt noch außerhalb von Sprache und Diskurse bleiben kann. Diesbezüglich leugnet der Poststrukturalismus nicht, dass es eine materielle Welt gibt, sondern bejaht den „materiellen Charakter jeder diskursiven Struktur“ (vgl. Laclau/Mouffe 2001: 108). Er widerspricht lediglich der Annahme, dass sich die Materialität außerhalb diskursiver Entstehungsbedingungen konstituieren kann (vgl. ebd.). Oder um anders anzudrücken, er leugnet, dass wir uns auf eine materielle Welt außerhalb des Diskurses beziehen können (vgl. Holzscheiter 2013: 3). Ein Panzer ist zum Beispiel nicht nur eine materielle Ansammlung von Metall und Gummi, sondern je nach Perspektive ein Objekt der Kriegsführung oder auch der Friedenssicherung. Sein materieller Aspekt wird nicht ignoriert, sondern zum Untersuchungsgegenstand dafür erhoben, welche Bedeutung diesem Objekt im Diskurs zugeschrieben wird (vgl. Hansen 2006: 22).
3.1.3 Hegemoniale Kämpfe und sozialer Antagonismus
Der Diskurs umfasst nicht nur eine abstrakte Ebene mit Sprache und Bedeutung, sondern erstreckt sich auch auf die gesellschaftliche Ebene, auf der er als Produkt hegemonialer Kämpfe verstanden werden kann (vgl. Torfing 2005: 15). Dieser Aspekt ist insofern bedeutsam, weil er den praktischeren Teil des diskursiven Kampfes um die Bedeutungsfixierung verdeutlicht. Nach Antonio Gramsci ist der Kampf um Hegemonie im Grunde ein Machtkampf um eine „politische und moralisch-intellektuelle Führung“ (ebd.: 11). Er wird durch eine Art artikulatori- sche Praxis ausgetragen, die besagt, dass bestimmte Artikulationen einen hegemonialen Status in der Gesellschaft erreichen können, sollte es ihnen gelingen, eine glaubwürdige Deutungshoheit über vergangene, gegenwärtige und zukünftige Ereignisse zu gewinnen, mit anderen Worten, die „Herzen und Gedanken der Menschen“ zu erobern (ebd.: 15). Aus einer politischen Akteursperspektive bedeutet dies, dass der Diskurs das Ergebnis einer endlosen Abfolge politischer Entscheidungen ist, die aus einer Unzahl strategischer Handlungen resultiert, um Hegemonie zu erreichen (vgl. ebd.).
Das Konzept des Hegemoniekampfes ist darüber hinaus eng mit der Vorstellung eines sozialen Antagonismus verbunden, der für die Stabilität des Diskurses sorgt. Um Stabilität zu erreichen, konstruieren Diskurse ein Other, mit dem sie keine Gemeinsamkeiten teilen und dessen Elemente als bedrohlich für das eigene diskursive System gelten (vgl. ebd.). Solche Antagonismen sind besonders dann aufzufinden, wenn Diskurse kämpferisch aufeinanderprallen (vgl. J0rgensen/Phillips 2002: 48). Innerhalb der außenpolitischen Domäne sind es der offizielle und oppositionelle Diskurs, die in bestimmten außenpolitischen Fragen aufeinanderprallen können. Tatsächlich müssen sie sich jedoch nicht zwangsläufig bekämpfen, da der oppositionelle Diskurs die politischen Repräsentationen des offiziellen Diskurses auch teilen oder sogar verstärken kann. In einem solchen Fall hat der offizielle Diskurs einen hegemonialen Status9 erreicht, weil er nicht angefochten wird (vgl. Hansen 2006: 7 f.).
3.2 Identität und außenpolitischer Diskurs
Nachdem die Grundbausteine der zeitgenössischen Diskurstheorie beleuchtet wurden, kann nun der Schwerpunkt der poststrukturalistischen Forschungsagenda wiedergegeben werden: die Beziehung zwischen Identität und Außenpolitik im Diskurs.
3.2.1 Das Konzept der Identität nach Hansen
Im Rahmen ihrer poststrukturalistischen Außen- und Sicherheitspolitikforschung konzeptuali- siert Hansen (vgl. 2006: 6) Identität als ein Konzept mit vier Eigenschaften: politisch, diskursiv, sozial und relational. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass ihr Konzept zwar weit verbreitet ist, jedoch nicht als repräsentativ für die poststrukturalistische Forschung insgesamt angesehen werden sollte. Es ist selbst Teil eines wissenschaftlichen Diskurses und seine Axiome sind somit anfechtbar.
Politisch bedeutet, dass Repräsentationen von Identität außenpolitische Angelegenheiten innerhalb einer bestimmten interpretativen Optik verorten, die wiederum Einfluss auf die Politikformulierung ausübt (vgl. ebd.). Diskursiv bedeutet, dass es keine objektiven Identitäten gibt, die in einem extra-diskursiven Bereich angesiedelt sind (vgl. ebd.). In diesem Punkt grenzt sich Hansen sowohl vom Rationalismus ab, der Identität als eine unabhängige, auf die Außenpolitik einwirkende nicht-diskursive Variable sieht, als auch von Alexander Wendts (1999) sozialkonstruktivistischem Konzept, demzufolge Identitäten präsozial, intrinsisch und staatlich sind (vgl. ebd.: 17). Sie argumentiert, es sei unmöglich, die Beziehung zwischen Identität und Außenpolitik im Sinne von kausalen Effekten zu konzeptualisieren, sodass sich infolgedessen keine Hypothesen über die (relative) Erklärungskraft des Diskurses formulieren ließen (vgl. ebd.: 17 f.) Ihr Argument wurzelt in der Auffassung, dass Identitäten und Politik im diskursiven Sinne ontologisch untrennbar sind. Identitäten werden sowohl durch den außenpolitischen Diskurs (re-)produziert als auch als Legitimationsgrund für die Politik verwendet und können nicht unabhängig von der Politik bestehen (vgl. ebd.: 26 f.). Der soziale Teil bedeutet, dass Identität weder Privateigentum noch Geisteszustand ist, sondern durch eine Reihe kollektiv konstruierter Regeln, die innerhalb und durch das kollektive Umfeld entstehen, geformt wird (vgl. ebd.: 6). Die relationale Komponente besagt, dass in Diskursen eine antagonistische Beziehung zwischen einem Self und einem Other besteht (vgl. Fierke 2015: 81 f.). Identitäten sind daher immer durch die Bezugnahme auf etwas gegeben, was sie nicht sind. Anders gesagt, wenn im außenpolitischen Kontext von Amerikanern oder Europäern die Rede ist, dann bedeutet dies im Umkehrschluss, dass andere Identitäten als nicht-amerikanisch oder nicht-europäisch bezeichnet werden können. Theoretisch können Identitätskonstruktionen jedoch verschiedene Grade von Other annehmen, die von einer geringen Differenz (z. B. Verbundenheit) zwischen Self und Other bis hin zu einer bedrohlichen und radikalen Differenz (z. B. Feindseligkeit) reichen (vgl. Hansen 2006: 6). Damit revidiert Hansen Campbells (1998) Identitätskonzept, wonach sich Identitäten nur durch die Gegenüberstellung mit einem Radical Other konstruieren (vgl. Hansen 2006: 6). Eine solche Vorab-Festlegung würde ansonsten zu einer unnötigen theoretischen und empirischen Einschränkung führen, die nur eine statische Sichtweise des außenpolitischen Diskurses erlaube. Stattdessen sei es sinnvoller, von einer ontologisch flexiblen Identität auszugehen, die in der Lage ist, unterschiedliche Erscheinungsformen anzunehmen (vgl. ebd.: 41). Eine solche Self / Other -Beziehung kann aus anderen Perspektiven wie der des Rationalismus heraus angezweifelt werden, da ein Self theoretisch auch ohne ein Other bestehen könnte (vgl. ebd. 27 f.). Allerdings ist es schwierig, die Nichtexistenz eines Other nachzuweisen, insbesondere wenn man bedenkt, dass seine Anwesenheit möglicherweise erst später im Diskurs offensichtlich wird, sollte sie nicht schon von Anfang an vorhanden gewesen sein.
Neben ihrer Abgrenzung von Campbell erweitert Hansen ihr eigenes Identitätskonzept um drei Dimension, wonach eine Identität räumliche, zeitliche und ethische Elemente umfasst (vgl. ebd.: 46-50). Alle drei haben den gleichen theoretischen und ontologischen Stellenwert, auch wenn in der Praxis bestimmte Quellen dazu neigen, sich stärker auf eine bestimmte Dimension zu konzentrieren. In der Regel zielt der Diskurs darauf ab, sich zu stabilisieren, indem er eine kohärente Verbindung zwischen allen drei Dimensionen anstrebt und sie auf eine Art und Weise artikuliert, dass sie sich gegenseitig stützen und verstärken. In einigen Fällen bringt der Diskurs jedoch unerwünschte Dimensionen zum Schweigen, etwa wenn es darum geht, die Option einer moralischen Verantwortung (ethische Dimension) gegenüber einem Drittstaat abzuwenden (vgl. Hansen 2006: 46 f.).
Um tiefer in spezifische Aspekte einzutauchen, sollen die drei Dimensionen nun einzeln erläutert werden. Räumlichkeit betont den relationalen Charakter von Identitäten und dass sie eine Konstruktion von Grenzen bzw. die Abgrenzung von Raum beinhalten. Eine Abgrenzung kann dabei sowohl auf eine konkrete als auch auf eine abstrakte Weise konstruiert sein. Konkret ist die Abgrenzung, wenn sich ein Nationalstaat (z. B. die USA) territorial von anderen Staaten (z. B. Russland und China) oder Regionen (z. B. Afrika und Naher Osten) abgrenzt. Abstrakt ist die Abgrenzung, wenn sie von politischen Subjekten erfolgt, die nicht an ein konkretes Territorium gebunden sind, wie im Fall von Terroristen (vgl. ebd.: 47). Durch Elemente wie die internationale Gemeinschaft oder universelle Menschenrechte kann eine Abgrenzung für Diskurse zwar erschwert werden, sie bleibt aber dennoch möglich. Der Akt des Othering wird spätestens dann deutlich, wenn einem politischen Subjekt ein Verstoß gegen das, was gemeinhin als universelle Rechte bezeichnet wird, nachgewiesen oder vorgeworfen wird (vgl. ebd.: 47 f.).
Mit der zeitlichen Dimension sind häufig Themen wie Entwicklung, Transformation, Kontinuität, Wandel, Wiederholung oder Stillstand verknüpft. Die Temporalität des Other kann im Verhältnis zu der des Self ähnlich oder unähnlich sowie positiv oder negativ konstruiert sein. Eine negative Perspektive würde das Other beispielsweise als rückständig, wild oder primitiv wahrnehmen, während eine positive Perspektive es als fortgeschrittener und moderner ansieht (vgl. ebd.: 48).
Die ethische Dimension ist im Vergleich zu den beiden anderen komplexer, da sie Elemente von Moral und Verantwortung umfasst. Der Begriff der Verantwortung ist hierbei von besonderer Bedeutung, da er in außen- und sicherheitspolitischen Diskursen häufig zum Ausdruck kommt. In der Logik der Self / Other -Konstruktion geht es dabei um das Verantwortungsbewusstsein des Self angesichts der Verantwortungslosigkeit des Other im Zusammenhang mit ethisch und moralisch aufgeladenen Themen wie Völkermord oder der Frage nach einer humanitären Intervention (vgl. ebd.: 50). Die Artikulation eines Verantwortungsbewusstseins kann jedoch je nach Diskurs verschiedene Formen annehmen. Wenn über nationale Sicherheit gesprochen wird, kann der Fokus ausschließlich auf dem nationalen Interesse liegen, wobei jegliche Rücksichtnahme auf internationale Ethik und die Bedeutung internationaler Verantwortung außer Acht gelassen wird. In Diskursen, in denen die Bedeutung der Prävention von Völkermorden und Menschenrechtsverletzungen überwiegt, unternimmt der Diskurs hingegen einen „mächtigen diskursiven Schritt“, um die Verantwortung weg vom strategischen und egoistisch-nationalen Interesse hin zum „moralisch Guten“ zu verschieben (vgl. ebd.).
3.2.2 Subjekt und Subjektpositionen
Im Rahmen der Diskursanalyse stellt sich die Frage, wie genau sich die Schlüsselakteure der internationalen Politik identifizieren lassen, die über eine Identität verfügen, und wie eine angemessene Konzeptualisierung ihrer Rollen aussieht. Wie bereits im vorherigen Kapitel angerissen, bestimmt sich das Self immer im Verhältnis zum Other, wobei beide Entitäten zum Beispiel Staaten oder auch beliebige andere Subjekte sein können (vgl. Baumann 2022: 7). Epstein (2011) weist darauf hin, dass Staaten nicht die einzigen Akteure in der Weltpolitik sind, da auch Nichtregierungsorganisationen und multinationale Konzerne häufig den außenpolitischen Diskurs lenken. Das entscheidende Kriterium, um zentrale Akteure ausfindig zu machen, ist daher die Frage „Wer spricht?“.10 Sie ermöglicht es, staatliche und nicht-staatliche Ebenen zu durchsuchen, um zu ermitteln, wer die relevanten Akteure (Sprecher und Handelnde) sind (vgl. Epstein 2011: 341 f.).
Bei der Frage nach der Identität dieser Akteure lohnt es sich erneut, einen Blick auf die Diskurstheorie von Laclau und Mouffe (2001) zu werfen, die das klassische westliche Verständnis des Individuums als autonomes Subjekt mit einer Identität als individuellem (inneren) Kern ablehnen.11 Stattdessen charakterisieren sie das Subjekt (ein Akteur mit Identität) durch drei ihm zugewiesene Eigenschaften: Interpellation, Fragmentation und Überdeterminierung (vgl. J0rgensen/Phillips 2002: 40-43). Deflatorisch ist ein Subjekt interpelliert, wenn es durch Sprache in eine bestimmte Diskursposition versetzt wird. Wenn ein Kind zum Beispiel das Wort „Mama“ ausspricht und die Erwachsene in ihrer Rolle darauf reagiert, so ist sie mit der Identität einer „Mutter“ interpelliert worden. Mit dieser Identität gehen dann bestimmte Erwartungen und entsprechende Verhaltensweisen einher (vgl. ebd.: 40 f.). Die Identität der Person ist in diesem Fall jedoch nicht vollständig, sondern nur auf eine ihr zugeschriebene Subjektposition beschränkt, nämlich die einer Mutter (vgl. Laclau/Mouffe 2001: 115). Sollte sie noch weitere Subjektpositionen aus anderen Diskursen erhalten haben, ist ihre Identität fragmentiert. Im Kontext einer Wahl wäre sie eine Wählerin, bei einer Party eine Gästin und in der Familie eine Mutter. Es spielt außerdem keine Rolle, ob sie als Subjekt gleichzeitig oder schrittweise fragmentiert wird, das heißt, verschiedene Positionen parallel oder nacheinander einnimmt (vgl. J0rgensen/Phillips 2002: 41). Eine Überdeterminierung des Subjekts bedeutet, dass eine Person Positionen aus widersprüchlichen Diskursen vertritt, was am Beispiel einer politischen Wahl verdeutlicht werden kann. Dort steht sie vor der Frage, als was sie sich mehr identifiziert, beispielsweise als Feministin, Christin oder Arbeiterin. Jede einzelne Subjektposition kann der Wählerin zwar als attraktiv erscheinen, kollidiert aber mit den anderen. In Fällen, in denen es keinen Konflikt zwischen den Subjektpositionen gibt, ist dies auf das Ergebnis hegemonialer Prozesse zurückzuführen, welche die widersprüchlichen Subjektpositionen zuvor harmonisieren konnten (vgl. ebd.).
Der bereitgestellte theoretische Rahmen ermöglicht es, dieses Subjektverständnis auch auf die Ebene der Außen- und Sicherheitspolitik anzuwenden. Anlehnend an Hansens drei identi- täre Dimensionen würde ein Identitätselement (eine Subjektposition) dann vorliegen, wenn einem im Diskurs vorhandenen Subjekt entweder ein räumliches, ein zeitliches oder ein ethisches Charakteristikum zugeschrieben wird (vgl. Hansen 2006: 46-50). Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich beim Subjekt um ein Selbstbild (Self) oder ein Fremdbild (Other) handelt, da beide Entitäten in der Regel mit diskursiv vorhandenen Identitätselementen ausgestattet sind, wie das folgende Kapitel zeigen soll.
3.2.3 Identitätskonstruktion
Identität (re-)konstruiert sich, wie jede diskursive Struktur, durch Verknüpfung und Differenzierung (vgl. Hansen 2006: 19), zwei Prozesse, die theoretisch `auf der von Laclau und Mouffe (vgl. 2001: 127-134) beschriebenen Logik der Äquivalenz und Differenz basieren. Ob Bedeutung oder Identität, beides konstruiert sich durch eine Reihe von Zeichen12, die miteinander verknüpft und von einer anderen Reihe von Zeichen abgegrenzt werden. Im Hinblick auf die Self / Other -Dichotomie bedeutet das, dass Identitäten dann entstehen, wenn sowohl das Self als auch das Other innerhalb eines diskursiven Systems mit bestimmten Zeichen benannt werden. Der Diskurs versucht dabei, eine Art „Beziehung der Gleichheit“ zwischen den Zeichengruppen sowohl in der Äquivalenzkette (positive Identität) als auch in der Differenzkette (negative Identität) zu konstituieren (Hansen 2006: 42). Während sich die beiden Prozesse (Verknüpfung und Differenzierung) auf der analytischen Ebene trennen lassen, laufen sie auf der theoretischen Ebene gleichzeitig ab (vgl. ebd.: 19).
Hansen wählt Todorovas (1997) Werk Imagining the Balkans aus, um die diskursive Gegenüberstellung von Self und Other idealtypisch grafisch darzustellen. Das Beispiel A in Abbildung 1 veranschaulicht die Gegenüberstellung von Balkan und Europa. Beide Subjekte sind innerhalb eines diskursiven Systems durch eine Reihe von Identitätselementen (Subjektpositionen) versehen worden. Das positiv konnotierte Europa wird durch die Elemente zivilisiert, kontrolliert, entwickelt und rational charakterisiert, während der Balkan negativ konnotiert ist und durch die Elemente barbarisch, gewalttätig, unterentwickelt und irrational gekennzeichnet wird.
Abbildung 1: Idealtypische Darstellung verschiedener Identitätskonstruktionen
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Quelle: vgl. Hansen 2006: 42 f.
Hinzu kommt, dass konkurrierende Diskurse häufig dasselbe Element mit unterschiedlicher Wirkung konstruieren. So zeigt Todorova (1997) in ihrer Analyse der spanischen Eroberung Amerikas (Beispiel B), dass es unter den spanischen Konquistadoren zwei dominante Diskurse gab, die zwar beide die Indianer als Wilde konstruierten, dies aber mit unterschiedlichen 19
weiteren Konstrukten verbanden. Cortés konstruierte die Wildheit der Indianer durch die Behauptung, dass sie unmenschlich und veränderungsunfähig seien und daher außerhalb der christlichen Erlösung stünden. Dagegen vertrat Las Casas die Auffassung, dass Indianer als menschliche Heiden betrachtet werden sollten, welche die Fähigkeit zur Transformation und Erlösung besäßen. Dadurch unterschieden sich die beiden Diskurse in der zeitlichen Dimension der Identität voneinander und gingen zusätzlich mit der Rechtfertigung unterschiedlicher politischer Maßnahmen einher. Während Cortés‘ Diskurs die Gewalt gegenüber den Indianern rechtfertigte, legte Las Casas den Spaniern die Verantwortung zur Bekehrung der Indianer zum Christentum auf (Todorova 1997; vgl. Hansen 2006: 42).
In der Theorie ist die Identität zwar immer relational, doch in der Praxis kommt es nicht immer zu einer „sklavischen Gegenüberstellung“ („ slavish juxtaposition “) eines Self und eines Other, da Entscheidungsträger beispielsweise nicht immer explizit zu verstehen geben, dass sie ihre eigene Nation als „die gute“ im Vergleich zur abzugrenzenden „bösen“ Nation darstellen (Hansen 2006: 44). Aus analytischer Perspektive bieten Verknüpfungs- und Differenzierungsprozesse jedoch den Nutzen, strukturierte und systematische Analysen zu ermöglichen, wie Diskurse Stabilität konstruieren, wo sie instabil sind oder wie und ob sie sich verändern (vgl. ebd.: 44 f.). Analysen solcher Art bleiben mit der theoretischen Prämisse verbunden, dass Sprache und die darin enthaltene Identitätskonstruktionen zwar strukturiert, von Natur aus aber auch instabil sind („ poststructuralism is not only structure but post “) (ebd.: 20).
3.2.4 Legitimität außenpolitischer Entscheidungen
Im Folgenden soll der Legitimitätsbegriff konzeptualisiert werden, der wie jedes andere Wort eine eigene Geschichte mitbringt. Um es poststrukturalistisch zu formulieren, ist diese Geschichte ein „Kampfplatz konkurrierender Interpretationen und ihrer Verwendung“ (Mulligan 2006: 352). Einerseits kann der Begriff Legitimität flexibel mit Ausdrücken wie „breiter Zustimmung“, „gesetzeskonform“ oder einfach nur „gerechtfertigt“ assoziiert werden (ebd.: 367), andererseits lässt der Poststrukturalismus seine genaue Bedeutung offen.
Hansen weicht starren Definitionen aus, indem sie auf die Sprache als das Medium verweist, mit dem außenpolitische Akteure wiederkehrend versuchen, ihre Politik gegenüber ihren jeweiligen Zielgruppen als legitim, notwendig und realistisch erscheinen zu lassen. Im poststrukturalistischen Kontext spielt es außerdem eine untergeordnete Rolle, inwiefern die Sprache transparent und wahr ist. Akteure können zwar „das eine sagen und das andere tun“, sind aber unabhängig davon dazu verpflichtet, ihrem Publikum Gründe zu nennen, warum sie eine bestimmte Politik betreiben (Hansen 2016: 102). Hansen zeigt dies am Beispiel, dass Präsident Bush im Jahr 2003 die irakische Identität in zwei Entitäten aufspaltete, um seine militärische Intervention im Irak zu rechtfertigen: Auf der einen Seite in ein bedrohliches „böses Regime“ unter dem „Diktator“ und „Massenmörder“ Saddam Hussein, der über Massenvernichtungswaffen verfügt, und auf der anderen Seite in eine Nation mit einem „unterdrückten Volk“, das sich nach Freiheit und Unabhängigkeit sehnt (Hansen 2006: 28 f.). Die Entscheidung, militärisch zu intervenieren, rechtfertigte Bush wiederum als verantwortungsbewusst und moralisch, indem er sie sowohl auf den Schutz der eigenen nationalen Sicherheit als auch auf den der Welt und des irakischen Volkes ausrichtete (vgl. ebd.: 29).
Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt allerdings nicht auf der Begriffsgeschichte der Legitimität, sondern darauf, wie Politik in der Praxis gerechtfertigt wird. Insofern lehnt sich die Arbeit an eine allgemeine Arbeitsdefinition von Hurrell an, die sich nahtlos auf die Außen- und Sicherheitspolitik übertragen lässt: „ Legitimacy is about providing persuasive reasons as to why a course of action, a rule or a political order is right and appropriate. ” (Hurrell 2007: 90). Dadurch, dass sich in Hansens (2006: 21) Konzept auch Identitäten als Legitimationsgrundlagen verstehen lassen („ [i]dentities are thus articulated as the reason why policies should be enacted“) sind sie in Anbindung an Hurrell als (mögliche) überzeugende Legitimationsgründe („ persuasive reasons “) zu verstehen (vgl. Hurrell 2007: 90).
3.2.5 Diskursive Stabilität und intertextuelle Verbindungen
Neben Legitimität, spielt auch Stabilität für das Zusammenspiel von Identität und Außenpolitik eine wichtige Rolle. Wie bereits in Kapitel 3.1.1 beschrieben, streben Diskurse danach, eine geschlossene Struktur um sich herum zu fixieren (vgl. Laclau/Mouffe 2001: 111). Übertragen auf die Außenpolitik bedeutet dies, dass Diskurse eine stabile Beziehung zwischen Identität und Politik anstreben.
Hansen führt hierzu ein Modell ein, das sich als Salz-Wasser-Gleichgewichtssystem des menschlichen Körpers visualisieren lässt (vgl. Hansen 2006: 28-31). Wenn jemand zu viel Salz isst, speichert sein Körper mehr Wasser ein, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ähnlich verhält es sich mit dem außenpolitischen Diskurs, der eine Anpassung vornimmt, wenn die Verbindung zwischen Identität und Politik aus dem Gleichgewicht gerät. Die beiden Möglichkeiten, die ihm bei der Widerherstellung offenstehen, sind entweder die Änderung der Identität oder der Politik. Typischerweise erreicht der Diskurs jedoch nie eine absolute Stabilität, sodass weder die Identitätskonstruktionen noch die Verbindungen zwischen Identität und Politik jemals völlig stabil sein können (vgl. ebd.).
Selbst wenn absolute Stabilität ausbleibt, hängt eine dauerhafte Identitäts-Politik-Konstellation jedoch von drei wesentlichen Faktoren ab. Erstens ist die Verbindung umso stabiler, je konsistenter die Identitätskonstruktion erscheint, das heißt, wenn sie möglichst frei von internen Widersprüchen ist. Ein interner Widerspruch würde hingegen beispielsweise vorliegen, wenn der Diskurs keine Grenzen zwischen dem Balkan und Europa artikuliert, gleichzeitig aber die balkanische Identität als „gewalttätig“ und die europäische als „friedlich“ konstruiert (ebd.: 29). Das zweite Kriterium ergibt sich daraus, ob andere Diskurse die Identitätskonstruktionen infrage stellen oder akzeptieren. Im Fall einer Infragestellung kann der etablierte Diskurs als Reaktion seine Identitätskonstruktionen verändern, um dem Anpassungsdruck gerecht zu werden (vgl. ebd.: 29 f.). Sollte er hingegen akzeptiert werden, so ist er hegemonial geworden (vgl. Torfing 2005: 15). Drittens kommt es darauf an, inwiefern eine bestimmte Identitäts-PolitikKonstellation externen Zwängen ausgesetzt ist, da Entscheidungsträger häufig mit einer Reihe von Beschränkungen konfrontiert sind, wenn sie politische Maßnahmen auf Grundlage bestimmter Identitätskonstruktionen formulieren wollen. Bei solchen Beschränkungen kann es sich etwa um begrenzte militärische Fähigkeiten, institutionellen Druck, die Medien oder kollektive Traumata handeln.13 Solche Faktoren sind jedoch nicht objektiv oder materiell, sondern entweder in älteren bzw. konkurrierenden Diskursen verwurzelt oder das Ergebnis davon (vgl. ebd.: 30).
Das skizzierte Modell bietet zwar einen Einblick, unter welchen Bedingungen die Identitäts-Politik-Konstellationen (in-)stabil sind, sagt aber wenig darüber aus, wie Diskurse Stabilität erzeugen. Eine mögliche diskursive Strategie besteht darin, dass Diskursakteure Quellen zitieren oder darauf verweisen, um Identitäten oder politische Entscheidungen besser zu rechtfertigen. Diese Quellen können sowohl politische und wissenschaftliche Inhalte umfassen als auch solche, die unpolitisch und unwissenschaftlich sind (z. B. fiktiv) (vgl. Hansen 2006: 8). Das hier zugrunde liegende Verständnis von Texten geht auf Kristevas (1980) Grundthese zurück, dass alle Texte, nicht nur schriftliche Dokumente, sondern auch alle sprachlichen Äußerungen, explizit oder implizit auf frühere Aussagen Bezug nehmen und somit innerhalb eines breiten Netzes in und gegen andere Texte verortet sind (vgl. ebd.: 55). Oder wie sie es selbst formuliert: „ [A]ny text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the absorption and transformation of another “ (Kristeva 1980: 66). Diese Grundthese besagt jedoch nicht, dass neuere Texte von älteren abhängig sind, sondern vielmehr, dass beide Elemente als interagierend zu betrachten sind und sich gegenseitig beeinflussen. Auf der einen Seite etablieren Texte ihre eigene Bedeutung, indem sie sich auf ältere Texte beziehen, und auf der anderen Seite reproduzieren sie den Bedeutungsstatus der älteren. Die Bedeutung der jeweiligen Texte ist somit nie vollständig durch sich selbst gegeben, sondern immer ein Produkt anderer Bedeutungen, Lesarten und Interpretationen (vgl. Hansen 2006: 55-57). Was die Außenpolitik betrifft, so impliziert dieses intertextuelle Verständnis, dass Erklärungen, Reden und Interviews nicht als getrennte Einheiten breiterer gesellschaftlicher Diskurse aufgefasst werden sollten. Vielmehr handelt es sich dabei um intertextuelle Einheiten, die innerhalb eines größeren Textgeflechts existieren, das Texte verschiedener Genres umfasst (vgl. ebd.: 55).
Solche Verbindungen lassen sich entweder durch direkte Zitate oder durch Schlagwörter identifizieren. Das Schlagwort Clash of Civilization verweist zum Beispiel direkt auf Samuel Huntingtons Werk, das in den 1990er-Jahren für viele westliche Politiker und Journalisten zu einer gängigen Referenz wurde. Intertextuelle Verbindungen können jedoch auch subtiler sein und erst durch Sekundärquellen aufgedeckt werden, die sich mit dem Hintergrund eines bestimmten Textes genauer befasst haben (vgl. ebd.: 56 f.). Besonders bemerkenswert ist, wenn unpolitische Texte für außenpolitische Entscheidungen mobilisiert werden. Ein prominentes Beispiel, auf das Hansen verweist, ist Kaplans (1993) Buch Balkan Ghosts. Es soll Präsident Clinton dazu veranlasst haben, eine Intervention in Bosnien abzusagen, weil es eine Identitätskonstruktion beschreibt, die gleichzeitig in denjenigen Diskursen mitschwang, die eine westlichen Nichteinmischung in Bosnien propagierten (vgl. ebd.: 58). Nachdem publik wurde, dass es Clintons Außenpolitik beeinflusst haben soll, erlangte das Buch außerdem eine neue Bedeutung, die auch danach die Identitätskonstruktion Bosniens stabilisierte und die damit zusammenhänge Politik der Nichteinmischung legitimierte (vgl. ebd.: 58 f.).
3.3 Diskursanalyse
Aufbauend auf den vorherigen Kapiteln, die sich mit dem theoretischen Hintergrund der Diskurstheorie befassten, stellt der nachfolgende Abschnitt den diskursanalytischen Rahmen dieser Arbeit vor. Dabei soll erläutert werden, was unter Diskursanalyse zu verstehen ist, welchen Nutzen sie bietet und wie sie in der vorliegenden Arbeit angewendet wird.
3.3.1 Das Konzept der Diskursanalyse
Zunächst sei gesagt, dass die Diskursanalyse weder nur Methode noch nur Theorie ist. Vielmehr ist sie „ein Feld von heterogenen Forschungsperspektiven bzw. Theorie-Methoden-Paketen“, die je nach Forschungsvorhaben zu klären sind (Keller/BosanciC 2018: 47). Allgemein handelt es sich um einen Ansatz zur Untersuchung von Sprache in ihrem Gebrauch und lässt sich in zwei verschiedene Formen unterteilen: die deskriptive und die kritische Diskursanalyse (vgl. Gee 2011: 8). Während der deskriptive Ansatz primär darauf abzielt, den Inhalt der verwendeten Sprache innerhalb bestimmter Themen zu beschreiben und zu verstehen, zielt der kritische Ansatz darüber hinaus darauf ab, bestimmte soziale und politische Probleme oder Kontroversen anzusprechen und in ihre Welt einzugreifen (vgl. ebd.: 9).
Obwohl beide Ansätze die Sprache zu analysieren beabsichtigen, ist die Diskursanalyse von einer Inhaltsanalyse abzugrenzen, da sie nicht an komplexe Transkriptionssysteme und Regeln gebunden ist, um Texte auszuwerten, und die Diskurstheorie der Idee widerspricht, dass sich Sprache kodifizieren lässt. Anders ausgedrückt versteht sie die Sprache weniger als etwas, das die Realität nur abbildet, sondern vielmehr als ein Medium, das die Realität durch Diskurse strukturiert. Ausgehend von dieser Prämisse besteht ihr Wesen darin, die Analyse der Art und Weise zu ermöglichen, wie Subjekte innerhalb von Diskursen Objekte interpretieren und ihre damit verbundenen Handlungen rechtfertigen. Als weiteres Merkmal kommt hinzu, dass die Diskursanalyse im Vergleich zu einer Inhaltsanalyse nicht nur auf die Kommunikationsform des Sprechens begrenzt, sondern auch auf zahlreiche weitere Formen anwendbar ist, darunter Zeitungsartikel, Bücher und Filme sowie modernere Formen wie Podcasts und YouTube-Videos (vgl. Clark et al. 2021: 484-486).
3.3.2 Diskursanalyse im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik
In der Außen- und Sicherheitspolitik spielt der Kampf um Bedeutungen eine zentrale Rolle, wobei politische Akteure um ihre spezifische Version der Realität ringen. Typische Fragen, um diskursive Kämpfe zu untersuchen, wären zum Beispiel, was durch den Einsatz bestimmter Sprachmuster und Strategien erreicht wird und welche Realitätsversionen und politischen Handlungsoptionen durch bestimmte Repräsentationen ein- und ausgeschlossen werden (vgl. Holzscheiter 2013: 3). Unabhängig davon stellt sich die analytische Frage, welche konkreten Schritte unternommen werden müssen, um zu einer vollständigen Analyse der diskursiven Kämpfe und der darin enthaltenen Identitäts-Politik-Konstellationen zu gelangen. Hansen schlägt diesbezüglich vor, die Analyse nach dem „theoretischen Doppelgriff“ („theoretical double grip“) (vgl. Hansen 2006: 51) auszurichten, der die analytische Beschäftigung mit den Differenzgraden (entstehend aus Verknüpfungs- und Differenzierungsprozessen) (siehe Kap. 3.2.3) und den drei Dimensionen der Identitätskonstruktion (siehe Kap. 3.2.1) kombiniert. Genauer gesagt erlaubt eine solche Perspektive zu analysieren, wie sich Self und Other im außenpolitischen Diskurs konstituieren, wie stark die Differenz zwischen ihnen ist und wie sie durch die Artikulation von räumlicher, zeitlicher und ethischer Identität konstituiert werden (vgl. ebd.).
Hansens „theoretischer Doppelgriff“ (vgl. ebd.) bietet zwar eine geeignete Grundlage, um Identität zu analysieren. Übertragen auf die in dieser Arbeit vorliegenden Forschungsfragen bleibt jedoch offen, wie damit die Rechtfertigung bestimmter Handlungsoptionen untersucht werden kann. Daher bedient sich die Arbeit zusätzlich dem breit gefassten Konzept sogenannter (rechtfertigender) Argumentationsmuster nach Stahl und Harnisch (2009). Darunter ist eine inhaltlich konstante, (oft) identitätsbezogene Art und Weise zu verstehen, auf die ein Thema im Diskurs behandelt wird (vgl. Stahl/Harnisch 2009: 52). Theoretisch betrachtet sind solche Argumentationsmuster ein integraler Bestandteil jedes diskursiven Kampfes, die zugleich widerspiegeln, inwiefern es einer Gruppe von Diskursträgern14 gelungen ist, ihre Muster gegenüber konkurrierenden durchzusetzen. Ein solches Gelingen wird umso wahrscheinlicher, wenn Akteure versuchen, ihre Argumente identitär zu „erden“ (vgl. ebd. 43). Das bedeutet, dass sie diese mit einem Identitätselement verknüpfen, um die Öffentlichkeit von der Überlegenheit ihres Arguments zu überzeugen (vgl. ebd.).
An dieser Stelle setzt die Diskursanalyse an, um zu erklären, wie aktive Identitätselemente innerhalb dieser Muster verwendet werden, insbesondere weil sie auch selbst als rechtfertigende Argumentationsmuster im Diskurs dienen können (vgl. ebd.). In solchen Fällen zeichnet sich ein Muster dadurch aus, dass es beim Bezug zum jeweiligen Self oder Other nicht weiter begründet wird, sondern als „konsensualer Ausgangspunkt - quasi als ultimatives Argument“ in einer Argumentationskette fungiert (Boekle et al. 2001: 14). Mit anderen Worten bilden (rechtfertigende) Identitätselemente entweder den Anfang oder das Ende einer Argumentationskette und erfordern in der Regel keine weitere Begründung, da sie als letzte und endgültige Argumente betrachtet werden. Ein Beispiel hierfür ist die Darstellung Deutschlands als Teil des Westens, die je nach Diskurs mit einer bestimmten Handlungsoption einhergeht (vgl. Stahl/Harnisch 2009: 52).
4 Methodologie
4.1 Leitfaden zur Entwicklung diskursanalytischer Forschungsdesigns
Aufbauend auf dem theoretischen und analytischen Hintergrund wendet sich das folgende Kapitel der Frage zu, wie die Diskursanalyse in die Praxis umgesetzt werden kann. Die vorliegende Arbeit orientiert sich hierbei an Hansens Leitfaden für diskursanalytische Forschungsdesigns (vgl. Hansen 2006: 73-87). Zur Entwicklung eines umfassenden Forschungsdesigns schlägt diese vier Parameter vor: die Wahl eines intertextuellen Modells, das mit drei weiteren inhaltlichen Dimensionen verbunden ist (Number of Events, Number of Selves und Temporal Perspective) (vgl. ebd.: 73 f.).
Intertextuelle Modelle sind als „diskursive Arenen“ zu verstehen, das heißt, als analytisch eingerahmte Orte der politischen Debatte, innerhalb derer verschiedene Diskurse zu finden sind (vgl. Baumann 2022: 14). Hansen präsentiert insgesamt vier mögliche Modelle (vgl. Hansen 2006: 59-64; 73-87), die sich alle am ersten Modell orientieren und dabei unterschiedliche Diskursträger unter die Lupe nehmen. Das erste Modell konzentriert sich auf den offiziellen außenpolitischen Diskurs (z. B. auf das Staatsoberhaupt und die Minister). Das zweite Modell erweiterte die Analyse auf die politische Opposition, Medien und Unternehmen. Schließlich kann die Analyse noch weiter gefasst werden und die Populärkultur (z. B. Film, Musik, Literatur und Kunst) (Modell 3A) oder marginale politische Diskurse wie soziale Bewegungen, illegale Vereinigungen, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen (Modell 3B) einschließen (vgl. ebd.: 64). Im weiteren Verlauf werden lediglich die ersten beiden Modelle genauer ausgeführt, da nur sie für das eigene Forschungsvorhaben relevant sind. Das erste Modell dient dabei als methodische Grundlage des zweiten, wobei die Modellerweiterung den Nutzen hat, den hegemonialen Status des offiziellen Diskurses genauer beurteilen zu können (vgl. ebd.: 74).
Die erste der inhaltlichen Dimensionen ist die Anzahl zu bestimmender Ereignisse (Number of Events), wobei hier offenbleibt, wie genau diese zu definieren sind (vgl. ebd.: 80). Grundsätzlich kann es sich um ein beliebiges, analytisch eingerahmtes Ereignis handeln, wie zum Beispiel den Ausbruch des Ukraine-Konflikts im Jahr 2014 (vgl. Baumann 2022: 14). Es stellt sich jedoch die Frage, wie viele Ereignisse untersucht werden sollten und ob sie sich auf einen bestimmten Zeitraum beschränken oder ob sie sich über mehrere Phasen erstrecken sollten. Während die Auswahl eines einzelnen Ereignisses eine detaillierte Analyse verspricht, bietet die Auswahl mehrerer über die Zeit hinweg den Vorteil, durch eine vergleichende Perspektive potenzielle „diskursive Transformationen“ oder „Reproduktionen“ besser identifizieren zu können (Hansen 2006: 80).
Auch bei der Wahl eines oder mehrerer Selves ergeben sich verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, sodass das Self entweder auf ein Ereignis oder auf mehrere bezogen werden kann. Wenn die Analyse über einen längeren Zeitraum erfolgt, erweitern sich die Kombinationsmöglichkeiten entsprechend, was jedoch mit unterschiedlichen analytischen Problemen einhergeht. Eines davon wäre, dass der Einbezug von mehr als zwei verschiedenen Selves mit einem enormen Aufwand verbunden ist, was den Rahmen sprengen könnte (vgl. ebd. 75 f.).
Um eine zeitliche Perspektive zu wählen, kann die Analyse je nach Interesse entweder einen einzelnen Moment oder eine längere Entwicklung fokussieren. Da Hansen für die Bestimmung der Zeiträume keine festen Regeln definiert, können für die Untersuchung sowohl ein längerer historischer Zeitraum in kleinere und markante Momente als auch einzelne Momente in noch kleinere Momente, sogenannte „ sub-moments or periods “, unterteilt werden (Hansen 2006: 79). Ein markanter Moment bezeichnet den auffälligen Charakter eines kleinen Zeitraums, wozu der Beginn oder das Ende eines Krieges gehören kann. Neben markanten Momenten können aber auch gewöhnliche Momente wie alltägliche Praktiken analysiert werden, wenn der Fokus auf die Reproduktion gerichtet wird. Ein Moment ist jedoch von einem Ereignis zu unterscheiden, da er im Gegensatz zu diesem zeitübergreifend ist. Unabhängig von den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten ist es von besonderem Vorteil, sich auf Momente zu konzentrieren, die wertvolle Einsichten in diskursive Veränderungen oder Reproduktionen bieten (vgl. ebd.: 78 f.).
4.2 Entwickeltes Forschungsdesign zur (Nicht-)Unterstützung der Ukraine
Die vorliegende Arbeit wählt eine verkürzte Version des zweiten intertextuellen Modells, indem sie sich ausschließlich auf den offiziellen US-amerikanischen und die damit verbundenen oppositionellen Diskurse konzentriert. Die Untersuchung anderer Gruppen lässt sie aus Praktikabilitätsgründen aus. Das gewählte Modell schließt außerdem die Untersuchung intertextueller Verbindungen ein, die zur Stabilisierung jeweiliger Diskurse beitragen können (siehe Kap. 3.2.5). Um den Rahmen nicht zu weit zu fassen, beschränkt sich die Untersuchung der intertex- tuellen Verbindungen ausschließlich auf die ausgewählten Primärquellen, die nach expliziten Zitaten und auffälligen Schlüsselwörtern durchsucht werden.
Das Ereignis, welches die Untersuchungszeiträume einrahmen soll, ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der am 24.02.2022 begann. Dieser Fokus wird mit der Untersuchung des US-amerikanischen Self kombiniert, das innerhalb der jeweiligen Diskurse umkämpft ist. Die zeitliche Dimension wird durch vier kurze Zeiträume konzeptualisiert, die aus Praktikabilitätsgründen jeweils einen Monat umfassen. Die ersten beiden Zeiträume beziehen sich das Anfangsstadium des Krieges (A: 24.02.-23.03.2022 und B: 10.05.-09.06.22) und die anderen beiden auf das darauffolgende Jahr (C: 20.02.-19.03.23 und D: 07.07.-06.08.23). Sie wurden deshalb ausgewählt, weil sie sowohl in Bezug auf die Befürwortung als auch auf die Ablehnung der Unterstützung für die Ukraine mit intensiven rechtfertigenden und identitätskonstruierenden diskursiven Aktivitäten in Verbindung stehen.
Inhaltlich zeichnet sich der erste Zeitraum dadurch aus, dass er das erste große Hilfspakete nach Kriegsbeginn im Rahmen des Consolidated Appropriations Act (H.R.2471)15 und den von Biden verhängten Importstopp für russisches Erdöl einbezieht. Der zweite Zeitraum setzt ein mit der Einführung des Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act (H.R. 7691), das weitere 40,1 Milliarden US-Dollar Unterstützungsgelder vorsah und zum wichtigsten Streitthema in- und außerhalb des Kongresses wurde. Der dritte Zeitraum beginnt mit Präsident Bidens Reise nach Kyjiw, bei der er weitere Unterstützung für die Ukraine in Aussicht stellte. Zudem umfasst dieser Zeitraum den Jahrestag des Angriffskriegs, der mit hoher Aktivität in den jeweiligen Diskursen verbunden war. Der vierte Zeitraum endet mit der Debatte um das National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024 und mit Bidens Ankündigung, Streumunition an die Ukraine zu liefern.
4.3 Datenkorpus
An dieser Stelle wird aufgezeigt, welches und wieviel Material warum für die Diskursanalyse ausgewählt wurde. Die Arbeit wertet geschriebenes und gesprochenes Material (Text und Video) nach dem Prinzip „ [w]idely read and attended to “ (Hansen 2006: 87) innerhalb der vier Zeiträume aus. Ausgehend von diesem Kriterium ist das in die Analyse eingeflossene Material das Ergebnis einer Stichwortsuche („ Ukraine “ und „ Support “) verschiedenster Primärquellen im Internet, wobei mindestens eines der beiden Stichwörter in der Quelle vorkommt und der Inhalt entweder auf die Befürwortung oder die Ablehnung der Unterstützung verweist. Während das Textmaterial in seiner ursprünglichen Form übernommen werden konnte, wurde das gesprochene Material (z. B. Interviews) aufbereitet, indem relevante Textpassagen transkribiert wurden. Um die Vielzahl an Daten einfacher auswerten zu können, wurden alle einschlägigen Quellen und Textpassagen in das Programm MAXQDA Plus 2022 importiert. Dadurch war es möglich, einen besseren Überblick über die Datenmenge zu behalten, was vor allem die induktive Ermittlung von auffälligen Mustern innerhalb der jeweiligen Diskurse erleichterte.
Zur Identifizierung des offiziellen Diskurses wurden Quellen der wichtigsten Vertreter der Administration ausgewählt. Sie bekleiden die höchsten Staatsämter und tragen somit die größte Verantwortung in der US-Außen- und Sicherheitspolitik. Hierzu zählen Präsident Joe Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris, Außenminister Anthony Blinken, Sicherheitsminister Lloyd Austin und Finanzministerin Janet Yellen. Um relevantes Material der jeweiligen Personen zu identifizieren, wurden sowohl formelle Quellen (Speeches, Remarks, Statements und Releases) auf der Webseite des Weißen Hauses als auch informelle Quellen wie gegebene Interviews und publizierte Meinungsbeiträge durchsucht. Innerhalb der vier Zeiträume konnten somit insgesamt 87 einschlägige Quellen (A: 37/B: 18/C: 20/D: 12) identifiziert werden.
Im Vergleich zum offiziellen Diskurs erforderte die Identifizierung des oppositionellen Diskurses eine umfassendere Recherchearbeit. Zudem setzt sie Wissen über die diskursive Struktur des offiziellen Diskurses voraus, da die Opposition aus theoretischer Perspektive als eine „diskursive Opposition“ zum offiziellen Diskurs zu verstehen ist, die sich durch ihre Kritik auszeichnet (Hansen 2006: 129). Insofern identifiziert die vorliegende Arbeit zwei unterschiedliche oppositionelle Unterdiskurse der Republikaner16, die sich zwar beide in ihrer Kritik an der Biden-Administration ähneln, sich jedoch inhaltlich durch ihre Haltung zur Unterstützung der Ukraine unterscheiden. Die Recherchearbeit zeigte, dass die Anzahl der formellen Quellen der oppositionellen Diskursträger im Vergleich zu den offiziellen Diskursträgern deutlich geringer ist, insbesondere wenn man sich nur auf die Kongressdebatten beschränkt. Aus diesem Grund wurden Kongressreden der jeweiligen oppositionellen Diskursträger durch informelle außerparlamentarische Quellen ergänzt, um eine möglichst gute theoretische Sättigung zu erreichen.
Insgesamt wurden acht Senatoren identifiziert, die den pro-ukrainischen Unterdiskurs der republikanischen Opposition repräsentieren. Ihre Kritik zeichnet sich dadurch aus, dass sie die bisherigen Maßnahmen für unzureichend halten. Zu ihnen zählen Mitch McConnell, Lindsey Graham, Tom Cotton, John Barrasso, Roger Wicker, Charles E. Grassley, John Cornyn und Ted Cruz. Neben ihren Senatsreden flossen weitere Quellen in die Analyse ein, darunter Interviews, Stellungsnahmen, Meinungsbeiträge (in Zeitungen und auf Twitter), Blogbeiträge und Vodcasts auf YouTube, wodurch sich die Gesamtzahl der Quellen auf insgesamt 90 beläuft (A: 47/B: 17/C: 15/D: 11). Der Unterdiskurs derjenigen Republikaner, welche die Unterstützung gänzlich ablehnen, umfasst dieselben Quellenarten, wobei es sich hier bei den Diskursträgern nicht nur um Senatoren, sondern auch um Mitglieder des Repräsentantenhauses handelt. Zu den Senatoren zählen Josh Hawley, J.D. Vance sowie Rand Paul und zu den Mitgliedern des Repräsentantenhauses Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz, Paul Gosar, Chip Roy sowie Warren Davidson. Die Quellenanzahl beträgt hier 87 (A: 26/B: 22/C: 14/D: 25). Aus Platzgründen beschränken sich die oppositionellen Unterdiskurse lediglich auf die Kongressabgeordneten, sodass andere Vertreter der Partei, insbesondere die Präsidentschaftskandidaten, nicht in die Analyse einbezogen werden.
5 Diskursanalyse: Rechtfertigungsmuster und Identitäten
5.1 Biden-Diskurs
Im Folgenden werden die wichtigsten rechtfertigenden Argumentationsmuster des offiziellen Diskurses aufgezeigt. Mit den ersten beiden (Kap. 5.1.1 und 5.1.2) werden diejenigen präsentiert, die keine identitäre Bezüge aufweisen, gefolgt von denen, die solche Bezüge aufweisen.
5.1.1 Friedensorientierung
Das erste identifizierte Argumentationsmuster besagt, dass die Biden-Administration die Ukraine unterstützt, weil sie damit eine friedensorientierte Politik verfolgt. Ihr Ziel ist es, den Krieg in der Ukraine zu beenden und andere potenzielle Aggressoren neben Russland abzuschrecken. Das Muster ist jedoch frei von identitären Aussagen und besteht lediglich aus sachlicher Argumentation, auf die die Administration zurückgreift. Das bedeutet, dass beispielsweise nicht explizit (re-)rekonstruiert wird, ob es sich bei Amerika und der Ukraine um friedliche Nationen und bei Russland um eine unfriedliche Nation handelt.
Gemäß Blinken (01.06.2022)17 lautet das Hauptziel der Administration: „ [O]ur objective [...] is to help the Ukrainians bring this aggression to an end [...]. “ Basierend auf dieser Zielausrichtung verkündete er seine Entschlossenheit, „in Abstimmung“ mit Verbündeten und Partnern zusätzliche Sanktionen gegen Russland zu verhängen, um die Fortsetzung des Krieges zu verhindern (Blinken, 28.02.2022). „ [O]ur focus is on trying to prevent President Putin from going even further [.]. We’re imposing massive costs “ (Blinken, 24.02.2022). In Bezug auf konkrete Schritte, um den Krieg zu beenden, wird die Stärkung der ukrainischen Verhandlungsposition gegenüber Russland als wichtig erachtet. In einem Gastbeitrag für die New York Times äußerte Biden seine Überzeugung, dass kein Weg an Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland vorbeiführe: „ This war will only definitively end through diplomacy “ (Biden, 31.05.2022). Er betonte zudem, dass die Administration mehr Munition und Waffen für die Ukrainer zur Verfügung stellen werde, damit sie in einer „stärkstmöglichen Position am Verhandlungstisch“ bleiben könnten, weil jede Verhandlung „die Fakten vor Ort“18 widerspiegle (ebd.). Obwohl eine Kriegsbeendigung durch Verhandlungen nicht erreicht wurde, gab die Administration ihre Bemühungen nicht auf und setzte sich weiterhin für eine Verhandlungslösung ein. Diese blieb eine Voraussetzung für die Etablierung des Friedens, wodurch die fortgesetzte Unterstützung mit demselben Grundsatz gerechtfertigt werden konnte. So erklärte Biden auch ein Jahr nach Kriegsbeginn in einem Interview mit ABC News, dass es im Frühjahr und Sommer 2023 entscheidend sei, die Ukrainer in die Lage zu versetzen, ihre Territorien zurückzuerobern und eine „Position der Stärke“ für zukünftige Verhandlungen zu erreichen (Biden, 24.02.2023).
Um den Kontrast zwischen den beiden Kriegsparteien zu betonen, artikulierte Blinken wiederholt, dass die Ukraine nach Frieden strebe (vgl. Blinken, 24.02.2023d), während Russland hingegen an „sinnvollen Friedensgesprächen“ desinteressiert sei (Blinken, 21.07.2023). Beim Ministertreffen des UN-Sicherheitsrates19 ergriff er die Gelegenheit, um den Kontrast nochmals zu verdeutlichen, indem er erläuterte, dass Selenskyj einen Zehn-Punkte-Plan für einen gerechten und dauerhaften Frieden vorgelegt habe, Putin jedoch versuche, der Ukraine seine „neuen territorialen Realitäten“20 aufzuzwingen, und dabei seine „brutale Taktik verdoppelt“ habe (Blinken, 24.02.2023). Der Kontrast erlaubt der Administration, Russland permanent die Schuld an einer gescheiterten Verhandlungslösung zu geben, was zugleich dazu beiträgt, die Fortsetzung der Unterstützung auf unbestimmte Zeit zu rechtfertigen. Dies betrifft zum Beispiel die Rechtfertigung der Lieferung von Munition für HIMARS21, Haubitzen, Javelins, Panzer- und Luftabwehrsystemen (vgl. Blinken, 20.02.2023), wobei die Administration stets auf die Stärkung der ukrainischen Verhandlungsposition verweisen kann:
„ [W]e will stand united with Ukraine for as long as it takes to strengthen its military on the battlefield so that they will be in the strongest possible position at any future negotiating table “ (Blinken, 03.03.2023).
Ein weiterer Aspekt, der neben der Beendigung des Krieges angesprochen wird, ist die Aufrechterhaltung des Friedens außerhalb der Ukraine. So betont die Biden-Administration, dass die Unterstützung der Ukraine im „vitalen nationalen Interesse“ liege, um Frieden, Stabilität und eine normenbasierte internationale Ordnung sowohl in Europa als auch in der Welt zu gewährleisten (Biden, 31.05.2022). Genauer gesagt soll, so die Administration, die Unterstützung andere „potenzielle Aggressoren“ („ would-be aggessors “) neben Russland davon abschrecken, Gebiete zu erobern und Länder zu unterwerfen (Yellen, 27.02.2023c; Biden, 31.05.2022). Dabei werden keine konkreten Angaben darüber gemacht, um welche anderen potenziellen Aggressoren es sich handeln könnte.
5.1.2 Wirksamkeit und Erfolg
Ein weiteres Rechtfertigungsmuster beruht darauf, dass die Administration ihre Maßnahmen damit rechtfertigt, dass diese bereits wirksam und erfolgreich sind oder es in naher Zukunft sein werden. Genauso wie das vorherige Muster ist auch dieses nicht identitätsbezogen, sondern pragmatisch ausgerichtet.
Zu Beginn des Krieges sollten Wirtschaftssanktionen ihre Wirksamkeit entfalten, indem sie die Finanzierung des Krieges durch Russland erschwerten. Sie führten laut US-Regierung dazu, dass sich Russland zunehmend auf einer „wirtschaftlichen Insel“ befinde (Yellen, 02.03.2022). Die Rating-Agenturen hätten Russland auf einen „Ramsch-Status“ herabgestuft (Biden, 11.03.2022b), und schon zu Beginn der Invasion habe der russische Rubel den „schwächsten Stand“ in seiner Geschichte erreicht (Biden, 24.02.2022). Als es darum ging, Waffen- und Munitionslieferungen fortzusetzen, wurden diese an die Aussicht nach Erfolg geknüpft. „ What I’m focused on is making sure that they have the capability to be successful in this next fight “ (Austin, 24.02.2023). Als Reaktion auf kritische Stimmen, welche die Unterstützung infrage stellten, sagte Blinken (vgl. 23.02.2023) in einem Interview mit The Atlantic, dass es am besten wäre, den Ukrainern zum Erfolg zu verhelfen, um diese Stimmen zu besänftigen.
Es ließe sich an dieser Stelle argumentieren, dass das wirksamkeits- und erfolgsorientierte Muster tendenziell mit der friedensorientierten Argumentation übereinstimmt. Dagegen spricht aber, dass sich eine Eigendynamik im Biden-Diskurs entwickelt hat, wenn es darum geht, die Maßnahmen mit Wirksamkeit und Erfolg zu legitimieren. So rechtfertigte Blinken, (24.02.2023c) im Interview bei CBS Mornings die Lieferung von Waffen mit dem Argument, dass sie einen „realen Effekt“ auf das russische Militär hätten, das „schreckliche Verluste“ an Personal zu beklagen habe und inzwischen „200.000 Tote oder Verwundete“ zähle. Die Eigendynamik zeigt sich auch daran, dass umstrittene Streumunitionslieferungen22 mit Pragmatismus gerechtfertigt wurden. Sie dienten als eine Überbrückungshilfe, um die Lücke für die fehlende konventionelle Munition zu füllen, so Blinken (vgl. 11.07.2023). Auf die Frage, wie lange Streumunition der Ukraine zur Verfügung gestellt werden müsse, antwortete Austin im Interview bei CNN, dass sie sicherstellen soll, dass die Ukraine in ihrem Kampf erfolgreich bleiben kann, ohne dass er einen konkreten Zeitraum erwähnte (vgl. Austin, 13.07.2023).
5.1.3 Demokratische Werte und internationale Normen
Das erste Argumentationsmuster der Biden-Regierung, das identitätsbezogenen Charakter besitzt, besagt, dass die USA durch ihre Unterstützung für den Schutz demokratischer Werte und internationaler Normen eintreten wollen. Es seien „gemeinsame“ Werte, die eine Verbindung zur Ukraine schüfen (Yellen, 01.03.2022) und für welche die Ukraine im Krieg kämpfe (vgl. Harris, 02.03.2022). Und es seien internationale Normen, die durch den Krieg auf die Probe gestellt würden, denn „Putins Krieg“ sei ein Angriff auf die Grundsätze der Souveränität und territorialen Integrität, die in der UN-Charta verankert sind (Blinken, 02.06.2022). So formuliert die Administration neben dem Ziel, die Aggression beenden zu wollen (vgl. Blinken, 01.06.2022), auch das Ziel, mithilfe von „präzedenzloser militärischer, humanitärer und finanzieller Unterstützung“ (Biden, 31.05.2022) zu einer Ukraine beizutragen, die gemeinsame Werte und internationale Normen verkörpert (vgl. Biden 31.05.2022; vgl. Blinken 03.06.2022). „ We want to see a democratic, independent, sovereign and prosperous Ukraine “ (Biden 31.05.2022).
Die Rechtfertigung durch Werte und Normen ließ im Zeitverlauf nicht nach, was sich besonders durch die bestärkenden Worte ein Jahr nach Kriegsbeginn zeigte: „ I am in Kyiv today to [...] reaffirm our unwaveringandunflaggingcommitment to Ukraine ’s democracy, sovereig- nty, and territorial integrity “ (Biden, 20.02.2023). Zudem brachte Austin (24.02.2023; 15.03.2023) wiederholt die Losung for as long as it takes ‘ mit der Verkörperung von Werten und Normen in Verbindung, was eine unbefristete Unterstützung impliziert: „ [W]e will remain resolute and united in support of Ukraine ’s right to live as a free and sovereign country - for as long as it takes “ (Austin, 15.03.2023).
Die im Diskurs artikulierten Werte und Normen haben einerseits gemeinsam, dass sie aufgrund ihres ideellen Charakters praktisch über die territorialen Grenzen der USA und der Ukraine hinausgehen. Andererseits unterscheiden sie sich dadurch, dass nur der Einsatz für demokratische Werte, insbesondere die Freiheit23, als identitär repräsentiert wird. Der Einsatz für Normen allgemein hingegen fällt nicht als identitär auf. „ He [Putin] still doesn’t understand that o ur commitment to our values, our freedom is something we can never [.] ever walk away from. It’s who we are “ (Biden, 12.07.2023). In Verbindung damit dient die Freiheit auf priorisierte Art und Weise durchgehend zur Rechtfertigung der Unterstützung. In seiner ersten Ansprache zur Lage der Union nach dem Kriegsausbruch formulierte Biden den prophetischen Satz: „ [F]reedom will always triumph over tyranny “ (Biden, 01.03.2022). Dabei betonte er, dass die Ukraine um ihre Freiheit kämpfe, weshalb er ihr militärische, wirtschaftliche und humanitäre Hilfe zusichere (ebd.). Auch in seiner Warschauer Rede stützte er sich im Februar 2023 besonders auf die Freiheit, die er glorifiziert: „ There is no sweeter word than freedom. There is no nobler goal than freedom. There is no higher aspiration than freedom ” (Biden, 21.02.2023).
Wie der Blick ins Detail zeigt, spielt der Einsatz für die Freiheit besonders bei der wirtschaftlichen und militärischen Hilfe eine wichtige rechtfertigende Rolle. Als Biden zu Kriegsbeginn eine Erklärung zur Bekanntgabe des Importverbots für russisches Öl, Flüssigerdgas und Kohle abgab, räumte er ein, dass die Maßnahme nicht nur für Putin, sondern auch für das amerikanische Volk Kosten verursachen würden. Um dies zu rechtfertigen, berief er sich auf die „Verteidigung der Freiheit“, die ihren „Preis“ habe (Biden, 08.03.2022). In Hinsicht auf die militärische Hilfe spielt das Motiv insofern eine wichtige Rolle, als es darum geht, den ukrainischen „Kampf für die Freiheit“ zu unterstützen (Blinken, 01.06.2022).
Ergänzend schafft der Begriff Freiheit eine räumliche Verbindung zwischen den USA und der Ukraine. Yellen brachte dies damit zum Ausdruck, dass der „ukrainische Kampf“ für die Freiheit gleichzeitig auch „unser Kampf“ sei, also auch ein amerikanischer Kampf (Yellen, 27.02.2023d). In diesem Punkt besteht die Verbindung nicht nur aufgrund des gemeinsamen Kampfes, sondern auch dadurch, dass die Ukraine als eine freiheitliche Nation (re-)konstruiert wird. Für Blinken (24.02.2023e) ist sie ein „Symbol der Freiheit“. Das ukrainische Volk zeichne sich durch seine „Liebe zur Freiheit“ aus, die Putin niemals auslöschen werde, so Biden (01.03.2022). Damit erhält die militärische Unterstützung in gewisser Weise eine identitäre Bedeutung, denn Waffen und Ausrüstung sollen nicht einfach nur auf das ukrainische Territorium, sondern direkt an die ukrainischen „Frontlinien der Freiheit“ geliefert werden (Biden, 19.05.2022). Das Ausmaß der militärischen Hilfe soll dabei „historisch“ sein (Blinken, 01.06.2022) und auf Dauer ausgelegt sein. Austin (18.07.2023) verdeutlichte dies mit einer Metapher: „ Ukraine’s fight for freedom is a marathon, not a sprint. “
5.1.4 Ukrainischer Heroismus
Ein weiteres zentrales Argumentationsmuster beruht darauf, dass die US-Administration die Ukrainer als heroisch konstruiert und dies als Rechtfertigungsgrund für die Unterstützung anführt. Seinen Ursprung nahm dieses Muster in der Anfangszeit des Krieges, als die Administration glaubte, dass Putin mit einem einfachen und schnellen Sieg in der Ukraine rechnete (vgl. Biden, 31.05.2022). Die Ukrainer hätten Putin jedoch deutlich gemacht, dass er sich getäuscht habe und nicht einfach in die Ukraine einmarschieren könne, da er dort auf eine ukrainische „Mauer der Stärke“ traf, die er sich nie hätte vorstellen können (Biden, 01.03.2022). Zum Zeitpunkt, als Putin dem ukrainischen Volk gegenübersteht, „überrascht“ es Putin (Biden, 31.05.2022) und inspiriert dabei die Welt „im wahrsten Sinne des Wortes“ („ in a literal sense “) (Biden, 08.03.2022). An dieser Stelle wird die Inspiration auf die attribuierten Eigenschaften der Ukrainer zurückgeführt: „ They’ve inspired the world with their bravery, their patriotism, their defiant determination to live free “ (ebd.). In diesem Sinne sind persönliche Eigenschaften die eigentliche Inspirationsquelle, während der Widerstand bzw. der Kampf nur deren „Produkt“ ist (Yellen, 27.02.2023). Yellen (27.02.2023b) hat dies wie folgt formuliert:
„ The Ukrainian resistance has inspiredmillions of people across the globe. [...]More broadly, the Ukrainian people’s strength and resilience have captivated the globe. “
In diesem Kontext wird ein Identitätselement konstruiert, demzufolge die Ukraine heroisch ist, das heißt, sie besteht aus „ukrainischen Helden“ (Biden, 08.03.2022; Biden, 21.02.2023). Hier sind Eigenschaften wie etwa „Mut“ („ bravery “) als heroisch zu verstehen (Yellen, 01.03.2022). Das ukrainische Subjekt ist in dieser Hinsicht homogen und nicht in heroische und nicht-heroische Ukrainer unterteilt. Vom „Militär“ über die „Führung“ bis hin zu allen „Menschen“ sind alle Ukrainer gleich (Yellen, 27.02.2023). „ We salute [.] all Ukrainian citizens who are de- fending their country with great skill, iron will, and profound courage “ (Blinken, 12.03.2022).
Die Struktur der Pressemitteilungen über genehmigte Lieferungen von Verteidigungsgütern im Rahmen der Presidential Drawdown Authority24 (PDA) zeigt, dass die militärische Unterstützung an den Heroismus der Ukrainer geknüpft wird. Darin wird betont, dass die kämpfenden Ukrainer angesichts des unprovozierten und brutalen Kriegs Mut bewiesen. Ihr Mut sticht besonders im Kontrast zu den von der russischen Seite verübten Taten hervor. Gleich im ersten nach Beginn des Krieges autorisierten Drawdown zeigt sich dieser Widerspruch:
„ Today, as Ukraine fights with courage and pride against Russia’s brutal and unpro- voked assault, I have authorized [.] an unprecedented third Presidential Drawdown “ (Blinken, 26.02.2022).
Auch bei der Sicherheitsfinanzierung, die mit dem Hilfspaket H.R. 2471 vom Kongress verabschiedet wurde, machte Biden von seinen Drawdown -Rechten Gebrauch, um sich für die „mutigen Menschen“ in der Ukraine einzusetzen (Biden, 15.03.2022). In der 12. Kriegswoche, nachdem die Schlacht um Kyjiw von den „mutigen“ Ukrainern gewonnen worden war, wurden sie weiterhin als heroische Kämpfer bezeichnet, die bei der Verteidigung weiterer Gebiete „fest im Kampf“ seien (Blinken, 19.05.2022). Dies sei ein Grund dafür, die Lieferung von Waffen und Ausrüstung zu beschleunigen (ebd.).
Der Kontrast zwischen den Ukrainern und den russischen Taten blieb auch im Juli 2023 Bestandteil der Drawdown -Struktur, nachdem sich die Ukraine im Norden und Süden erfolgreich in der Gegenoffensive behauptete. Erneut wurde betont, dass der „unerschütterliche Mut“ der Ukrainer weiterhin Widerstand gegen die russische Aggression leiste und die Welt inspiriere, obwohl die Zivilbevölkerung im ganzen Land unter Drohnen- und Raketenangriffen leide (Blinken, 07.07.2023). Die Inspirationskraft, die von der Ukraine ausging, führte dazu, dass sich die USA verstärkt darum bemühten, ihr zu helfen, wie in der Begründung angegeben wird (ebd.). Während der Krieg sich fortsetzte, trug der ukrainische Heroismus dazu bei, eine Rechtfertigungsgrundlage aufrechtzuerhalten, da durch den Heroismus Erfolgspotenzial gesehen wurde. Wie Blinken in einem Interview bei NBC News erklärte, seien die Ukrainer gewillt, bis zum Ende zu kämpfen: „ And what we’ve learned over the past couple of weeks is that they will fight to the end for their country - and if it takes a week, if it takes a month, if it takes a year“ (Blinken, 06.03.2022).
5.1.5 Amerikanisches Verantwortungsbewusstsein
Ein weiteres Muster in der Regierungsargumentation ist das amerikanische Verantwortungsbewusstsein, das sich darin zeigt, dass die Administration verschiedene ethisch-moralische Argumente vorbringt, um ihre Unterstützung zu rechtfertigen. So geht es beispielsweise darum, das Leid der Ukrainer zu „lindern“ und dafür zusätzliche Hilfen bereitzustellen (Biden, 01.03.2022). Ein weiteres Zitat zeigt, wie Blinken dem amerikanischen Volk ein ethisches Verantwortungsbewusstsein zuschreibt, als er im Interview bei CBS Mornings den Einsatz zusätzlichen Steuergeldes für die Ukraine wie folgt rechtfertigt: „ [M]ost Americans don’t like to see a big country bullying another, and they just feel it’s wrong and want to do something about it “ (Blinken, 24.02.2023c).
Im Vergleich zu den vorherigen Argumentationsmustern, in denen es eher um die Rechtfertigung wirtschaftlicher und militärischer Unterstützung geht, konzentrieren sich die verantwortungsbezogenen Argumente auf die humanitäre Unterstützung. Sie traten besonders zu Beginn der Invasion auf, als es um die Versorgung ukrainischer Geflüchteter und das Leid der Ukrainer ging. Direkt vom ersten Tag stammt die Aussage: „ We’ll provide humanitarian relief to ease their [Ukrainian] suffering “ (Biden, 24.02.2022). Später wurde erklärt, dass sich Amerika als Reaktion auf die russische Aggression an der „Verantwortung“ für die Versorgung von Geflüchteten beteiligen werde (Biden, 08.03.2022). In diesem Sinne führte Biden in seiner Erklärung zum Hilfspaket H.R. 2471 im März 2022 aus, dass die amerikanischen Milliarden, die für humanitäre Hilfe vorgesehen waren, darauf abzielten, den „humanitären Bedarf“ des ukrainischen Volkes schnell zu decken und dafür Nahrungsmittelhilfe in den Auffanglagern, besonders in ukrainischen Nachbarländern wie Moldawien, bereitzustellen (Biden, 15.03.2022). Ergänzend dazu versicherte Blinken (vgl. 15.03.2022b), dass die humanitäre Hilfstranche über Organisationen flösse, die ebenfalls verantwortungsbewusst ausgerichtet seien. Damit zielte er darauf ab, die verantwortungsbewusste US-Orientierung glaubhafter zu machen:
„ Our humanitarian assistance flows through independent humanitarian organizations that deliver needs-based assistance with impartiality, humanity, neutrality, and inde- pendence “ (ebd.).
Auch in seiner Jahrestagrede zu Russlands Angriff auf die Ukraine bekräftigte Biden, dass die Amerikaner weiterhin verantwortungsbewusst handeln würden, indem er erneut die Unterstützung für ukrainische Geflüchtete und für ortsansässigen Ukrainer betonte. Angesichts des „grausamen russischen Bombardements“ halte die humanitäre Hilfe das ukrainische Versorgungssystem am Laufen (Biden, 21.02.2023).
Bei genauerem Blick auf den im vorliegenden Diskurs artikulierten Begriff der Verantwortung, zeigt sich, dass er auch eine Identitätsfunktion in Form eines amerikanischen Identitätselements erfüllt. Ein Identitätselement liegt nämlich dann vor, wenn „ein Bezug zum eigenen Land hergestellt wird, der nicht weiter begründet wird, sondern als ,konsensualer Ausgangspunkt’ - quasi als ultimatives Argument“ dient (Boekle et al. 2001: 14). Solche Argumente kommen beispielsweise bei Yellen (27.02.2023) zum Ausdruck, wenn sie sagt, die amerikanisch Verantwortung sei sowohl ethisch („ Americans have always been quick to stand up to do the right thing “) als auch moralisch („ Our support is motivated, first and foremost, by a moral duty to come to the aid of a people under attack “). Auch im Fall Bidens erscheint das amerikanische Verantwortungsbewusstsein als ein nicht weiter begründeter Ausgangspunkt. In seiner Ansprache zur Lage an die Union erklärte er im März 2022, dass der russische Angriffskrieg das Verantwortungsbewusstsein Amerikas auf die Probe stelle: „ Now is the hour. Our moment of re- sponsibility. Our test of resolve and conscience, of history itself. It is in this moment that our character is formed “ (Biden, 01.03.2022). Der Test sei bestanden, wenn das
Verantwortungsbewusstsein bewiesen worden sei: „ We will meet the test. To protect freedom and liberty, to expand fairness and opportunity. We will save democracy “ (ebd.).
5.1.6 Rechenschaft für die Taten
Während das vorherige sowohl tatenbasiert als auch identitär ausgerichtete Argumentationsmuster sich auf Amerika bezieht, ist das nächste Muster zwar ähnlich strukturiert, aber umgekehrt, denn es betrifft die Verantwortlichen aus Russland. Die Administration argumentiert, Sanktionen gegen alle Verantwortlichen des Krieges in der Ukraine zu verhängen, um sie für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Die Sanktionen gelten in diesem Zusammenhang als eine indirekte Unterstützungsleistung für die Ukraine, da sie Russland finanziell schwächen sollen.
Das Hauptaugenmerk des Argumentationsmusters liegt darauf, dass der russische Angriffskrieg viel Leid und Tod verursache. Biden (31.05.2022) äußerte dazu, dass die Situation vor Ort moralische Fragen aufwerfe: „ [T]he bombing of maternity hospitals and centers of culture, and the forced displacement of millions of people make the war in Ukraine a profound moral issue ” (ebd.). Bei den Haupttätern, die seit Beginn des Krieg als solche hervorgehoben werden, handelt es sich vor allem um Putin und die russische Armee. Putin sei derjenige, der „entsetzliche Verwüstungen und Schrecken“ („ appalling devastation and horror “) anrichte (Biden, 16.03.2022). Die russischen Streitkräfte und Söldner begingen zudem „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ und viele andere „Gräueltaten“ (Biden, 21.02.2023). Infolgedessen verhing die Administration zahlreiche Sanktionen, die sich zunächst gegen Putin und hochrangige Beamte richteten (Blinken, 25.02.2022), später dann gegen Oligarchen und andere russische Eliten (vgl. Yellen, 02.03.2022) sowie Einrichtungen, die den „illegalen Krieg“ unterstützen (Blinken, 20.07.2023).
Nicht nur die Taten allein gelten in diesem Zusammenhang als verantwortungslos, sondern auch ihr diskursiv gesehen identitätsbasiertes Erscheinungsbild. In ethischer Hinsicht gehören die Verantwortlichen dem korrupten System Russlands an (vgl. Biden, 11.03.2022; vgl. Yellen, 02.03.2022). Zudem werden Putin und „seine Armeen“ als „Tyrannen“ (re-)konstruiert (Biden, 24.02.2022). „Tyrannen“ sollten fossile Brennstoffe nicht mehr als „Waffe“ gegen Nationen wie die Ukraine verwenden dürfen, so Biden (08.03.2022), weshalb er ein Importverbot für fossile Brennstoffe aus Russland verhänge.
5.1.7 Identitätskonstruktion im Biden-Diskurs
Der vorherige Abschnitt hat gezeigt, dass die rechtfertigenden Argumentationsmuster nicht vollständige Identitäten, sondern wenn dann nur einzelne Identitätselemente einbeziehen. Umfassendere Identitäten formen sich erst dann, wenn eine Reihe von Zeichen - in diesem Fall eine Reihe von Identitätselementen - miteinander zu einer Äquivalenzkette verknüpft und gleichzeitig von einer Reihe anderer Identitätselemente (Differenzkette) abgegrenzt wird (vgl. Hansen 2006: 42). Eine solche Struktur gibt Aufschluss darüber, wie der Diskurs versucht, Stabilität in der Identitätskonstruktion zu erreichen und wo „Instabilitäten und Abweichungen zwischen diesen Konstruktionen“ (Äquivalenz- und Differenzketten) auftreten (ebd.). Das bedeutet, sie ermöglicht es, eine Bewertung vorzunehmen, wie stabil die jeweiligen Identitätskonstruktionen sind.
Während es in den vorherigen Unterkapiteln mehr um die Frage ging, wie die Unterstützung gerechtfertigt wird, konzentrieren sich die folgenden Ausführungen, basierend auf dem oben genannten theoretischen Hintergrund, auf aktive Identitäten, die sich wiederum in einzelne Identitätselemente dekonstruieren lassen. Das schließt auch solche Elemente ein, die in der Rechtfertigungsstruktur zwar eine geringere oder keine Rolle spielten, in der diskursiven Struktur aber auftauchen, sprich, häufig artikuliert wurden und als verdeckte Identitätselemente aufgefasst werden können. Durch die Betrachtung all dieser Elemente lässt sich ein umfassenderes Bild der Identitäten und ihrer Bedeutung im Diskurs nachzeichnen.
Innerhalb der diskursiven Struktur zeigt sich, dass sich die amerikanische Identität sowohl in Gegenüberstellung zur ukrainischen als auch zur russischen - und umgekehrt - konstruiert. Während die ukrainische Identität in Bezug auf die amerikanische eine Verbundenheit aufweist, da überwiegend Gemeinsamkeiten existieren, zeigt sich bei der russischen Identität eine radikale Differenz, die durch das Fehlen jeglicher Gemeinsamkeiten gekennzeichnet ist. Insofern besteht das amerikanische Selbstbild aus einer Reihe von verknüpften Identitätselementen. Ein wichtiger Baustein stellt das multilaterale Engagement in einer weltweiten Koalition demokratischer Staaten dar. Dieses Bündnis hat sich zur Unterstützung der Ukraine angesichts der russischen Aggression zusammengeschlossen und schließt die amerikanischen Verbündeten innerhalb der NATO sowie ihre Partner über die Allianz hinaus ein. Laut Diskurs handelt es sich um „ allies and partners across the globe “ (Blinken 11.03.2022), um „ America, Europe, a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific “ (Biden, 21.02.2023). Ihre identitätsstiftenden Merkmale sind eine freiheitsliebende Wertebasis sowie innere Einheit. Es seien nämlich „ freedom- loving nations everywhere “ (Biden, 24.02.2022), die an der Seite der Ukraine stehen und gemeinsam vereint sind: „ He [Putin] wasn’t anticipating the extent or the strength of our unity “ (Biden 21.03.2022).
Neben seinem multilateralen Engagement in der wertebasierten Koalition liegt Amerikas Wesen auch unabhängig davon im Engagement für demokratische Werte, insbesondere für Freiheit: „ We stand up for freedom. This is who we are “ (Biden 24.02.2022). Das Engagement des Landes hänge dabei nicht nur von aktuellen Umständen ab, sondern basiere auf einer zeitlich unbegrenzten, beständigen Hingabe: „ It’s the calling of our lifetime, of all time “ (Biden 12.07.2023). Ein Verweis, der versucht, diese identitätsbasierte Rolle zu stabilisieren, ist Bidens Verwendung des Ausdrucks „ arsenal of democracy “, insbesondere, als er eine Fabrik zur Produktion der Javelin-Raketen besuchte, die für die Ukraine bestimmt waren: „ America is the arsenal of democracy. That’s what we are. We always have been “ (Biden, 11.05.2022). Mit diesem Ausdruck stellt er eine intertextuelle Verbindung zum früheren Präsidenten Roosevelt her, der ihn erstmals in einer Ansprache im Jahr 1940 nutzte. Damals erklärte er die USA zum „ arsenal of democracy “, um die Verbundenheit zwischen den USA und anderen freien Nationen im „Kampf der Demokratie“ gegen die Achsenmächte zu betonen (Roosevelt 1940). Roosevelt forderte das Hochfahren der amerikanischen Rüstungsindustrie, um Großbritannien und anderen freien Nationen materielle Unterstützung zu bieten (ebd.). Daraus ergibt sich eine Parallele zu Biden, der seine Unterstützung für die Ukraine bekundet und dabei die historische Rolle Amerikas als Unterstützer von Demokratien und Verteidiger demokratischer Werte reaktiviert.
Die Verbindung zum Fremdbild von der Ukraine ergibt sich aus gemeinsamen Werten sowie dem ukrainischen Bestreben, diese Werte durch ihren Kampf gegen Russland zu schützen. Genauso wie die US-Amerikaner sind die Ukrainer demnach freiheitsliebend (vgl. Biden, 01.03.2022) und entschlossen, eine demokratische Ukraine aufrechtzuerhalten (vgl. Blinken, 01.06.2022b). „ Ukraine ’s fight is our fight - for our shared values of democracy [...] on the frontlines offreedom“ (Yellen, 27.02.2023d). Während die Ukraine und die USA gemeinsame Wertvorstellungen teilen und dadurch eine Verbindung haben, wird im Diskurs jedoch betont, dass die Ukraine sich noch im Prozess der Nationsbildung befinde. Das Ziel einer freien, souveränen und demokratischen Ukraine sei noch ein „Traum“, der auf die Unabhängigkeitserklärung vor mehr als 30 Jahren zurückgehe und für den die Ukrainer bis in die Gegenwart kämpften (Biden, 21.02.2023). Trotz des andauernden Krieges stünden dem Land auf staatlicher Ebene „notwendige Reformen“ bevor, beispielsweise zur Beseitigung der Korruption und zur Stabilisierung der Wirtschaft (Yellen, 27.02.2023d). Diese zeitliche Asymmetrie unterstreicht, dass die Entwicklung der nationalen Identität in der Ukraine nicht denselben Stand wie in den USA erreicht hat, jedoch ein Anliegen darstellt, für das sich Amerika engagiert: „ The United States remains committed to [...] their efforts to build a thriving, safe, democratic, and free future “ (Blinken, 24.02.2023b).
Neben der diskursiven Verbindung zwischen den USA und der Ukraine, die sich durch den Schutz gemeinsamer Werte auszeichnet, wird der Ukraine auch ein Alleinstellungsmerkmal at- tribuiert, nämlich ein heroischer Charakter. Dieser umfasst im Diskurs nicht nur die Streitkräfte, sondern auch die Führung und die Bürger. In diesem Sinne wird von „ heroes of Ukraine “ (Biden, 08.03.2022) „ From President Zelenskyy to every Ukrainian “ (Biden, 01.03.2022) gesprochen. Der Heroismus ist zwar ein herausragendes Merkmal, erhält jedoch seine volle Bedeutung erst in Verbindung zu anderen Elementen der ukrainischen und amerikanischen Identität. Er zeigt sich nämlich laut der Biden-Administration nicht nur darin, dass die Ukraine für sich heroisch kämpft, sondern auch für gemeinsame Werte: „ [T]he people of Ukraine [.] fight for their country and our shared democratic ideals “ (Yellen, 01.03.2022). Gemeinsam ergibt sich daraus ein „ heroicfight forfreedom “ (Yellen, 27.02.2023b).
Demgegenüber erfolgt die Unterscheidung zwischen Amerika und Russland auf räumlicher und ethischer Ebene. Einer geeinten und wertebasierten Koalition unter amerikanischer Führung an der Seite der Ukraine steht Putin demnach isoliert gegenüber: „ Putin is now isolated from the world more than ever “ (Biden, 02.03.2022). Die Isolation betrifft nicht nur seine politische Rolle, sondern auch die russische Wirtschaft, die durch die ökonomischen Druckmittel der Koalition weitgehend „isoliert und angeschlagen“ dastehe (Biden, 20.02.2023). Auch dem Schutz demokratischer Werte durch die Ukraine und Amerika steht Putin als Antagonist gegenüber, indem er mit seiner Aggression zugleich diese Werte angreift. Er wird als „russischer Diktator“ (Biden, 01.03.2022), „Tyrann“ (Biden, 24.02.2022) und „Autokrat“ (Biden, 21.02.2023) bezeichnet und mit jenen Kräften assoziiert, die den demokratischen Werten räumlich entgegenstehen. Er verkörpere „Angst und Unterdrückung“ und stehe damit für Kräfte, die „Freiheit, Demokratie und Menschenwürde“ unterlegen seien, weil diese von Tyrannen wie ihm und seiner Armee nicht ausgelöscht werden könnten (Biden, 24.02.2022). Außerdem schlägt der Diskurs eine Brücke zwischen Putin und der russischen Elite, einer Gruppe, die eine vertraute Verbindung zu ihm hat, ihn unterstützt, und deswegen mit ihm zusammen zu einem gemeinsamen Fremdbild verschmolzen wird. Hier wird ein korruptes System aus Oligarchen und anderen elitären Gruppen nachgezeichnet: „ They’re part of [.] that kleptocracy that exists in Moscow “ (Biden, 11.03.2022). Gemeint sind „ oligarchs or Russian elites who are key to President Putin’s corrupt power “ (Yellen, 02.03.2022).
Im Diskurs wird das Russland-Fremdbild jedoch nicht als einheitliches Subjekt betrachtet, da ein Teilsubjekt, das russische Volk, von Putin und der Elite abgegrenzt wird: „ We greatly respect the citizens of Russia, who are not our enemy and who deserve a better future “ (Blinken, 03.06.2022). Es handelt sich dabei um ein leidtragendes Subjekt der russischen Aggression, dem jedoch keine spezifischen Elemente zugeschrieben werden, die eine diskursive Verbindung zum amerikanischen Selbstbild aufweisen. Putins Krieg habe nicht nur den Ukrainern, sondern auch den Russen „enormes Leid und unnötige Verluste an Menschenleben“ zugefügt (Biden, 08.03.2022). Zudem seien sie Opfer der verstärkten Einschränkung ihrer Freiheitsrechte durch die Regierung (vgl. Blinken, 15.03.2022) und würden von Oligarchen bestohlen (vgl. Biden, 11.03.2022).
Der Diskurs der Biden-Administration lässt sich somit wie folgt zusammenfassen: Auf ethischer Ebene stehen die USA als verantwortungsbewusster Akteur, motiviert durch Ethik und Moral, an der Seite der Ukrainer und in Opposition zu Putins verantwortungslosem Handeln. Während Amerika auf der einen Seite für das eintritt, was als „das Richtige“ betrachtet wird, und seine „moralische Pflicht“ erfüllt, verübt Putin auf der anderen Seite durch brutal handelnde russische Streitkräfte und Söldner (Biden, 21.02.2023) unmoralische und unethische Angriffe auf die Zivilbevölkerung (vgl. Biden, 16.03.2022). Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass der Diskurs Putin nicht zwangsläufig als unethisch darstellt, obwohl dies nahegelegen hätte, sondern sich lediglich auf die Klassifikation seiner Handlungen als „ illegal and immoral actions “ (Yellen, 01.03.2022) beschränkt.
5.2 Pro-ukrainischer Unterdiskurs
Der Diskurs derjenigen Republikaner, für die die bestehenden Unterstützungsmaßnahmen nicht schnell und umfassend genug sind, weist sowohl ähnliche als auch unterschiedliche Muster im Vergleich zum Biden-Diskurs auf. Mit Ausnahme der Rechtfertigung der Unterstützung durch die Bedrohung nationaler Sicherheit (Kap. 5.2.1) und den Schutz internationaler Normen und Ordnung (Kap. 5.2.5), was hauptsächlich US-Interessen abbildet, weisen alle Muster identitäre Bezüge auf.
5.2.1 Bedrohung nationaler Sicherheit
Das erste Argumentationsmuster setzt sich aus drei Narrativen über die Bedrohung der nationalen Sicherheit für die USA zusammen, falls die Ukraine den Krieg aufgrund mangelnder Unterstützung verliert. Diese Bedrohungsnarrative beziehen sich auf Europa, den Pazifikraum um Taiwan und den Nahen Osten, wo wachsende Spannungen zu erwarten seien. Zur Bedrohung aus Europa heißt es, Putin wolle seine Aggression in der Ukraine nicht beenden, sondern den Krieg auf weitere Territorien, auch die der NATO, ausdehnen. Dafür stehen folgende Aussagen:
„ If Vladimir Putin succeeds in Ukraine, he will not stop there [...] every former repub- lic of the USSR is at risk. NATO is at risk “ (Wicker, 24.02.2022).
„ Putin will be emboldened and may well eventually invade a NATO country “ (Cruz, 18.05.2022).
Auf lange Sicht bedeute dies, dass Amerika potenziell in einen „größeren Krieg“ in Europa hineingezogen werden könnte, der mehr Menschenleben und Ressourcen kosten würde, mit einem ukrainischen Erfolg aber zu verhindere wäre (Grassley, 10.03.2022b).
Damit dieses Szenario glaubwürdig klingt, versuchen die Diskursträger Putin und seine Absichten als bedrohlich darzustellen. Seine Aggression in der Ukraine wird als Imperialismus zur Wiederherstellung eines „russischen“ (McConnell, 28.02.2022) bzw. eines „sowjetischen Imperiums“ (Cornyn, 27.02.2023; Wicker, 21.03.2022) interpretiert. Beginnend mit der Intervention in Georgien im Jahr 2008 und der darauffolgenden Annexion der Krim im Jahr 2014 (vgl. Wicker, 21.03.2022) diene die aktuelle Aggression der „Wiedereingliederung“ der Ukraine in das ehemals „russische Imperium“ (Cotton, 02.03.2022). Anschließend stünden die baltischen NATO-Verbündeten auf Putins „ kill list “, wie Wicker (15.03.2022) angemerkt hat. Um ihre Deutung der Bedrohung zu untermauern, stützen sich die Diskursträger auf Aussagen von Putin, wie etwa die, dass der Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums „die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ gewesen sei (Cornyn, 27.02.2023). Oder wie Graham (26.05.2022) es im Senat formulierte: „ His [Putins] words, not mine - he wants to recon- struct the Soviet Union, the Russian Empire. “ Durch Putins „unstillbaren Durst nach Macht“ nimmt Grassley (19.05.2022) ihn als denjenigen wahr, der mit imperialistischen Handlungen nicht aufhören wird, sondern eine Bedrohung darstellt: „ Putin is a threat “ (ebd.).
Das zweite Narrativ lautet, dass China in Taiwan intervenieren würde, falls Putin in der Ukraine erfolgreich ist. McConnell (18.05.2022) formulierte das wie folgt: „ President Xi’s Communist Party is looking for a green light to apply the Russian model to their own wish list ofsovereign territories to subjugate, starting, of course, with Taiwan. “ Obwohl es sich um zwei verschiedene Kontinente handelt, verknüpfte auch Graham (15.03.2023) die Lage in der Ukraine direkt mit einer darauffolgenden chinesischen Intervention: „ If Putin gets away with this, there goes Taiwan. The two are connected “ (Graham, 15.03.2023). Das artikulierte Risiko besteht hier weniger in der Gefahr einer direkten militärischen Konfrontation zwischen den USA und China um die Insel Taiwan, denn dieses Szenario wird zumindest im Kontext der UkrainePolitik nicht näher erläutert. Vielmehr liegt die Gefahr für die Diskursträger in Lieferengpässen bei Halbleiterchips aus Taiwan, sollte die Insel unter chinesische Kontrolle fallen. Materiell gesehen sei Taiwan eine Insel, von der „90 Prozent der weltweit fortschrittlichsten Halbleiterchips“ stammten (Cruz, 18.05.2022). Die Eroberung durch das kommunistische China würde bedeuten, dass China die weltweite Versorgung mit Halbleiterchips in einen „Würgegriff“ (ebd.) bekäme. Cruz behauptete zudem, dass ein solches Szenario chinesische Monopolgewinne und Spionage über die Halbleiterchips zur Folge hätte, was für die nationale Sicherheit Amerikas „katastrophal“ (ebd.) sei. Ähnlich wie bei der Bedrohung seitens Putins wird im Fall Taiwans auf Xis Absichten verwiesen, um auch diese auf überzeugende Weise als gefährlich darstellen zu können. Dieser habe vor, China bis 2027 mit Taiwan zu vereinen; ein Plan, den er als „Wiedervereinigung“ („ unification “) bezeichne (Cornyn, 27.02.2023).
Das dritte Narrativ ist ebenfalls eng mit einer möglichen Niederlage der Ukraine verbunden. Es besagt, dass dies den Iran ermutigen würde, die Herstellung von Atomwaffen abzuschließen. Wie Graham (17.03.2022) erklärte: „ The Ayatollah will sprint to a nuclear weapon in Iran, believing that's an insurance policy, and all the Arabs are going to want their own nuclear weapon. ” Ähnlich äußerte er sich bereits am 07.03.2022: „ Iranians are going to break out for a bomb.“ Im Vergleich zu den anderen beiden Narrativen wurde dieses Motiv im Zusammenhang mit der Ukraine allerdings weniger thematisiert und fand unter den Diskursträgern lediglich bei Senator Graham Erwähnung.
Alle drei Narrative zielen in ihre Struktur darauf zu verdeutlichen, warum die Unterstützung der Ukraine aus einer geopolitischen Perspektive wichtig ist. Um diesen geopolitischen Risiken entgegenzuwirken, bezeichnet Graham (07.03.2022) die Unterstützung des ukrainischen Volkes mit Waffen als die „richtige Vorgehensweise“.
5.2.2 Frieden durch Stärke
Angesichts der vorgetragenen Narrative, dass ein Sieg Putins weitere sicherheitspolitische Probleme nach sich ziehen würde, weshalb die Unterstützung der Ukraine erforderlich sei, zeigt das folgende Muster, dass die Diskursträger in Ergänzung dazu mögliche Konflikte durch die Doktrin ,Frieden durch Stärke’ (, Peace through Strength ‘) vermeiden wollen. Die Unterstützung der Ukraine selbst wird dabei als eine Form der Stärke gerechtfertigt, die gegenüber den amerikanischen Feinden - Russland und China - signalisiert werden soll. Die Doktrin, die auf den ehemaligen Präsidenten Ronald Reagan zurückgeht und auf die sich die Diskursträger in der Debatte direkt oder indirekt (erkennbar durch Schlagwörter) berufen, hat im Diskurs eine bestimmte Lesart erlangt. Diese wird als besonders wirksam angesehen, um vor dem Hintergrund gegenwärtiger sicherheitspolitischer Herausforderungen durch Stärke, oft auch als „Abschreckung von Konflikten“ (Wicker, 15.03.2023) bezeichnet, Auseinandersetzungen zu verhindern. Das betrifft primär die Abschreckung potenzieller Konflikte, in die Amerika durch seine Feinde verwickelt werden könnte.
Während einer Senatssitzung zum Verteidigungshaushalt für 2024 erläuterte Wicker (19.07.2023) seine Sichtweise auf die Doktrin: Früher sei es die „globale militärische Präsenz“ Amerikas gewesen, die Frieden brachte und gleichzeitig an der Doktrin des Friedens durch Stärke festhielt. Heute sehe er den besten Abwehrmechanismus in der Prävention, das heißt, den Gegner vom Angriff abzuschrecken (ebd.). Cruz (23.02.2023) versteht die Doktrin in ähnlicher Weise wie Wicker: „I believe inpeace through strength. [...] The way you avoid war is you’re so strong, your enemies don’t want to screw with you. “ Daraus leiten die Diskursträger zwei Maßnahmen ab, die zum gewünschten Frieden und zu mehr Sicherheit führen sollen: Der Aufbau eines starken Militärs bei gleichzeitiger Demonstration von Stärke. Wie McConnell (16.03.2022) betont: „ America must lead and lead with strength. “ Weiterhin unterstreicht er: „ [T]he safest America is a strong - strong - and engaged America. [...] invest in our own defense, equip our friends, and keep America safe “ (McConnell, 01.03.2023).
In die Bedeutungsstruktur dieser Lesart fügt sich die Unterstützung der Ukraine ein, die als Demonstration der Stärke ausgelegt wird, wie einige Beispiele zeigen:
„ Our support for Ukraine is not a provocation for Putin. It is a necessary show of strength, and it is a deterrence “ (Cornyn, 17.03.2022).
„ American strength is not the provocation; American weakness is. We need to help get air defense systems to Ukraine without wasting another second “ (McConnell, 15.03.2022).
Sollte die Ukraine mit US-Militärhilfe Putin besiegen, werde auch Xi erkennen, dass Aggressionen zum Scheitern führen, besonders da die USA Willensstärke („ strength of will “) besäßen, ihren Verbündeten beizustehen und sicherzustellen, dass sie die notwendigen Ressourcen für ihre Verteidigung haben, so Cruz (18.05.2022). In diesem diskursiven Kontext sichert die US- Militärhilfe nicht nur den Frieden für Amerika, ohne dass sie militärisch eingreifen muss, sondern auch den Frieden für die Ukraine selbst. Sie ist ein „Weg zum Frieden“, vorausgesetzt die notwendige Ausrüstung wird schnell bereitgestellt (McConnell, 24.02.2023b).
Aus Sicht der Idee von Frieden durch Stärke erscheint Biden aufgrund seines Zögerns, bestimmte Militärlieferungen an die Ukraine umgehend zu genehmigen, als provokativ und schwach. Ein Beispiel dafür ist seine Zögerlichkeit hinsichtlich der Genehmigung des polnischen Plans zur Verlegung sowjetischer MiG-Flugzeuge in die Ukraine (vgl. McConnell, 15.03.2022). Die Zurückhaltung wird als provokativ bewertet, da sie eine „Einladung“ an die Gegner Amerikas aussende, ähnlich wie Putin aggressiv zu handeln (ebd.). Cornyn (17.05.2022) betont, dass autoritäre Gegner der USA, wie China oder Iran, Amerikas Entscheidungen genau verfolgten und dabei nach jedem „Anzeichen von Schwäche“ suchten, um diese auszunutzen und gegen Amerika auszuspielen. Diese Ansicht wurde durch Wicker (15.03.2022) in einer Rede gestützt, in der er auf die Geschichte verweist, die gezeigt habe, dass Schwäche zu Kriegen führe und „Tyrannen“ wie Putin ermutige.
Über die Grundauslegung der Doktrin und die Kritik an Biden hinaus fällt auf, dass ,Friede durch Stärke‘ auf eine Art und Weise ausgelegt wird, die systematisch eine bedrohliche Gegensätzlichkeit des Other gegenüber dem Self abbildet. Dies manifestiert sich besonders deutlich in Begründungen von Cruz, der sich ein Amerika wünscht, das stark genug ist, um sich gleichzeitig gegen Russland und China zu verteidigen:
„America needs to be strong - strong enough to stand up to Putin, strong enough to stand up to communist China, strong enough to defend the greatest Nation in the his- tory of the world ” (Cruz, 18.05.2022).
Auf der Seite des Selbstbildes sieht er ein Amerika, gekennzeichnet durch das Element „ grea- test Nation in the history of the world “ (ebd.), das in Russland und China seinen größten Feinden gegenübersteht. Ein Jahr später legte er dies bei Verdict ausführlicher dar:
„ Russia is our enemy; China is our enemy. Both are the truth. Putin is a bad guy, Xi is a bad guy. In both instances, we have nations that are deeply antagonistic and hostile to the United States ” (Cruz, 23.02.2023).
Wie Cruz seine Feindbilder (re-)konstruiert, macht deutlich, dass er sich im Grunde Reagans Konstruktionen bedient - Fremdbilder, die während des Kalten Krieges die Sowjetunion als ein „böses Imperium“ und den Marxismus-Leninismus als auf dem „Scheiterhaufen der Geschichte“ endend darstellten (ebd.).
5.2.3 Investition in die nationale Sicherheit
Das dritte identifizierte Muster verfolgt eine ähnliche Stoßrichtung wie die beiden vorherigen, verweist aber darauf, dass die Unterstützung deswegen erfolgen sollte, weil sie aus materieller Sicht eine Investition in die eigene nationale Sicherheit darstelle. In diesem Muster bildet, wie auch im vorherigen, die (Re-)Konstruktion der politischen Realität die diskursive Grundlage für die Argumentation, wobei Russland und China als bedrohliche Feinde Amerikas auftreten. Von diesen gehe eine „wachsende Bedrohung“ aus (McConnell 28.02.2022), sodass „Putins Krieg“ gegen die Ukraine lediglich als „Manifestation der langfristigen, erheblichen Bedrohungen“ für die nationale Sicherheit betrachtet wird (McConnell, 10.03.2022). Unter Berücksichtigung dieser Bedeutungsstruktur werden die USA als mächtiger und engagierter „Anführer der freien Welt“ (McConnell 16.03.2022) gesehen, der am Beispiel der Ukraine seine unter Beweis stellen müsse: „ United States is, indeed, the leader of the free world, so it is time we acted like it “ (ebd.). Ähnlich lässt sich folgende Aussage deuten: „ We should be the great United States of America that we are because we are dealing with a sick autocrat “ (Grassley 10.03.2022).
Ein wiederkehrendes Motiv, das die Unterstützung als Investition rechtfertigen soll, ist der Verweis auf einen erheblichen Nutzen für die eigene Verteidigung und Wirtschaft. Ein Großteil des amerikanischen Geldes, das als Hilfe für die Ukraine bestimmt ist, fließe in Wirklichkeit in die eigene Verteidigungsindustrie, so McConnell (vgl. 01.03.2023). Der Investitionsprozess beruhe darauf, dass ältere Versionen von Munition und Waffen an die Ukraine verschickt und modernere Versionen nachproduziert würden (vgl. McConnell, 01.03.2023; vgl. McConnell, 24.02.2023b). Diese gewährleisteten dann, dass die eigenen Streitkräfte besser ausgerüstet seien, um Russland und China effektiver abzuschrecken (vgl. McConnell, 25.07.2023). Der wirtschaftliche Nutzen der Investition wird beispielsweise darin gesehen, dass die Produktion die Lieferkette für Rüstungsgüter „offen und am Laufen“ halte und neue Arbeitsplätze in den USA schaffe (Graham, 19.05.2022). Wicker (vgl. 19.07.2023) sieht in der Unterstützung sogar einen dreifachen Nutzen: Die bewilligten Mittel sicherten langfristige Verträge in der Rüstungsindustrie, trügen zur Modernisierung der Bestände bei und gewährleisteten die Produktion von Munition und Waffen für die Ukraine. Gleichzeitig, so Wicker, werde dies einen ukrainischen Sieg gegen Amerikas „strategischen Gegner Russland“ sichern (ebd.).
Im Umkehrschluss warnen die Diskursträger davor, dass die Konsequenzen einer ausbleibenden Investition für die Steuerzahler weitaus kostspieliger wären, womit sie den materiellen Nutzen noch weiter hervorheben. In der Debatte um das 40-Milliarden-US-Dollar-Hilfspaket im Frühjahr 2022 wurde die Warnung besonders deutlich. Aus finanzieller Überlegung argumentierte Cruz (18.05.2022), dass die 40 Milliarden aus „rein fiskalisch konservativer Sicht“ deutlich sinnvoller seien als die langfristigen Kosten, sollte Putin den Krieg gewinnen, die Hunderte Milliarden Dollar betragen würden. McConnell äußerte ähnliche Ansichten, indem er hervorhob, dass die Unterstützung im Falle eines Sieges der Ukraine aus finanzieller Perspektive weniger kostspielig wäre als die potenziellen Kosten im Falle einer Niederlage. Die Konsequenz wäre nämlich, dass enge Verbündete und Handelspartner an einen „aggressiven“ und „autokratischen Tyrannen“ angrenzen würden, was mit erheblichen Kostensteigerungen für die amerikanische Sicherheit verbunden sei (McConnell, 19.05.2022; 07.06.2022). Auch nach der Verabschiedung des Hilfspakets blieb die Warnung vor höheren Kosten bestehen, sollten zusätzliche Finanzmittel für die Ukraine, die als „direkte Investitionen“ in Amerikas eigene Kerninteressen vorgesehen seien, ausbleiben (McConnell, 24.02.2023b).
Die hier deutlich werdende materielle Perspektive stellt gleichzeitig das Narrativ, die Unterstützung aus einem Verantwortungsbewusstsein heraus zu tätigen, infrage. Zwar gab es durch Cornyn einige Versuche, amerikanisches Verantwortungsbewusstsein als Rechtfertigungsgrundlage durchzusetzen, diese Perspektive konnte sich aber nicht als Muster verfestigen. Zu Beginn des Krieges argumentierte er, dass Amerika eine moralische Verpflichtung habe, militärische und humanitäre Unterstützung bereitzustellen (vgl. Cornyn, 07.03.2022; vgl. Cornyn, 10.03.2022). Sein Standpunkt wurde allerdings von denjenigen Parteikollegen übertönt, die US-Unterstützung auf rein materiell ausgerichtete Sicherheitsinteressen begrenzt sehen wollten. McConnell verdeutlichte, dass die Unterstützung keine bloße „Philanthropie“ (McConnell, 14.05.2022), „Nächstenliebe“ (McConnell, 17.05.2022) oder „Altruismus“ (McConnell, 18.05.2022) sei, sondern eine „direkte Investition“ in die eigenen Interessen (McConnell, 24.02.2023). Gleiches gilt für Cruz, der sich in diesem Punkt als Hardliner erweist. Er ging sogar so weit zu argumentieren, dass er überhaupt kein Interesse daran habe, die ukrainische Regierung oder ihre Bürokratie oder das dortige Wohlfahrtssystem zu finanzieren (vgl. Cruz, 23.02.2023). Außerdem zeigt er in seinen Äußerungen kaum Interesse am Schutz der Demokratie oder internationaler Normen. Für ihn bleibt, dass so lange die Ukraine gegen Russland kämpft, sie dadurch verhindere, dass amerikanische Feinde stärker werden, das Land bedrohen und Kosten verursachen (vgl. Cruz, 18.05.2022). Nach all dem Druck änderte sich auch Cornyns (vgl. 27.02.2023) Standpunkt, indem er aufhörte, mit moralischer Verantwortung zu argumentieren. Danach betonte er ebenfalls, dass Amerikas Unterstützung kein „Almosen“ und kein „Wohltätigkeitsprojekt“ sei, sondern im nationalen Interesse liege (ebd.).
5.2.4 Demokratische Werte
Die vorherigen drei Argumentationsmuster sind materialistisch. Wie im Folgenden dargelegt wird, spaltet sich der Diskurs durch den Einbezug von demokratischen Werten in zwei Bedeutungsstrukturen auf: eine materialistische und eine ideelle. Zur ideellen Struktur zählt der Aspekt, dass Amerika - ähnlich wie im Biden-Diskurs - als Verfechter demokratischer Werte (re-)konstruiert und über diese Werte eine identitäre Verbindung zur Ukraine hergestellt wird.
Dass die USA als Verfechter demokratischer Werte (re-)konstruiert werden, zeigte sich besonders, als im Senat über das 40-Milliarden-US-Dollar-Hilfspaket debattiert wurde. Grassley und Graham brachten die Ansicht zum Ausdruck, dass Amerika eine historisch fundierte Aufgabe habe, sich als Verfechter der Freiheit (ein demokratischer Wert) für unterdrückte Nationen einzusetzen:
„ Because of our own history, Americans naturally sympathize with an underdog seek- ing freedom and independence in the face of an imperialist tyrant “ (Grassley, 19.05.2022).
„ America has historically been the arsenal of democracy and stood up for freedom [...]. It is in our national security interest to stand up for freedom for the Ukrainian people “ (Graham, 19.05.2022).
Mit der Selbstzuschreibung einer historischen Rolle, welche die Bedeutung von Freiheit und Demokratie betont, teilen der republikanische und der Biden-Diskurs eine Gemeinsamkeit. Sie besteht darin, dass beide Diskurse die Werte und das amerikanische Verständnis, für diese einzutreten, als identitätsgeleitet repräsentieren. Im Einklang damit wird betont, dass die Ukraine nicht nur Empfänger der amerikanischen Unterstützung sei, sondern ebenso wie Amerika selbst aktiv den Wert der Freiheit und Demokratie verkörpere. Zum einen geht dies indirekt daraus hervor, dass die Ukraine nicht nur ihre „eigene Freiheit“ (Graham/Johnson, 22.02.2023), sondern auch „unsere [amerikanischen] Werte“ verteidige (Cornyn, 01.03.2022). Zum anderen kommt es im Diskurs direkt zum Ausdruck, indem der Ukraine eine freiheitlich-demokratische Identität zugeschrieben wird. Als Beispiel hierfür kann eine Rede Grassleys (vgl. 10.03.2022) im Senat gelten, in der er die nationale Identität der Ukraine historisch gesehen als nahe der amerikanischen ansieht und gleichzeitig von der russischen abgrenzt, die gravierende Unterschiede aufweise:
„ Russia, since the Mongol invasion, has been ruled with an iron fist. By contrast, Ukraine has been home to the Cossacks, who embody a sense offreedom and individual autonomy. Just think of Ukrainian Cossacks as the equivalent of the American cowboys of the Wild West. They hated serfdom and oppressive government and sought to elect their own rulers, which they called a hetman. [A] Ukrainians’ strong national identity threatens the claim of Russian nationalists to be the heir to the ancient Kyiv civilization. [...] What Putin is really threatened by is that Ukraine, true to the history I just gave you, is asserting an independent path. They don’t like that independent path because it separates them from Russia “ (Grassley, 10.03.2022).
Um die demokratischen Werten als Rechtfertigungsgrund zu etablieren, artikulierte Cornyn mehrfach, dass die Ukraine im Krieg für diese Ideale kämpfe. Seit Russlands Angriffskrieg stünden die ukrainischen Streitkräfte „an der Frontlinie des Krieges gegen unsere Werte“. Dadurch müssten die USA alles in ihrer Macht Stehende tun, bei der Verteidigung „ihrer Freiheit“ und „ihrer Demokratie“ zu helfen (Cornyn, 01.03.2022; Cornyn 17.05.2022). In einer Erklärung zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs äußerte Cornyn (24.02.2023) zudem, dass „universelle Ideale“ Demokratien miteinander verbänden. Dadurch, dass diese Werte aktuell von autoritären Regimen wie Russland und China bedroht seien, bleibe ein geschlossener Beistand für die Ukrainer „unerlässlich“. Ein ukrainischer Sieg wäre „ein Sieg für alle“, die die Freiheit schätzen, so Cornyn (ebd.). Eine weitere rechtfertigende Aussage, die unterstreicht, dass der Kampf um Werte nicht nur auf das ukrainische Territorium begrenzt wird und eine Unterstützung aus Sicht der Diskursträger unumgänglich macht, stammt von Graham und Johnson. In ihrer Wall-Street-Journal-Kolumne schreiben sie:
„ The Ukrainians are fighting for more than their own freedom. They are fighting for the cause of freedom around the world. We should give them what they need “ (Gra- ham/Johnson, 22.02.2023).
5.2.5 Internationale Normen und Ordnung
Zusätzlich zu den demokratischen Werten wird in diesem Teildiskurs die Unterstützung als notwendig erachtet, um die Einhaltung internationaler Normen zu fördern und einen Beitrag zur Erhaltung der bestehenden internationalen Ordnung zu leisten. In weiteren Texten seiner Kolumne führte Graham dazu aus, dass eine Verweigerung wirtschaftlicher und militärischer Unterstützung für die Ukraine praktisch einer Streichung von Polizeimitteln für die bestehende „Weltordnung“ gleichkäme (Graham, 19.05.2022). Die negativen Konsequenzen wären, dass die „Weltordnung“ zusammenbrechen (ebd.) und alle Gesetze über Kriegsverbrechen „zu einem Witz“ würden, sollte Putin aufgrund unzureichender Unterstützung für die Ukraine den Krieg gewinnen (Graham, 10.05.2022). Beim Zusammenbruch der Ordnung würde die „globale Sicherheitsarchitektur“, die seit 1945 dazu beigetragen habe, „Frieden und Wohlstand in Amerika zu sichern“, zu Ende gehen (Wicker, 19.07.2023). Im Umkehrschluss sei zu erwarten, dass sich „die Welt mit der Zeit stabilisieren“ werde, wenn Putin in der Ukraine verliert (Graham, 19.05.2022). In diesem Zusammenhang zählte Graham in einer Senatsrede die positiven Aspekte eines ukrainischen Sieges auf:
„ I am here to say that victory for Ukraine is victory for America; it is victory for the rule of law; and it is victory for the post-World War II order that has led to historic prosperity “ (Graham, 16.03.2022).
Ob positiv oder negativ motiviert, aktuell stehe das „Prinzip der Rechtsstaatlichkeit“ gegenüber dem „Prinzip der Waffengewalt auf dem Spiel“, für das sich Putin entschieden habe, weshalb mehr tödliche Waffen an die Ukraine geschickt werden müssten (Graham, 26.05.2022). Mit dem gegenwärtigen Krieg sei eine Phase eingeleitet worden, in der sich entscheide, wer künftig die Weltordnung bestimmt: Entweder die USA, die die „Herrschaft des Rechts“ aufrechterhalten wollten, oder „die kommunistische Diktatur in China“ und „Leute wie Putin“, die auf solches verzichteten und stattdessen „ the rule of the gun “ priorisierten (Graham, 12.05.2022).
Im Vergleich zum vorherigen Muster, bei dem der Schutz demokratischer Werte als identi- tär verstanden wird, ist der Schutz von Normen und Ordnung nicht explizit als identitär konno- tiert. Vielmehr scheint der Schutz der Rechtsstaatlichkeit und der internationalen Ordnung den Aussagen nach darauf ausgelegt zu sein, den amerikanischen Einfluss in der Welt zu rechtfertigen. Diese Annahme bestätigt Wickers Aussage im Senat, dass mit dem Zusammenbruch der bisherigen Ordnung Amerikas „Frieden und Wohlstand“ verspielt wäre (Wicker, 19.07.2023). Zwar wird somit nicht genau artikuliert, inwieweit die Förderung des internationalen Regelwerks identitären Charakter hat, aber zur Repräsentation der Staaten, die dieses Regelwerk bedrohen, werden im Diskurs Identitätselemente aktiviert. Bei diesen Akteuren handelt es sich im Diskurs um Russland und China, angeführt von Putin und Xi - zwei „Diktatoren“ (Wicker, 22.02.2023), die bestrebt seien, die bestehende „friedliche internationale Ordnung“ durch „Einflusssphären“ zu ersetzen (McConnell, 28.02.2022). Während Xi danach strebe, das Regelwerk zukünftig durch die Einverleibung Taiwans zu missachten, sei bei Putin die Missachtung der ukrainischen Souveränität Gegenwart. Insofern wird ein verbrecherisches Wesen Putins (re- )aktiviert, der versuche, die Ukraine zu „zerstückeln“ und ihre demokratisch gewählte Regierung zu „enthaupten“ (McConnell, 28.02.2022). Durch dieses Vorhaben gilt er im Diskurs ethisch gesehen als „machthungriger“ (Cornyn, 27.02.2023), „mörderischer Diktator“ (Graham, 17.03.2022) und „Kriegsverbrecher“ (Graham, 12.05.2022).
5.2.6 Ukrainischer Heroismus
Abschließend ist darauf zu verweisen, dass die Unterstützung ähnlich wie im Biden-Diskurs durch die heroischen Eigenschaften der Ukrainer gerechtfertigt wird. Diese Eigenschaften lassen sich zu einem Identitätselement summieren, das aber diskursiv nicht für sich allein steht, sondern mit dem heroisch ausgetragenen Kampf gegen Russland verflochten ist. Wie der Diskurs offenbart, bilden die Eigenschaften und der Kampf zusammen zwei Inspirationsquellen, welche die amerikanische Unterstützung auf sich ziehen.
Die Diskursträger artikulieren zahlreiche heroisch konnotierte Eigenschaften, wenn sie über die Ereignisse und den Widerstand der Ukrainer vor Ort sprechen. Die am häufigsten genannten sind Mut, Stärke, Resilienz und Entschlossenheit, wie drei ausgewählte Zitate zeigen sollen:
„ The bravest people on the planet are the Ukrainian people “ (Graham, 17.03.2022).
„ President Zelensky embodies the resolve, courage, and indominable will of all Ukrainians “ (Cotton, 08.03.2022).
„ Zelenskyy, of course, is a product of Ukrainian culture that values strength, resilience, a love of homeland, and we know that the people of Ukraine are the same and certainly no different “ (Cornyn, 17.05.2022).
Solche Aussagen sollen in erster Linie das amerikanische Publikum davon überzeugen, dass es sich um einen „heroischen“ und „inspirierenden“ Kampf handle, der neben wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland auch materielle Unterstützung für die Ukraine erfordere, um aufrechterhalten zu werden (Cornyn, 01.03.2022). In einem Interview mit FoxNews ging McConnell (vgl. 01.03.2022) in diesem Punkt sogar noch weiter, indem er appellierte, nicht nur generell materielle Unterstützung bereitzustellen, sondern alles, was die Ukraine brauche, so schnell wie möglich zu geben. Eine seiner Begründungen dafür lautete, dass die Ukrainer viel getan hätten, um die Welt zu „inspirieren“ (ebd.).
Der Verweis auf den heroischen und inspirierenden Kampf ließ im Zeitverlauf nicht nach, was immer wieder aufs Neue dieselbe Rechtfertigung ermöglichte. Wie zwei Diskursträger artikulieren, beschränke sich dieser Heroismus nicht auf eine einmalige Aktion zu Beginn der Invasion, sondern werde jeden Tag aufs Neue bestätigt (vgl. McConnell, 07.06.2022) und setze sich nach wie vor fort (vgl. Wicker, 28.02.2023). Wenn sie von heroischen Ukrainern sprechen, beziehen sie sich nicht nur auf die Streitkräfte, sondern auch auf das ukrainische Volk als Ganzes. Aus Diskursperspektive heißt dies, dass Ukrainer aus verschiedenen Bevölkerungsschichten und mit unterschiedlichen Funktionen ein einheitliches ukrainisches Subjekt bilden, dessen Heldenhaftigkeit als Rechtfertigungsgrundlage aufgeführt wird:
„ The world has been awestruck at the courage of teachers, architects, grandmothers, Ukrainians from all walks of life “ (Cornyn, 07.03.2022).
„ The brave and free men and women of Ukraine, along with their elected leaders, have inspired the world with their courage and resolute determination “ (McConnell, 24.02.2023b).
„ The courage and ingenuity shown by Ukrainian troops, many of whom were civilians before the war, continues to be nothing short of heroic “ (Wicker, 28.02.2023).
Das Muster des ukrainischen Heroismus knüpft nahtlos an die vorangegangenen Rechtfertigungen an. Es steht in kohärenter Verbindung zum wert- und normbasierten Handeln Amerikas, das sich für Freiheit, Demokratie und Souveränität einsetzt. Der Heroismus offenbart nämlich, dass die Ukrainer auf ihre Weise versuchen, genauso wie die USA für gemeinsame Werte und Normen einzutreten. Diese Lesart schafft eine diskursive Brücke zwischen Amerika und der Ukraine, was die Rechtfertigung aufgrund einer gemeinsamen ideellen Grundlage erleichtert. Einige Diskursträger artikulieren, dass sich die Ukrainer „mutig“ für die „Verteidigung ihrer Demokratie“ (Cornyn, 07.03.2022) und ihrer „Freiheit“ einsetzten, obwohl sie „zahlenmäßig und waffentechnisch“ unterlegen seien (Barrasso, 02.03.2022). Ein weiteres Beispiel, das die Verbindung zwischen ideeller Gemeinsamkeit und gerechtfertigter Unterstützung verdeutlicht, ist ein Tweet von McConnells (vgl. 16.03.2022b) aus der Frühphase des Krieges. Er plädierte damals nachdrücklich für mehr Waffenlieferungen an die Ukrainer, da sie der Welt „unglaublichen Mut und Widerstandsfähigkeit“ bewiesen und für die Erhaltung von „Souveränität und Freiheit“ kämpften.
Darüber hinaus steht die Idee des Heroismus im Einklang mit der Erwartung, dass sich die Investition in die ukrainische Verteidigung lohnt. Das betrifft etwa die Abwendung möglicher Bedrohungen für Amerika, indem durch umfassende Unterstützung ein ukrainischer Sieg erwirkt wird (siehe Kap. 5.2.3). Der geschilderte ukrainische Heroismus soll nämlich sicherstellen, dass die Ukrainer am eigenen Sieg festhalten und somit das amerikanische Sicherheitsinteresse mit erfüllen werden. Dies veranschaulichen McConnells (vgl. 14.05.2022) Worte, nach seinem Kyjiw-Besuch. Er habe aus erster Hand erleben dürfen, dass die Ukrainer „bereit und entschlossen“ seien, „bis zum Sieg“ zu kämpfen. Ähnlich äußerte sich sein Parteikollege Cornyn, der auf derselben Reise war und ein Jahr später erneut betonte, dass die Ukrainer durch „Stärke, Widerstandskraft und Heimatliebe“ bewiesen hätten, dass sie den Krieg gewinnen würden (Cornyn, 24.02.2023).
Die Artikulation des ukrainischen Heroismus erfolgt jedoch nicht isoliert, sondern in bewusster Abgrenzung zu Putin und den damit verbundenen, negativ konnotierten Zuschreibungen. Von einer Reise nach Kyjiw kehrte Wicker mit der Botschaft zurück, dass sich der „russische Tyrann aus der [ukrainischen] Nachbarschaft“ („ Russian neighborhood bully “) durch „Mut und Entschlossenheit“ der Ukrainer eine „blutige Nase“ holen werde (Wicker, 21.03.2022). An anderer Stelle heißt es, dass die Ukrainer angesichts eines „geistesgestörten Eindringlings“ („ deranged invader“) (McConnell, 14.05.2022) oder eines „kriegslüsternen Diktators“ („ belli- gerent dictator “) Heroismus unter Beweis stellten (Cornyn, 24.02.2023).
5.2.7 Identitätskonstruktion unter den republikanischen Unterstützern
Im Vergleich mit dem Biden-Diskurs weist der Unterdiskurs der Biden-kritischen Republikaner sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede im Bereich des Self und des Other auf. Was die Gemeinsamkeiten betrifft, so wird im Diskurs Amerika erneut die Rolle des Verfechters demokratischer Werte zugeschrieben - ein Element, das einerseits mit der freiheitlich-demokratischen Ukraine und ihrem heroischen Kampf verbunden und andererseits von der bedrohlich-autoritären Herrschaft Putins abgegrenzt wird. In dieser Konstellation treten die USA als Verfechter demokratischer Werte auf, da es in der Ukraine um die Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Bereitschaft gehe, für „Werte einzutreten“ und „Freiheiten zu verteidigen“ (Cornyn, 24.02.2022). Ähnlich dem Biden-Diskurs fungiert hierbei die intertextuelle Verbindung zu Roosevelt als Stabilitätsfaktor für die amerikanische Verfechterrolle: „ They [Ukrainians] are fighting on behalf of freedom itself, and we should be the arsenal of democracy “ (Graham, 12.05.2022). Der Verweis auf Roosevelt sichert Stabilität, da die Übernahme des Ausdrucks „ arsenal of democracy “ darauf hinweist, dass die Unterstützung für die Ukraine nicht bloß ein zeitgenössischer Akt ist. Sie wird vielmehr als Fortführung der historischen Rolle Amerikas dargestellt, sich für bedürftige Demokratien einzusetzen: „ America has historically been the arsenal of democracy “ (Graham, 19.05.2022). Die intertextuelle Verbindung schlägt sich außerdem im Gesetzestext nieder, als Biden am 09. Mai 2022 den von Cornyn eingebrachten Entwurf des Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act unterzeichnete. Das Gesetz greift auf einen Mechanismus zurück, der es Cornyn zufolge Roosevelt 1941 ermöglichte, den demokratischen Verbündeten Amerikas militärische Ausrüstung bereitzustellen, um sein Prinzip „ arsenal of democracy “ zu verwirklichen (Cornyn, 17.05.2022).
Das Element, Amerika als Verfechter demokratischer Werte zu zeichnen, wird jedoch durch Cruz‘ kritische Stimme teilweise aufgeweicht. Er lehnt es ab, die Unterstützung für die Ukraine primär auf das ideelle Ziel auszurichten, die „Demokratie weltweit zu verteidigen“ (Cruz, 18.05.2022). Stattdessen betrachtet er dies als „leeren Nonsens“ und argumentiert, dass der Hauptgrund materiell orientierte Sicherheitsinteressen sein sollten (ebd.). Die Stabilität des Diskurses wird in diesem Punkt jedoch nicht ausgehebelt, insbesondere weil Cruz von seinen Parteikollegen Graham, Cornyn und McConnell übertönt wird - Diskursakteure, die maßgeblich an der (Re-)Konstruktion der USA als Verfechter demokratischer Werte mitwirken.
Die diskursive Verbindung zur Ukraine basiert darauf, dass dem Land identitätseigene Elemente zugeschrieben werden. Dies lässt sich beispielsweise an Grassleys Aussagen veranschaulichen, der die Ukraine als eine Nation beschreibt, die bereits in ihrer Vergangenheit, konträr zum autoritären Russland, freiheitlich-demokratische Werte verkörpert habe, z. B. durch Selbstbestimmung und freie Wahlen (vgl. Grassley, 10.03.2022). Heute gelte sie als eine „befreundete Demokratie“ (Cornyn, 01.03.2022). Die Verbindung entsteht ebenfalls durch die Heroisierung der Ukrainer, die sich mit ihrem heroischen Kampf nicht nur für die eigene, sondern gleichzeitig für die „Freiheit weltweit“ einsetzten (Graham/Johnson, 22.02.2023), ähnlich wie Amerika als Verfechter demokratischer Werte. Demgegenüber steht erneut die bedrohlich-autoritäre Herrschaft Putins, welche die Demokratie untergrabe. Er wird als „Diktator“ bezeichnet, der versuche, die Ukraine zu destabilisieren und ihre demokratisch gewählte Regierung zu stürzen (McConnell, 28.02.2022). Die Ukraine strebe daher nach Freiheit und Unabhängigkeit angesichts eines „imperialistischen Tyrannen“ (Grassley, 19.05.2022).
In Anbetracht der identifizierten Gemeinsamkeiten sollte gerade den Unterschieden zum Biden-Diskurs besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dabei gilt es in erster Linie darauf hinzuweisen, dass Amerika nicht nur auf seine Wertorientierung beschränkt wird, sondern unabhängig davon als starke und selbstbewusste Nation mit einer führenden Rolle in der Welt konstruiert wird:
„America must lead and lead with strength. [...] United States is, indeed, the leader of the free world, so it is time we acted like it “ (McConnell, 16.03.2022).
„America needs to be strong - [...] the greatest Nation in the history of the world“ (Cruz, 18.05.2022).
In diesem Punkt spaltet sich der Diskurs auf, da die Unterstützung nun weniger darauf abzielt, einer befreundeten, freiheitlich-demokratischen Ukraine zu Hilfe zu kommen, sondern vielmehr darauf ausgerichtet ist, in der Großmachtkonkurrenz gegen die bedrohlichen und feindlichen Mächte Russland und China zu bestehen. Dementsprechend wird Russland im Vergleich zum Biden-Diskurs weitaus radikaler konstruiert. Es ist Amerikas „strategischer Gegner“ (Wicker, 19.07.2023) und „Feind“, regiert von einem „ bad guy “ (Graham, 16.03.2022; Graham, 12.05.2022), der zweifellos „Kriegsverbrecher“ ist (Graham, 25.02.2022; Wicker, 15.03.2022). Zusätzlich wird das kommunistische China als weiteres Fremdbild hinzugefügt und auf dieselbe Differenzebene wie Russland gestellt. Beide Staaten sind den USA demnach „zutiefst feindlich gesinnt“, beide Regierungschefs sind „ bad guys “ (Cruz, 23.02.2023).
5.3 Anti-ukrainischer Unterdiskurs
Der Diskurs der Unterstützungsgegner verfolgt eindeutig eine konter-hegemoniale Bedeutungsstruktur, da kaum Gemeinsamkeiten mit dem Biden-Diskurs erkennbar sind. Mit Ausnahme der Rechtfertigung der Ablehnung aufgrund der fehlenden Sicherheitsbedrohung (Kap. 5.3.3) und der Priorisierung einer Verhandlungslösung (Kap. 5.3.6) enthalten alle Muster identitäre Bezüge.
5.3.1 Innenpolitische Prioritäten
Das zentrale Argumentationsmuster im anti-ukrainischen oppositionellen Unterdiskurs zielt darauf, die vorgebrachten Gründe zur Rechtfertigung der Ukraine-Unterstützung zu untergraben. Kritisch eingestellte Diskursträger argumentieren, innenpolitische Probleme seien gegenüber der Ukraine vorzuziehen und vorrangig zu bewältigen. Die politische Unterstützung stellen sie hingegen als Kurs dar, der falsche Prioritäten setze und dazu führe, dass die Amerikaner vernachlässigt würden.
Zu den zentralen innenpolitischen Problemen, die Vertreter dieses Unterdiskurses wiederholt artikulieren, gehören die Sicherheit der eigenen Grenzen, wirtschaftliche Probleme und der Mangel an Babynahrung. In Bezug auf den Grenzschutz wird argumentiert, dass die Mittel, die für die Ukraine vorgesehen sind, stattdessen für den Schutz der US-Grenze und den Kampf gegen Drogenkartelle eingesetzt werden sollten. Gleich zu Beginn des Krieges dient das Thema Grenzsicherheit als Versuch der Delegitimierung, indem darauf verwiesen wird, dass der ukrainischen Grenzsicherheit mehr Aufmerksamkeit geschenkt werde als der eigenen: „ Biden orders our border patrol to leave our border open to help Ukraine with its borders. #AmericaLast “ (Gosar, 24.02.2022). In einem Newsmax -Interview gab Gaetz wenige Tage später zu verstehen, dass seine pro-ukrainischen republikanischen Parteikollegen Besorgnis über die ukrainische Grenze äußerten, während er selbst der Meinung sei, dass die „Kämpfe näher an der Heimat“ für Amerikaner von größerer Bedeutung seien (Gaetz, 28.02.2022). Davidson kritisierte, dass das Homeland Security Department mehr Wert auf die ukrainische als auf die eigene Grenzsicherheit lege. Er bemängelte zudem, dass die nachrichtendienstliche Priorität eher „potenziell feindlichen Ländern“ (wie Russland) als den „eindeutig feindlichen“ mexikanischen Drogenkartellen gelte (Davidson, 02.03.2022).
Daran anknüpfend wuchs in den folgenden Monaten die Unzufriedenheit, dass die finanzielle Unterstützung für die Ukraine den Betrag für den eigenen Grenzschutz um ein Vielfaches übersteige. In Bezug auf das 40 Milliarden-US-Dollar-Hilfspaket heißt es, dass die Ukraine angesichts der Ausgaben für den Zoll- und Grenzschutz, die sich auf 15,3 Milliarden US-Dollar beliefen, „mehr als doppelt so wichtig“ sei als das eigene Heimatland (Gaetz, 11.05.2022). Nach mehr als einem Jahr Kriegsdauer wurde darauf verwiesen, der Kongress habe inzwischen einer Unterstützung in Höhe von 113 Milliarden US-Dollar zugestimmt, was „ungefähr das Zehnfache der Kosten für den Bau unserer eigenen Grenzmauer“ entspräche, und dies „losgelöst vom Willen der Amerikaner“ (Greene, 13.07.2023).
Was die Wirtschaft und den Mangel an Babynahrung anbelangt, so wurden die Probleme in den ersten Kriegsmonaten thematisiert, um drängende Sorgen der amerikanischen Bevölkerung widerzuspiegeln und von der Bedeutung der Ukraine-Unterstützung abzulenken. Während in den Nachrichten nur von der Ukraine die Rede wäre, seien die eigentlichen Anliegen der „echten Amerikaner“ nicht die Ukraine, sondern die überteuerten Gaspreise, steigende Lebensmittelpreise und die zunehmende Inflation (Greene, 17.03.2022). Mit dem Ausdruck „ and we go, Oh, blank check, $40 billion “ äußerte Roy seinen Unmut darüber, dass vor dem Hintergrund steigender Schulden und explodierender Benzinpreise ein Hilfspaket verabschiedet wurde (Roy, 17.05.2022). Angesichts steigender Preise könne die Ukraine gar nicht gerettet werden, solange die „US-Wirtschaft dem Untergang geweiht“ sei (Paul, 12.05.2022). Außerdem erhob Greene öffentlich Einspruch gegen das 40-Milliarden-Hilfspaket, indem sie mehrmals in ihrer Rede die vielfältige Ukraine-Unterstützung dem gleichzeitigen Mangel an „Babynahrung für amerikanische Mütter und Babys“ gegenüberstellte (Greene, 10.05.2022).
Die genannten Probleme eröffnen einen diskursiven Raum, der es den Kritikern der Unterstützung fortwährend ermöglicht, eine ablehnende Haltung gegenüber der Hilfe für die Ukraine einzunehmen, ohne jedes Mal erneut auf spezifische Inlandsprobleme hinweisen zu müssen. Ohne konkretere Begründungen abzugeben, hieß es dann in Bezug auf das 40-Milliarden-Paket auf Twitter: „[W]e cannot continue to spend money we don’t have “ (Paul, 13.05.2022). Ähnlich kritisierte Gaetz (26.05.2022) in seinem Vodcast, dass das Ergebnis des Pakets insgesamt nicht gut für das amerikanische Volk sei. In späteren Monaten, als die ausgegebene Geldsumme Hawley zufolge bereits über 100 Milliarden US-Dollar lag, teilte dieser bei FoxNews mit, dass er nicht mehr mitmachen wolle und dass das amerikanische Volk es satt habe. Stattdessen forderte er, dass die Europäer mehr Verantwortung für die Ukraine übernehmen müssten (vgl. Hawley, 01.03.2023). Als über die Verteidigungsausgaben für das Jahr 2024 debattiert wurde, gab Greene auf Twitter bekannt, dass sie die im NDAA25 enthaltenen 300 Millionen US-Dollar und die Lieferung von F-16-Jets durch einen Änderungsantrag verhindern möchte, um nicht den „Krieg in einem anderen Land“ zu finanzieren (Greene, 10.07.2023).
Basierend auf der inländischen Problemlage wird nicht nur eine ablehnende Haltung gegenüber den Finanzhilfen eingenommen, sondern darüber hinaus die Darstellung der amerikanischen Identität beanstandet, die in den Diskursen der vorherigen Kapitel als wichtige Rechtfertigungsgrundlage diente. Genauer gesagt werden die Identitätselemente eines Amerikas infrage gestellt, das sich als wertbasierter Akteur für Freiheit und Demokratie engagiert und sich verantwortungsbewusst für das Wohl anderer Länder einsetzt. In seinem Podcast Firebrand hinterfragte Gaetz die Glaubwürdigkeit des Begriffs „Werte“, indem er darauf hinwies, dass dieser stärker auf die Ukraine als auf die USA abziele: „ [D]on’t tell me about your values. If you show me your checkbook, I can tell you about your values and in this case America’s check- book seems to be valuing Ukraine more (Gaetz, 10.05.2022). Den Ausdruck „Verteidigung der Freiheit in der Ukraine“, der häufig in der Debatte verwendet wird, stellte Gaetz mehrfach im negativen Licht dar (Gaetz, 26.02.2022). Er argumentiert, dass die Freiheit der Amerikaner beeinträchtigt sei, weil deren Geld in die Ukraine fließe, da sie „höhere Kosten und weniger Auswahl“ hätten (ebd.). Die „Rettung der Demokratie“ sieht Gosar als einen durchsichtigen Vorwand, um US-Steuergelder nicht für Amerika, sondern für andere Länder einzusetzen (Gosar, 17.03.2022). Das amerikanische Verantwortungsbewusstsein, wie es im Biden-Diskurs vorzufinden ist, wird beanstandet, indem Amerika als „Weltpolizist“ „ Uncle Sam “ bezeichnet wird, der in seinem internationalen Einsatz nur weitere Schulden verursache. Beispielhaft dafür stehen folgende Aussagen:
„ It isn’t that we always have to be the Uncle Sam, the policeman who saves the world [...]. With a $30 trillion debt, America can ’t afford to be the worldspoliceman“ (Paul, 12.05.2022).
„ Uncle Sam’s tab is full. It is complete. To be clear, I am not for raising taxes to finance Ukraine’s defense, but it is irresponsible to simply borrow more money “ (Paul, 17.05.2022).
Auch wenn im Biden-Diskurs Amerika nicht als eine Art Weltpolizei (re-)konstruiert wird, spielt Paul hier auf das ethisch-moralische Motiv hinter der Unterstützung an, wie es zum Beispiel von Yellen (27.02.2023) zum Ausdruck gebracht wurde: „ Americans have always been quick to stand up to do the right thing [...]. Our support is motivated, first and foremost, by a moral duty to come to the aid ofa people under attack “. Das Bemerkenswerte am beschriebenen Diskursausschnitt ist, dass keine alternativen Identitätselemente artikuliert werden, sondern nur die vorhandenen negativ konnotiert werden.
5.3.2 Die ,korrupte Ukraine’ als ,Geldwäscheparadies‘
Mit dem vorherigen Argumentationsmuster stellen die kritisch eingestellten Diskursträger ein internationalistisches Amerika, das nach der Erreichung ideeller Ziele im Ausland strebt, in negativem Licht dar. Durch eine spezifische (Re-)Konstruktion der Ukraine tun sie dasselbe, indem sie dem Land negative Eigenschaften zuschreiben, die das nationale wirtschaftliche System repräsentieren sollen. Sie bedienen sich dieser Eigenschaften, um sowohl ihre Ablehnung finanzieller Unterstützung für das Land zu rechtfertigen als auch um die bereits überwiesenen Hilfen in ein negatives Licht zu rücken.
Die erste kritisierte Eigenschaft besteht darin, dass die Ukraine ein „korruptes Land“ (Greene, 20.03.2022) mit einem „historischen“ Ausmaß an Korruption repräsentiere (Gaetz, 22.02.2023). In einem Interview mit Newsmax vertrat Gaetz (28.02.2022) sogar die Ansicht, dass es sich bei der Ukraine um das „drittkorrupteste Land der Welt“ handle. Auch die zweite zugeschriebene Eigenschaft fokussiert auf einen verantwortungslosen Umgang mit Geldflüssen. Das Land sei ein „globales Geldwäscheunternehmen “ („ global money laundering enterprise“) für amerikanische und globalistische Eliten (Gaetz, 28.02.2022) und Kyjiw eine Art „Geldwäschehauptstadt Europas“ („ money laundering capital ofEurope “) (Gaetz, 10.05.2022). Die in die Ukraine fließenden 40 Milliarden US-Dollar aus dem zuvor verabschiedeten Hilfspaket waren Gaetz zufolge nur eine „Geldoperation für die Eliten“, was bedeutet, dass es eine Gelegenheit gewesen sei, amerikanisches Geld dort zu waschen (ebd.).
Die beiden (re-)konstruierten Eigenschaften haben zweifelsohne das Potenzial, beim amerikanischen Publikum den Eindruck zu erwecken, dass die finanzielle Unterstützung eine Verschwendung amerikanischer Steuergelder darstellt, welche so lange andauert, wie dem osteuropäischen Land finanziell geholfen wird. Um die Verschwendung von Steuergeldern durch Korruption in der Ukraine zu unterstreichen, nannte Pauls in einer Rede im Senat verschiedene Beispiele:
„ There will be 40 billion in this for restaurants. New grants will go to yachts, yacht clubs, limousine businesses, racket clubs, and luxury gyms, and minor league sports.
[...] [W]hile Americans across the country are gettingpoorer“ (Paul, 19.05.2022).
Ein Jahr später, als die Geldsumme weiter erhöht wurde, erneuerte er seine Kritik: „ The United States sent $113 billion in aid to Ukraine. It is impossible to send this much aid this fast into war-torn Ukraine without waste, fraud, and abuse “ (Paul, 26.07.2023).
5.3.3 (Fehlende) Sicherheitsbedrohung
Die Diskursträger delegitimieren die Unterstützung der Ukraine nicht nur durch den Verweis auf innerstaatliche Probleme und eine negative Darstellung der Ukraine, sondern thematisieren auch die äußere Sicherheit Amerikas, um dieses Ziel zu verfolgen. Zum einen argumentieren sie, dass der Krieg in der Ukraine die nationale Sicherheit der USA im Gegensatz zu China nicht bedrohe, und zum anderen, dass die Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine Probleme für die eigene Sicherheit verursachten. Beide Argumentationsstränge führen zu der Schlussfolgerung, dass die Unterstützung für die eigenen Sicherheitsinteressen kontraproduktiv wirkt.
Unter Rückgriff auf den ersten Argumentationsstrang positionierte sich Gosar bereits zu Beginn des Angriffskriegs mehrfach gegen jegliche amerikanische Einmischung, wobei er betonte, im Namen aller Amerikaner zu sprechen. Der Krieg sei „nicht unser“ (Gosar, 25.02.2022), dieser habe nichts mit der eigenen nationalen Sicherheit zu tun (Gosar, 02.03.2022) und die Ukraine sei nicht „unser Problem“ (Gosar, 06.08.2023). Ein weiterer Versuch, die Bedrohung durch Russlands Krieg in der Ukraine herunterzuspielen, stammt von Paul (17.05.2022), der eine Gefahr im „Krieg des Kongresses“ gegen den eigenen Steuerzahler und nicht im dem Russlands gegen die Ukraine sah. Damit impliziert er, dass der Steuerzahler, der die eigentliche Finanzierungsquelle der Ukraine darstelle, von der Führung zur Unterstützung gezwungen werde.
Das Narrativ einer fehlenden Bedrohung wird durch die Artikulation der räumlichen Distanz zum Krieg in der Ukraine verstärkt. Gosar betont, dass dieser „5000 Meilen“ von Amerikas Grenze (Gosar, 02.03.2022) und „6000 Meilen“ vom Bundesstaat Arizona entfernt stattfinde (Gosar, 25.02.2022). Neben der räumlichen Distanz versucht Vance (vgl. 26.02.2022) zudem eine emotionale Distanz aufzubauen. Er habe es satt, dass man sich mehr um Menschen kümmern müsse, die „6000 Meilen“ weit entfernt sind (die ukrainische Bevölkerung) als um die eigene Bevölkerung. Konkret nennt Vance „ my mom and my grandparents and all the kids affected by this crisis “ (ebd.).
Im Vergleich zum Krieg in der Ukraine wird China hingegen als eigentliche Bedrohung dargestellt: „ [The] real threat in this world [...] is the Chinese “ (Vance, 17.07.2023). Gleichzeitig wird China als Grund aufgeführt, keine weitere Unterstützung für die Ukraine zu leisten: „ [W]e need to be focused on China but what we don’t need to do is spend any more money on Ukraine “ (Hawley, 17.03.2023). Im ausgewerteten Material gehen die Diskursträger jedoch nicht darauf ein, warum China im Gegensatz zu Russland als Bedrohung wahrgenommen wird. Im Diskurskontext erscheinen die Aussagen in Richtung China primär als eine Strategie, um die Unterstützung der Ukraine als kontraproduktiv darzustellen. Die zentrale narrative Verbindung zwischen China und Russland im ersten republikanischen Unterdiskurs, dass der beste Weg, Chinas expansiven Plänen Einhalt zu gebieten, darin bestehe, dass Putin seinen „Angriffskrieg in der Ukraine“ verliert (Wicker, 22.02.2023), wird von den Unterstützungsgegnern weitgehend infrage gestellt. Als Beispiel dafür sind Vances Aussagen anzuführen, in denen er das Narrativ, die Stärkung der Ukraine sei eine warnende Botschaft an China, sich nicht mit Taiwan oder dem Rest von Ostasien anzulegen, als Lüge bezeichnet (vgl. Vance, 16.07.2023). Er halte es militärpolitisch für „einen Witz“, sich während eines akuten Mangels an Artilleriegeschossen, der den vielen Lieferungen geschuldet sei, gleichzeitig auf China und Russland konzentrieren zu wollen (Vance, 09.07.2023).
Am Beispiel der militärischen Unterstützung wird hier deutlich, dass die Bedeutung von Stärke und Schwäche, wie sie im vorherigen Unterdiskurs artikuliert wird, angesichts der Bedrohung durch China umgedeutet wird. Munitionslieferungen sorgen für Mangel und verursachen Schwäche, während ihre Zurückhaltung Stärke fördert:
„ China [.] cares about how strong we are. And if we’re sending so many of our bullets to Ukraine that we can’t preserve them for our own troops; that is a disaster “ (Vance, 16.07.2023).
„ We need to stop supporting the Ukrainian war effort at the least until we have enough bullets for our own country “ (Vance, 17.07.2023).
Aber auch ohne China jedes Mal aufs Neue zu erwähnen, wird argumentiert, dass die Lieferung von Militärgütern an die Ukraine ein Sicherheitsproblem verursache. Durch die zurückgehenden Bestände an Artilleriegranaten sei der Krieg eine „massive Belastung“ für die nationale Sicherheit geworden (Vance, 09.07.2023). Die Lieferung anderer Güter, wie Flugzeuge oder Raketen, „erschöpft aktiv“ die militärischen Ressourcen, wodurch die USA für ihre Gegner angreifbarer werde (Greene, 12.07.2023).
5.3.4 Gefahren aufgrund der Unterstützung
Aufbauend auf der Sicherheitsbedrohung, die aus der Unterstützung resultieren würde, mahnen die Diskursträger zusätzlich mit dem Narrativ, dass die Unterstützung zur Ausweitung und Eskalation des Krieges unter Beteiligung Amerikas führen könnte.26
In der Diskussion um die 40-Milliarden-Hilfe für die Ukraine warnte Greene (10.05.2022b) vor einer Kriegsbeteiligung mit der rhetorischen Frage in Richtung Biden: „ [W]hy are you dri- ving us to war with nuclear Russia? “ In derselben Debatte bezeichnete Gaetz (11.05.2022) das Hilfspaket als einen „gefährlichen überparteilichen Konsens“, womit er seine Sorge vor Russlands Atomwaffen zum Ausdruck brachte. In einem FoxNews -Interview fügte er hinzu, dass er nicht wisse, ob die 40 Milliarden US-Dollar nicht den Dritten Weltkrieg auslösen würden (Gaetz, 13.05.2022). Auch im Juli 2023 setzten sich die Warnungen fort, insbesondere im Zusammenhang mit Bidens Entscheidung, Streumunition zu liefern. Dass 50 Jahre nach dem Vietnamkrieg immer noch Streumunition entschärft werden müsse, bezeichnete Gaetz (15.07.2023) als „eine schreckliche Sache“. Damit würde „ Sleepy Joe “ (Biden) Amerika in einen direkten Krieg mit einer Atommacht „schlafwandeln“ (ebd.). Zwei Tage zuvor nutzte er eine ähnliche Ausdrucksweise, um seinen Antrag auf Verbot der Sicherheitshilfe für die Ukraine im Repräsentantenhaus zu rechtfertigen: „ I offer this amendment because the Biden administration is sleepwalking our great country into a world war “ (Gaetz, 13.07.2023). Auch Greene warnte zu diesem Zeitpunkt, dass Finanzhilfen für die Ukraine den Krieg nicht verhindern, sondern ihn angesichts einer „nuklear bewaffneten Nation“ fördern würden:
„ Ukraine is not the 51st State. Sending money to fund a war in a foreign country does not deter war, it continues it. It causes it. It enables it and it allows it. Sending money to fund a war in a foreign country against a nuclear-armed nation does not protect our national security, it endangers our national security. It endangers every single American. It endangers the entire world. We do not want World War III “ (Greene, 13.07.2023).
Alle diese Warnungen gründen auf der Konstruktion von Putins Russland als gefährlicher Entität. Das Land wird wiederholt als gefährliche „Atommacht“ dargestellt, repräsentiert durch Putin, der wie „eine Art Bösewicht wirkt“ und „gefährlicher und geistesgestörter“ werde, je weiter Russland an Macht und Einfluss verliere (Gaetz, 22.02.2023). Vor diesem Hintergrund suggerieren Gaetz und Greene, dass die verantwortlichen Unterstützungsbefürworter unfähig seien, Russland als eine Gefahr anzuerkennen. Gaetz (15.07.2023) charakterisiert den Präsidenten als schläfrig („ Sleepy Joe “), der wie ein „Demenzkranker“ Amerika „schlafwandelnd in den 3. Weltkrieg“ führe (Gaetz, 11.07.2023). In der Sendung Tucker Carlson Tonight wertete Greene zudem nicht nur Biden, sondern auch die Administration und andere Unterstützer ab:
„ The war mongers and our Supreme leaders in the Biden administration are so clue- less, they are so stupid, and they are so disconnected with what the American people want, that they are literally going to lead us into World War 3 ” (Greene, 23.02.2023).
Die Rhetorik seitens Gaetz und Greene vermittelt den Eindruck, dass sie ihren politischen Opponenten abwertende und beleidigende Charaktereigenschaften zuschreiben, um deren Entscheidungen auf ihre Persönlichkeit zurückführen zu können.
5.3.5 Verantwortungsloses Handeln der amerikanischen Politik
Nichtdestotrotz geht die Ablehnung der Unterstützung auch darauf zurück, dass den Entscheidungsträgern ein verantwortungsloses Handeln bei der Vergabe von Hilfen an die Ukraine unterstellt wird. Ein häufig vorgebrachter Rechtfertigungsgrund lautet, dass die Waffenlieferungen in den Händen der ukrainischen Frontbrigade Asow landeten. Diese bestehe aus Neonazis, die beabsichtigten, der russischen Bevölkerung mit den Waffen Leid zuzufügen:
„A lot of those arms are ending up in the hands of the AZOV battalion. [...] I don’t think it’s wise to say anyone who’s shooting at Russians should get unlimited non- overseeing in dollars. [.] Javelins to Neo-Nazis today in Ukraine “ (Gaetz, 13.05.2022).
„ We should not spend billions of American’s hard-earned tax dollars on lethal aid to be given to possible Nazi militias that are torturing innocent people, especially chil- dren and women “ (Greene, 20.03.2022b).27
Mit solchen Aussagen versuchen die Diskursträger, die Deutungshoheit über die ethische Dimension der Unterstützungsdebatte zu gewinnen. Die Strategie dahinter ist jedoch nicht die Verurteilung der russischen Taten gegen die ukrainische Bevölkerung (dazu schweigen sie), sondern die Beschuldigung der ukrainischen Kämpfer und der Biden-Administration. Eine weitere Aussage, die dies belegt, ist Gaetz‘ rhetorische Frage im Repräsentantenhaus: „ Now that they [Asow Batallion] are killing Russians, are these avowed ethnonationalists apparently not so bad? “ (Gaetz, 11.05.2022). Mit der Gleichsetzung des Bataillons mit Neo-Nazis wird jedoch kein Element konstruiert, dass auf alle Ukrainer übertragen werden könnte, wie Davidson in einem Interview mit NewsNation bestätigt hat:
„ They do have a neo-Nazi Azov battalion. It’s not necessarily the whole country or the whole culture. But they’re based in Mariupol and they were used really heavily to counter Russian population ” (Davidson, 14.03.2022).
Eine weitere Behauptung, die Greene vorbrachte, hat zwar eine äußerst dürftige Grundlage, zielt jedoch unterschwellig darauf ab, die Entscheidungsträger ethisch und moralisch zu tadeln. Sie unterstellt, dass die USA Biolabore in der Ukraine finanzieren würden, aus denen „tödliche Krankheitserreger“ entwichen und Tod verursachten (Greene, 17.03.2022b). Belege dafür lieferte sie zwar nicht, sie brachte aber dennoch einen Gesetzesentwurf28 ein, der darauf abzielte, die Finanzierung der (unbewiesenen) Entwicklung und Produktion von „Biowaffen“ zu verhindern. Ihre Begründung lautete unter anderem, dass ihre Herstellung böse und falsch sei: „ [N]o American citizen wants to be heldmorally andethically responsible, [...] nogovernment should be creating bioweapons. That is evil and wrong “ (ebd.).
Der häufigste Versuch, die Entscheidungen der Administration aus ethisch-moralischer Sicht zu delegitimieren, stellt jedoch die Kritik an der gelieferten Streumunition dar. Wie Greene (14.07.2023) auf Twitter mitteilte, handle es sich bei dieser um eine „brutale“ und „unmenschliche“ Waffe, die der Zivilbevölkerung dauerhaften Schaden zufüge. Lediglich bei der Frage, ob die Lieferung zu Kriegsverbrechen führen würde, herrscht eine gewisse Uneinigkeit. Während sie für Greene (09.07.2023) „möglicherweise“ Kriegsverbrechen als Folge hat, ist dies für Gaetz hingegen eindeutig:
„ Democrats used to call the use of cluster bombs a war crime. And that war crime is now an American export. [.] Cluster bombs are features of the world’s bloodiest and most inhumane wars “ (Gaetz, 10.07.2023).
Diese Darstellung der Biden-Administration beschränkt sich jedoch nicht nur auf Kritik und Verurteilung, sondern stellt zugleich die (identitäre) ethisch-moralische Rolle Amerikas infrage.
So argumentierte Vance (16.07.2023) bezüglich der Streumunition, dass Amerika seine „moralische Führungsrolle“, für die es in der Ukraine kämpfen würde, nicht durchsetze, sondern im Gegenteil darauf verzichte. Bidens Entscheidung, die „illegale“ Munition in die Ukraine zu schicken, werde zum Tod „unschuldiger Menschen“ sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine führen (ebd.).
5.3.6 Verhandlungen statt Unterstützung
Abschließend rechtfertigen die Gegner ihre Ablehnung damit, dass es notwendig sei, stattdessen Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland zu fördern. Dieses Argument bringt besonders Greene (26.07.2023) vor, die wiederholt das Ende der Finanzierung des „Krieges in der Ukraine“ im Tausch für eine Friedensinitiative forderte. Auf diese Weise verspricht sie das Ende der Eskalation „auf Kosten des amerikanischen Volkes“ (Greene, 08.07.2023). Auch Gaetz (28.02.2023) beteiligt sich an dieser Art Friedensdebatte, indem er als konkreten Schritt fordert, die Ukraine und Russland bzw. Selenskyj und Putin dazu zu drängen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. In dieser Vorgehensweise sehe er den „einzigen Ausweg“, weshalb er im Repräsentantenhaus eine entsprechende Resolution29 einbrachte. Diese sah vor, militärische und finanzielle Hilfen für die Ukraine bis zum Abschluss eines Friedensabkommens auszusetzen (ebd.).
Mit dieser Argumentation stellt der vorliegende Unterdiskurs einen kompletten Gegenentwurf zum Friedensverständnis im Biden-Diskurs dar, bei dem es darum geht, die Ukraine mittels Unterstützung gegenüber Russland in die „stärkstmögliche Position am Verhandlungstisch“ zu bringen (Biden, 31.05.2022). Stattdessen schweigt der Unterdiskurs zu den Verhandlungspositionen und möglichen territorialen Einbußen der Ukraine, die aus einem sofortigen Friedensabkommen resultieren könnten.
5.3.7 Identitätskonstruktion unter den republikanischen Unterstützungsgegnern
Mit dem Biden-Diskurs weist der Diskurs der Unterstützungsgegner keine Gemeinsamkeiten in der Konstruktion des eigenen Selbstbilds und des ukrainischen Fremdbildes auf. Lediglich beim russischen Fremdbild sind einige Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede feststellbar. Beim Selbstbild greift der Diskurs auf intertextuelle Verbindungen zu Trump und Reagan zurück, wobei die politischen Ansätze dieser Persönlichkeiten mit Wertschätzung aufgenommen werden. Dies wird deutlich, wenn der Diskurs eine klare Verbindung zu Trumps innenpolitischer Agenda, die mit dem Slogan Make America Great Again ‘ zusammengefasst wird, und seiner außenpolitischen Agenda, die unter dem Schlagwort , America First ‘ bekannt ist, aufweist (vgl. Restad 2020: 2). Um ein Beispiel zu nennen, bezog sich Hawley in der Sendung Tucker Carlson Tonight auf Trumps Agenda, um seine Unzufriedenheit über die bereits bewilligten 100 Milliarden US-Dollar für die Ukraine zu betonen und um weitere Hilfen abzulehnen. Sein zentrales außenpolitisches Statement lautete: „ No more welfare for Europeans, put Americans first “ (Hawley, 25.02.2023). In Bezug auf die Innenpolitik äußerte er: „ It is time to put the working people of this country first, to make this folk strong again, and to make this country strong again “ (ebd.). Ähnlich wie der Trump-Diskurs, der die Vision einer nationalen Identität repräsentierte, in der die „weiße (männliche) Arbeiterklasse“ reproduziert und als Grundpfeiler der US-Wirtschaft und Außenpolitik propagiert wurde (vgl. Holland/Fermor 2021: 65), setzt Hawley auf die Priorisierung der Arbeiterklasse. Ebenso ist der Ausdruck Make this country strong again ‘ semantisch als Äquivalent zu Trumps .Make America Great Again ‘ zu verstehen.
Die nationale Stärke, auf die Hawley hierbei verweist, stellt eine intertextuelle Verbindung dar, die im diskursiven Kontext nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen kritischen Stimmen eine zentrale Rolle spielt. In einem Meinungsbeitrag bei Compact führte er allerdings aus, dass er sich einen „robusten, realistischen amerikanischen Nationalismus“ wünsche, ähnlich dem unter Theodore Roosevelt (Hawley, 24.05.2022). Er wolle einen Ansatz, der auf die Stärkung der nationalen Industrie und der Armee abziele, um „amerikanische Stärke“ zu erreichen (ebd.). Gleichzeitig distanziert er sich vom globalistischen Ansatz, wie er einst unter Woodrow Wilson vertreten wurde und gegenwärtig von den Führungspersonen der GOP30 verfolgt werde. Diese setzen aus seiner Sicht „falsche Prioritäten“, zumal sie die Ukraine langfristig zum Klientstaat31 („ client state “) amerikanischer Hilfen machten und somit das Ziel der Erreichung nationalen Stärke Amerikas verfehlten (ebd.).
Darüber hinaus bezieht sich der Diskurs nicht nur auf Trump oder Roosevelt, sondern vor allem auch auf Ronald Reagans Grundsatz , Peace through strength ‘, der in Kohärenz zu den anderen intertextuellen Verbindungen steht und dadurch den Wunsch nach amerikanischer Stärke nochmals unterstreicht. „ Ronald Reagan - he was a nationalist. We need a robust na- tionalism. [...] We need to make America strong, and Reagan was right all those years ago “ (Hawley, 17.03.2023). Das Bemerkenswerte an der intertextuellen Verbindung zum Grundsatz Reagans ist, dass der Diskurs der Unterstützungsgegner ebenso wie der Diskurs der republikanischen Befürworter darauf zugreift, um Stabilität zu erzeugen, jedoch beide Seiten eine gegenteilige Lesart verfolgen. Anders als die republikanischen Unterstützungsbefürworter, die Amerika gegenwärtig als stark betrachten und mit ihrem politischen Kurs darauf abzielen, seine Stärke gegenüber Russland zu demonstrieren (siehe Kap. 5.2.2), sehen die Unterstützungsgegner Amerika gegenwärtig als schwach an:
„ Everything happening to the poor people of Ukraine is a direct result of a WEAK America under the WEAK leadership of Joe Biden. Under President Trump, America was STRONG and the world was at PEACE “ (Greene 24.02.2022).
Aufgrund der Wahrnehmung, dass Amerika schwach sei, konstruiert der Diskurs eine Lesart von Reagans Grundsatz, wonach jegliche Unterstützung für die Ukraine die USA nur schwächer mache und die militärischen Ressourcen besser einzusparen seien. So charakterisierten Greene und Vance, die beide , Peace through strength‘ idealisieren, die Ukraine-Unterstützung auf der , Turning Point Action’- Konferenz als problematisch. Greene zufolge führt die Bereitstellung militärischer Ressourcen dazu, dass sich Amerika in einem „Stellvertreterkrieg mit Russland“ befinde, welcher das amerikanische Militär dezimiere und es so schwach gemacht habe, wie es „seit Jahrzehnten nicht mehr“ der Fall war (Greene, 16.07.2023). Vance verweist hingegen auf die Notwendigkeit, militärische Ressourcen, insbesondere Munition, für die Herausforderung durch China einzusparen. Seine Begründung lautet: „ China doesn’t care how tough we talk; they don’t care how tough we act. They care about how strong we are “ (Vance, 16.07.2023). Hinsichtlich des Selbstbildes artikuliert der Diskurs somit deutlich, welches Amerika die Akteure sich wünschen, und verknüpft dies mit Identitätselementen, die innerhalb des diskursiven Rahmens positiv konnotiert sind - nämlich ein nationalistisches und starkes Amerika.
Demgegenüber grenzt der Diskurs das eigene Wunschbild von Amerika nicht direkt von externen Akteuren wie der Ukraine oder Russland ab, sondern vielmehr von der gegenwärtigen politischen Elite der Vereinigten Staaten, die für die Ukraine-Unterstützung verantwortlich sei. Er attribuiert eine Vielzahl negativer Merkmale, die es schwierig machen, sich in der Darstellung auf wenige zu beschränken. Dazu gehört beispielsweise die Bezeichnung Bidens als „ Sleepy Joe “ (Gaetz, 15.07.2023) und die Beschreibung der übrigen Führungspersonen als „ahnungslose“ und „dumme“ „Kriegstreiber“ (Greene, 23.02.2023). Alle diese Eigenschaften können so interpretiert werden, dass sie aus Sicht der Diskursträger als ursächlich für die „schwache Führung“ unter Biden (Greene 24.02.2022) anzusehen sind und einer Rückkehr zu einem „starken Amerika“, wie es unter Trump existiert habe, im Wege stehen (ebd.).
Was die Rolle der externen Akteure im Diskurs anbelangt, grenzt sich das nationale Selbstbild nur indirekt von der Ukraine und gar nicht von Russland ab. Das im Diskurs konstruierte ukrainische Subjekt untergliedert sich in das politische System und die kämpfende Frontbrigade Asow, wobei beide Subjektteile negativ konnotiert sind. Das ukrainische System biete der amerikanischen Elite eine Plattform für illegale Machenschaften. Die Ukraine sei ein „globales Geldwäscheunternehmen“ und damit ein Ort, an dem die „amerikanisch-globalistische Elite“ in „Geldwäsche“ und „korrupte Handlungen“ verwickelt sei (Gaetz, 28.02.2022). Das schließt die Familie Biden mit ein, die an der dortigen Korruption beteiligt sein soll (vgl. Greene, 19.03.2022). Den ukrainischen Kämpfern der Asow-Brigade schreibt der Diskurs hingegen Neo-Nazismus und Rassismus zu (vgl. Gaetz 13.05.2022). Diese Merkmale werden instrumentalisiert, um sich erneut von der US-Elite abzugrenzen. Indem diese die Asow-Kämpfer unterstütze, zeige sie verantwortungsloses Handeln (siehe Kap. 5.3.5). Im Kontrast dazu erhält Trump Lob dafür, dass unter seiner Führung die „Finanzierung von Neonazis in der Ukraine“ eingestellt worden sei (Greene, 15.03.2022).
Russland wird genauso wie die beiden anderen Fremdbilder, die US-Elite und die Ukraine, negativ konnotiert konstruiert. Russland erscheint als „gefährliche“ Atommacht und Putin als „gefährlicher und geistesgestörter“ „Bösewicht“ (Gaetz, 22.02.2023), steht dem amerikanischen Selbstbild jedoch nicht antagonistisch gegenüber. Russland wird dadurch zum isolierten Subjekt im Diskurs, da es weder abgegrenzt noch mit den anderen beiden Fremdbildern verknüpft werden kann. Das Land strahlt für die Diskursträger insofern eine Gefahr aus, als man es mit der Unterstützung für die Ukraine provoziert und damit einen „3. Weltkrieg“ riskiert (Gaetz, 11.07.2023). Der Verzicht auf Unterstützung hingegen impliziert die Abwendung einer solchen Gefahr. Ansonsten ist die diskursive Rolle Russlands begrenzt, besonders weil die Unterstützungsgegner im Gegensatz zu den Befürwortern, Russland nicht als einen Feind oder als einen Akteur, der langfristig die amerikanische Sicherheit und Interessen bedrohen würde, sehen: „ Russia is not our enemy “ (Gosar, 20.02.2023).
Was der Diskurs weitgehend vermeidet, ist, über die Situation des ukrainischen Volkes zu sprechen und ihm Identitätselemente zuzuschreiben. Im Vergleich zum ukrainischen System und zum Asow-Bataillon bleibt es ein blinder Fleck, wodurch zwei Subjektteile in den Vordergrund gerückt werden, die schließlich die ganze Ukraine repräsentieren. Das ermöglicht diskursive Stabilität, weil der Diskurs nicht in Gefahr gerät, vom Fokus auf innenpolitische Probleme im Sinne des America First ‘ -Ansatzes abzurücken.
5.4 Bedeutungskampf im Vergleich: Inhärente Spannungen und Diskursmacht
Aufbauend auf der bisherigen Analyse gilt es im nächsten Schritt genauer auf die Frage einzugehen, inwiefern der Biden-Diskurs durch die oppositionellen Gegendiskurse angefochten wird. Das bedeutet, dass in einer vergleichenden Perspektive untersucht werden muss, worüber der offizielle Diskurs eine Deutungsmacht (hegemonialen Status) erreicht hat und wo die diskursive Opposition ihm diesen Status verwehrt. Dies schließt auch den Deutungskampf darüber ein, wie Selbst- und Fremdbild im Zusammenspiel nachgezeichnet werden. Im Wettbewerb der drei Diskurse zeigt sich, dass der Biden-Diskurs in nahezu jedem Aspekt herausgefordert wird. Eine Ausnahme bildet der ukrainische Heroismus, auf den abschließend eingegangen wird, nachdem die Antagonismen herausgearbeitet wurden, die einem hegemonialen Status entgegenwirken.
Gerade beim Thema der Friedensorientierung wird deutlich, dass dieser Punkt zwar in allen drei Diskursen vorkommt, jedoch jeweils eine unterschiedliche Lesart erfährt. Im Biden-Diskurs halten die Diskursträger Friedens nur durch Diplomatie für erreichbar. Um jedoch in die Phase der Diplomatie zu gelangen, müsse der Ukraine zunächst die „stärkstmögliche Verhandlungsposition“ verschafft werden, was nur durch Waffen und Munition möglich sei (Biden, 31.05.2022).
Im Diskurs der pro-ukrainischen Republikaner bezieht sich Frieden in erster Linie auf Amerika. Seine Gewährleistung erfordere, dass Amerika in Anlehnung an Reagans Doktrin , Peace trough strength‘ Stärke zeige (Wicker, 28.02.2023). Dies schließt sowohl starke Verteidigungsfähigkeiten als auch ein starkes Selbstbewusstsein auf der internationalen Bühne ein (vgl. McConnell, 16.03.2022). Das Zusammenwirken beider Komponenten sorge dann dafür, dass Amerikas Feinde abgeschreckt werden (vgl. Wicker, 19.07.2023). Die Unterstützung der Ukraine mit militärischen Gütern sei dabei ein Weg zur Gewährleistung des eigenen Friedens und gleichzeitig des Friedens in der Ukraine (vgl. McConnell, 24.02.2023b). Vor diesem Hintergrund wird die Rolle der Diplomatie im Vergleich zum Biden-Diskurs wenig beachtet und stattdessen ein vollständiger Sieg der Ukraine befürwortet: „ If we spent more time thinking about how to help Ukraine win [...] we would be better off“ (Graham, 14.03.2022). Diese Ausrichtung stützt auch die Kritik, Biden würde nicht schnell genug handeln, um möglichst viel militärische Hilfen für die Ukraine bereitzustellen und somit einen schnellstmöglichen ukrainischen Sieg zu erreichen. Daher sind diese republikanischen Akteure stets unzufrieden mit der Wirksamkeit und dem Erfolg der bisherigen Maßnahmen der Biden-Administration. Für sie besteht Erfolg darin, dass die Ukraine einen Sieg erlangt, und weniger darin, auf eine diplomatische Lösung hinzuarbeiten. Eine Aussage von Cotton (18.07.2023) verdeutlicht dies: „ He [Biden] keeps saying we’ll fight as long as it takes: how about fighting to win as quickly as they can. “
Eine dritte Friedensorientierung zeigt sich im Diskurs der Unterstützungsgegnern, die zwar eine diplomatische Lösung befürworten, allerdings ohne jegliche Form von Unterstützung. Ein Grund dafür ist, die Eskalation eines „unerwünschten Krieges mit dem nuklear bewaffneten Russland“ vermeiden zu wollen (Greene, 08.07.2023). Zudem betrachten die Gegner Ressourceneinsparung (z. B. bei Munition) als einen geeigneteren Weg, um den Frieden für Amerika zu bewahren. In dieser Hinsicht interpretieren sie Reagans Doktrin , Peace trough strength‘ neu und sehen die Notwendigkeit militärischer Stärke ausschließlich für das eigene Land und nicht als Lösung auch für die Ukraine. Militärhilfen seien ressourcenverschwendend und machten die USA anfälliger für Bedrohungen von außen, insbesondere seitens China (Vance, 16.07.2023).
Neben der Friedensorientierung findet auch das Narrativ des verantwortungsbewussten Handelns als Rechtfertigungsgrund bei der Opposition keinen Anklang. Einerseits kehrt der Diskurs der Unterstützungsgegner die Rolle einer verantwortungsbewussten Administration ins Negative. Militärhilfen würden in die Hände ukrainischer „Neonazis“ gelangen (Gaetz, 13.05.2022), Finanzmittel an Bio-Labore zur Herstellung von Biowaffen gehen (vgl. Greene, 17.03.2022b) und mit der Lieferung von Streumunition eine kriegsverbrecherische Rolle eingenommen (vgl. Greene, 09.07.2023). Andererseits zieht der pro-ukrainische Unterdiskurs der Republikaner das Handeln im nationalen Sicherheitsinteresse einem Handeln im ethisch-moralischen Sinne vor. Wie McConnell (vgl. 12.05.2022; vgl. 12.07.2023) betont, geschehe die Unterstützung nicht aus bloßer Philanthropie oder aus moralischer Verpflichtung heraus, sondern weil es im nationalen Sicherheitsinteresse liege.
Darüber hinaus betrifft die Anfechtung nicht nur das verantwortungsbewusste Handeln, sondern auch die damit verbundene identitäre Seite. So versuchen die Unterstützungsgegner das Verantwortungsbewusstsein der USA in seinen derzeit anzutreffenden Facetten als unglaubwürdig darzustellen. Zum Beispiel äußert Vance (16.07.2023), dass Amerika durch die Lieferung „illegaler“ Streumunition nicht seiner „moralischen Führungsrolle“ in der Welt nachkomme, sondern dem entgegenwirke. Mit solchen Aussagen fechten die Gegner nicht nur das Verantwortungsbewusstsein an, sondern auch die gegenwärtige Rolle Amerikas als Schützer internationaler Normen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie internationale Normen gänzlich infrage stellen. Eine Anmerkung von Davidson (10.05.2022) zeigt nämlich, dass das „Recht auf Selbstverteidigung und Selbstbestimmung der Ukrainer“ (eine internationale Norm) akzeptiert wird. Die Unterstützungsgegner lehnen lediglich die Finanzierung des Schutzes internationaler Normen ab, da sie nationale Angelegenheiten priorisieren. In diesem Sinne kritisiert Paul (12.05.2022; 17.05.2022), dass die Rolle Amerikas als „Weltpolizist“ im internationalen Einsatz nur unnötige Schulden verursache.
Zur Anfechtung der Unterstützungsgründe kommt hinzu, dass die zugrunde liegenden iden- titären Elemente der Rechtfertigung ebenfalls einem diskursiven Kampf ausgesetzt sind. Dies betrifft sowohl das amerikanische Selbstbild als auch die jeweiligen Fremdbilder. Im pro-ukrainische Unterdiskurs findet das Selbstbild zwar einerseits Zustimmung, denn es ist auch dort präsent und wird durch denselben Ausdruck - „ arsenal of democracy “ (Graham, 19.05.2022) - stabilisiert. Andererseits wird das Selbstbild des Biden-Diskurses durch die Idee eines nationalistischen Amerikas, wie es Hawley (vgl. 25.02.2023) präsentiert, durch die Unterstützungsgegner angefochten. Stattdessen propagieren sie die Wiederherstellung eines Amerikas der Vergangenheit (unter Trump), das sich vom Globalismus abgrenzt (vgl. Gaetz, 28.02.2022; vgl. Hawley, 17.03.2023). Dieses Amerika grenzen sie auch von Biden ab, der der Verwirklichung entgegenstehe. Wie Greene (24.02.2022) darlegt: „ Under President Trump, America was STRONG [...].“
Im Sinne eines amerikanischen Nationalismus übernimmt der Diskurs somit die Agenda von Donald Trump, das heißt, der Fokus liegt auf nationalen Angelegenheiten bei gleichzeitiger Ablehnung eines internationalistischen Ansatzes, mit Ausnahme des Ausbaus des militärischen Gegengewichts zu China. Hawley (17.03.2023) kontrastiert die Positionen wie folgt: „ You’re either a nationalist or you’re a globalist. [...] We need a robust nationalism. [...] We need to rebuild America. We need to make America strong. “ In diesem Zusammenhang üben einige Diskursträger direkt Kritik am ideell-internationalistischen Charakter Amerikas, wie er im Biden-Diskurs vertreten wird. Das identitäre Narrativ, wonach Amerika als Verfechter demokratischer Werte auftritt („ It’s who we are “ (Biden, 24.02.2022; 12.07.2023)), wird insbesondere von Gaetz und Gosar in ein negatives Licht gerückt. Sie betrachten die „Verteidigung der Freiheit“ (Gaetz, 26.02.2022) und die „Rettung der Demokratie“ (Gosar, 17.03.2022) im Ausland lediglich als eine finanzielle Belastung, die nicht dem Volkswillen entspricht.
Ebenso sind in den Diskursen unterschiedliche Ausprägungen des Fremdbilds Russland zu beobachten, obwohl das Land in jedem von ihnen ein radikales Other darstellt. Im Biden-Diskurs wird Putins Russland als autokratisch charakterisiert und ist mit ethisch-identitären Elementen wie diktatorisch, tyrannisch und korrupt behaftet. Als bedrohlich für Amerika gilt es jedoch nur indirekt. Dafür spricht, dass es in keiner der gesichteten Quellen als direkte Bedrohung für Amerika bezeichnet wird. Es bedrohe lediglich die „europäische Sicherheit“ (Yellen, 27.02.2023), das regelbasierte internationale System (vgl. Biden, 10.03.2022) und die „globale Ernährungssicherheit“ (Blinken, 01.06.2022b). Die einzige schwach formulierte Ausnahme, die jedoch nicht das amerikanische Territorium direkt betrifft, zielt auf den Cyberbereich ab. Biden (21.03.2022) warnt nämlich vor einer „erhöhten Wahrscheinlichkeit“, dass Russland einen Cyberangriff gegen die USA starten könnte.
Der pro-ukrainische Unterdiskurs der Opposition schlägt dagegen einen konfrontativeren Ton gegenüber Putins Russland an. Dabei wird ihm nicht nur ein autokratisch-tyrannisches Element zugeschrieben, sondern zusätzlich auch ein verbrecherisches (ethisches) Element, wenn etwa von „ the war criminal, Putin “ die Rede ist (Graham, 20.02.2023). Hinzu kommt, dass Putins Russland als „Feind“ mit unmittelbarer Bedrohlichkeit dargestellt wird, wie im Fall von Cruz (23.02.2023). Alles in allem wird das Fremdbild weitaus radikaler als im Biden-Diskurs konstruiert.
Bei den Unterstützungsgegner zeigt sich einerseits ebenfalls ein radikales Fremdbild: Putin als „ evil man “ (Gaetz, 11.05.2022) und als schon immer dagewesener „ bad guy “ (Davidson, 20.03.2022). Andererseits geht diese Ausprägung des Fremdbild mit anderen politischen Handlungsoptionen einher. Da Russland eine „gefährliche Atommacht“ mit einem „gefährlicher“ Anführer an der Macht sei (Gaetz, 22.02.2023), riskiere Amerika durch jegliche Unterstützung für die Ukraine eine neue Eskalationsstufe und einen dritten Weltkrieg (siehe Kap. 5.3.4).
Im Vergleich dazu zeigt sich im Fremdbild der Ukraine eine große Ähnlichkeit unter den demokratischen und republikanischen Befürwortern der Unterstützung und eine Gegensätzlichkeit zwischen den republikanischen Unterdiskursen. Durch die Zuschreibung freiheitlich-demokratischer Ideale konstruieren die Befürworter eine Nähe zur Ukraine, während die Gegner unter Einbeziehung negativ konnotierter Elemente eine Differenz schaffen. Wiederkehrende Abgrenzungselemente bilden die Ukraine als „korruptes Land“ (Greene, 20.03.2022), als „Geldwäscheparadies“ (Gaetz, 10.05.2022) und als Land mit kämpfenden „Neo-Nazis“ (Gaetz, 11.05.2022). Insgesamt finden die Gegner der Unterstützung kaum positive Fremdbezeichnungen für die Ukraine, was mit deren ablehnenden Haltung kohärent ist. Zugleich lassen sie jedoch offen, inwieweit auch Russland ein Land mit systemischen Mängeln ist. Es wird nicht thematisiert, ob es sich nicht auch hier - wie vom Biden-Diskurs betont - um ein korruptes Land handelt (vgl. Biden, 11.03.2022; vgl. Yellen, 02.03.2022).
Abbildung 2: Zusammenfassung der Identitäts-Außenpolitik-Konstellationen
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Quelle: eigene Darstellung
Das einzige Element im Fremdbild der Ukraine, das während des untersuchten Zeitraums einen hegemonialen Status einnimmt, ist das Merkmal „heroische Ukrainer“ (Biden, 08.03.2022; Biden, 21.02.2023). Dieses Merkmal wird in den pro-ukrainischen Diskursen geteilt und von den Gegnern der Unterstützung zumindest nicht infrage gestellt. Im Diskurs der Gegner gibt es teilweise sogar Zustimmung, dass der Verteidigungskampf gegen die russische Invasion heroisch sei. So schrieb Greene noch zu Beginn des Krieges auf Twitter: „ Americans should learn a powerful lesson from their [Ukrainian] example “ (Greene, 27.02.2022). Davidson (20.03.2022) äußerte sich in einem CNN-Interview bewundernd über Präsident Selenskyj: „ Zelenskyy has really led heroically his country to resist this invasion [...]. “ Insofern zeigt sich, dass dieses rechtfertigende Element partielle Diskursmacht erlangte. Eine stabile Diskurshegemonie verlangt jedoch, dass sich eine solche Darstellung nicht nur für die Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch für die Zukunft behauptet (vgl. Stahl/Harnisch 2009: 52 f.). Da dieses Element bisher eng mit der Leistung der Ukrainer an der Front verwoben war, im Rahmen ihres „heroischen Widerstands“ (Yellen, 27.02.2023) gegen die russische Invasion, bleibt seine Bedeutung für die Zukunft abzuwarten. Es liegt allerdings nahe, dass weitere Erfolge an der Front, wie beispielsweise erfolgreiche Gegenoffensiven, erforderlich sein werden, damit Heroismus als Inspirationsquelle im Diskurs fortbesteht. Nur dann dürfte dieser Aspekt für neuen politischen Druck auf die Entscheidungsträger sorgen, der Ukraine weiterhin wie bisher Unterstützung zukommen zu lassen.
6 Fazit und Ausblick
Die vorliegende Masterarbeit setzte mit ihrer Forschung am Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine an, als in präzedenzlosem Ausmaß Soforthilfen in verschiedenen Formen zu fließen begannen. Der in der US-Öffentlichkeit ausgetragene politischer Kampf um die Rechtfertigung der Unterstützung regte dazu an, diskursanalytisch das Ziel zu verfolgen, die wichtigsten Rechtfertigungsgründe für und gegen die Unterstützung nachzuvollziehen und gleichzeitig die inhärenten Spannungen innerhalb des diskursiven Kampfes zu identifizieren. Um das Ziel zu erreichen, wurde ein poststrukturalistischer Ansatz als theoretisch-methodische Grundlage dieser Arbeit gewählt. Im Abschnitt zum Forschungsstand wurde daher ein kurzer Überblick darüber gegeben, welche bisherigen Erkenntnisse diesem Ansatz zu verdanken sind und warum dieser sich für die zugrunde liegende Forschungsfrage eignet. Seine Besonderheit liegt darin, dass er es ermöglicht, über die sachlich ausgerichtete Oberfläche von Diskursen hinaus bis zur identitätsbasierten Tiefe vorzudringen.
Mithilfe des Leitfadens zur Entwicklung diskurstheoretischer Forschungsdesigns wurden anschließend drei zu untersuchende Diskurse erfasst: ein offizieller Diskurs und zwei oppositionelle Unterdiskurse. Im Hauptteil wurden dann die wichtigsten Argumentationsmuster der jeweiligen Diskurse dargelegt und im Zusammenspiel mit der Konstruktion von identitären Elementen analysiert. Diesem Schritt folgte eine vergleichende Perspektive, die sich auf den diskursiven Bedeutungskampf fokussierte, um den hegemonialen Status des offiziellen Diskurses zu ermitteln.
Die zentralen Ergebnisse dieser Masterarbeit in Bezug auf die zugrundeliegenden Forschungsfragen zur Rechtfertigung der (Nicht-)Unterstützung der Ukraine in den zentralen politischen US-Diskursen sowie zur Rolle der nationalen Identität und der Herausforderung des offiziellen Diskurses lassen sich wie folgt zusammenfassen: Im Biden-Diskurs wird die Unterstützung auf eine pragmatische, ideelle und situative Art und Weise gerechtfertigt, die eine internationalistische Haltung der demokratischen Administration widerspiegelt. Auf pragmatischer Ebene rechtfertigen die Diskursträger die Unterstützung durch das Ziel, Frieden zu etablieren, und mit der Feststellung, dass sie sich generell als wirksam erweist. Auf ideeller Ebene beruht die Rechtfertigung darauf, dass die Hilfe für die Ukraine sowohl ethisch-moralischen Standards entspricht als auch darauf abzielt, demokratische Werte und internationale Normen in der Ukraine zu verteidigen. Der situative Grund der Unterstützung ist hingegen, dass die Ukrainer durch ihren Heroismus amerikanische Unterstützung verdient haben. All diese Gründe unterliegen der identitären Rolle Amerikas, das als verantwortungsbewusster Akteur und Verfechter demokratischer Werte repräsentiert wird. Über diese Werte wird zugleich auf der einen Seite eine diskursive Verbindung zur Ukraine hergestellt, die als freiheitlich-demokratisch gilt, und auf der anderen Seite eine radikale Differenz zu Putins Russland aufgebaut, das als autokratisch, tyrannisch und korrupt wahrgenommen wird. Unabhängig von dieser Wertung erhält die Ukraine angesichts des Kampfes gegen Russland außerdem das Merkmal des Heroismus zugeschrieben.
Im Unterdiskurs der republikanischen Unterstützungsbefürworter wird die Ukraine-Hilfe ähnlich wie im Biden-Diskurs ideell (durch den Schutz demokratischer Werte und internationaler Normen) und situativ (durch den ukrainischen Heroismus), aber auch materialistisch gerechtfertigt. Die Argumentation erfolgt auf eine Art und Weise, die sich einerseits durch deutlichere Bedrohungskonstruktionen (bei gleichzeitiger Bedrohungsabwehr durch materielle Stärke) vom Biden-Diskurs unterscheidet, aber andererseits ebenfalls eine internationalistische Haltung verkörpert. Die identitäre Rolle Amerikas weist durch das Element des Verfechters demokratischer Werte ebenfalls Ähnlichkeiten auf, unterscheidet sich aber dadurch, dass das Verantwortungsbewusstsein weitgehend ausgeklammert wird und das Element eines starken und weltpolitisch engagierten Amerikas hinzukommt. Die diskursive Verbindung zur Ukraine wird ähnlich hergestellt, aber die Abgrenzung von Russland ist radikaler. Putins Russland gilt hier als bedrohlich, feindlich und verbrecherisch.
Demgegenüber gibt es im Diskurs der Unterstützungsgegner, der sich als konter-hegemonial zu den beiden anderen erweist, keine Gemeinsamkeiten mit dem Biden-Diskurs. Die erkennbare außenpolitische Haltung ist isolationistisch. Die Ablehnung der Unterstützung wird durch innenpolitische Angelegenheiten, alternative außen- und sicherheitspolitische Prioritäten sowie eine konträre Auslegung des ethisch-moralisch Verständnisses gerechtfertigt. Die identi- täre Rolle Amerikas wird durch die Elemente Stärke und Nationalismus repräsentiert, wie sie bereits unter Trump propagiert wurden. Putins Russland wird nicht als feindlich angesehen, sondern als gefährlich, während die Ukraine als ein Land dargestellt wird, das keine Verbindung zu Amerika hat. Es sei ein korrupter Geldwäscheparadies, in dem Neo-Nazis an der Front kämpften.
Einzelne rechtfertigende Argumentationsmuster wie der Schutz demokratischer Werte und internationaler Normen sowie die damit zusammenhängenden ideellen Elemente des amerikanischen Selbstbilds (USA als Verfechter demokratischer Werte) und der Fremdbilder (eine freiheitlich-demokratische Ukraine und ein autokratisch-tyrannisches Russland) finden nur bedingt Anklang über den offiziellen Diskurs der Biden-Administration hinaus. Das liegt daran, dass spätestens im gegnerischen Unterdiskurs fast alle Argumentations- und Bedeutungsstrukturen angefochten werden. Nur die Zuschreibung als heroische Ukrainer genießt eine gewissen Diskursmacht, die aber eng mit den Ereignissen an der Front verbunden ist und sich bisher nur deshalb behaupten kann, weil die Unterstützungsgegner dieses Element nicht angefochten haben.
Nachdem durch diese Zusammenfassung der Erkenntnisgewinn dieser Arbeit deutlich wird, darf an dieser Stelle eine kurze kritische Würdigung der gesamten Arbeit nicht fehlen. Die poststrukturalistische Identitätstheorie hat sich als nützlich erwiesen, um aktive Identitätselemente im ausgewählten Materials ausfindig zu machen und zu analysieren. Dies betrifft nicht zuletzt das Fremdbild Russlands, das durch persönliche Eigenschaften Putins als Putins Russland repräsentiert wird. Allerdings ist die sprachlich-diskursive Identitätstheorie sehr liberal und setzt kaum Grenzen, um im Diskurs zwischen wiederkehrenden identitären und nicht-identitä- ren Elementen zu unterscheiden. Die Methodik ermöglicht zwar das Auffinden kurzer Zeiträume mit intensiver Diskursaktivität, jedoch konnte aufgrund der Fokussierung des Materials auf die Anfangsphase des Krieges (die ersten 1,5 Jahre) noch keine Diskursentwicklung festgestellt werden. Die Muster und identitären Bedeutungsstrukturen scheinen sich eher zu verfestigen als zu verändern. Nichtdestotrotz offenbaren die Ergebnisse, dass bereits in der Anfangsphase ein intensiver Bedeutungskampf beim Thema Ukraine-Unterstützung herrscht, der in Zukunft eine Einigung auf neue Hilfspakete erschweren könnte. Dies sehr wäre wahrscheinlich, falls sich ein isolationistischen Kurs im Diskurs durchsetzt.
Über die Zielsetzung der Arbeit hinaus erfordern die gewonnenen Ergebnisse daher noch eine wissensgeschichtliche Einordnung (Genealogie), um ihre diskursive Stabilität besser beurteilen zu können. In Hinsicht auf die identitären Rollenverständnisse von Amerika und Russland wäre eine solche Einordnung bereits möglich, da Forschung hierzu verfügbar ist. Allerdings gibt es noch einen Mangel an identitätsbasierter Forschung zum ukrainischen Fremdbild aus amerikanischer Perspektive, was zukünftig aufgeholt werden sollte. Die vier untersuchten kurzen Zeiträume stellen hier nur eine Momentaufnahme dar.
Daher wäre es empfehlenswert, weitere Diskursanalysen zum Fremdbild der Ukraine im amerikanischen Diskurs vorzunehmen, die einen längeren Zeitraum umfassen. Konkret empfiehlt es sich, den US-Diskurs zwischen 2014 und 2016 (zu Beginn des Ukraine-Konflikts) mit dem gegenwärtigen Diskurs während des Angriffskriegs zu vergleichen, um mögliche diskursive Veränderungen zu identifizieren. Auch für die Zukunft scheint der russische Angriffskrieg ein relevantes außenpolitisches Thema zu bleiben, da derzeit kein Ende in Sicht ist, während zugleich die weltpolitische Lage stark davon beeinflusst wird. Aktuell zeigt sich im Kongress, dass die weitere Unterstützung der Ukraine durch das oppositionelle Lager der Republikaner gefährdet ist. Hier spielen sicherlich äußere Zwänge wie beispielsweise der Präsidentschaftswahlkampf eine wichtige Rolle, die zwar nicht den Schwerpunkt dieser Arbeit bildeten, in künftige Untersuchungen aber einfließen sollten.
7 Quellenverzeichnis
Primärquellen
Austin, Lloyd (24.02.2023): CNN This Morning. Lloyd Austin is Interviewed about Ukraine. CNN. Online verfügbar unter https://transcripts.cnn.com/show/ctmo/date/2023-02-24/segment/02, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Austin, Lloyd (18.07.2023): Opening Remarks by Secretary of Defense Lloyd J. Austin III at the 14th Ukraine Defense Contact Group (As Delivered). Speech. U.S. Department of De- fense. Online verfügbar unter https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech/Article/3461668/opening-remarks-by-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-at-the-14th-ukra- ine/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Austin, Lloyd (15.03.2023): Opening Remarks by Secretary of Defense Lloyd J. Austin III at the Tenth Ukraine Defense Contact Group (As Delivered). Speech. U.S. Department of De- fense. Online verfügbar unter https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech/Article/3329644/opening-remarks-by-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-at-the-tenth-ukraine/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Austin, Lloyd (13.07.2023): One-On-One with Defense Secretary Lloyd Austin. The Situation Room. Online verfügbar unter https://transcripts.cnn.com/show/sitroom/date/2023-07-13/segment/01, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Barrasso, John (02.03.2022). In: Congressional Record - Senate 168 (38), S941-S943. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/03/02/168/38/CREC-2022-03-02-pt1-PgS924.pdf zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (19.05.2022): Statement by President Joe Biden on Senate Passage of Ukraine Supplemental. The White House. Online verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/19/statement-by-president-joe-bi- den-on-senate-passage-of-ukraine-supplemental/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (21.03.2022): Remarks by President Biden Before Business Roundtable’s CEO Quarterly Meeting. The White House. Washington, D.C. Online verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/21/remarks-by-president-biden-before-business-roundtables-ceo-quarterly-meeting/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (15.03.2022): Remarks by President Biden at Signing of H.R. 2471, “Con- solidated Appropriations Act, 2022”. The White House. Eisenhower Executive Office Building. Online verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/15/remarks-by-president-biden-at-signing-of-h-r-2471-consolidated-appropriations-act-2022/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (12.07.2023): Remarks by President Biden on Supporting Ukraine, Defend- ing Democratic Values, and Taking Action to Address Global Challenges. The White House. Vilnius, Lithuania. Online verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/07/12/remarks-by-president-biden-on-supporting-ukraine-efending-democratic-values-and-taking-action-to-address-global-challenges-vilnius-lithu- ania/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (24.02.2023): David Muir of ABC News Interviews Joe Biden. Online verfügbar unter https://factba.se/biden/transcript/joe-biden-interview-david-muir-abc-news-february-24-2023, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (24.02.2022): Remarks by President Biden on Russia’s Unprovoked and Unjustified Attack on Ukraine. The White House. East Room. Online verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/24/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (21.02.2023): Remarks by President Biden Ahead of the One-Year Anniver- sary of Russia’s Brutal and Unprovoked Invasion of Ukraine. The White House. Warschau, Polen. Online verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/02/21/remarks-by-president-biden-ahead-of-the-one-year-anniversary-of-russias-brutal-and-unprovoked-invasion-of-ukraine/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (20.02.2023): Remarks by President Biden and President Zelenskyy of Ukraine in Joint Statement. The White House. Kyjiw, Ukraine. Online verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/02/20/remarks-by-president-biden-and-president-zelenskyy-of-ukraine-in-joint-statement/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (11.05.2022): Remarks by President Biden on Supporting Farmers and American Families. The White House. Kankakee, Illinois. Online verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/05/11/remarks-by-president-biden-on-supporting-farmers-and-american-families/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (11.03.2022): Remarks by President Biden Announcing Actions to Con- tinue to Hold Russia Accountable. The White House. Roosevelt Room. Online verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/11/remarks-by-president-biden-announcing-actions-to-continue-to-hold-russia-accountable/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (10.03.2022): Remarks by President Biden and President Duque of the Re- public of Colombia Before Bilateral Meeting. The White House. Cabinet Room. Online verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/10/remarks-by-president-biden-and-president-duque-of-the-republic-of-co- lombia-before-bilateral-meeting/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (08.03.2022): Remarks by President Biden Announcing U.S. Ban on Imports of Russian Oil, Liquefied Natural Gas, and Coal. The White House. Roosevelt Room. Online verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/08/remarks-by-president-biden-announcing-u-s-ban-on-imports-of-russian- oil-liquefied-natural-gas-and-coal/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (02.03.2022): Remarks by President Biden On Building A Better America. The White House. Online verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/spe- eches-remarks/2022/03/02/remarks-by-president-biden-on-building-a-better-america-2/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (01.03.2022): Remarks of President Joe Biden - State of the Union Address As Prepared for Delivery. The White House. United States Capitol. Online verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/01/remarks-of-pres- ident-joe-biden-state-of-the-union-address-as-delivered/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (16.03.2022): Remarks by President Biden on the Assistance the United States is Providing to Ukraine. The White House. Eisenhower Executive Office Building. Online verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/16/remarks-by-president-biden-on-the-assistance-the-united-states-is- providing-to-ukraine/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (11.03.2022b): Remarks by President Biden at the House Democratic Cau- cus Issues Conference. The White House. Philadelphia, Pennsylvania. Online verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/11/remarks- by-president-biden-at-the-house-democratic-caucus-issues-conference/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Biden, Joseph R. (31.05.2022): President Biden: What America Will and Will Not Do in Ukraine. Guest Essay. In: The New York Times, 31.05.2022. Online verfügbar unter https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (23.02.2023): Secretary Antony J. Blinken Virtual Conversation on “Rus- sia’s War on Ukraine: One Year Later” With Jeffrey Goldberg of The Atlantic. Interview. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/secretary-antony-j- blinken-virtual-conversation-on-russias-war-on-ukraine-one-year-later-with-jeffrey-gold- berg-of-the-atlantic/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (20.02.2023): More U.S. Security Assistance on the Way for Ukraine.
Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/more-u-s-security-assistance-on-the-way-for-ukraine/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (28.02.2022): Additional Measures Against the Russian Financial System. Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/additional-measures-against-the-russian-financial-system/, zuletzt geprüft am 01.03.2022.
Blinken, Antony J. (26.02.2022): Additional Military Assistance for Ukraine. Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/additional- military-assistance-for-ukraine/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (25.02.2022): Imposing Sanctions on President Putin and Three Other Senior Russian Officials. Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/imposing-sanctions-on-president-putin-and-three-other-senior- russian-officials/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (24.02.2023e): The United States Imposes Additional Sweeping Costs on Russia. Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/the-united-states-imposes-additional-sweeping-costs-on-russia/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (24.02.2022): Secretary Antony J. Blinken on ABC World News Tonight with David Muir. Interview. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-abc-world-news-tonight-with-david- muir/, zuletzt geprüft am 01.03.2022.
Blinken, Antony J. (24.02.2023c): Secretary Antony J. Blinken with Michelle Miller, Tony Dokoupil, and Nate Burleson of CBS Mornings. Interview. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-with-michelle- miller-tony-dokoupil-and-nate-burleson-of-cbs-mornings/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (24.02.2023b): Continued Support for Ukraine to Withstand Russia’s As- saults. Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/continued-support-for-ukraine-to-withstand-russias-assaults/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (24.02.2023): Secretary Blinken’s Remarks at the United Nations Security Council Ministerial Meeting on Ukraine. Remarks. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/secretary-blinkens-remarks-at-the-united-nations- security-council-ministerial-meeting-on-ukraine/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (24.02.2023d): Secretary Antony J. Blinken with George Stephanopoulos of ABC Good Morning America. Interview. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-with-george-stephanopoulos-of- abc-good-morning-america/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (20.07.2023): Imposing Additional Sanctions on Those Supporting Rus- sia’s War Against Ukraine. Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/imposing-additional-sanctions-on-those-supporting-russias- war-against-ukraine-2/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (01.06.2022): Secretary Antony J. Blinken at the Foreign Affairs Magazine Centennial Celebration. Remarks. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-the-foreign-affairs-magazine-centen- nial-celebration/, zuletzt geprüft am 01.03.2022.
Blinken, Antony J. (15.03.2022b): Additional Humanitarian Assistance for the People of Ukraine. Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/additional-humanitarian-assistance-for-the-people-of-ukraine/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (19.05.2022): $100 Million in Additional U.S. Military Assistance for Ukraine. Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/100-million-in-additional-u-s-military-assistance-for-ukraine/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (21.07.2023): Secretary Antony J. Blinken at Aspen Security Forum Fire- side Chat Moderated by NBC News Chief Washington and Chief Foreign Affairs Corre- spondent Andrea Mitchell. Remarks. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-aspen-security-forum-fireside-chat- moderated-by-nbc-news-chief-washington-and-chief-foreign-affairs-correspondent-andrea- mitchell/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (03.03.2023): Additional U.S. Military Assistance for Ukraine. Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/addi- tional-u-s-military-assistance-for-ukraine/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (03.06.2022): One Hundred Days of the Kremlin’s War Against Ukraine. Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/one-hundred-days-of-the-kremlins-war-against-ukraine/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (06.03.2022): Secretary Blinken with Chuck Todd of NBC News. Interview. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/secretary- antony-j-blinken-on-nbc-meet-the-press-with-chuck-todd/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (07.07.2023): Additional U.S. Security Assistance for Ukraine. Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/addi- tional-u-s-security-assistance-for-ukraine-8/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (11.03.2022): Continuing to Hold the Kremlin to Account. Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/continuing- to-hold-the-kremlin-to-account/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (11.07.2023): Secretary Antony J. Blinken with Andrea Mitchell of Andrea Mitchell Reports on MSNBC. Interview. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/secretary-antony-j -blinken-with-andrea-mitchell-of-andrea- mitchell-reports-on-msnbc/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (02.06.2022): Targeting Russia’s Oligarchs and Vessels. Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/targeting-russias- oligarchs-and-vessels/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (15.03.2022): Promoting Accountability for Human Rights Abuses Perpe- trated by the Governments of Russia and Belarus. Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/promoting-accountability-for-human- rights-abuses-perpetrated-by-the-governments-of-russia-and-belarus/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (01.06.2022b): $700 Million Drawdown of New U.S. Military Assistance for Ukraine. Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/700-million-drawdown-of-new-u-s-military-assistance-for-ukraine/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Blinken, Antony J. (12.03.2022): $200 Million in New Security Assistance for Ukraine.
Press Statement. U.S. Department of State. Online verfügbar unter https://www.state.gov/200-million-in-new-security-assistance-for-ukraine/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Cornyn, John (24.02.2022): Cornyn Statement on Russian Invasion of Ukraine. Online verfügbar unter https://www.cornyn.senate.gov/news/cornyn-statement-on-russian-invasion- of-ukraine/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Cornyn, John (24.02.2023): Cornyn Statement on Anniversary of Russia’s Invasion of Ukraine. Online verfügbar unter https://www.cornyn.senate.gov/news/comyn-statement- on-anniversary-of-russias-invasion-of-ukraine/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Cornyn, John (27.02.2023): Ukraine (Executive Session). In: Congressional Record - Senate 169 (37), S494-S495. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/118/crec/2023/02/27/169/37/CREC-2023-02-27-pt1-PgS494-3.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Cornyn, John (17.05.2022): Legislative Session. NATO. In: Congressional Record - Senate 168 (84), S2531-S2532. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/05/17/168/84/CREC-2022-05-17-pt1-PgS2526-3.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Cornyn, John (07.03.2022): Legislative Session. Ukraine. In: Congressional Record - Senate 168 (40), S1007-S1008. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/03/07/168/40/CREC-2022-03-07-pt1-PgS1001-6.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Cornyn, John (10.03.2022): Government Funding. In: Congressional Record - Senate 168 (43), S1083-S1084. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/03/10/168/43/CREC-2022-03-10-pt1-PgS1083.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Cornyn, John (17.03.2022): Ukraine. In: Congressional Record - Senate 168 (48), S1235-S1236. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/03/17/168/48/CREC-2022-03-17-pt1-PgS1229-10.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Cornyn, John (01.03.2022). In: Congressional Record - Senate 168 (37), S870. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/03/01/168/37/CREC-2022-03-01- senate.pdf zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Cotton, Tom (18.07.2023): Speech at Christian United for Israel (CUFI) Summit. Online verfügbar unter https://www.cotton.senate.gov/news/speeches/speech-at-christian-united-for- israel-cufi-summit, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Cotton, Tom (08.03.2022): Cotton delivers speech at the Ronald Reagan Presidential Library. Online verfügbar unter https://www.cotton.senate.gov/news/speeches/cotton-delivers-spe- ech-at-the-ronald-reagan-presidential-library, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Cotton, Tom (02.03.2022): Unanimous Consent Request - S. 3731. In: Congressional Record - Senate 168 (38), S936-S937. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/03/02/168/38/CREC-2022-03-02-pt1-PgS924.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Cruz, Ted (23.02.2023): Joe’s Secret Trip - A Ukraine Deep Dive. Verdict Ep. 160. Online verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=Ma3OQlvd9Jo, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Cruz, Ted (18.05.2022): Ukraine (Executive Calendar). In: Congressional Record - Senate 168 (85), S2572. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/05/18/168/85/CREC-2022-05-18-pt1-PgS2570.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Davidson, Warren (20.03.2022): CNN Newsroom. Interview With Rep. Warren Davidson (R-OH). CNN (Transcripts). Online verfügbar unter https://transcripts.cnn.com/show/cnr/date/2022-03-20/segment/05, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Davidson, Warren (10.05.2022): Davidson Votes No on Massive Ukraine Aid Package (Press Releases). Online verfügbar unter https://davidson.house.goV/2022/5/davidson-votes-no-on-massive-ukraine-aid-package, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Davidson, Warren (14.03.2022): Some lawmakers dissent on US aid to Ukraine | Morning in America. NewsNation (Morning in America). Online verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=qaoBlngzeps, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Davidson, Warren (02.03.2022): Current Border Insecurity. In: Congressional Record - House 168 (38), H1270-H1271. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/03/02/168/38/CREC-2022-03-02-pt1-PgH1270.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gaetz, Matt (26.05.2022): Episode 46 LIVE: Dark Days Ahead - Firebrand with Matt Gaetz (Firebrand, U.S. House of Representatives). Online verfügbar unter https://gaetz.house.gov/media/videos/episode-46-live-dark-days-ahead-firebrand-matt- gaetz, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gaetz, Matt (15.07.2023): Full Speech: Matt Gaetz at Turning Point Action Conference - Day One - 7/15/23. One News Page. Online verfügbar unter https://www.onenewspage.com/video/20230715/15954950/FULL-SPEECH-Matt-Gaetz- at-Turning-Point-Action.htm, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gaetz, Matt (13.05.2022): Gaetz: I’m Not Sure That $40 Billion Dollars ISN'T Going To Start World War 3. WEAR-3 Pensacola. Online verfügbar unter https://gaetz.house.gov/media/videos/gaetz-im-not-sure-40-billion-dollars-isnt-going-start- world-war-3, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gaetz, Matt (11.07.2023): Matt Gaetz: Joe Biden Is SLEEPWALKING America into World War 3! Newsmax, Eric Bolling (The Balance). Online verfügbar unter https://www.y- outube.com/watch?v=aRSBrDnycOY, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gaetz, Matt (28.02.2022): American Elites Care More About Ukraine's Border Than Our Own. Newsmax (The Benny Report). Online verfügbar unter https://gaetz.house.gov/media/videos/american-elites-care-more-about-ukraines-border-our-own, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gaetz, Matt (22.02.2023): Matt Gaetz: America Doesn’t Need a National Divorce. FoxNews (Ingraham Angle). Online verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=Myz7 eU- PaNW4, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gaetz, Matt (10.07.2023): Episode 110 LIVE: Don't Haiti My Florida - Firebrand with Matt Gaetz (Firebrand, U.S. House of Representatives). Online verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=gnU4T0YgDDI, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gaetz, Matt (10.05.2022): Episode 41 LIVE: Pro-Life, Pro-Living - Firebrand with Matt Gaetz (Firebrand, U.S. House of Representatives). Online verfügbar unter https://gaetz.house.gov/media/videos/episode-41-live-pro-life-pro-living-firebrand-mattgaetz, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gaetz, Matt (28.02.2023): Episode 90 LIVE: Lab Leak - Firebrand with Matt Gaetz (Firebrand, U.S. House of Representatives). Online verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=x0InO7EqIj8&list=PLALlWxZ7jritawZLKZ92mYRBQf4To- nIAp&index=28, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gaetz, Matt (26.02.2022): Part of Conservative Political Action Conference, Day 3. Rep. Gaetz and Others. C-SPAN. Online verfügbar unter https://www.c-span.org/vi- deo/?518033-4/conservative-political-action-conference-rep-gaetz, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gaetz, Matt (13.07.2023): National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024 169 (120), H3512-H3514. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/118/crec/2023/07/13/169/120/CREC-2023-07-13-pt1-PgH3504.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gaetz, Matt (11.05.2022): Dangerous Bipartisan Consensus on Ukraine. In: Congressional Record - House 168 (80), H4808. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/05/11/168/80/CREC-2022-05-11-pt1-PgH4808.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gosar, Paul (06.08.2023): This Week with Gosar. August 6, 2023. Online verfügbar unter https://gosar.house.gov/news/email/show.aspx?ID=C2FBKS FXHSKR55MXOKQRUGC2TM, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gosar, Paul (20.02.2023). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/RepGosar/status/1627788864256372736?lang=en, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gosar, Paul (02.03.2022): Gosar votes against resolution that drags the United States into an- other war (Press Releases). Online verfügbar unter https://gosar.house.gov/news/document-single.aspx?DocumentID=4918, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gosar, Paul (17.03.2022). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/DrPaul-Gosar/status/1504396034977538059, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gosar, Paul (24.02.2022). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/DrPaul-Gosar/status/1496898243988365313, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Gosar, Paul (25.02.2022): Lessons to Learn from the Russian Invasion of Ukraine. In: congressional Record - Extensions of Remarks 168 (35), E180. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/02/25/168/35/CREC-2022-02-25-pt1-PgE180.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Graham, Lindsey (19.05.2022): Why I support a Ukraine aid package before it's too late (Op-Eds/Columns). Online verfügbar unter https://www.lgraham.senate.gov/public/index.cfm/op-eds-columns?ID=10EF9CB5-EFB7-4A96-8197-987FDA2A457C, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Graham, Lindsey (25.02.2022). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twit-ter.com/LindseyGrahamSC/status/1497242545927208962, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Graham, Lindsey (07.03.2022): Graham Discusses Latest News on Ukraine And More. FoxNews. Online verfügbar unter https://www.lgraham.senate.gov/public/index.cfm/2022/3/graham-discusses-latest-news-on-ukraine-and-more, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Graham, Lindsey (20.02.2023): Graham on Biden Visit to Ukraine. Online verfügbar unter https://www.lgraham.senate.gov/public/index.cfm/2023/2/graham-on-biden-visit-to-ukraine, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Graham, Lindsey (17.03.2022): Graham Discusses Need for Congressional Action on Ukraine, Sanctions, and More. FoxNews. Online verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=wr8IFFBs8vk, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Graham, Lindsey (10.05.2022): Graham Discusses the Importance of Designating Putin's Russia a State Sponsor of Terrorism and More. FoxNews. Online verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=soWyJ8AWzhE, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Graham, Lindsey (14.03.2022): Graham Reacts To Russian Attacks In Ukraine And More. FoxNews. Online verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=SF5 akiq10A, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Graham, Lindsey (15.03.2023): Graham: American Foreign Policy is in Freefall. FoxNews. Online verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=t7SHektUkOA, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Graham, Lindsey (26.05.2022): Ukraine. In: Congressional Record - Senate 168 (92), S2726-S2727. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/05/26/168/92/CREC-2022-05-26.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Graham, Lindsey (12.05.2022): Ukraine (Executive Calendar). In: Congressional Record - Senate 168 (81), S2482-S2483. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/05/12/168/81/CREC-2022-05-12-pt1-PgS2482.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Graham, Lindsey (16.03.2022): Ukraine (Executive Calendar). In: Congressional Record - Senate 168 (47), S1209-S1210. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/03/16/168/47/CREC-2022-03-16-pt1-PgS1209-2.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Graham, Lindsey; Johnson, Boris (22.02.2023): Ukraine Needs More Weapons and Support from the West. Making sure that Russia loses is the best long-term investment we can make in global security. In: The Wall Street Journal, 22.02.2023. Online verfügbar unter https://www.wsj.com/articles/ukraine-needs-more-from-the-west-missiles-tanks-planestraining-putin-crimea-sanctions-wagner-group-terrorism-c007b9c4, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Grassley, Charles E. (10.03.2022b). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/ChuckGrassley/status/1502050632378822663, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Grassley, Charles E. (19.05.2022): H.R. 7691. In: Congressional Record - Senate 168 (86), S2606-S2607. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/05/19/168/86/CREC-2022-05-19-pt1-PgS2605-2.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Grassley, Charles E. (10.03.2022): H.R. 2471. In: Congressional Record - Senate 168 (43), S1092. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/03/10/168/43/CREC-2022-03-10-pt1-PgS1089-2.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (09.07.2023). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/RepMTG/status/1678042604364021763, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (23.02.2023): Marjorie Taylor Greene to introduce bill to force Congress to provide Ukraine aid audit. Rep. Marjorie Taylor Greene, R-Ga., says war- mongers and Biden admin leaders are going lead U.S. into WWIII on 'Tucker Carlson To- night. FoxNews (Tucker Carlson Tonight). Online verfügbar unter https://www.foxnews.com/video/6321077622112, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (08.07.2023). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/RepMTG/status/1677651441693933570, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (19.03.2022). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/RepMTG/status/1504983031437795334, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (15.03.2022). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/RepMTG/status/1503858439759482881, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (10.05.2022b). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/RepMTG/status/1524071646213992448, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (20.03.2022b). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/RepMTG/status/1505562727145689091, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (20.03.2022). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/RepMTG/status/1505600273082982403?lang=en, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (10.07.2023). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/RepMTG/status/1678487285564600333, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (27.02.2022). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/RepMTG/status/1498025435392741380, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (14.07.2023). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/RepMTG/status/1679644491991400449, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (12.07.2023). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/RepMTG/status/1679163751793147915, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (16.07.2023): Live: MTG, Hawley, and Ted Cruz to Speak at Turn- ing Point Action Conference - Day Two - 7/16/23. One News Page. Online verfügbar unter https://www.onenewspage.com/video/20230716/15956175/LIVE-MTG-Hawley-and-TedCruz-To-Speak.htm, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (24.02.2022). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/RepMTG/status/1496876668484472838, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (26.07.2023): Military Construction, Veterans Affairs, and Related Agencies Appropriations Act, 2024 169 (129), H3993-H3994. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/118/crec/2023/07/26/169/129/CREC-2023-07-26-pt1-PgH3976- 3.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (13.07.2023): National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024. In: Congressional Record - House 169 (120), H3511-H3512. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/118/crec/2023/07/13/169/120/CREC-2023-07-13-pt1-PgH3504.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (10.05.2022): H.R. 7691, Additional Ukraine Supplemental Appro- priations Act, 2022. In: Congressional Record - House 168 (78), H4767. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/05/10/168/78/CREC-2022-05-10-pt1-PgH4764.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (17.03.2022): Focus on America First. In: Congressional Record - House 168 (48), H3788. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/03/17/168/48/CREC-2022-03-17-pt1-PgH3788-2.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Greene, Marjorie Taylor (17.03.2022b): America in Crisis. In: Congressional Record - House 168 (48), H3822-3824. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/03/17/168/48/CREC-2022-03-17-house.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Harris, Kamala (02.03.2022): Remarks by Vice President Harris Highlighting the Admin- istration’s Historic Investments in Our Workers. The White House. Durham, North Carolina. Online verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/02/remarks-by-vice-president-harris-highlighting-the-administrations-historic-investments-in-our-workers/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Hawley, Josh (17.03.2023): Globalists & Woke Billionaires: Senator Hawley Talks Ukraine and SVB. FoxNews. Online verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=lLu8kz-68DQ, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Hawley, Josh (01.03.2023): All of a sudden we have billions we can give to Ukraine?: Sen. Josh Hawley. Sen. Josh Hawley: We need an accounting of every single penny we have sent to Ukraine. FoxNews (Ingraham Angle). Online verfügbar unter https://www.foxnews.com/video/6321461337112, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Hawley, Josh (25.02.2023): Josh Hawley: Time to say no more welfare for Europeans and put Americans first. Tucker Carlson Tonight (FoxNews). Online verfügbar unter https://www.foxnews.com/video/6321184326112, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Hawley, Josh (24.05.2022): No to Neoconservatism. In: Compact Magazine, 24.05.2022. Online verfügbar unter https://www.compactmag.com/article/no-to-neoconservatism/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (14.05.2022): Leader McConnell and Senators Collins, Cornyn, and Bar- rasso Meet President Zelenskyy in Kyiv (Press Releases). Online verfügbar unter https://www.republicanleader.senate.gov/newsroom/press-releases/leader-mcconnell-and-senators-collins-cornyn-and-barrasso-meet-president-zelenskyy-in-kyiv, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (16.03.2022b). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/LeaderMcConnell/status/1504139835237273600, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (01.03.2022): ICYMI: McConnell on ‘The Story with Martha Mac- Callum’ (Press Releases). Online verfügbar unter https://www.republicanleader.senate.gov/newsroom/press-releases/icymi-mcconnell-on-the-story-with-martha-maccallum-, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (24.02.2023). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/LeaderMcConnell/status/1629126080559710208?lang=en, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (24.02.2023b): McConnell on One-Year Anniversary of Ukraine Escala- tion (Press Releases). Online verfügbar unter https://www.republicanleader.senate.gov/newsroom/press-releases/mcconnell-on-one-year-anniversary-of-ukraine-escalation, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (17.05.2022): Ukraine. In: Congressional Record - Senate 168 (84), S2525-S2526. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/05/17/168/84/CREC-2022-05-17-pt1-PgS2525-6.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (18.05.2022): Ukraine. In: Congressional Record - Senate 168 (85), S2554. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/05/18/168/85/CREC-2022-05-18-senate.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (19.05.2022): H.R. 7691. In: Congressional Record - Senate 168 (86), S2599-S2600. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/05/19/168/86/CREC-2022-05-19-senate.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (07.06.2022): Ukraine. In: Congressional Record - Senate 168 (97), S2796-S2797. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/06/07/168/97/CREC-2022-06-07-senate.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (01.03.2023): Executive Session. Congressional Delegation. In: Congres- sional Record - Senate 169 (39), S539-S540. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/118/crec/2023/03/01/169/39/CREC-2023-03-01-senate.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (12.07.2023): Ukraine. In: Congressional Record - Senate 169 (119), S2331-S2332. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/118/crec/2023/07/12/169/119/CREC-2023-07-12-pt1-PgS2331-8.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (25.07.2023): Legislative Session. Ukraine. In: Congressional Record - Senate 169 (128), S3504-S3505. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/118/crec/2023/07/25/169/128/CREC-2023-07-25-pt1-PgS3503-7.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (16.03.2022): Ukraine (Executive Session). In: Congressional Record - Senate 168 (47), S1195. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/03/16/168/47/CREC-2022-03-16-pt1-PgS1194-3.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (15.03.2022): Ukraine. In: Congressional Record - Senate 168 (46), S1158-S1159. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/03/15/168/46/CREC-2022-03-15-senate.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (12.05.2022): Ukraine (Executive Session). In: Congressional Record - Senate 168 (81), S2466. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/05/12/168/81/CREC-2022-05-12-pt1-PgS2466.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (10.03.2022): Ukraine. In: Congressional Record - Senate 168 (43), S1071. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/03/10/168/43/CREC-2022-03-10-pt1-PgS1071-2.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
McConnell, Mitch (28.02.2022): Ukraine. In: Congressional Record - Senate 168 (36), S817- S818. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/02/28/168/36/CREC-2022-02-28-pt1-PgS817-4.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Paul, Rand (13.05.2022). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/Rand-Paul/status/1524913120606552066?lang=en, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Paul, Rand (12.05.2022): Mexico (Executive Calendar). In: Congressional Record - Senate 168 (81), S2481. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/05/12/168/81/CREC-2022-05-12-pt1-PgS2481.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Paul, Rand (17.05.2022): Legislative Session. H.R. 7691. In: Congressional Record - Senate 168 (84), S2526-S2528. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/05/17/168/84/CREC-2022-05-17-pt1-PgS2526-3.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Paul, Rand (19.05.2022): Small Business COVID Relief Act of 2022—Motion to Proceed— Resumed. In: Congressional Record - Senate 168 (86), S2608-S2609. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/05/19/168/86/CREC-2022-05-19-pt1-PgS2607-2.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Paul, Rand (26.07.2023): National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024—Contin- ued. In: Congressional Record - Senate 169 (129), S3585. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/118/crec/2023/07/26/169/129/CREC-2023-07-26-pt1-PgS3585-4.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Roosevelt, Franklin D. (1940): Speeches by Franklin D. Roosevelt: The Arsenal of Democ- racy. U.S. Diplomatic Mission to Germany. Online verfügbar unter https://usa.usem-bassy.de/etexts/speeches/rhetoric/fdrarsen.htm, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Roy, Chip (17.05.2022): Feeling the Impacts in Texas. In: Congressional Record - House 168 (84), H5093-H5095. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/05/17/168/84/CREC-2022-05-17-pt1-PgH5092-3.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Vance, James D. (17.07.2023): Sen. JD Vance: We need to stop supporting Ukraine’s war ef- forts. Sen. JD Vance, R-Ohio, slams President Biden's depletion of ammunition stockpiles, saying the U.S. should roll back its support until ‘we have enough bullets for our own troops. FoxNews (Ingraham Angle). Online verfügbar unter https://www.foxnews.com/video/6331366727112, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Vance, James D. (26.02.2022): Part of Conservative Political Action Conference, Day 3. J.D. Vance Remarks. C-SPAN. Online verfügbar unter https://www.c-span.org/video/?5180335/conservative-political-action-conference-jd-vance-remarks, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Vance, James D. (16.07.2023): Full Speech: JD Vance at Turning Point Action Conference - Day Two - 7/16/23. One News Page. Online verfügbar unter https://www.onenewspage.com/video/20230716/15956882/FULL-SPEECH-JD-Vance-at-Turning-Point-Action.htm, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Vance, James D. (09.07.2023). Twitter (X). Online verfügbar unter https://twitter.com/JDVance1/status/1678101777739120640, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Wicker, Roger (24.02.2022): Miss. Senator Addresses International Assembly on Russian Invasion. Press Releases. Online verfügbar unter https://www.wicker.senate.gov/2022/2/wicker-blasts-putin-s-brazen-attack-on-ukraine, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Wicker, Roger (28.02.2023): Miss. Senator: “Ukrainian Battlefield Victories Are Necessary for A Just Peace” (Press Releases). Online verfügbar unter https://www.wicker.senate.gov/2023/2/wicker-leads-ukraine-hearing-pushes-for-faster-aid-to-help-defeat-russia, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Wicker, Roger (22.02.2023): Sen. Roger Wicker: Biden needs to match his speech with action. Mississippi Sen. Roger Wicker emphasizes the importance of supporting Ukraine as Russia and China appear to be establishing closer ties. FoxNews. Online verfügbar unter https://www.foxnews.com/video/6320980807112, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Wicker, Roger (21.03.2022): Ukraine Needs Fighter Jets, Missiles, And A Humanitarian Airlift (Weekly Report). Online verfügbar unter https://www.wicker.senate.gov/2022/3/wicker-returns-from-war-torn-europe, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Wicker, Roger (15.03.2022): Ukraine. In: Congressional Record - Senate 168 (46), S1186- S1187. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/117/crec/2022/03/15/168/46/CREC-2022-03-15-pt1-PgS1186- 7.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Wicker, Roger (15.03.2023): Senate Armed Services Committee. In: Congressional Record - Senate 169 (48), S807-S808. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/118/crec/2023/03/15/169/48/CREC-2023-03-15-pt1-PgS807-4.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Wicker, Roger (19.07.2023): Recess. S. 2226. In: Congressional Record - Senate 169 (124), S3132-S3133. Online verfügbar unter https://www.congress.gov/118/crec/2023/07/19/169/124/CREC-2023-07-19-senate.pdf, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Yellen, Janet L. (01.03.2022): Statement from Secretary of the Treasury Janet L. Yellen on G7 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting. U.S. Department of Treasury. Online verfügbar unter https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0621, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Yellen, Janet L. (27.02.2023c): Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen in Kyiv, Ukraine. Secretary Statements & Remarks. U.S. Department of Treasury. Online verfügbar unter https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1305, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Yellen, Janet L. (27.02.2023b): Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen at Wreath Laying Ceremony in Kyiv, Ukraine. Secretary Statements & Remarks. U.S. Department of Treasury. Online verfügbar unter https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1306, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Yellen, Janet L. (02.03.2022): Secretary of the Treasury Janet L. Yellen’s Remarks at the University of Illinois Chicago’s Innovation Center. Secretary Statements & Remarks. U.S. Department of Treasury. Online verfügbar unter https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0623, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Yellen, Janet L. (27.02.2023d): Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen at Bilateral Meeting with President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Secretary Statements & Remarks. U.S. Department of Treasury. Online verfügbar unter https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1303, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Yellen, Janet L. (27.02.2023): Janet L. Yellen in Kyiv: Economic Aid to Ukraine Is Vital.
Guest Essay. In: The New York Times, 27.02.2023. Online verfügbar unter https://www.nytimes.com/2023/02/27/opinion/janet-yellen-ukraine-russia.html, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Sekundärquellen
Ali, Murad (2009): US Aid to Pakistan and Democracy. In: Policy Perspectives 6 (2), S. 119-132.
Askarov, Zohid; Doucouliagos, Hristos; Paldam, Martin; Stanley, T. D. (2022): Reward- ing good political behavior: US aid, democracy, and human rights. In: European Journal of Political Economy 71. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2021.102089.
Baumann, Mario (2022): Poststructuralism in International Relations: Discourse and the Military. In: Anders McD Sookermany (Hg.): Handbook of Military Sciences. Cham: Springer International Publishing, S. 1-18.
Belsey, Catherine (2013): Poststrukturalismus. Stuttgart: Reclam (Reclams Universal-Biblio- thek Reclam-Sachbuch).
Blanton, Shannon Lindsey (2000): Promoting Human Rights and Democracy in the Devel- oping World: U.S. Rhetoric versus U.S. Arms Exports. In: American Journal of Political Science 44 (1), S. 123. DOI: 10.2307/2669298.
Blanton, Shannon Lindsey (2005): Foreign Policy in Transition? Human Rights, Democ- racy, and U.S. Arms Exports. In: International Studies Quarterly 49 (4), S. 647-668. DOI: 10.1111/j.1468-2478.2005.00382.x.
Boekle, Henning; Nadoll, Jörg; Stahl, Bernhard (2001): Nationale Identität, Diskursanalyse und Außenpolitikforschung: Herausforderungen und Hypothesen. Trier (PAFE-Arbeitspapier, Nr. 4).
Brunner, Elgin Medea (2013): Foreign Security Policy, Gender, and US Military Identity. London: Palgrave Macmillan UK.
Campbell, David (1998): Writing Security. United States Foreign Policy and the Politics of Identity. Rev. ed. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Capie, David (2015): The United States and Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) in East Asia: Connecting Coercive and Non-Coercive Uses of Military Power. In: Journal of Strategic Studies 38 (3), S. 309-331. DOI: 10.1080/01402390.2014.1002914.
Chilton, Paul; Schaffner, Christine (1997): Discourse and Politics. In: Teun A. van Dijk (Hg.): Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduc- tion. London: SAGE (Discourse studies, Volume 2), S. 206-230.
Clark, Tom; Foster, Liam; Sloan, Luke; Bryman, Alan (2021): Social Research Methods. Sixth edition. Oxford: Oxford University Press.
Congressional Research Service (2024): U.S. Security Assistance to Ukraine (In Focus). Online verfügbar unter https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Convention on Cluster Munitions (2022): States Parties and Signatories by region. Online verfügbar unter https://www.clusterconvention.org/states-parties/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Derrida, Jacques (1997): Of grammatology. Corrected ed. Baltimore, Md.: Johns Hopkins Univ. Press.
Dimant, Eugen; Krieger, Tim; Meierrieks, Daniel (2020): Paying Them to Hate US: The Effect of U.S. Military Aid on Anti-American Terrorism, 1968-2014. In: SSRN Journal. DOI: 10.2139/ssrn.3639277.
Dube, Oeindrila; Naidu, Suresh (2015): Bases, Bullets, and Ballots: The Effect of US Military Aid on Political Conflict in Colombia. In: The Journal of Politics 77 (1), S. 249-267. DOI: 10.1086/679021.
Duncombe, Constance (2016): Representation, recognition and foreign policy in the Iran-US relationship. In: European Journal of InternationalRelations 22 (3), S. 622-645. DOI: 10.1177/1354066115597049.
Epstein, Charlotte (2011): Who speaks? Discourse, the subject and the study of identity in international politics. In: European Journal ofInternational Relations 17 (2), S. 327-350. DOI: 10.1177/1354066109350055.
Fermor, Ben; Holland, Jack (2020): Security and polarization in Trump’s America: securiti- zation and the domestic politics of threatening others. In: Global Affairs 6 (1), S. 55-70. DOI: 10.1080/23340460.2020.1734958.
Fierke, Karin M. (2015): Critical approaches to international security. 2. ed. Cambridge, Malden, MA: Polity Press.
Fleck, Robert K.; Kilby, Christopher (2006): How Do Political Changes Influence US Bilateral Aid Allocations? Evidence from Panel Data. In: Rev Development Economics 10 (2), S. 210-223. DOI: 10.1111/j.1467-9361.2006.00313.x.
Gee, James Paul (2011): An Introduction to Discourse Analysis. Theory and Method. Third Edition. New York: Routledge.
Hall, Stuart (2018): The West and the Rest: Discourse and Power [1992]. In: Stuart Hall und David Morley (Hg.): Essential Essays, Volume 2: Duke University Press, S. 141-184.
Hansen, Lene (2006): Security as Practice. Discourse Analysis and the Bosnian War. First published. New York: Routledge.
Hansen, Lene (2016): Discourse analysis, post-structuralism, and foreign policy. In: Steve Smith, Amelia Hadfield und Timothy Dunne (Hg.): Foreign policy. Theories, actors, cases. Third edition. Oxford: Oxford University Press, S. 94-109.
Herschinger, Eva; Renner, Judith (2017): Diskursforschung in den Internationalen Beziehungen. In: Frank Sauer und Carlo Masala (Hg.): Handbuch Internationale Beziehungen. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 313-337.
Holland, Jack; Fermor, Ben (2021): The discursive hegemony of Trump’s Jacksonian popu- lism: Race, class, and gender in constructions and contestations of US national identity, 2016-2018. In: Politics 41 (1), S. 64-79. DOI: 10.1177/0263395720936867.
Holzscheiter, Anna (2013): Between Communicative Interaction and Structures of Significa- tion: Discourse Theory and Analysis in International Relations. In: International Studies Perspectives, S. 1-21. Online verfügbar unter https://www.polsoz.fu-berlin.de/en/pol- wiss/forschung/international/atasp/publikationen/4 artikel papiere/2013 AH Between- Communicative-Interaction/index.html, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Hurrell, Andrew (2007): On Global Order: Power, Values, and the Constitution of International Society. First published. New York: Oxford University Press.
Johnson, Robert (2008): Victory and Identity. The end of the Cold War in American imagination. In: Kenneth Christie (Hg.): United States Foreign Policy & National Identity in the 21st Century: Routledge, S. 3-19.
Jorgensen, Marianne; Phillips, Louise (2002): Discourse Analysis as Theory and Method. 6 Bonhill Street, London England EC2A 4PU United Kingdom: SAGE Publications Ltd.
Kaplan, Robert D. (1993): Balkan Ghosts: A Journey Through History. First published. New York: St. Martin's Press.
Keller, Reiner; BosanciC, Sasa (2018): Diskursanalyse. In: Ralf Bohnsack, Alexander Gei- mer und Michael Meuser (Hg.): Hauptbegriffe qualitativer Sozialforschung. 4., vollst. überarbeitete und erweiterte Auflage. Opladen, Toronto: Verlag Barbara Budrich (UTB Erziehungswissenschaft, Sozialwissenschaft, 8226), S. 44-49.
Kevlihan, Rob; DeRouen, Karl; Biglaiser, Glen (2014): Is US Humanitarian Aid Based Pri- marily on Need or Self-Interest? In: International Studies Quarterly 58 (4), S. 839-854. DOI: 10.1111/isqu.12121.
Kiyani, Ghashia (2022): US aid and substitution of human rights violations. In: Conflict Management and Peace Science 39 (5), S. 587-608. DOI: 10.1177/07388942211045045.
Kristeva, Julia (1980): Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. New York, NY: Columbia University Press (European perspectives).
Laclau, Ernesto; Mouffe, Chantal (2001): Hegemony and socialist strategy. Towards a radi- cal democratic politics. 2. ed. London: Verso. Online verfügbar unter http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1311/2001268509-d.html, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Lock, Ed (2008): The Complex Fate of Being America. The constitution of identity and the politics of security. In: Kenneth Christie (Hg.): United States Foreign Policy & National Identity in the 21st Century: Routledge, S. 66-81.
Marsden, Lee (2011): Religion, identity and American power in the age of Obama. In: International Politics 48 (2-3), S. 326-343. DOI: 10.1057/ip.2011.8.
Martinez Machain, Carla (2021): Exporting Influence: U.S. Military Training as Soft Power. In: Journal of Conflict Resolution 65 (2-3), S. 313-341. DOI: 10.1177/0022002720957713.
Milliken, Jennifer (1999): The Study of Discourse in International Relations. In: European Journal of International Relations 5 (2), S. 225-254. DOI: 10.1177/1354066199005002003.
Mulligan, Shane P. (2006): The Uses of Legitimacy in International Relations. In: Millennium: Journal of International Studies 34 (2), S. 349-375. DOI: 10.1177/03058298060340021801.
Nabers, Dirk (2009): Filling the Void of Meaning: Identity Construction in U.S. Foreign Pol- icy After September 11, 2001. In: Foreign Policy Analysis 5 (2), S. 191-214. DOI: 10.1111/j.1743-8594.2009.00089.x.
Nau, Henry R. (2002): At Home Abroad. Identity and Power in American Foreign Policy: Cornell University Press (Cornell Studies in Political Economy).
Pan, Chengxin; Turner, Oliver (2017): Neoconservatism as discourse: Virtue, power and US foreign policy. In: European Journal of International Relations 23 (1), S. 74-96. DOI: 10.1177/1354066115623349.
Parmar, Inderjeet (2008): Neo-Conservative-Dominated US Foreign Policy Establishment? In: Kenneth Christie (Hg.): United States Foreign Policy & National Identity in the 21st Century: Routledge, S. 37-49.
Pedersen, Carl (2008): Cosmopolitanism or Nativism? US national identity and foreign pol- icy in the twenty-first century. In: Kenneth Christie (Hg.): United States Foreign Policy & National Identity in the 21st Century: Routledge, S. 20-33.
Regilme, Salvador Santino (2023): United States Foreign Aid and Multilateralism Under the Trump Presidency. In: New Global Studies 17 (1), S. 45-69. DOI: 10.1515/ngs-2021-0030.
Regilme, Salvador Santino Fulo (2018): Does US Foreign Aid Undermine Human Rights? The “Thaksinification” of the War on Terror Discourses and the Human Rights Crisis in Thailand, 2001 to 2006. In: Human Rights Review 19 (1), S. 73-95. DOI: 10.1007/s12142- 017-0482-2.
Restad, Hilde Eliassen (2020): What makes America great? Donald Trump, national identity, and U.S. foreign policy. In: Global Affairs 6 (1), S. 21-36. DOI: 10.1080/23340460.2020.1734955.
Rowley, Christina; Weldes, Jutta (2012): The evolution of international security studies and the everyday: Suggestions from the Buffyverse. In: Security Dialogue 43 (6), S. 513-530. DOI: 10.1177/0967010612463490.
Sandlin, Evan W. (2022): The limits of US national identity: interests and values in US military aid. In: International Relations, 1-25. DOI: 10.1177/00471178221140087.
Schonberg, Karl K. (2009): Constructing 21St Century U.S. Foreign Policy. Identity, Ideol- ogy, and America's World Role in a New Era. New York: Palgrave Macmillan US.
Sirakov, David (2023): Die USA zwischen Internationalismus und Isolationismus. In: Deutschland Archiv. Online verfügbar unter https://www.bpb.de/themen/nordamerika/usa/517667/die-usa-zwischen-internationalismus-und-isolationismus/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Stahl, Bernhard; Harnisch, Sebastian (2009): Nationale Identitäten und Außenpolitiken: Erkenntnisse, Desiderate und neue Wege in der Diskursforschung. In: Bernhard Stahl und Sebastian Harnisch (Hg.): Vergleichende Außenpolitikforschung und nationale Identitäten: Nomos, S. 31-58.
Steele, Brent J. (2008): Ideals that were really never in our possession': Torture, Honor and US Identity. In: International Relations 22 (2), S. 243-261. DOI: 10.1177/0047117808089897.
Stewart, Caitlin (2008): Patriotism, National Identity, and Foreign Policy. The US-Israeli alliance in the twenty-first century. In: Kenneth Christie (Hg.): United States Foreign Pol- icy & National Identity in the 21st Century: Routledge, S. 50-65.
Sullivan, Patricia L.; Tessman, Brock F.; Li, Xiaojun (2011): US Military Aid and Recipi- ent State Cooperation. In: Foreign Policy Analysis 7 (3), S. 275-294. DOI: 10.1111/j.1743- 8594.2011.00138.x.
Taesuh, Cha (2015): The formation of American exceptional identities: A three-tier model of the “standard of civilization” in US foreign policy. In: European Journal of International Relations 21 (4), S. 743-767. DOI: 10.1177/1354066114562475.
Todorova, Maria (1997): Imagining the Balkans: Oxford University Press.
Tokdemir, Efe (2017): Winning hearts & minds (!): The dilemma of foreign aid in anti- Americanism. In: Journal of Peace Research 54 (6), S. 819-832. DOI: 10.1177/0022343317708831.
Torfing, Jacob (2005): Discourse Theory: Achievements, Arguments, and Challenges. In: David Howarth und Jacob Torfing (Hg.): Discourse Theory in European Politics. London: Palgrave Macmillan UK, S. 1-32.
Trebesch, Christoph; Antezza, Arianna; Bushnell, Katelyn; Dyussimbinov, Yelmurat; Frank, Andre; Frank, Pascal et al. (2023): The Ukraine Support Tracker: Which coun- tries help Ukraine and how? Kiel Institute for the World Economy (Kiel Working Papers, 2218). Online verfügbar unter https://www.ifw-kiel.de/publications/the-ukraine-support-tracker-which-countries-help-ukraine-and-how-20852/, zuletzt geprüft am 01.03.2024.
Turner, Oliver (2014): American Images of China. Identity, Power, Policy: Routledge.
Weldes, Jutta (1999): The Cultural Production of Crises: U.S. Identity and Missiles in Cuba. In: Jutta Weldes, Mark Laffey, Hugh Gusterson und Raymond Duvall (Hg.): Cultures of insecurity. States, communities, and the production of danger. Minneapolis: University of Minnesota Press (Borderlines Series, 14), S. 35-62.
Wendt, Alexander (1999): Social Theory of International Politics: Cambridge University Press.
Wendt, Alexander (1992): Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. In: International Organization 46 (2), S. 391-425.
Zevelev, Igor (2002): Russian and American National Identity, Foreign Policy, and Bilateral Relations. In: International Politics 39 (4), S. 447-465. DOI: 10.1057/pal- grave.ip.8892004.
[...]
1 Bezogen auf die Demokratische Partei in den USA („Democratic Party“).
2 Gender-Hinweis: In der vorliegenden Arbeit wird aus stilistischen und sprachkonventionellen Gründen die männ- liehe Geschlechtsform verwendet, selbstverständlich sind aber alle Geschlechter (m/w/d) gemeint.
3 Abgesehen davon gibt es auch Werke, die nicht einem der beiden Lager zuzuordnen sind, da sie entweder literaturbasiert und argumentativ verfahren oder auf anderen Methoden und Theorien aufbauen.
4 Die Begriffe Self und Other werden synonym zu den deutschen Begriffen Selbstbild und Fremdbild verwendet.
5 Der Begriff Amerika wird synonym mit dem Begriff USA (Vereinigte Staaten von Amerika) verwendet.
6 Die Prognose konnte sich offenbar jedoch nicht erfüllen, da mit Donald Trumps Präsidentschaft der Isolationismus wieder an Bedeutung gewonnen hat.
7 Ein Forschungsstrand, das weder dem Wendt’schen noch dem Campbell’schen Lager zugeordnet werden kann.
8 Solche Elemente heißen fließende Signifikanten (eng.: floating signifiers).
9 In Anlehnung an Laclau und Mouffes Theorie bieten Hansens (2006) Forschungsmodelle (siehe Kapitel 4.1) einen analytischen Rahmen dafür, um zu untersuchen, inwieweit ein hegemonialer Status erreicht ist und wie dieser Status herausgefordert wird (vgl. Hansen 2006: 7; 216).
10 Der Akt des Sprechens ist eine Eigenschaft, die sowohl staatliche als auch nicht-staatliche Akteure teilen und die zur Bestimmung ihrer Identität von zentraler Bedeutung ist (vgl. Epstein 2011: 341 f.).
11 Außerdem distanzieren sie sich vom historischen Materialismus des Marxismus und seinem Begriff der kollektiven Identität, die durch ökonomische und materielle Faktoren bestimmt wird.
12 In Bezug auf die Identität wird der Begriff Element synonym zum Begriff Zeichen verwendet.
13 Die Berücksichtigung all dieser Faktoren ist jedoch nicht Teil der vorliegenden Arbeit, da dies den Rahmen sprengen würde.
14 Diskursträger sind privilegierte Akteure - sogenannte „ privileged storyteller “ (Milliken 1999: 236), die aktiv am Diskurs teilnehmen und aufgrund ihrer verfassungsmäßigen oder gesellschaftlichen Rolle höhere Überzeugungschancen genießen als andere Mitglieder der Gesellschaft (vgl. Stahl/Harnisch 2009: 52).
15 Es sieht ungefähr 14 Milliarden US-Dollar Soforthilfe für die Ukraine vor.
16 Darunter sind nicht alle republikanischen Kongressabgeordnete gemeint, sondern nur diejenigen, die in der Debatte als die aktivsten aufgefallen sind.
17 Ab hier wird bei den Quellenangaben der Diskursanalyse im Vergleich zu den Literaturquellen durch die Ergänzung des genauen Datums und eines Kommas bewusst ein abweichender Zitierstil verfolgt, um die Quellen derselben Person im gleichen Jahr besser voneinander abzugrenzen.
18 Mit anderen Worten: Jede Verhandlung spiegelt den Verlauf an der ukrainischen Front wider.
19 Streumunition ist besonders wegen des hohen Anteils nicht detonierter Submunitionen umstritten, sodass insgesamt 112 Staaten sich in einem Übereinkommen dazu verpflichtet haben, diese nicht einzusetzen. Die USA, die Ukraine und Russland gehören jedoch nicht zu den Staaten, die sich diesem Übereinkommen angeschlossen haben (vgl. Convention on Cluster Munitions 2022).
20 Freiheit ist in diesem Kontext auch als ein Wert zu verstehen.
21 Es ist ein seit 2021 bestehendes Recht, das den Präsidenten unter besonderen Umständen erlaubt, eine sofortige militärische Unterstützung an Verbündete zu genehmigen. Sie umfasst Dienstleistungen und militärische Güter aus Lagern oder Vorräten des US-Verteidigungsministeriums und darf eine vorab bestimmte gesetzlich festgelegte Obergrenze nicht überschreiten (Congressional Research Service 2024).
22 National Defense Authorization Act.
23 Hierbei ist anzumerken, dass die Diskursträger sich mit solchen Aussagen der russischen Propaganda über die Ukraine bedienen.
24 Republikanische Partei (Grand Old Party)
25 Hawley zufolge führt die Unterstützungspolitik dazu, dass sich Amerika dazu verpflichtet, die „Finanzierung des Krieges“ fortzusetzen und den darauf folgenden Wiederaufbau zu übernehmen (Hawley, 24.05.2022).
26 Der gewählte Begriff Gefahr soll eine Abgrenzung zum Begriff Bedrohung ausdrücken, da der Diskurs der Unterstützungsgegner in Russland keine Bedrohung für die nationale Sicherheit sieht.
27 Hierbei ist anzumerken, dass die Diskursträger sich mit solchen Aussagen der russischen Propaganda über die Ukraine bedienen.
28 Stopping the Spread of Taxpayer-Funded Bioweapons Act of 2022.
29 H.Res.113 - Ukraine Fatigue Resolution.
30 Republikanische Partei (Grand Old Party)
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Inhaltsverzeichnis des Textes?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst:
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Forschungsstand
- 2.1 Identität im Zusammenspiel mit der US-Außen- und Sicherheitspolitik
- 2.2 US-Auslandshilfe als Außen- und Sicherheitspolitik
- 2.3 Die Relevanz der Verbindung von Identität und Auslandshilfe
- 3 Theoretischer Hintergrund
- 3.1 Diskurstheorie nach Laclau/Mouffe
- 3.1.1 Grundbegriffe: Bedeutung und Diskurs
- 3.1.2 Die Rolle der Sprache und der Materialität
- 3.1.3 Hegemoniale Kämpfe und sozialer Antagonismus
- 3.2 Identität und außenpolitischer Diskurs
- 3.2.1 Das Konzept der Identität nach Hansen
- 3.2.2 Subjekt und Subjektpositionen
- 3.2.3 Identitätskonstruktion
- 3.2.4 Legitimität außenpolitischer Entscheidungen
- 3.2.5 Diskursive Stabilität und intertextuelle Verbindungen
- 3.3 Diskursanalyse
- 3.3.1 Das Konzept der Diskursanalyse
- 3.3.2 Diskursanalyse im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik
- 3.1 Diskurstheorie nach Laclau/Mouffe
- 4 Methodologie
- 4.1 Leitfaden zur Entwicklung diskursanalytischer Forschungsdesigns
- 4.2 Entwickeltes Forschungsdesign zur (Nicht-)Unterstützung der Ukraine
- 4.3 Datenkorpus
- 5 Diskursanalyse: Rechtfertigungsmuster und Identitäten
- 5.1 Biden-Diskurs
- 5.1.1 Friedensorientierung
- 5.1.2 Wirksamkeit und Erfolg
- 5.1.3 Demokratische Werte und internationale Normen
- 5.1.4 Ukrainischer Heroismus
- 5.1.5 Amerikanisches Verantwortungsbewusstsein
- 5.1.6 Rechenschaft für die Taten
- 5.1.7 Identitätskonstruktion im Biden-Diskurs
- 5.2 Pro-ukrainischer Unterdiskurs
- 5.2.1 Bedrohung nationaler Sicherheit
- 5.2.2 Frieden durch Stärke
- 5.2.3 Investition in die nationale Sicherheit
- 5.2.4 Demokratische Werte
- 5.2.5 Internationale Normen und Ordnung
- 5.2.6 Ukrainischer Heroismus
- 5.2.7 Identitätskonstruktion unter den republikanischen Unterstützern
- 5.3 Anti-ukrainischer Unterdiskurs
- 5.3.1 Innenpolitische Prioritäten
- 5.3.2 Die ,korrupte Ukraine’ als ,Geldwäscheparadies‘
- 5.3.3 (Fehlende) Sicherheitsbedrohung
- 5.3.4 Gefahren aufgrund der Unterstützung
- 5.3.5 Verantwortungsloses Handeln der amerikanischen Politik
- 5.3.6 Verhandlungen statt Unterstützung
- 5.3.7 Identitätskonstruktion unter den republikanischen Unterstützungsgegnern
- 5.4 Bedeutungskampf im Vergleich: Inhärente Spannungen und Diskursmacht
- 5.1 Biden-Diskurs
- 6 Fazit und Ausblick
- 7 Quellenverzeichnis
- Primärquellen
- Sekundärquellen
Was ist die Einleitung des Textes?
Die Einleitung behandelt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Rolle der USA als wichtiger Unterstützer. Sie thematisiert die Debatte über die US-Unterstützung, die zwischen internationalistischen und isolationistischen Haltungen steht, und die Herausforderung der Biden-Administration, die Unterstützung effektiv umzusetzen. Die Einleitung stellt die Forschungsfragen, die sich mit der Rechtfertigung der (Nicht-)Unterstützung der Ukraine und der Rolle der nationalen Identität befassen.
Welchen Forschungsstand behandelt der Text?
Der Forschungsstand konzentriert sich auf die Rolle der Identität in der amerikanischen Politik, wobei zwischen dem sozialkonstruktivistischen Ansatz nach Wendt und dem poststrukturalistischen Ansatz nach Campbell unterschieden wird. Weiterhin werden Studien zur US-Auslandshilfe beleuchtet. Zum Schluss wird die Relevanz der Verbindung von Identität und Auslandshilfe herausgestellt.
Welchen theoretischen Hintergrund liefert der Text?
Der theoretische Hintergrund umfasst:
- Diskurstheorie nach Laclau/Mouffe: Grundbegriffe wie Bedeutung, Diskurs, Rolle der Sprache und Materialität, hegemoniale Kämpfe und sozialer Antagonismus.
- Identität und außenpolitischer Diskurs: Das Konzept der Identität nach Hansen, Subjekt und Subjektpositionen, Identitätskonstruktion, Legitimität außenpolitischer Entscheidungen, diskursive Stabilität und intertextuelle Verbindungen.
- Diskursanalyse: Das Konzept der Diskursanalyse und deren Anwendung im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik.
Welche Methodologie wird in dem Text verwendet?
Die Methodologie umfasst:
- Einen Leitfaden zur Entwicklung diskursanalytischer Forschungsdesigns basierend auf Hansen.
- Ein entwickeltes Forschungsdesign zur (Nicht-)Unterstützung der Ukraine, das auf der Analyse des offiziellen US-amerikanischen und der oppositionellen Diskurse basiert.
- Die Beschreibung des verwendeten Datenkorpus, der aus Primärquellen wie Reden, Parlamentsdebatten, Interviews und Beiträgen in sozialen Medien besteht.
Welche Diskursanalyse wird im Text durchgeführt?
Die Diskursanalyse untersucht die Rechtfertigungsmuster und Identitäten im Zusammenhang mit der US-Unterstützung der Ukraine. Sie analysiert:
- Den Biden-Diskurs, einschließlich Friedensorientierung, Wirksamkeit und Erfolg, demokratische Werte und internationale Normen, ukrainischer Heroismus, amerikanisches Verantwortungsbewusstsein, Rechenschaft für die Taten und Identitätskonstruktion.
- Den pro-ukrainischen Unterdiskurs, einschließlich Bedrohung nationaler Sicherheit, Frieden durch Stärke, Investition in die nationale Sicherheit, demokratische Werte, internationale Normen und Ordnung, ukrainischer Heroismus und Identitätskonstruktion.
- Den anti-ukrainischen Unterdiskurs, einschließlich innenpolitischer Prioritäten, die ,korrupte Ukraine’ als ,Geldwäscheparadies‘, (fehlende) Sicherheitsbedrohung, Gefahren aufgrund der Unterstützung, verantwortungsloses Handeln der amerikanischen Politik, Verhandlungen statt Unterstützung und Identitätskonstruktion.
- Den Bedeutungskampf im Vergleich: Inhärente Spannungen und Diskursmacht.
Was ist das Fazit und der Ausblick des Textes?
Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Diskursanalyse zusammen, insbesondere die unterschiedlichen Rechtfertigungsgründe für und gegen die Unterstützung der Ukraine und die diskursiven Spannungen, die damit verbunden sind. Abschließend wird eine kritische Würdigung der Arbeit mit einem Ausblick auf künftige Forschung gegeben.
Details
- Titel
- Die US-Außen- und Sicherheitspolitik zwischen Internationalismus und Isolationismus. Die amerikanische Debatte über die Unterstützung der Ukraine seit dem russischen Angriffskrieg
- Hochschule
- Philipps-Universität Marburg (Institut für Politikwissenschaft)
- Note
- 1,0
- Autor
- Maxim Motruk (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2024
- Seiten
- 101
- Katalognummer
- V1502938
- ISBN (Buch)
- 9783389071595
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- us-außen- sicherheitspolitik internationalismus isolationismus debatte unterstützung ukraine angriffskrieg
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Maxim Motruk (Autor:in), 2024, Die US-Außen- und Sicherheitspolitik zwischen Internationalismus und Isolationismus. Die amerikanische Debatte über die Unterstützung der Ukraine seit dem russischen Angriffskrieg, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1502938
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-