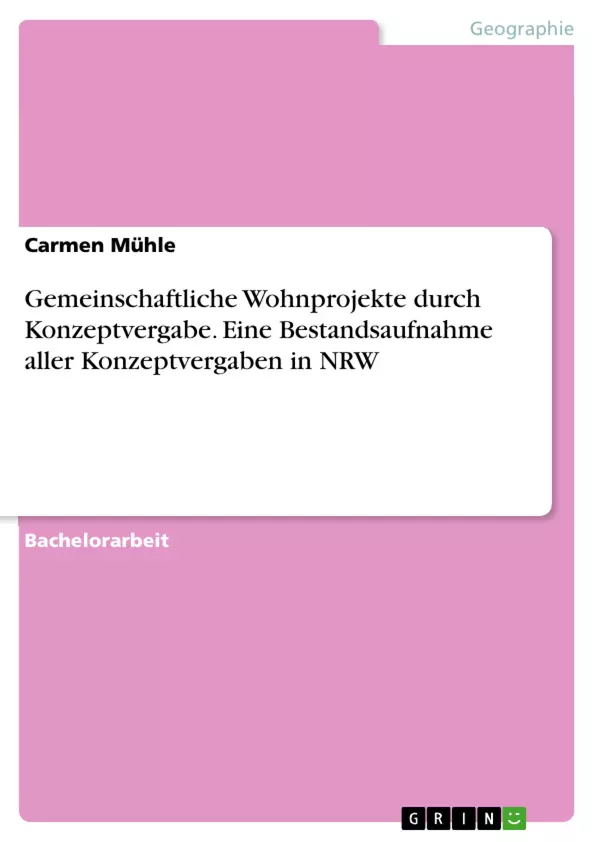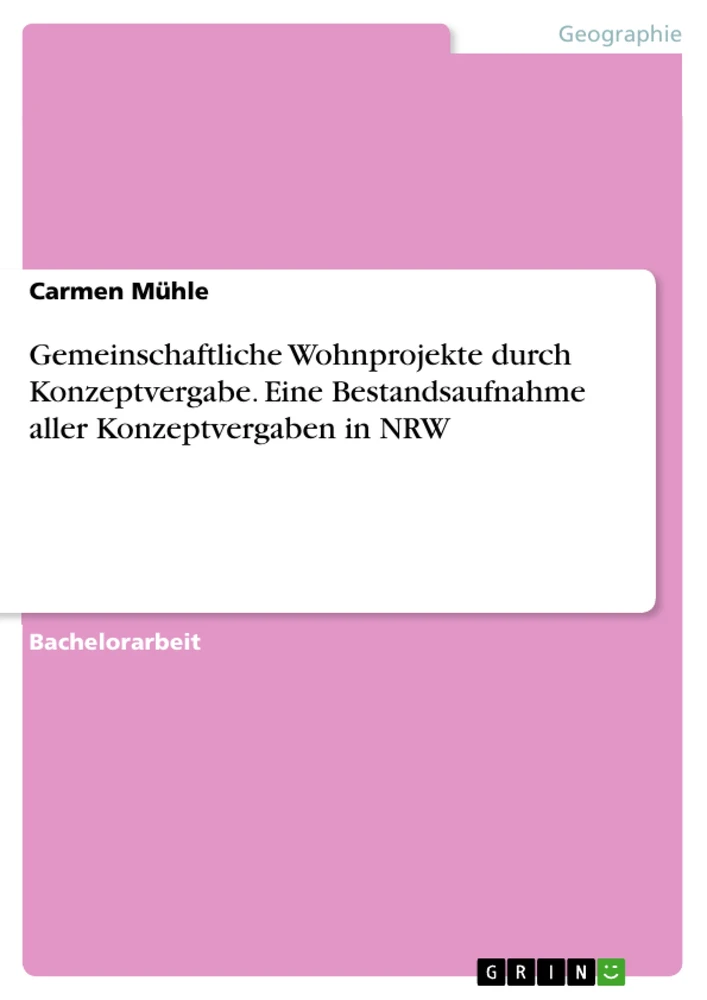
Gemeinschaftliche Wohnprojekte durch Konzeptvergabe. Eine Bestandsaufnahme aller Konzeptvergaben in NRW
Bachelorarbeit, 2024
100 Seiten, Note: 1,6
Geowissenschaften / Geographie - Bevölkerungsgeographie, Stadt- u. Raumplanung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Anlass und Problemstellung
3 Zielsetzung und Forschungsgegenstand
3.1 Begriffsbestimmung
3.2 Untersuchungsgebiet
4 Konzeptvergabe als Instrument gemeinwohlorientierter Stadtentwicklung
4.1 Boden als Grundlage für Stadtentwicklung
4.2 Vergabe von städtischen Flächen
4.3 Konzeptvergabe
4.4 Gemeinschaftliche Wohnprojekte durch Konzeptvergabe
5 Methodik
5.1 Forschungsdesign
5.2 Methodisches Vorgehen
6 Bestandsaufnahme der Konzeptvergaben in Nordrhein-Westfalen
6.1 Durchführung von Konzeptvergaben
6.2 Schwerpunkte und Grundlage von Konzeptvergaben
6.3 Einbezug gemeinschaftlicher Wohnprojekte
7 Diskussion und kritische Einordnung
7.1 Diskussion der Ergebnisse
7.2 Kritische Einordnung der Ergebnisse und Methodik
8 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Angespannte Wohnungsmärkte NRW
Abbildung 2: Abbildung 2: Übersicht kommunaler GrundstücksVeräußerungen
Abbildung 3: Vor- und Nachteile von Konzeptvergaben aus Sicht der Kommune
Abbildung 4: Gemeinsame Leitvorstellung
Abbildung 5: Forschungsdesign
Abbildung 6: Übersicht Anwendung Konzeptvergabe
Abbildung 7: Konzeptvergaben nach Stadtgröße
Abbildung 8: Anzahl Konzeptvergaben pro Kommune
Abbildung 9: angestrebte Nutzungen
Tabellenverzeichnis
Tab. 1 Überblick Kategorien
Tab. 2 Forschungsfragen und Auswertungskategorien
Tab. 3 Überblick Kommunen, die gemeinschaftliche Wohnprojekte adressieren und Anzahl realisierte Projekte
Abkürzungsverzeichnis
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Gemeinwohlorientierte Stadtentwicklungspolitik ist Grundlage für eine Transformation der Städte, so die Neue Leipzig Charta (2021). Sie formuliert Prinzipien guter Stadtentwicklungspolitik und möchte als EU-weites Leitbild dienen. Wohnraummangel, zunehmende soziale Ungleichheit in Städten wie im Umland und der Klimawandel führen zu einer Notwendigkeit einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung, die die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt und sichert. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wird die Bedeutung der kommunalen Handlungsfähigkeit hervorgehoben und gefordert (ebd.). Zudem ist festzustellen, dass sowohl ein Wandel im Planungsverständnis stattfindet, (Bottom-Up, kooperative Stadtentwicklung) als auch zivilgesellschaftlich die Forderung nach mehr Teilhabe und Mitwirkung besteht (Ginski & Schmitt 2014: 293). Das zeigt sich unter anderem im größer werdenden Wunsch nach gemeinschaftlichen Wohnformen. Historisch gesehen waren gemeinschaftliche Wohnformen seit der Industrialisierung eine Reaktion auf unzureichende Wohnungspolitik (Fredowitz & Gailing 2003: 20f). Auch aktuell stehen sie für die Forderung nach mehr Teilhabe und bedürfnisorientierter Wohnraumversorgung. Expert*innen, sowie einige Kommunen sehen gemeinschaftliche Wohnprojekte bereits als Möglichkeit, eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung zu verwirklichen und mitzugestalten. Potenziale sind zum einen die Wohnraumversorgung, Integration vulnerabler Bevölkerungsgruppen, Sicherung einer sozialen Durchmischung, Klimaschutz und soziale Innovationen und Adaptionsfähigkeit an die Bedürfnisse der Menschen und die lokalen Gegebenheiten (Hettich & Ritter 2020: 80). Laut Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) (2020:7) werden ihre Umsetzer*innen werden als “besonders engagiert und innovationsorientiert” angesehen. Daher sollten sie einen erleichterten Zugang zu Grundstücken erhalten, um ihre strukturelle Benachteiligung am Grundstücksmarkt auszugleichen. Ein elementares Problem bei der Realisierung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten stellt somit also die Positionierung auf dem Wohnungsmarkt dar. Wegen fehlendem Eigenkapital und erschwerten Finanzierungsbedingungen durch die Andersartigkeit im Vergleich zu konventionellen Bauvorhaben, ist es für diese Projekte schwierig an geeignetes und vor allem günstiges Bauland zu gelangen (FORUM Gemeinschaftliches Wohnen 2020: 30). Daher stehen Kommunen vor der Aufgabe, diesen Ak- teur*innen Zugang zum Bauland- und Wohnungsmarkt zu ermöglichen.
Eine Möglichkeit dieser Problematik zu begegnen ist die Vergabe von Liegenschaften im Zuge von Konzeptvergaben. Sie stellen meist die einzige Chance dar, dass sich gemeinschaftliche Wohnprojekte auf dem kommerzialisierten Immobilienmarkt durchsetzen (Gennies 2022: 37). Bei einer Konzeptvergabe erfolgt die Vergabe von Grundstücken im Rahmen eines Wettbewerbs, bei dem die Kommunen anhand vorher festgelegter Kriterien die eingereichten Konzepte bewerten. Dabei wird der Kaufpreis zugunsten der Qualität der Konzepte nur geringfügig oder gar nicht berücksichtigt. Bei dem jeweiligen Wettbewerb werden in der Regel wohnungs- und umweltpolitische Vorgaben besonders beachtet, um Liegenschaften im Sinne einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung zukunftsorientiert zu vergeben und zu bebauen. Um die Konzeptvergabe erfolgreich umsetzen zu können, ist es entscheidend, dass Kommunen eine aktive Boden- und Liegenschaftspolitik betreiben und über ausreichend Grundstücke verfügen, um die städtische Entwicklung gezielt lenken (und mitgestalten) zu können (BBSR 2019: 109). Die Konzeptvergabe bietet dabei eine flexible Möglichkeit, individuelle kommunalpolitische Ziele zu realisieren und einen Mehrwert für das jeweilige Quartier zu schaffen. Die Konzeptvergabe beweist sich bereits in anderen Kommunen (Hamburg, Berlin, Tübingen, Leipzig) als geeignetes Instrument, um einerseits gemeinschaftliche Wohnprojekte und ihre Strahlkraft zu ermöglichen, wie auch kommunale Handlungsfähigkeit zu stärken und entsprechende soziale und wohnungspolitische Ziele zu erreichen.
2 Anlass und Problemstellung
“ Selbstorganisation als Reaktion auf Krise” (Netzwerk Immovielien 2021: 32)
Gemeinschaftliches Wohnen war bis zum 18. Jahrhundert weit verbreitet und eine selbstverständliche Notwendigkeit zum Überleben, bis die Industrialisierung Wohnen und Arbeiten trennte, was zu einer Reduzierung großer Familiengruppen führte (Netzwerk Immovilien 2021:45). Die Haushaltsstruktur wurde auf die Kernfamilie reduziert, was zu einem Verlust von Nachbarschaft und Gemeinschaft führte und sich in Isolation, Anonymität und einem Verlust sozialer Bindungen zeigte (Häußermann & Siebel 2000: 30; Fredowitz & Gai- linger 2003: 20). Diese Entwicklung wurde stark kritisiert und so entstand das Konzept des gemeinschaftlichen Wohnens, wie es heute verwendet wird (Fre- dowitz & Gailinger 2003: 20). Historische Beispiele wie sozialistische Mustersiedlungen, Gartenstädte und Beginenhöfe gelten als Vorläufer dieses Konzepts (Ginski & Schmitt 2014: 293). Das Aufkommen gemeinschaftlicher Wohnprojekte (und andere gemeinschaftliche Wohnformen) lassen gesellschaftliche Prozesse und Probleme erkennen und äußern sich durch ihre Lebensweise auf soziale, räumliche und bauliche Weise (Schmid 2021: 175).
Die Abkehr von traditionellen Familienmodellen, demografische Entwicklungen und zunehmende gesellschaftliche Unsicherheiten verstärken die Notwendigkeit von Wohnkonzepten, die auf Kooperation und Zielgruppenorientierung basieren. Die wachsende soziale Diversität und ökologische Herausforderungen unterstreichen die Bedeutung gemeinschaftlicher Wohnformen als Antwort auf die Defizite traditioneller städtischer Strukturen. Angesichts dieser Herausforderungen werden gemeinschaftliche Wohnformen als wirksame Möglichkeit betrachtet, den gesellschaftlichen Strukturwandel zu bewältigen und eine nachhaltige städtische Entwicklung zu fördern (Fredowitz & Gailinger 2003: 31). Traditionelle Formen des Wohnens entsprechen nicht mehr allen aktuellen Bedürfnissen. Aktuell sind zwei Bedürfnisse zu unterscheiden: Einerseits dauert der Trend nach mehr Privatheit und Individualität an und wird u.a. durch die hohe Anzahl von Einpersonenhaushalten sichtbar gestützt. Andererseits ist der zunehmende Wunsch einer größer werdenden Anzahl von Menschen festzustellen, die in selbst gewählten Gemeinschaften leben möchten (Dürr & Kuhn 2017: 9; Spellerberg 2018: 7). Dazu kommen demografische Entwicklungen, die sich nicht nur in einem bedürfnisorientierten Wohnraummangel zeigen, sondern auch in der generellen Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit. Der langfristige Alterungs- und Schrumpfungsprozess bleibt bestehen, während gleichzeitig ein Wanderungsüberschuss die Gesellschaft verjüngt (statistisches Bundesamt 2024). Diese Prozesse geschehen parallel und wirken sich auf die räumliche Situation, insbesondere den Wohnungsmarkt aus. Das Angebot, bestehend aus Wohnungsbestand, Neubau und der Wohnungspolitik generell, passen sich bekannterweise nur schwer den veränderten Bedürfnissen an (Fredowitz & Gailinger 2003: 30).
Ursachen für (bezahlbaren) Wohnraummangel sind vielfältig, die unter anderem auf vergangene Jahrzehnte in der Wohnungspolitik zurückgehen. In den 1980er Jahren fokussierte die Wohnungspolitik auf knappe öffentliche Haushalte und den Umgang mit dem demografischen Wandel (Metzger 2016). Man setzte auf Marktregulierung, was zur Abschaffung der Gemeinnützigkeit und einem Rückgang des sozialen Wohnungsbaus führte (Ginski & Schmitt 2014). Die Niedrigzinsphase nach der Immobilienkrise von 2007/08 verstärkte die Liberalisierung des Marktes (Metzger 2016). Heutige Herausforderungen umfassen begrenzte kommunale Haushalte, Baulandprobleme, sozialen Wohnungsbau und heterogene Entwicklungsmuster (Dransfeld & Hemprich 2017: 26f). Die Abgabe von Handlungsmacht an den Markt erschwert die Umsetzung wohnungspolitischer Ziele, was die aktuelle Wohnungskrise verschärft. Auch angesichts demografischer und gesellschaftlicher Veränderungen besteht dringender Handlungsbedarf. Die städtische Bevölkerung wächst weiter, unterstützt durch Migration und Veränderungen in Lebensstilen und Arbeitsverhältnissen (ebd.). Dies führt zu Wohnungsmangel in Städten und Abwanderung in umliegende Regionen. Trotz einiger Versuche dagegen anzusteuern, bleibt die Situation mehr als angespannt (Faller et. al 2021: 2). Tendenzen zur Rückkehr zur Gemeinnützigkeit und ein verstärktes Interesse an gemeinschaftlichen Wohnformen werden sichtbar (Gennies 2021: 15f.).
Ein hier relevantes Problem für die Realisierung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten sind die steigenden Baulandkosten und Baukosten, wie auch der generelle Flächenmangel (Hagbert et al. 2020: 1). Durchschnittlich sind die Baupreise in Deutschland seit 2015 gestiegen, in manchen Kommunen haben sie sich sogar verdoppelt (Deutschlandatlas 2023). Kommunen könnten durch die Vergabe von Grundstücken nach Konzeptqualität eben solche Wohnprojekte unterstützen. Konzeptvergabe bzw. das Konzeptverfahren ist eine Möglichkeit der Kommune Grundstücke zu verkaufen oder in Erbpacht zu vergeben. Hier geht es nicht um eine Veräußerung zum Höchstpreis, sondern für das beste Konzept und gilt als “ein hervorragendes Instrument für Kommunen, um lebendige, gemischte Quartiere in hoher städtebaulicher und architektonischer Qualität zu entwickeln und dabei bezahlbares Wohnen zu ermöglichen” (BBSR 2020a: 121).
Wohnprojekte, die Ende des 20. Jahrhunderts entstanden, waren wegweisend und entstanden oft in Zusammenarbeit mit den Kommunen. Beispiele sind die Berliner Besetzungen in den 1980er-Jahren und das französische Viertel in Tübingen, das die Quartiersentwicklung durch Konzeptvergabe mit Baugemeinschaften zeigte. In den 2000er-Jahren profitierten Projekte von günstigen Immobilienpreisen, während Kommunen auf die steigende Nachfrage mit verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen reagierten. In den 2010er-Jahren erlebte die Wohnprojekte-Bewegung einen erneuten Aufschwung, wobei große und komplexe Projekte umgesetzt und anspruchsvolle Rechtsformen etabliert wurden. Selbstorganisierte Gruppen und Dachgenossenschaften entwickelten Projekte in Selbstverwaltung. Einige Kommunen führten Konzeptvergabeverfahren ein und richteten kommunale sowie städtisch finanzierte Koordinierungsstellen ein, um die Entwicklungen zu unterstützen (vgl. FORUM Gemeinschaftliches Wohnen 2016). Dies zeigt, wie gemeinschaftliche Wohnprojekte durch kooperative Stadtentwicklung umgesetzt werden können, wobei die Unterstützung seitens der Kommunen eine wichtige Rolle spielt.
Im Folgenden wird die konkrete Zielsetzung und der Forschungsgegenstand erläutert.
3 Zielsetzung und Forschungsgegenstand
Zentraler Forschungsgegenstand sind Konzeptvergaben im Rahmen einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung und als Instrument zur Umsetzung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Einige Kommunen haben bereits erkannt, dass eine sozialgerechte und nachhaltige Stadtentwicklung von eigenen Flächen abhängt und daran ebenfalls eine enorme Steuerungsfähigkeit geknüpft ist. Dazu gehört auch eine langfristige kommunale Finanzplanung und die Einsicht, dass die bisherige Marktorientierung die Herausforderungen nicht löst (Adrian et al. 2021: 21). Davon ausgehend soll diese Arbeit mit dem Titel “gemeinschaftliche Wohnprojekte durch Konzeptvergabe. Eine Bestandsaufnahme der Konzeptvergaben in NRW.” einen Überblick darüber geben, welche Kommunen in Nordrhein-Westfalen (NRW) das Instrument Konzeptvergabe bereits durchführen und inwiefern gemeinschaftliche Wohnprojekte ein Teil dieses Verfahrens sind. Bundesweit sind schon zahlreiche Kommunen dieser Erkenntnis nachgegangen. In Nordrhein-Westfalen liest man oftmals nur von Kommunen, wie Münster oder neuerdings Köln, dabei steht NRW als einwohnerstärkstes Bundesland unter enormem Druck bezüglich einer angemessenen Daseinsvorsorge.
Diese folgende Bestandsaufnahme zielt vorrangig darauf ab, einen Überblick über das Vergabeverfahren in Nordrhein-Westfalen zu geben. Dabei sollen Erkenntnisse über die Beziehungen zwischen Kommunengröße (gemessen an der Einwohnerzahl), Auswahl der Bewertungskriterien und Zugänglichkeit der Informationen gewonnen werden. Im Bereich der Konzeptvergaben, insbesondere in Verbindung mit gemeinschaftlichen Wohnprojekten, hat sich gezeigt, dass ein Austausch zwischen den Kommunen motivierend sein kann und ein gegenseitiges Lernen ermöglicht. Daher ist es sinnvoll zu untersuchen, welche Kommunen bereits ein solches Verfahren durchgeführt haben und wie sie es umgesetzt haben. Dies stellt einen weiteren Anreiz für diese Bestandsaufnahme dar.
Die zugrundeliegende Forschungsfrage lautet also: "Welche Kommunen in NRW haben bereits Erfahrung mit Konzeptvergaben und gemeinschaftlichen Wohnprojekten gemacht?“.
Darauf ausgehend werden diese Unterfragen gestellt:
- Welche Schwerpunkte werden bei der Vergabe gesetzt und auf welcher Grundlage finden Konzeptvergaben statt?
- Wie werden gemeinschaftliche Wohnprojekte in das Verfahren einbezogen?
3.1 Begriffsbestimmung
gemeinschaftliche Wohnprojekte
Da sowohl in der Literatur, im Internet oder auch umgangssprachlich verschiedene Begriffe für die gleiche Idee verwendet werden, muss klargestellt werden, dass in der zugrundeliegenden Arbeit der Begriff des gemeinschaftlichen Wohnprojektes genutzt, und folgendermaßen definiert wird: Gemeinschaftliche Wohnprojekte umfassen eine Personengruppe, “die freiwillig und bewusst bestimmte Bereiche ihres Lebens räumlich und zeitlich miteinander teilen.“, also gemeinschaftlich wohnen möchte (Schader Stiftung: 2024). Diese Gruppe schließt sich möglichst dauerhaft zusammen und erarbeitet gemeinsam eine Vorstellung von ihrem zukünftigen Zusammenleben. Der Arbeitsbegriff versucht, das aktuelle Verständnis über diese Wohnform widerzuspiegeln.
Konzeptvergabe
Die Konzeptvergabe ist eine Verfahrensart, bei der die Kommune das Grundstück an die Interessenten veräußert, die das beste Konzept vorlegen. Der angebotene Preis spielt, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle und steht damit konträr zum Höchstpreisverfahren. Die Konzeptvergabe setzt auf die Kreativität von (innovativen) Projektentwickler*innen (BBSR 2020a: 6). Sie gilt als ein wesentliches Instrument für die integrierte Umsetzung sowohl wohnungspolitischer als auch umwelt- und/oder stadtentwicklungspolitischer Ziele” (Peters 2020: 421). Diese Verfahrensart wird auch manchmal als "Vergabe nach Konzeptqualität”, Konzeptverfahren oder Bestgebotsverfahren genannt. In dieser Arbeit wird überwiegend “Konzeptvergabe” oder eine wortverwandte Umschreibung verwendet.
Gemeinwohlorientiert
Die neue Leipzig Charta hat grundsätzlich unter dem Punkt “gemeinwohlorientiert” festgehalten, dass “eine gute Stadtentwicklungspolitik in der Lage ist, gesamtgesellschaftliche und privat Interessen in Einklang zu bringen und die öffentliche Daseinsvorsorge für alle sicher, bezahlbar und inklusiv zu gewährleisten (Schweitzer: 2021 3). Es geht also um das Wohl der Allgemeinheit. Das ist auch im Baugesetzbuch (BauGB) festgehalten (§1 Abs. 5 BauGB) und soll somit die Ausrichtung aller städtebaulichen Entwicklungen im Sinne der Allgemeinheit sichern. Gemeinwohl wird hier lose definiert und im Weiteren nicht begriffstheoretisch von anderen verwandten Begriffen wie Sozialgerechtigkeit, Gemeinsinn oder der Daseinsvorsorge abgegrenzt.
3.2 Untersuchungsgebiet
Diese Arbeit fokussiert sich auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW), welches mit 18,1 Millionen Menschen das einwohnerstärkstes Bundesland Deutschlands ist (NRW.Bank 2023: 9). Bundesweite Entwicklungen zeigende, dass wachsende Ballungsräume und Städte gegenüber schrumpfenden, strukturschwachen Regionen gegenüberstehen und das lässt sich auch innerhalb des Bundeslands NRW beobachten (Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 2023; Demografieportal 2024). Das bedeutet mancherorts mangelnder bezahlbarer Wohnraum und an anderen Orten führt es zu Wohnungsleerständen, steigenden einwohnerbezogenen Kosten für die öffentliche Infrastruktur sowie zu einer Ausdünnung von Versorgungseinrichtungen (ebd.). 95 der insgesamt 396 Kommunen sind aktuell als angespannte Wohnungsmärkte gemäß §201a BauGB identifiziert (Regio Kontext 2022), somit rund % aller Kommunen. Darunter fällt insbesondere das Rheingebiet um und zwischen Köln und Düsseldorf, die großen Städte des Ruhrgebiets, Teile des Münsterlandes und die Gegend rund um Bielefeld. Diese Städte zeichnen sich durch ihre hohen Miet- und Baulandpreise sowie eine starke Nachfrage aus. Köln, Düsseldorf, Münster, Bonn liegen mit einem Mietpreis von über 10 Euro pro Quadratmeter an erster Stelle und auch Mittelstädte in der Umgebung ziehen nach (RegioKontext 2022: 12). In Nordrhein-Westfalen (NRW) gibt es fünf Universitäten, die über 40.000 Studierende verzeichnen (LWL-Statistik 2024) und somit Auswirkungen auf die örtlichen Wohnungsmärkte haben. Hinzu kommt eine beträchtliche Zuwanderung in die Städte aufgrund verschiedener Faktoren, wie auch eine Abwanderung in umliegende Städte durch die zunehmende Digitalisierung seit der Corona-Pandemie (NRW.Bank 2023: 38). Die hohe Binnenwanderungsrate zeigt die parallellaufenden Trends der Zu- und Abwanderung in Städte und ländliche Regionen. Die Haushaltsstruktur in NRW zeigt einen Anstieg von alleinlebenden Personen, deren Anteil bei 41% liegt. Dieser ist somit höher als der Anteil von Paaren mit Kindern (30%) und Paaren ohne Kinder (29%), was auch dem bundesweiten Trend entspricht (NRW.Bank 2023: 9).
Anmerkung der Redaktion: Die Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Angespannte Wohnungsmärkte NRW, Quelle: RegioKontext 2022: 24)
Die Einleitung bietet einen Überblick über den Hintergrund, die Problemstellung und die Zielsetzung der Forschungsarbeit. In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen erläutert, wobei die Konzeptvergabe im Kontext einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung betrachtet wird. Dabei wird zunächst auf die grundsätzliche Boden- und Flächenproblemaitk eingegangen, gefolgt von der Diskussion über die Notwendigkeit einer bodenpolitischen Strategie und somit einer Vergabe nach Konzeptqualität. Des Weiteren werden gemeinschaftliche Wohnprojekte in Verbindung mit dem Konzeptvergabeverfahren beleuchtet. Kapitel 5 wird das Forschungsdesign sowie die angewandte Methodik vorstellen, gefolgt von der Datenerhebung und -auswertung in Bezug auf die formulierten Forschungsfragen (vgl. Kapitel 6). Eine kritische Einordnung und Diskussion der Ergebnisse bilden den Abschluss des Hauptteils. Schließlich endet die Arbeit in Kapitel 8 mit einem Fazit und Ausblick.
4 Konzeptvergabe als Instrument gemeinwohlorientierter Stadtentwicklung
4.1 Boden als Grundlage für Stadtentwicklung
„Die Tatsache, dass der Grund und Boden unvermehrbar und unentbehrlich ist, verbietet es, seine Nutzung dem unübersehbaren Spiel der freien Kräfte und dem Belieben des Einzelnen vollständig zu überlassen“ (OpinioIuris 2024 nach BVerfGE 21, S. 82f.).
Die Wechselwirkungen der dargelegten Herausforderungen sind komplex. Wohnen kann als Grundlage für weitere gesellschaftliche Verhältnisse gesehen werden und als Ausgangspunkt. Um die Thematik des Wohnens anzugehen, ist es wichtig auch den Bodenmarkt zu betrachten, da dieser dem Wohnungsmarkt vorgelagert ist. Um also eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung zu betreiben, bedarf es einer Bodenpolitik, die diesen Entwicklungen Raum gibt (vgl. Dransfeld & Hemprich 2017: 7). Dadurch, dass die meisten Kommunen in den letzten Jahrzehnten ihre Flächen privatisiert haben und jedes Grundstück nur einmal bebaut werden kann, konkurrieren viele Akteur*innen um die gleiche Fläche und haben unterschiedliche Interessen bezüglich der Nutzung (Rettich & Tastel 2021: 45). Zum einen gilt es für private unternehmerische Eigentümer*innen Profit aus derjeweiligen Nutzung zu schlagen, ob mit Wohnbau, Nahversorgung/Einzelhandel oder keiner Entwicklung aus Spekulationsgründen. Städtische Akteure brauchen Flächen für (öffentlichen) Wohnungsbau, soziale Infrastruktur oder die Entwicklung von Gewerbeflächen für wirtschaftliche Zwecke. Zudem kommen übergeordnete nachhaltige Ansprüche dazu, wie den Erhalt von Grün- und Freiflächen. Zusätzlich gibt es noch zivilgesellschaftliche Akteure (Privatpersonen, Gruppen oder Initiativen), die ihr Recht auf Eigentum nutzen wollen (ebd.).
In Deutschland sind Bodennutzung und Eigentum eng miteinander verknüpft, zudem kommt die private Einstellung und der Wunsch nach eigenem Grund und Boden, die sich starr hält (Statista 2023). Im Grundgesetz Art. 14 soll mit Eigentum auch eine Verpflichtung gegenüber dem Allgemeinwohl geregelt sein. Wie das auszusehen hat, wird durch weitere gesetzliche Vorgaben, auf kommunaler Ebene, geregelt. Durch die kommunale Planungshoheit und dem Selbstverwaltungsauftrag, soll in erster Linie die Bauleitplanung dem Wohl der Allgemeinheit nachkommen (Adrian et al. 2021: 8). Im Baugesetzbuch (BauGB) sind diese Entwicklungsziele und die Verantwortung festgesetzt. Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleistet werden, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen in Einklang bringt und dem Wohl der Allgemeinheit dient. Damit ist eine sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse, der Schutz natürlicher Lebensgrundlagen, die Förderung von Klimaschutz und -anpassung sowie die Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Landschaftsbildes gemeint. Vorrangig sollen Maßnahmen der Innenentwicklung zur Förderung dieser Ziele erfolgen (§ 1 Abs. 5 BauGB). Angesichts der generellen Knappheit von Flächen, insbesondere in stark wachsenden Regionen, und der Privatisierungstrends der letzten Jahrzehnte stehen die Kommunen vor einer teils selbstauferlegten Herausforderung. Der Rückkauf von Flächen ist mit erheblichen Kosten verbunden, und Eingriffe in das Eigentumsrecht gestalten sich schwierig. Dennoch wird es für die Kommunen zunehmend schwierig, den aktuellen Herausforderungen und den daraus resultierenden gesellschaftlichen, demografischen und ökologischen Entwicklungen allein durch bauleitplanerische Maßnahmen zu begegnen, insbesondere wenn ihnen keine eigenen Flächen zur Verfügung stehen. So wird von allen Seiten ein Fokus auf Innenentwicklung gefordert, ein Flächensparziel bundesweit und europaweit aufgestellt und kaum eine Kommune hat kein Stadtentwicklungs- oder Handlungskonzept aufgestellt, um den genannten Problemen zu begegnen. Es bedarf ergänzenden liegenschaftspolitischen Handlungsoptionen, um mehr Steuermöglichkeiten auszuschöpfen (Adrian et al. 2021: 8; Heinz & Belina 2019: 21).
Eine aktive Bodenpolitik umfasst Strategien wie Baulandentwicklung, Flächenmanagement und Bodenvorratspolitik (Peters 2020: 421; Heinz & Belina 2019: 21). Diese Politik betrifft alle Aktivitäten der Gemeinden zur Nutzung und Zielen von Flächen und erfordert eine Verknüpfung mit bauplanungsrechtlichen Instrumenten (Adrian et al. 2021: 55). Kommunale Liegenschaftspolitik umfasst also bestimmte Maßnahmen zur Mobilisierung von Grundstücken, einschließlich privatrechtlicher und hoheitlicher Instrumente (Dransfeld & Hemp- rich 2017: 8). Sie ist zentral für die kommunale Bodenpolitik (Adrian et al. 2021: 55). Für eine allgemeine Umstrukturierung relevante Akteure sind z.B. Verwaltung, Kommunalpolitik, kommunale Unternehmen, insbesondere Wohnungsunternehmen und zivilgesellschaftliche Akteure, wie Nachbarkommunen bzw. die Region (Adrian et al. 2021: 27ff.). Im Rahmen einer Dekommodifizierung und Demokratisierung des Wohnungswesens wird auch von einer Einbindung der gemeinwohlorientierten Ziele in die Unternehmensstruktur, z.B. bei kommunalen Wohnungsunternehmen, gesprochen. Laut Holm (2022: 249) stehen "Markt und Privateigentum als scheinbar alternativlose Grundlage der Wohnversorgung einer konsequenten Gemeinwohlorientierung im Wege." Dies unterstreicht die Bedeutung einer Umorientierung hin zu gemeinwohlorientierten Zielen im Wohnungswesen.
Im Folgenden wird der Fokus auf die Möglichkeiten der Kommune bei der Vergabe von Grundstücken gelegt, insbesondere unter Berücksichtigung gemeinschaftlicher Wohnprojekte.
4.2 Vergabe von städtischen Flächen
In Bezug auf das Forschungsinteresse wird sich speziell mit dem Aspekt der Vergabe von Flächen beschäftigt.
Wenn die Kommune in Besitz von Flächen/Grundstücken ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten diese zu veräußern. Diese werden im Folgenden vorgestellt. Eines der Werkzeuge der Liegenschaftspolitik ist die Konzeptvergabe. Daneben stehen die Direktvergabe und das Bieterverfahren (BBSR 2020: 6). Direktvergabe und Konzeptvergabe ermöglichen gewisse Auflagen, wohingegen das Bieterverfahren über den Höchstpreis geregelt wird. Daneben gibt es noch den Investorenwettbewerb und das Erbbaurecht, die keine eigenen Vergabeverfahren sind, aber in Kombination mit einem der drei oben genannten stehen können. Mit einigen dieser Verfahren gibt es mehr Gestaltungsoptionen, mit einigen weniger. Je nach Fläche, schon bekannten Zielen durch beschlossene Entwicklungskonzepte eignen sich andere Verfahren. Darüber hinaus gibt es andere ergänzende Steuerungsmöglichkeiten, mit denen die Kommune bestimmte Auflagen setzen oder Ziele erreichen kann, zum Beispiel Vergaberichtlinien beim Verkauf oder städtebauliche Verträge. Dies sind keine Kauf/Vergabeverfahren, sondern eher Bedingungen, an die der Verkauf, in welcher Form auch immer, geknüpft sein kann.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Übersicht kommunaler Grundstücksveräußerungen, Quelle: AKH Rheinlandpfalz 2019: 9
4.3 Konzeptvergabe
Im folgenden Kapitel wird näher auf die Konzeptvergabe als Instrument eingegangen. Wie gestaltet sich der Ablauf? Was sind Kriterien, anhand derer Konzepte ausgewählt und bewertet werden? In dieser Arbeit soll es vor allem um Konzeptvergaben in Verbindung mit der Nutzung Wohnen gehen, genauer um die Wohnnutzung durch gemeinschaftliche Wohnformen. Konzeptvergabe bzw. das Konzeptverfahren ist eine Möglichkeit der Kommune Grundstücke zu verkaufen oder in Erbpacht zu vergeben.
Ablauf einer Konzeptvergabe
Auf Grundlage von Peters (2020) wird hier der typische Ablauf einer Konzeptvergabe geschildert. Dabei ist anzumerken, dass jedes Verfahren individuell ist und Unterschiede in Punkten wie zum Beispiel Öffentlichkeitsbeteiligung, Verkauf, Dauer, Verfahrensgröße, Zielgruppen und weiteren aufweisen kann (BBSR 2020a: 97ff.). Das Vergabeverfahren unterscheidet sich zwar in Einzelheiten, aber zur allgemeinen Veranschaulichung ist der Verfahrensablauf auch in Abbildung 2 zu sehen.
Die Ausschreibung von Grundstücken mittels Konzeptvergabe ist ein mehrstufiger Prozess, der in der Regel drei bis sechs Monate dauert. Zunächst wird der Marktwert der betreffenden Grundstücke durch ein Sachverständigengutachten ermittelt. Dieser Wert wird entweder als Festpreis für die Konzeptvergabe ohne Kaufpreisangebot oder als Mindestpreis für die Konzeptvergabe mit Kaufpreisangebot festgelegt (Peters 2020: 419ff.). Der Prozess beginnt mit der öffentlichen Bekanntmachung der Ausschreibung, die in der Tageszeitung sowie auf der Webseite der Stadt und anderen Portalen veröffentlicht wird. Dabei werden die im Vorfeld festgelegten Qualitätskriterien und ihre Gewichtung bekannt gegeben. Nur Bewerber, die alle Zulassungskriterien erfüllen, werden zum Verfahren zugelassen. Die eingereichten Angebote werden dann von einem ausgewählten Gremium bewertet, das in der Regel aus Vertretern der Politik, Fachämter, Planungsdezernenten und unabhängigen Fachleuten besteht. Während der Bewerbungsfrist können Fragen zu den zu vergebenden Liegenschaften und den Kriterien gestellt werden (ebd.). Für die qualitative Bewertung der Konzepte wird ein Expertengremium empfohlen, das die entsprechenden Fachkenntnisse besitzt. Die Bieter haben üblicherweise die Möglichkeit, ihr Konzept dem Gremium in einer Präsentation vorzustellen, bevor das Gremium anhand der Bewertungskriterien entscheidet. Nach der Entscheidung werden die Bieter informiert, und gegebenenfalls kann das Expertengremium zur Nachbesserung einzelner Bestandteile des Konzepts auffordern. Die Entscheidungen werden ausführlich dokumentiert, und die Bieter erhalten eine begründete Information. Nach Abschluss des Verfahrens wird das Grundstück dem erfolgreichen Bieter für einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren übergeben. In dieser Zeit werden "Meilensteine" vereinbart, um die im Angebot dargestellten Qualitäten zu realisieren. Der endgültige Verkauf oder die Verpachtung erfolgt nach Ablauf dieser Anhandgabefrist durch notarielle Beurkundung (ebd.). Insgesamt dauert das Verfahren oft zwischen 1-2 Jahren. Dazu kommt noch die Dauer für das Bauvorhaben an sich, je nach Umfang.
Vor- und Nachteile aus Sicht der Kommunen
Durch die vorherige Auseinandersetzung der Kommune mit der Fläche und ihren Vorstellungen und Zielen, vielleicht sogar unter Beteiligung der Bevölkerung, kann die Konzeptvergabe dazu beitragen, Lücken in der Qualitätssicherung bei Stadtentwicklungsprozessen zu schließen (BBSR 2020a: 6). Bestehende Gestaltungssatzungen und Entwicklungskonzepte können in den Ausschreibungen ergänzt werden, um den Interessenten einen detaillierten Einblick in die Entwicklungsrichtung zu geben. Andererseits kann die Ausschreibung auch offen gestaltet werden, um Raum für Innovationen zu schaffen und neue Impulse zu ermöglichen. Durch den Wettbewerb mit dem Ziel des besten Konzeptes kann Vielfalt erzeugt werden und innovative Akteure beteiligt und zusammengebracht werden, was wiederum das bürgerschaftliche Engagement fördert (vgl. BBSR 2020a). Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der Kombination mit dem Erbbaurecht. So bleibt die Fläche im Eigentum der Kommune, die soziale Nutzung ist bei passender Auswahl dauerhaft gesichert und der Kommune kommen dauerhafte Einnahmen aus dem Erbbauzins zugute (Heinz & Belina 2019: 24).
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Vor- und Nachteile von Konzeptvergaben aus Sicht der Kommune, eigene DarStellung nach BBSRa 2020 & Adrian et al. 2021
Konzeptvergaben bieten trotz Herausforderungen Vorteile für Stadtentwicklung, indem sie innovative Lösungen hervorbringen und einen Teil zur Daseinsvorsorge leisten (vgl. Adrian et al. 2021, BBSR 2020a). Viele Kommunen zeigen bereits, dass Kooperationen mit diversen Akteuren und der Zivilgesellschaft sowie Investitionen in die Stadtentwicklung durch Konzeptvergaben langfristig erfolgreich sind.
4.4 Gemeinschaftliche Wohnprojekte durch Konzeptvergabe
Das folgende Kapitel widmet sich gemeinschaftlichen Wohnprojekten und beginnt mit einer Charakterisierung. Es werden Probleme und Hindernisse in der Umsetzung dargestellt. Ebenso wird das Potenzial solcher Projekte für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung herausgearbeitet und in diesem Kontext die Rolle der Konzeptvergabe betrachtet.
gemeinschaftliche Wohnformen
Gemeinschaftliche Wohnprojekte zeichnen sich durch bewusst gewählte Zusammenschlüsse aus, die auf gemeinsamen Werten und einer geteilten Vision des Zusammenlebens basieren (Schader Stiftung: 2024). Diese Projekte zeichnen sich durch hohe Partizipation der Mitglieder von Anfang an aus, sei es beim Bau oder bei der Gestaltung der Räumlichkeiten, und zeichnen sich weiter durch eine starke Selbstorganisation und Alltagsstrukturierung aus. Die Haushaltszusammensetzung besteht meistens aus mehreren einzelnen Haushalten in privaten Wohnungen, die gemeinschaftliche Räume und Außenflächen teilen. Neben der eigenen Gestaltung des Zusammenlebens zeigen gemeinschaftliche Wohnprojekte häufig ein hohes soziales Engagement (Schader Stiftung: 2024). Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Individualität dieser Projekte. Jedes Projekt ist einzigartig in Bezug auf Gruppengröße, Altersstruktur, Raumnutzung, Wertesystem und Organisationsform (Schader Stiftung: 2024). Die Ziele und Gründe für solche Zusammenschlüsse können vielfältig sein, von baulichen und ökologischen Aspekten bis hin zu sozialen und ökonomischen Vorteilen. Ansprüche an gemeinschaftliches Wohnen müssen konkretisiert werden, um den abstrakten Wünschen nach einer anderen Art des Wohnens gerecht zu werden. Diese Ansprüche betreffen Grundstück, Gebäude und Wohnraum (Schmid 2021: 117). Wohngruppen setzen sich intensiv mit dem Thema auseinander, da das bestehende Angebot ihren Bedürfnissen nicht entspricht, was ein alternatives Denken und Abstimmung innerhalb der Gruppe erfordert (Spellerberg 2020: 7; Ginksi & Schmitt 2014: 295). Durch den Zusammenschluss vieler Einzelner zu einer Wohngemeinschaft setzten sie sich intensiv mit bestehenden und alternativen Eigentumsstrukturen auseinander.
Somit institutionalisiert sich das Zusammenleben als Wohnprojekt in unterschiedlichen Rechtsformen, die je Gruppe unterschiedliche Vor- und Nachteile aufweisen. Zum einen gibt es den Verein (e.V.), die Genossenschaft (eG), das Mietshäuser Syndikat, die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), die GbR, sowie die GmbH. Zudem ist es auch möglich, dass schon etablierte Akteure auf dem Wohnungsmarkt die Form des gemeinschaftlichen Wohnens umsetzen und ein Wohnprojekt gründen oder in Kooperation mit einem Wohnprojekt handeln (Schader Stiftung 2024; Herwig 2018: 162f.).
Gemeinschaftliche Wohnprojekte als Teil gemeinwohlorientierter Stadtentwicklung
Gemeinschaftliche Wohnprojekte können die Kernprinzipien einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung im Sinne der neuen Leipzig Charta (BBSR 2021) darstellen. Wie oben bereits skizziert, verkörpern sie diese Werte in ihrem Wohnprojekt an sich, darüber hinaus können sie über ihr Handeln auch ins Quartier wirken und als Motor für Entwicklungen und soziale Innovationen wirken (Spellerberg 2020: 6).
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Gemeinsame Leitvorstellung, eigene Darstellung
Herausforderung: Flächenzugang
Zahlreiche gemeinschaftliche Wohnprojekte sahen sich in den letzten Jahren vor besonders schweren Hürden. Steigende Bodenpreise, steigende Baukosten und der Wegfall der KfW Förderung bringen die Projektgruppen an ihre Grenzen (Gennies 2022: 9). In einer Studie des Forums gemeinschaftliches Wohnen e.V. wurden zahlreiche Fallbeispiele betrachtet und zusammenfassend lassen sich drei zentrale Herausforderungen festhalten: Selbstorganisation, Partizipation, Finanzierung/Förderung (FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V. 2020: 29ff.). Die Probleme und ihre Lösungen sind wie die Wohnprojekte individuell, jedoch lassen sich die Problemfelder allgemein festhalten. Von der Findungsphase bis zur Umsetzung treten die folgenden genannten Herausforderungen auf. Zu Beginn steht die Suche nach einer Gruppe von Menschen mit diesen eine gemeinsame Vorstellung und daraus ein tragfähiges Konzept entwickelt werden soll. Es muss eine passende Rechtsform gewählt werden und ein geeignetes Objekt oder Grundstück erworben werden. Dazu kommen Überzeugungsarbeit bei Politik und Verwaltung sowie die Auswahl von passenden Partnerinnen und Partner für Planung, Betreuung, Bau und Finanzierung, bauliche, ökologische und soziale Ansprüche, wie z. B. Barrierefreiheit, inklusive Wohnformen und die Alltagsstrukturierung. Während des ganzen Prozess der Projektentstehung wird die Fähigkeit der Selbstorganisation der Gruppe auf die Probe gestellt (FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V. 2020: 29).
Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere der Aspekt der Grundstücksgenerierung wichtig, daher wird sich folgend mehr mit den Herausforderungen diesbezüglich beschäftigt. Nachdem die Findungsphase abgeschlossen ist, kommt die nächste Hürde auf gemeinschaftliche Wohnprojekte zu: die Suche nach einem geeigneten Grundstück und die Finanzierung (Töllner 2016: 29). Die Ausgangssituation für Bauland ist grundsätzlich schwierig. Angesichts der stark steigenden Immobilienpreise und der begrenzten Verfügbarkeit von Grundstücken ist es für selbstorganisierte Gruppen herausfordernd, bezahlbare Grundstücke oder Immobilien zu finden, insbesondere wenn es an entsprechenden Netzwerken und Kontakten mangelt. Darüber hinaus ist die oft innerhalb kurzer Fristen zu zahlende Anzahlung, besonders für kleinere Gruppen, kaum zu bewältigen (FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V. 2020: 30). Diese Probleme verringern sich für trägerinitiierte Projekte. Eine damit einhergehende weitere Herausforderung kann auch die Zusammenarbeit mit der Verwaltung bzw. dem Planungsrecht sein (ebd.). Das Grundstück bildet, physisch gesehen, die Grundlage des Projektes, da es überhaupt das Bauvorhaben möglich macht. Zudem gehen vom jeweiligen Grundstück zahlreiche Bedingungen für die zukünftige Entwicklung aus. Der Grundstückspreis sowie die Baukosten bestimmen die späteren tatsächlichen Wohnkosten. Ebenfalls bestimmen die Beschaffenheit und Lage des Grundstücks die generellen Gestaltungsoptionen (Holm 2021: 234). Somit wird das Grundstück, neben der Gruppenfindung an sich, zum Kernaspekt, der die Entwicklungsrichtung maßgeblich beeinflusst (ebd.)
Konzeptvergabe und gemeinschaftliche Wohnprojekte
Die Geschichte der Konzeptvergabeverfahren ist eng mit Baugemeinschaften bzw. gemeinschaftlichen Wohnformen verbunden (Gennies 2022: 5; Adrian et al. 2021: 61). Sowohl in Tübingen als auch in Hamburg entstand das Konzeptverfahren im Zusammenhang mit der Vergabe von Grundstücken an gemeinschaftliche Wohnprojekte. Die Städte haben ihren innovativen Charakter erkannt und den Gruppen den Zugang zu Grundstücken erleichtert, wodurch die Vergabe über Konzeptqualität institutionalisiert wurde. Dadurch wurde die städtebauliche, nutzungsbezogene und soziale Qualität in den Quartieren gesichert (BBSR 2020a: 7; Fedrowitz & Gailinger 2003: 31). Gemeinnützige Wohnungsunternehmen und Genossenschaften waren in der Vergangenheit bedeutend und sind es auch heute, was zeigt, dass gemeinschaftliche Wohnprojekte eine wichtige Rolle spielen können (Ginski & Schmitt 2014: 293). Eine enge Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Wohnprojekten ermöglicht die eindeutige Bestimmung der Entwicklungsziele oder bietet Raum für Innovationen (BBSRa 2020: 7, 114). Die Festlegung der Bewertungskriterien spielt eine entscheidende Rolle für die Sicherung gemeinschaftlicher Wohnprojekte. Vor Beginn der Konzeptvergabe müssen Kriterien für die Bewertung festgelegt werden, die sich auf verschiedene Aspekte wie Nutzung, Gestaltung, Ökologie und Klimaschutz beziehen können. Auch die soziale Wohnraumversorgung spielt eine wachsende Rolle, indem z. B. Anforderungen bezüglich des Anteils öffentlich geförderter oder preisgedämpfter Wohnungen vorgegeben werden. Es können ebenso die Originalität des Konzeptes oder die explizite Einbeziehung von innovativen, gemeinschaftlichen Wohnformen berücksichtigt werden. Eine ressortübergreifende Koordination bei der Ausarbeitung der Vergabekriterien kann im Hinblick auf die weiteren Anforderungen der Daseinsvorsorge sinnvoll sein. Wenn die Kommune beabsichtigt, gemeinschaftliche Wohnprojekte anzusprechen, sollten diese durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit oder in den Kriterien explizit angesprochen werden (Adrian et al. 2021: 61). Es gibt geschätzt 4.000 bis 5.000 gemeinschaftliche Wohnprojekte in Deutschland, und ihre Bedeutung wächst weiter (FORUM Gemeinschaftliches Wohnen 2024; Ginski & Schmitt 2014: 296). Die Unterstützung der Kommunen spielt eine entscheidende Rolle bei der Realisierung solcher Projekte und der Lösung wohnungspolitischer Herausforderungen wie dem demografischen Wandel (Töllner 2016: 27). Sie bieten Chancen für den ländlichen Raum und können in Städten Vereinsamung und Anonymität entgegenwirken (Kasper 2018: 18; Töllner 2016: 28). Kommunen können das Entstehen von gemeinschaftlichen Wohnprojekten, wie bereits erwähnt, durch Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und die Bereitstellung von Grundstücken fördern (Töllner 2016). Die Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit von Grundstücken ist entscheidend, und Kommunen können kooperativ bei der Suche nach geeigneten Objekten vorgehen (vgl. BBSR 2020a). Alternativen zum Höchstgebotsverfahren, wie die Konzeptvergabe, können den Zugang zu Grundstücken erleichtern (FORUM Gemeinschaftliches Wohnen 2020: 40).
Eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung räumt Solidarität, Teilhabe, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung einen zentralen Platz ein und beginnt bei einem entsprechenden Umgang mit der Ressource Boden (BBSR 2020b: 20) Sie ist also gleichzusetzen mit einer transparenten Bauland- und Immobilienentwicklung, die ihre wirtschaftlichen Ziele mit einer Orientierung an gesellschaftlichen Mehrwerten zum Wohle des Stadtviertels und seiner Bewohnerschaft verbindet (ebd.). Wie im bisherigen Kapitel erläutert, stellen gemeinschaftliche Wohnprojekte eben diese Werte dar. Sie leben diese Werte als Gruppe aus und geben diese idealerweise nach außen ins Quartier weiter.
Durch ihre üblicherweise gemischte Haushaltsstruktur tragen sie zu sozial gemischten Quartieren bei, entziehen das Grundstück dem privaten, spekulativen Wohnungsmarkt und können auch ökologische Ziele umsetzen. Eine wichtige Voraussetzung für ihren Beitrag zu einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung ist kommunale Unterstützung in Form von Beratung, Vernetzung und einem begünstigenden Liegenschaftsmanagement.
5 Methodik
5.1 Forschungsdesign
Um die in Kapitel 3 vorgestellten Forschungsfragen zu beantworten, wurde folgendes Forschungsdesign aufgestellt. Das methodische Vorgehen wird in Kapitel 5.2 erläutert.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Forschungsdesign, eigene Darstellung
5.2 Methodisches Vorgehen
Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Bestandsaufnahme aufzustellen, aus der hervorgeht, welche aller 396 Kommunen in NRW eine Konzeptvergabe durchführen. Dazu wird eine strukturierte webbasierte Datenerhebung durchgeführt, die in Tabellenform festgehalten wird. Die Datenerhebung folgt den Prinzipien einer “Desk Research”, oder auch Desktop Recherche, im Rahmen einer Sekundäranalyse.
Eine Sekundärdatenanalyse bezieht sich auf die Untersuchung von Daten, die bereits von anderen Forschern oder Organisationen gesammelt wurden, im Gegensatz zur Primärdatenanalyse, bei der Forscher ihre eigenen Daten sammeln. Sekundärdaten können aus verschiedenen Quellen stammen, darunter bereits vorhandene Forschungsstudien, Regierungsberichte, Umfragen, Statistiken, administrative Aufzeichnungen, Bücher, Zeitschriftenartikel oder OnlineDatenbanken. Bei einer Sekundärdatenanalyse werden die vorhandenen Daten erneut analysiert, um neue Forschungsfragen zu beantworten, bestehende Hypothesen zu überprüfen oder zusätzliche Einblicke in ein bestimmtes Thema zu gewinnen (vgl. Thommen et al. 2017). In dieser Arbeit sind die eher informativen Daten von den kommunalen Websites, Presseartikel und Dokumente aus dem Internet die Basis der Analyse. Die vollzogene Desktop Recherche eignet sich für Informationsüberblick und insbesondere bei Themen, die sich schnell ändern oder für die aktuelle Informationen benötigt werden. Es ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von Quellen wie Zeitschriftenartikel, Berichte, Online-Datenbanken und Websites, die regelmäßig aktualisiert werden. Da für das Forschungsinteresse alle 396 Kommunen untersucht werden sollen, bietet das die effizienteste Methode für einen ersten, aber umfassenden Überblick der Konzeptvergaben. Auch aus der Perspektive der Informationsbeschaffung eignet sich diese Methodik für dieses Forschungsvorhaben. Das Internet dient mittlerweile für die meisten Menschen als erste Anlaufstelle, um Informationen zu gewissen Themen zu erhalten (Statista 2021). Insbesondere rund um das Thema gemeinschaftliche Wohnformen bedarf es Recherche, und oftmals sind Beratungsstellen oder Netzwerke noch nicht bekannt. Als digitale Kontaktstelle zur eigenen Kommune dient die Website als Plattform für alle möglichen Informationen, Dienstleistungen und sonstige Angebote. Darauf ausgehend soll diese Methodik nicht nur Ergebnisse über die bestehenden Konzeptvergaben liefern, sondern auch die Zugänglichkeit und Transparenz betrachtet werden.
Die von Cheong et al. (2023) aufgestellte “Guideline” für qualitative Sekundärdatenanalysen konzentriert sich auf das Nutzen von online verfügbaren Daten und umfasst 7 Schritte, die für diese Arbeit die Grundlage bilden, jedoch angepasst werden. Der erste Schritt ist die Formulierung der Forschungsfragen (1). Hierbei ist es wichtig, zielgerichtete, aber offene Fragen zu formulieren, um Flexibilität bezüglich Datenerhebung zu haben, aber auch die Qualität und Eignung der Informationen im Auge zu behalten. Das Ziel der hier zugrundeliegenden Fragestellungen ist es eine Übersicht über bestehende Konzeptvergaben in ganz Nordrhein-Westfalen zu erstellen, da die bisherige Literatur oft nur einzelne Verfahren oder bestimmte Städte behandelt. Nachdem die Forschungsfragen aufgestellt wurden, folgt die Datensammlung (2). Laut den Autor*innen ist es bei diesem Schritt wichtig, eine umfassende Datensammlung zu generieren, statt bereits an dieser Stelle zu selektieren. Bezogen auf diese Erhebung bedeutet das, dass alle deutschsprachigen Internetquellen, die das Thema Konzeptvergaben in der jeweiligen Kommune beschreiben, gesammelt wurden. Dabei sollten diese nicht länger als 10 Jahre zurückliegen. Die Datenerhebung findet zwischen Januar und März 2024 statt. Auf diesen Schritt folgt, falls zutreffend, die Transkription von Audio- oder Filmmaterialien (3). Für diese Arbeit wurden nur Daten im Textformat behandelt. Darauf folgt die Datenfilterung (4). Bei diesem Schritt geht es vor allem um die Überprüfung der Datenqualität. Die Daten müssen die Forschungsfragen nicht direkt beantworten, sollten jedoch geeignet sein. Die Websites, sofern sie nicht die Website der Kommune selbst sind, müssen auf Glaubwürdigkeit überprüft werden. In der Guideline wird vorgeschlagen, an dieser Stelle die Position des Forschenden zu reflektieren (5). Dies ist je nach Themenschwerpunkt unterschiedlich zu gewichten. Auf dieses Forschungsvorhaben bezogen geht es um die Sicherstellung der wertfreien Darstellung, ob und wie Konzeptverfahren durchgeführt wurden. Darauf folgt die eigentliche inhaltliche Analyse der Daten (6). Die Autor*innen beziehen sich hier auf das Codieren von Interviews. Für dieses Forschungsvorhaben wurden Kriterien zur Beantwortung der Forschungsfrage aufgestellt (siehe Tabelle). Die Ergebnisse werden entlang dieser Forschungsfragen erläutert. Der letzte Schritt der Guideline ist die Bewertung der Glaubhaftigkeit der Ergebnisse (7). Hier soll am Ende anhand von Kriterien die Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Übertragbarkeit bewertet werden (Cheong et al. 2023). Für die Bestandsaufnahme ist des Weiteren der Aspekt der Konsistenz in Bezug auf eine konsistente Datenerhebung wichtig. Die generelle Einschätzung der Ergebnisse erfolgt in Kapitel 7. Im Folgenden wird die hier verwendete Methodik im Detail vorgestellt.
Die Forschungsfragen beziehen sich im Wesentlichen auf die Durchführung einer Konzeptvergabe, der Art und Weise der Nutzung und auf die Transparenz der Informationen darüber. Anhand entsprechender Kategorien wurde eine Tabelle für die Datenerhebung aufgestellt. Diese dient insbesondere der Sortierung der Daten und als Grundlage für die inhaltliche Auswertung. In der Abbildung werden die Kriterien näher definiert.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Überblick Kategorien, eigene Darstellung
Um die Nachvollziehbarkeit dieser Methodik zu gewährleisten, wird im Folgenden der Suchablauf geschildert. Die Informationen werden über eine strukturierte web-basierte Internetrecherche zusammengetragen. Dies läuft wie folgt ab:
- Eingabe in Suchmaschine Google: “Name Kommune” “Konzeptvergabe” or ''Konzeptverfahren''
- Suche primär nach Beiträgen von der Kommune selber aus z.B. Pressemitteilung auf Homepage
- daraufhin wird untersucht, ob es noch weitere Dokumente zu der Konzeptvergabe gibt: an sich und Dokumente über das Verfahren
- gibt gleichzeitig auch Aufschluss über Verfügbarkeit von Informationen
- Über Suchspalte auf Website oder manuell über die verschiedenen Reiter
- Wenn keine Informationen der Kommune selbst vorhanden ist, werden journalistische oder anderweitige Beiträge herangezogen
- die Suche beschränkt sich auf Seite 1-3 der Ergebnisse
- in Einzelfällen (bei Kommunen mit Konzeptvergabe), wird das Ratsinformationssystem zur weiteren Recherche herangezogen
- wenn weder Artikel noch offizielle Dokumente zu finden sind, ist davon auszugehen, dass diese Kommune kein Konzeptverfahren durchgeführt hat oder die Informationen nicht öffentlich zugänglich sind
- zudem werden Beiträge der letzten 10 Jahre berücksichtigt, um für einen umfassenden Vergleich zu sorgen
- Eingabe in Suchmaschine Google: “Name Kommune” “gemeinschaftliches Wohnen” or “Wohnprojekte”
- wenn es durch Google Suchergebnisse Hinweise auf das Themengebiet der Konzeptvergabe oder gemeinschaftlicher Wohnprojekte gibt, werden andere Begriffe wie “Konzeptverfahren”, “Wohnformen”, “Vergabe Grundstücke” in der Suchleiste der Website der Kommune eingegeben
Die Auswertung wird mit Hinblick auf die Forschungsfragen vorgenommen. Dazu werden einzelne Tabellen und Grafiken erstellt und die Ergebnisse anhand der zuvor vorgestellten Literatur interpretiert. Grundlage für die Auswertung stellt die Tabelle mit den oben beschriebenen Kategorien dar. Zudem werden für einige Aspekte die Website Inhalte und Dokumente genauer betrachtet und herangezogen.
Die folgende Abbildung stellt dar, welche Kategorien aus der Tabelle für welche Fragestellung herangezogen werden:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Forschungsfragen und Auswertungskategorien, eigene Darstellung
6 Bestandsaufnahme der Konzeptvergaben in NordrheinWestfalen
Eingebettet in die zentrale Forschungsfrage “ Welche Kommunen in NRW haben, bereits Erfahrung mit Konzeptvergaben und gemeinschaftlichen Wohnprojekten gemacht?”, werden die Ergebnisse entsprechend der Unterfragen zunächst dargestellt und jeweils anschließend analysiert. Das Kapitel 6.1 behandelt die Durchführung von Konzeptvergaben. Es wird dargestellt, wie viele Kommunen bereits Konzeptvergaben nutzen, sowie die Häufigkeit der Nutzung. Abschließend werden in diesem Abschnitt weitere relevante Aspekte, wie die Größe der Kommunen, erörtert. Im darauffolgenden Kapitel 6.2, werden die Ergebnisse bezüglich der Grundlagen und der Vergabeart dargestellt. Kapitel 6.3 stellt den Bezug zu gemeinschaftlichen Wohnprojekten her und stellt dar, welche Schwerpunkte in den Konzeptvergaben gesetzt wurden, um solche Projekte zu realisieren. Dabei werden die Kommunen ausgewertet, die in ihren Kriterien explizit auf Wohnprojekte eingehen, sowie die Anzahl der umgesetzten Wohnprojekte. Zudem wird ein besonderes Augenmerk auf die Kommunen gelegt, die eine zugrundeliegende Strategie bezüglich Flächenentwicklung und Beratungsangebote für gemeinschaftliche Wohnprojekte sowie Konzeptvergaben haben.
Die komplette Tabelle der Bestandsaufnahme sowie die dazugehörigen Quellen befinden sich im Anhang.
6.1 Durchführung von Konzeptvergaben
Von den 396 Kommunen in NRW haben 51 bereits Erfahrung mit Konzeptvergaben gemacht oder sind gerade dabei (“ja”), 10 Kommunen haben vor, dieses Instrument zu nutzen, sind aber noch nicht im konkreten Vergabeprozess (“in Planung”) und 335 Kommen führen keine durch (“nein”). Insgesamt sind es derzeit 86 Konzeptvergaben, die bereits beschlossen sind und sich entweder im Verfahrensprozess befinden, aktuell ausgeschrieben, abgeschlossen oder bereits abgebrochen sind. Davon ausgenommen sind Konzeptvergaben, die erst in Planung sind. In einer Übersichtskarte sind die Kommunen in der Kategorie “ja” in grün eingefärbt, Kategorie “in Planung” ist blau-lila und Kommunen, die zur Kategorie “nein” gehören sind in rot eingefärbt.
Anmerkung der Redaktion: Die Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Übersicht Anwendung Konzeptvergabe, eigene Darstellung, Quelle: Geo-Ba- sis-DE / BKG (2022)
Die 51 Kommunen, die Konzeptvergaben durchführen sind folgende: Aachen, Alfter, Altenbeken, Altenberge, Bad Driburg, Bochum, Bonn, Borken, Bottrop, Castrop-Rauxel, Coesfeld, Detmold, Dortmund, Drensteinfurt, Duisburg, Düsseldorf, Gescher, Gummersbach, Hamm, Heiden, Hilden, Hövelhof, Kaarst, Kerpen, Kevelaer, Kleve, Köln, Kreuztal, Leverkusen, Lienen, Lotte, Minden, Mönchengladbach, Münster, Neuenkirchen, Neukirchen-Vluyn, Olsberg, Paderborn, Petershagen, Remscheid, Rheine, Senden, Sprockhövel, Telgte, Tönisvorst, Verl, Viersen, Voerde, Wenden, Winterberg, Xanten.
24 dieser Kommunen, knapp unter die Hälfte, gehören zu den aktuell 95 Kommunen, die gemäß § 201a BauGB einen angespannten Wohnungsmarkt aufweisen (vgl. RegioKontext 2022). Dazu gehören Aachen, Alfter, Altenberge, Bochum, Bonn, Borken, Dortmund, Drensteinfurt, Duisburg, Düsseldorf, Hilden, Hövelhof, Kaarst, Kerpen, Köln, Leverkusen, Mönchengladbach, Münster, Paderborn, Rheine, Senden, Telgte, Verl, Xanten.
Unter den Konzeptvergabe-Kommunen sind alle Kommunengrößen vertreten. Die kleinste mit 8.809 Einwohnern ist Lienen und die größte ist Köln (1.086.138 Einwohner). Die Verteilung nach den BBSR-Raumabgrenzungen (BBSR 2024] sieht folgendermaßen aus:
- Großstadt (über 100.000 EW): 13
- Mittelstadt (20.000-100.000 EW: 26 Kommunen
- Kleinstadt (5-20.000): 14 Kommunen
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Konzeptvergaben nach Stadtgröße, eigene Darstellung
Wie in Abbildung 8 dargestellt, haben die meisten Kommunen ein Verfahren
durchgeführt (oder sind dabei), einige wenige haben schon zwei bis drei Verfahren durchgeführt. Münster liegt an der Spitze mit 18 Konzeptvergabeverfahren. 22 Kommunen sind gerade im Konzeptvergabeprozess. Wie in Kapitel 4.3 dargestellt, beträgt die durchschnittliche Dauer eines Vergabeverfahren ca. 2 Jahre, ausgenommen der Bauzeit. In zwei Kommunen (Lotte, Telgte) wurde das Verfahren abgebrochen. In Lotte musste es abgebrochen werden, da für die vorgelegten Konzepte kein geeigneter Investor gefunden wurde (Lotte 2023). Die Kommune Telgte beendete das Verfahren, da keine passenden Angebote eingereicht wurden (Telgte 2024). Viele Fälle müssen als “unsicher” eingestuft werden, das heißt, aus den Quellen kann nicht eindeutig gesagt werden, wo im Prozess das Verfahren steht bzw. die Quellen unterschiedliche Deutungen erlauben.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten Anzahl Kommunen
Abbildung 8: Anzahl Konzeptvergaben pro Kommune
6.2 Schwerpunkte und Grundlage von Konzeptvergaben
Einen Gleichstand gibt es in Bezug auf die Vergabeart. 15 Kommunen vergeben rein nach Konzeptqualität und 15 nach einer Kombination von Konzept und Preisangebot. Zu den restlichen 31 Kommunen, gab es keine (öffentlich zugängliche) Information darüber. Gewertet wurden hier Kommunen, die Konzeptvergaben durchführen oder “in Planung” sind (also insgesamt 61 Kommunen). Das Verhältnis zwischen Konzept/Preis-Gewichtung ist unterschiedlich und auf einzelne Verfahren bezogen. Grundsätzlich ist es also möglich, bei anderen Verfahren wiederum andere Kriterien zu bilden, sofern es nicht anders festgelegt ist.
Bei der Erhebung wird hauptsächlich zwischen Mischnutzung, Wohnnutzung, Gewerbenutzung und soziale Infrastruktur unterschieden. Dazu kommen die Kategorien “offen”, wenn noch nicht klar ist, welche Nutzung kommen soll oder wenn es extra offengelassen wird. Die folgende Abbildung stellt die Verteilung dar.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 9: angestrebte Nutzungen, eigene Darstellung
Die Grundlage von allen Konzeptvergaben ist ein Ratsbeschluss der jeweiligen Städte. Sofern eine weitreichende Strategie zugrunde liegt, wird diese unter “Verankerung/Grundlage” festgehalten. Als Strategie werden hier z.B. Handlungskonzepte für den Bereich Wohnen oder Integrierte Stadtentwicklungskonzepte (ISEK) bzw. Stadtentwicklungskonzepte (StEK), Dorfentwicklungskonzepte o.ä. aufgelistet. Auf dieser Grundlage werden in 13 Kommunen Konzeptvergaben angewandt. Darüber hinaus gibt es noch Baulandmodelle, die meistens aus einem Handlungskonzept entspringen, und sich mit konkreten Maßnahmen und speziell mit der Bodenentwicklung auseinandersetzen. Dazu zählen Baulandstrategien, Baulandbeschlüsse oder auch Modell der sozialgerechten Bodennutzung (Münster). 5 Kommunen haben sich auf eine Art Baulandmodell, mit dem sie Konzeptvergaben umsetzen wollen, verständigt. Des Weiteren gibt es etwas lose gefasste Konzepte, die hier mit aufgenommen werden wie Vergaberichtlinien, Vermarktungskonzepte oder Gestaltungsvereinbarungen. Das betrifft 4 Kommunen. Insbesondere für die Kommunen, die sich die Durchführung von Konzeptvergaben vorgenommen haben, also “in Planung" sind, sind Beschlussvorlagen oder Anträge der örtlichen Parteien die Grundlage. Das trifft auf 4 Kommunen zu. Für die übrigen 34 Kommunen lassen sich keine Strategien oder Konzepte, die Konzeptvergaben als Instrument verankern wollen, finden. Diese beruhen lediglich auf einem Ratsbeschluss.
Insgesamt gibt es 13 Städte, die zwar keine Konzeptvergabe durchführen, aber durch Empfehlungen aus den lokalen politischen Gruppen das Thema auf die politische Agenda bringen. Die Vergabe nach Konzeptqualität findet sich entweder in direkten Anträgen (z.B. Frechen), im Wahlprogramm (Geldern, Simmerath) oder bereits im jeweiligen Koalitionsvertrag (Wachtberg). Diese Kommunen (Frechen, Geilenkirchen, Geldern, Rheda-Wiedenbrück, Rheinbach, Siegburg, Simmerath, Solingen, Steinhagen, Wachtberg, Wermelskirchen, Wiehl) sind Mittelstädte, ausgenommen der Kleinstadt Simmerath (15.864 Ein- wohner*innen) und der Großstädte Solingen (161.029 Einwohner*innen) und Essen (586.344 Einwohner*innen).
6.3 Einbezug gemeinschaftlicher Wohnprojekte
Für die Unterfrage, inwiefern bei den Konzeptvergaben gemeinschaftliche Wohnprojekte einbezogen wurden, geben die erhobenen Daten der Kategorien “Ansprache” und "Beratungsstelle" Auskunft.
Die Konzeptbewertungskriterien unterscheiden sich. Üblicherweise betreffen die Kriterien folgende Aspekte: städtebauliche Qualität, Ökologie, Mobilität, Wohnen und den Kaufpreis. Von den 51 Städten mit Konzeptvergabe haben 19 in ihrer Ausschreibung oder Kriterien gemeinschaftliche Wohnformen angesprochen. 22, wenn man die “in Planung" befindlichen Städte inkludiert. Dabei gibt es Unterschiede in der Ansprache. Es reicht von vagen Aussagen, wie dem Wunsch nach “Integration neuer Wohnformen” (Rheine), zu einer direkten Einbindung durch Kriterien wie in Verl, wo Mehrgenerationenwohnen ein eigenes Bewertungskriterium ist, über das Vorsehen bestimmter Baufelder für “besondere Wohnformen (Bonn, Neukirchen-Vluyn), oder wie in Münster beispielsweise eine direkte Vergaberichtlinie für Mehrfamilienhäuser und Gemeinschaftswohnprojekte. In der folgenden Abbildung werden die Kommunen aufgezeigt, die gemeinschaftliche Formen in ihren Vergabekriterien oder auf sonstige Art und Weise ansprechen und die Zahl der gemeinschaftlichen Wohnprojekte, die durch eine Konzeptvergabe entstanden sind.
(Hinweis: Die realisierten gemeinschaftlichen Wohnprojekte wurden nach der Erhebung für die einzelnen Fälle erhoben.)
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3: Überblick Kommunen, die gemeinschaftliche Wohnprojekte adressieren und Anzahl realisierte Projekte
Es gibt 7 Kommunen, die Konzeptvergaben durchführen (wollen), eine Beratungsstelle für gemeinschaftliche Wohnprojekte aufweisen und gemeinschaftliche Wohnprojekte in ihren Ausschreibungen und/oder Kriterien adressieren (s.o.). Darunter Aachen, Bielefeld, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Münster. All diese Städte außer Dortmund haben die Konzeptvergabe von städtischen Grundstücken in Modellen oder Konzepten strategisch verankert. Folglich wird auf die Kommunen und ihre Strukturen genauer eingegangen.
In Aachen liegt für die Umsetzung von Konzeptvergaben das Handlungskonzept Wohnen zugrunde und hat 2022 eine wohnungspolitische Gesamtstrategie beschlossen (Aachen (2024h). Daraus sind einige Maßnahmen in der Umsetzung, wie zum Beispiel “Bauen und Wohnen in Gemeinschaft”. Dieser Punkt widmet sich der Realisierung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten und Baugemeinschaften. Auf der Website findet man dazu Informationenmaterialien, eine Übersicht über sich in Entwicklung befindliche und realisierte Wohnprojekte, einen Flyer zu Konzeptvergabe und Erbbaurecht (Aachen 2024a), sowie eine Koordinationsstelle als Anlaufpunkt. Die Koordinationsstelle “Bauen und Wohnen in Gemeinschaft” führt eine Liste über interessierte Wohnprojekte, die auf Grundstückssuche sind, um somit die Nachfrage zu erfassen und bei der Suche zu unterstützen (Aachen 2024b). Dort werden auch bei der Investorensuche, Kontaktvermittlung, Vernetzung und Prozessbegleitung unterschiedliche Hilfe angeboten. Weitere Informationen zum Thema Konzeptvergaben findet man im Bereich Grundstücksangebote (Aachen 2024c). Dort werden aktuelle laufende wie abgeschlossene Konzeptverfahren aufgeführt.
Die Bielefelder Baulandstrategie wurde 2019 für eine bedarfsgerechte Entwicklung von Bauland für Wohnen und Gewerbe beschlossen (Bielefeld 2019). Grundstücke für Miet- und Geschosswohnungsbau sollen grundsätzlich durch Konzeptvergabe veräußert werden. Auf der Website unter dem Punkt Baulandmanagement findet man grundsätzliche Informationen zum Vergabeverfahren und einen Verweis auf die “Richtlinie zu Vergabekriterien für Wohnbaugrundstücke im Rahmen der Bielefelder Baustrategie”, die zukünftig von einer Krite- rienliste abgelöst werden soll. Die Richtlinie beinhaltet die Kriterien Städte- bau/Quartier/Architektur und Klimaschutz/Energie/Mobilität, sowie die Integration Konzeptinhalten. Darunter werden verschiedene Aspekte genannt wie zielgruppengerecht, gemeinschaftsorientiert, Inklusion etc. Die Stadt behält sich vor, je nach Grundstück die Kriterien spezifisch anzupassen und auszuführen. Im zugrundeliegenden Handlungskonzept Wohnen wird ausführlich über das Thema und den Prozess gemeinschaftlichen Wohnens geschrieben (Bielefeld 2022). Auf dieses Dokument wird im Bereich Wohnen unter “gemeinschaftliche Wohnformen” verwiesen. Darüber hinaus findet man weitere Informationen und Kontaktdaten. Es gibt keine eigene Kontaktstelle, aber zwei explizite Kontaktpersonen im Büro Sozialplanung und Bauamt (Bielefeld 2024c). Es wird zudem auf das Bielefelder Netzwerk Wohnprojekte verwiesen. Die Stadt informiert an dieser Stelle über Wohnprojektinitiativen und über Termine zu einem eigens organisierten Interessententreffen, das seit 2007 stattfindet (ebd.).
Bonn hat im 2017 beschlossenen Baulandmodell insbesondere die Sicherung von wohnungspolitischen und sozialpolitischen Zielen durch städtebauliche Verträge festgehalten (Bonn 2023). Dazu stand auch die Veräußerung im Erbbaurecht im Mittelpunkt. 2023 wurde im Rahmen des Baulandmodells auch die Richtlinie zur Vergabe von städtischen Grundstücken erneuert und der Konzeptvergabe als Verfahren mehr Bedeutung eingeräumt. In der Präambel dieser Richtlinie ist wortwörtlich das Ziel einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung notiert (Bonn o.J.). Grundsätzlich stehen alle Verfahrensoptionen zur Auswahl und es soll fallspezifisch entschieden und beschlossen werden. Das Dokument enthält für jeden Fall eine Beschreibung. Auf der Website ist unter dem Punkt Soziales, Gesellschaft alles rund um das Thema innovativer Wohnformen zu finden, wie zum Beispiel eine Kontaktstelle “innovative Wohnformen", die Beratungsangebote und eine Vermittlungsfunktion innehat. Des Weiteren findet sich dort eine Übersicht existierende und in Planung befindlicher Wohnprojekte wie weiterführende Links zu Netzwerken und Servicestellen (Bonn 2024a).
Dortmund beschreibt in seiner Imagebroschüre des Liegenschaftsamtes, dass Konzeptvergaben insbesondere in Verbindung mit gemeinschaftlichen Wohnprojekten gesehen werden. Dazu wurden 2020 zwei speziell an diese Wohnformen ausgeschrieben (Dortmund 2021). In einer Beschlussvorlage findet man Vorschläge zu einer dauerhaften Festlegung von 10% der städtischen Grundstücke für solche Vorhaben wie auch Verfahrensschritte (Dortmund 2019) Dazu lässt sich kein Beschluss finden.
Düsseldorf hat ein Baulandmodell, in dem auch explizit gemeinschaftliche Wohnformen und Konzeptvergabe genannt sind. Zudem gibt es eine Ansprechperson zu gemeinschaftlichen Wohnformen. Die Bezeichnung ist “Agentur für Baugemeinschaften und Wohngruppen”. Sonstige Beratung zum Thema Wohnen ist im Amt für Wohnungswesen oder bezüglich freier städtischer Grundstücke im Bereich Liegenschaften zu erhalten. Dort lassen sich die Vergabe Richtlinie und auch Verfahrensbeschreibungen zu den Grundstücken finden, sofern welche frei sind. Es lassen sich nicht direkt Informationen zu laufenden, abgeschlossenen oder geplanten Konzeptvergaben finden. Darüber hinaus gibt es aber eine Übersicht über Wohnprojekte (Düsseldorf 2024b). Aktuell zählt die Stadt 3 Konzeptvergaben, die an gemeinschaftliche Wohnprojekte gegangen sind. Alle sind in der Bauphase. In der Verfahrensbeschreibungen und den Unterlagen wird das Verfahren “Anhandgabeverfahren” oder “Konzeptbewerbung” genannt (Düsseldorf 2020a)
Die Stadt Köln hat bereits 2014 ein Stadtentwicklungskonzept zur Sicherung der wohnungspolitischen Ziele beschlossen. Ein Bestandteil davon ist das Kooperative Baulandmodell, welches seitdem mehrmals angepasst wurde (Köln 2024c). Im Stadtentwicklungskonzept (StEk) sind im Handlungsfeld “Baulandmanagement - Liegenschaftspolitik” Konzeptvergabe und durch diese die Förderung von Baugemeinschaften als “priorisierte Maßnahme” festgehalten. (Köln 2015: 21). Zudem wird auch im Handlungsfeld “altengerechtes und barrierefreies Wohnen" auf die Förderung von Mehrgenerationen eingegangen. Darauf aufbauend wurde 2016 beschlossen städtische Grundstücke für “Mehrfamilienbehausung” über eine Konzeptvergabe im Erbbaurecht zu veräußern. Die Website führt unter Planen und Bauen - Grundstücks - und Immolbienservice eine Liste abgeschlossener Konzeptvergaben (Köln 2024a). Im Anhang des Beschlusses für das StEK lässt sich zudem ein Leitfaden zur Konzeptvergabe städtischer Grundstücke finden, in der Einzelheiten zum Verfahren beschrieben sind (Köln o.J.b). Eingegliedert in das Amt für Wohnungswesen ist die Beratungsstelle für soziales und innovatives Wohnen. Dort werden Projekte in Köln vorgestellt, die teilweise aus einem Förderprogramms entstanden, wie auch unabhängige. Zudem werden weiterführende Links und Informationen zu Netzwerken und Portalen bereitgestellt.
Münster verfolgt mit dem 2014 beschlossenen Modell der sozialgerechten Bodennutzung als Teil des Handlungskonzept Wohnens das Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu sichern. Dazu gehört unter anderem auch die Schaffung von gemischten Wohnquartieren mit gemeinschaftlichen Wohnformen (Münster 2024d). Das Modell beruht auf zwei Kernprinzipien: die aktive Rolle der Stadt und die Mitwirkung privater Akteure. Um die Rolle der Stadt zu stärken, wird festgehalten, dass alle städtischen Flächen für Mietwohnungsbau per Konzeptvergabe oder an denjenigen, der die niedrigste Startmiete garantiert, veräußert werden sollen. Dazu gibt es eine eigene Richtlinie, die auch explizit an Gemeinschaftswohnformen gerichtet ist (Münster 2022). Auf der Website unter Immobilienangebote werden die verfügbaren städtischen Grundstücke für die unterschiedlichen Zielgruppen vorgestellt: Investoren, Privatpersonen, gemeinschaftliche Wohnprojekte, kommende Baugebiete (Münster 2024f). Beratung zu gemeinschaftlichen Wohnformen bekommt man im Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung. Auf der Website findet man neben den Kontaktdaten allgemeine Informationen zu dem Thema, eine Übersicht zu Projekten in Planung, Umsetzung und zu bereits existierenden, sowie zu geeigneten Grundstücken bzw. Immobilien. Zudem wird dort auch über den städtisch organisierten Tag des offenen Wohnprojektes berichtet und informiert (Münster 2024e).
7 Diskussion und kritische Einordnung
Zielsetzung dieser Arbeit war eine Bestandsaufnahme der Konzeptvergaben in Nordrhein-Westfalen unter der Annahme, dass Konzeptvergaben insbesondere für gemeinschaftliche Wohnprojekte erleichterten Zugang zu Flächen und damit zur Realisierung dieser Projekte beitragen können. Auf den folgenden Seiten folgen die Diskussion der Ergebnisse sowie die kritische Einordnung.
7.1 Diskussion der Ergebnisse
Die Bestandsaufnahme hat ergeben, dass 51 von insgesamt 396 Kommunen Grundstücke durch Konzeptvergabe veräußert haben (oder dabei sind). Wenn man die Kommunen dazu rechnet, die es vorhaben, sind es 61 Kommunen, was 15,4 % beträgt. Zu erwarten waren insbesondere die Städte, die in Verbindung mit Konzeptvergaben und gemeinschaftlichen Wohnprojekten schon in diversen Medien genannt wurden, wie zum Beispiel Köln und Münster. Zudem ist interessant festzustellen, dass 24 Städte, die Konzeptvergaben durchführen, auch einen angespannten Wohnungsmarkt aufweisen. Dies deutet auf eine Verbindung zu den in Kapitel 4 erwähnten Zielsetzungen hin, insbesondere im Hinblick auf das Potenzial, preisdämpfend zu wirken. Kommunen mit angespannten Wohnungsmärkten sind gemäß §201a BauGB definiert als solche, in denen die Mieten im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich steigen, die Mietbelastung der Haushalte überdurchschnittlich hoch ist, die Nachfrage nach Wohnraum höher ist als das Angebot und/oder ein geringer Leerstand bei großer Nachfrage besteht. Somit ist weniger überraschend, dass Städte mit den höchsten durchschnittlichen Mieten (Bonn, Düsseldorf, Köln, Münster) Konzeptvergaben durchführen und diese auch in Strategien verankert haben und Städte mit kontinuierlich steigenden Baulandpreisen darunter sind.
Es ist festzustellen, dass im absoluten Vergleich ungefähr gleich viele Kleinstädte wie Großstädte Konzeptvergaben durchführen. Das zeigt, dass auch Kommunen im ländlichen Raum, trotz geringerer personeller Ressourcen, Interesse an diesem Verfahren und seinen Vorteilen haben. Gegensätzlich dazu fällt beim Betrachten der Karte in Kapitel 6.1 auf, dass sich im südöstlichen Teil keine Städte mit Konzeptvergabe auseinandersetzen. Laut dem aktuellen Grundstücksmarktbericht (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 2023), gibt es in der Eifel, im Sauer- und Siegerland oder Ostwestfalen/Lippe erschlossenes Bauland für unter 50€/qm. Das kann also am verfügbaren bezahlbaren Bauland liegen und lässt vermuten, dass die Herausforderungen dieser Kommune andere Bereiche betrifft und die Konzeptvergabe (noch) nicht als passendes Instrument gewählt wird. Die Übersichtskarte zeigt zudem, dass insbesondere benachbarte Kommunen Konzeptvergaben durchführen. Die Gründe dafür können vielfältig sein und von ähnlichen Problemstellungen über regionale Vernetzung bis hin zu unterstützenden Austausch reichen. Eine tiefergehende Analyse der Hintergründe wird aufgrund des eingeschränkten Rahmens dieser Arbeit nicht durchgeführt.
Über die Hälfte der Kommunen, die Konzeptvergaben durchführen, haben dies bisher nur einmal getan, wobei die meisten Verfahren noch nicht abgeschlossen sind. Es fällt auf, dass es vor allem Mittelstädte sind, die diesen Weg einschlagen, vermutlich aufgrund der Handlungsbedarfe auf dem Wohnungsmarkt und einer größeren personellen Kapazität für solche Vergabeverfahren. Die hohe Anzahl laufender Verfahren ist auch auf die Dauer dieser Verfahren zurückzuführen. Das eigentliche Vergabeverfahren dauert 1-2 Jahre, hinzu kommen die Vorbereitungszeit, der Beschluss und die Bauphase. Im Vergleich zu anderen Verfahren ist dies nicht ungewöhnlich lang, erfordert aber eine andere, neue Herangehensweise.
Die Grundlage für Konzeptvergaben ist von Bedeutung, da sie den Handlungswillen der Kommune signalisiert. Sie dienen als Leitbild und Maßnahmenkatalog für bestimmte Bereiche, in denen Probleme erkannt wurden. Wenn diese Konzepte die Förderung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten und/oder Konzeptvergaben beinhalten und beschlossen werden, deutet dies auf eine gewisse Verpflichtung hin (BBSR 2023: 58). Die Gründe für diese Konzepte liegen in den Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt, sowie in der demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung und den Versuchen, damit umzugehen. Zum Beispiel gibt die Stadt Voerde in seinem Handlungskonzept Wohnen (Schulten Stadt- und Raumentwicklung (2019) an, dass Alterung und Schrumpfung vorherrschen, aber auch die Nachfrage durch Zuwanderung aus umliegenden Großstädten und durch die Aufnahme von Geflüchteten stark zunimmt und durch Konzeptvergaben diese komplexen Herausforderungen angegangen werden soll. Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass in vielen Fällen die Parteien "SPD" oder "Bündnis 90/die Grünen" das Thema auf die örtliche wohnungspolitische Agenda bringen wollen.
Die Erhebung zeigt, dass nur 8 von 51 Kommunen, die Konzeptvergaben durchführen, über ein Beratungsangebot für gemeinschaftliche Wohnprojekte verfügen. Insbesondere vor dem Hintergrund der in Kapitel 4 vorgestellten Wechselwirkungen. Sowohl die Literatur über gemeinschaftliche Wohnprojekte wie auch die Literatur über Konzeptvergaben, thematisieren diese Verknüpfung. Wie bereits dargelegt, sind Beratung und Information neben dem geeigneten und bezahlbaren Grundstück entscheidend für die Umsetzung solcher Projekte. Eine entsprechende Informationsarbeit seitens der Kommunen, die spezielle Wohnformen in ihren Konzeptvergaben berücksichtigen, ist daher förderlich. Die 7 vorgestellten Kommunen unterstreichen somit die Bedeutung einer bodenpolitischen Strategie und Öffentlichkeitsarbeit, die gemeinschaftliche Wohnprojekte inkludiert, für die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen und Strukturen. Die Ansprache von gemeinschaftlichen Wohnprojekten erfolgt sehr unterschiedlich und ist stark von den individuellen Verfahren abhängig. Ein abschließender Überblick darüber, welche gemeinschaftlichen Wohnprojekte durch Konzeptvergaben entstanden sind, lässt sich im Rahmen dieser Arbeit nicht geben. Es ist jedoch festzuhalten, dass viele Verfahren noch im Prozess sind und Informationen über ältere Verfahren oft fehlen.
Weiterhin ergibt die Erhebung, dass die meisten Konzeptvergaben für eine Nutzungsmischung angewandt werden, was darauf hindeutet, dass die zu entwickelnde Grundstücke möglichst viele Bedürfnisse abdecken sollen. Flächenkonkurrenzen stellen eine Herausforderung dar, der unter anderem mit Konzeptvergaben begegnet werden soll. Die erfassten Konzeptvergaben werden für vielfältige Grundstücke eingesetzt, von großen Quartiersentwicklungen über bestimmte Baufelder einer Quartiersentwicklung bis hin zu kleinteiligen Grundstücken mit bereits vorhandener Bebauung.
Zusammenfassend fällt neben der relativ geringen Anzahl an Städten mit Konzeptvergabeverfahren auf, dass insbesondere die Zahl der durch Konzeptvergabe entstehenden gemeinschaftlichen Wohnprojekte vor dem Hintergrund des Potenzials eher niedrig ausfällt. Das lässt sich auf das eher lang andauernde Verfahren zurückführen und darauf, dass viele Konzeptvergaben aktuell noch laufen. Zudem kann es auch an methodischen Einschränkungen liegen, die nachfolgend beschrieben werden.
7.2 Kritische Einordnung der Ergebnisse und Methodik
Zusammenfassend eignet sich die Methodik einer Desk Research für den ersten Schritt einer Forschungsarbeit, um eine solide Grundlage zu schaffen und wichtige Informationen zu sammeln, bevor weiterführende Methoden wie Umfragen oder Interviews durchgeführt werden. Insgesamt ist die ausschließliche Betrachtung von Internetquellen bzw. online verfügbare Dokumente für einen umfassenden Blick schwierig - aus verschiedenen Gründen. Manche Inhalte werden durch fehlende Aktualität von der Website entfernt oder gar nicht erst hochgeladen. Einige Kommunen betreiben eine Notfall-Webseite aufgrund eines Hackerangriffs, der am 30.10.2023 alle Kommunen in Südwestfalen betraf (KommunalWiki 2023).
Die geringe Anzahl der Konzeptvergaben, insbesondere der realisierten Wohnprojekte durch Konzeptvergaben, lässt sich nicht abschließend erklären. Es besteht die Möglichkeit, dass einige Verfahren und Projekte aufgrund der angewandten Methodik übersehen wurden. Da sich die Analyse ausschließlich auf online verfügbare Informationen stützt, besteht immer die Chance, dass relevante Daten übersehen wurden oder nur auf Nachfrage verfügbar sind. Um zu einem eindeutigen und umfassenden Ergebnis zu gelangen, wäre es notwendig, die betroffenen Kommunen und/oder Wohnprojekte direkt zu kontaktieren. Diese Problematik bezüglich der Datenqualität und Zugänglichkeit betrifft das gesamte Forschungsvorhaben. Für ein eindeutiges Ergebnis und eine tiefergehende Analyse müssten an dieser Stelle Kommunen und/oder Wohnprojekte kontaktiert werden. Die Problematik der Datenqualität und allgemeinen Zugänglichkeit gilt für das gesamte Forschungsvorhaben. Für die Erhebung wurden die Internetquellen in “Quelle Kommune” und “Quelle Sonstiges” aufgeteilt, um einen Überblick zu bekommen, welche Kommunen selbst über das Verfahren informieren und welche nicht. Diese Aufteilung entspringt der grundsätzlichen Auffassung, dass in einer zunehmend digitalisierten Welt der Zugang zu jeglichen Informationen, hier über Konzeptvergaben und gemeinschaftliches Wohnen im Internet, von entscheidender Bedeutung ist. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Kommunen solche Verfahren möglichst transparent halten sollen (vgl. Kapitel 4.3) und auch Öffentlichkeitsarbeit, worunter das zur Verfügung stellen von Informationen fällt, eine entscheidende Rolle für die Etablierung der Konzeptvergabe und gemeinschaftlichen Wohnprojekte (vgl. Kapitel 4.4), spielt. Die Aufbereitung der Informationen auf den jeweiligen Websites unterscheidet sich stark und kann in diesem Rahmen nicht abschließend verglichen werden.
Die Diversität der verwendeten Begriffe stellt eine herausfordernde Hürde dar, sowohl für Forscherinnen als auch potenzielle Interessentinnen. Es werden verschiedene Begriffe für Konzeptvergabe genutzt, aber auch für gemeinschaftliche Wohnprojekte, was die Informationsbeschaffung zusätzlich erschwert. In Bochum heißt das Verfahren beispielsweise “Bestgebotsverfahren”, während in Düsseldorf die Begriffe “Anhandgabeverfahren” oder “Konzeptbewerbung” genutzt werden. Somit musste in einigen Fällen die Methodik angepasst und z.B. auf alternative Begriffe zurückgegriffen werden. Grundsätzlich hat sich der Begriff "Konzeptvergabe" etabliert, und die alternativen Bezeichnungen sind nicht falsch, jedoch kann dies insbesondere für Personen, die nicht mit dem Thema vertraut sind, die Suche erschweren. Nicht nur die Terminologie, sondern auch die Strukturierung der Website Inhalte beeinflussen die Zugänglichkeit. Die Verortung von Informationen zu Konzeptvergaben innerhalb der Website kann stark variieren, was die Erhebung erschwert hat, und auch übertragen auf die Suche für potenzielle Interessentinnen eine Hürde darstellen kann. Somit sind eine einheitliche Terminologie und eine klare Strukturierung der Websiteinhalte entscheidend, um potenziellen Interessentinnen den Zugang zu relevanten Informationen zu erleichtern. Problematisch ist vor allem in Bezug auf diese Arbeit, wenn innerhalb der Kommune keine konsequente Begriffsbezeichnung verwendet wird (Köln 2024b; Beratungsstelle, Informationsstelle). Durch die sich zum Teil stark voneinander unterscheidenden Begriffsdefinitionen der Städte kann keine Vollständigkeit der angewandten Methode garantiert werden.
Eine mögliche Strategie der Verbesserung der Informationsbeschaffung seitens der Kommunen ist die Präsenz einer Beratungsstelle oder zumindest die Möglichkeit, Beratung von den zuständigen Fachbereichen zu erhalten, trägt ebenfalls zur Zugänglichkeit bei und signalisiert die Unterstützung seitens der Kommunen für derartige Initiativen. Wie in der Ergebnisdarstellung hervorgehoben, gibt es 14 Kommunen, die eine Beratungsstelle für gemeinschaftliche Wohnprojekte haben und 8 davon grundsätzlich Konzeptvergaben durchführen. Dazu gibt es Kommunen, die ihre Unterstützung unabhängig von einer Beratungsstelle betonen (Mülheim 2019) und die eine allgemeine Wohnberatung durchführen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einschränkungen durch und Abhängigkeit von Internetquellen für eine tiefergehende Analyse hinderlich sind. Für das Forschungsziel und den Rahmen dieser Forschungsarbeit aber ausreichend ist, um einen Überblick zu gewinnen.
Es kommt die Frage auf, inwiefern Konzeptvergaben wirklich einen Beitrag zu bezahlbarem Wohnraum und einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung leisten können. Viele Konzeptvergaben, sei es durch Handlungskonzepte oder Baulandmodelle, sollen dazu beitragen, mehr (bezahlbaren) Wohnraum zu schaffen und preisdämpfend zu wirken. Doch Erfahrungen in Städten wie München, die bereits lange mit solchen Instrumenten arbeiten, weisen immer noch einen angespannten Wohnungsmarkt auf. Die Auswirkungen dieser Instrumente auf den Wohnungsmarkt sind langwierig und erfordern auch auf Bund- und Landesebene entsprechende Maßnahmen (Faller et al. 2021: 98). Im Hinblick auf die Problematik der Wohnraumschaffung ist eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung nicht die alleinige Lösung. Es bedarf Instrumenten zur Mobilisierung und nicht nur zur Nutzung vorhandener Flächen (ebd.). Konzeptvergaben sind daher eher als Teil einer umfassenderen Strategie und eines Instrumentariums zu verstehen und sollten nicht als alleinige Hoffnungsträger für wohnungspolitische Herausforderungen betrachtet werden. Darüber hinaus weist dieses Vergabeverfahren auch andere Potenziale auf. An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass diese Arbeit keine Aussagen über die Wirkung von Konzeptvergaben treffen kann, da dies über den Rahmen der formulierten Forschungsfrage hinausgeht.
8 Fazit und Ausblick
Die vorliegende Arbeit ging der Frage nach, “Welche Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben, bereits Erfahrung mit Konzeptvergaben und gemeinschaftlichen Wohnprojekten gesammelt?”. Dazu wurde eine strukturierte Internetrecherche vorgenommen, um eine Bestandsaufnahme der Konzeptvergaben in NRW und ihrer Eigenschaften bzgl. Durchführung, Einbezug gemeinschaftlicher Wohnprojekte und Verfügbarkeit der Informationen aufzustellen.
Die Erhebung zeigt, dass von den insgesamt 396 Kommunen in NordrheinWestfalen insgesamt 53 Kommunen bereits Erfahrungen mit Konzeptvergabe haben, während 8 weitere Kommunen planen, dieses Verfahren zu nutzen. In 13 weiteren wird dies von verschiedenen Akteuren wie der Lokalpolitik empfohlen. Dies deutet darauf hin, dass das Thema in einigen Kommunen präsent ist, auch wenn (noch) nicht alle aktiv daran teilnehmen. Besonders interessant ist, dass sowohl Kleinstädte als auch Mittelstädte Konzeptvergaben durchführen. Obwohl Großstädte traditionell mit solchen Initiativen in Verbindung gebracht werden, zeigen die Daten, dass dies kein ausschließlich großstädtisches Phänomen ist, was darauf hinweist, dass das Interesse und die Notwendigkeit, auf Herausforderungen des Wohnungsmarkts zu reagieren, nicht auf (großstädtische Gebiete beschränkt sind. Ein bedeutender Teil der Kommunen mit Konzeptvergaben leidet unter einem angespannten Wohnungsmarkt, was die Verbindung zwischen Konzeptvergaben und der Bewältigung von Wohnraumherausforderungen unterstreicht. Durch die Vergabe von städtischen Grundstücken mittels Konzeptvergaben können die Kommunen versuchen, preisdämpfend einzugreifen und alternative Wohnformen zu fördern.
Ein weiteres Kernthema dieser Arbeit ist der Einbezug gemeinschaftlicher Wohnprojekte. Obwohl nicht alle Kommunen explizit darauf eingehen, zeigen einige, dass sie diesen Bereich aktiv fördern wollen. Dies spiegelt sich in ihren Konzeptvergaben wider, die Kriterien zur Unterstützung solcher Projekte enthalten oder sogar Baufelder für solche Projekte vorsehen. Um langfristig gemeinschaftliche Wohnprojekte in ihrem Entstehen und Umsetzen zu fördern, ist zudem auch die allgemeine Webpräsenz wichtig. Die Website der Kommune spielt eine zentrale Rolle als Informationsplattform für Bürgerinnen und potenzielle Entwicklerinnen gleichermaßen. Ein klar strukturierter Webauftritt, der alle relevanten Informationen bündelt und leicht zugänglich macht, fördert eine transparente Kommunikation und ermöglicht eine niedrigschwellige Beteiligung. Dies stärkt das Vertrauen in den Entscheidungsprozess der Verwaltung und trägt zur demokratischen Teilhabe bei.
Insgesamt verdeutlicht die Untersuchung der Konzeptvergaben in NRW-Kommunen ihre Bedeutung als vielseitiges Instrument zur Bewältigung von städtischen Herausforderungen und zur Förderung alternativer Wohnformen. Die Vielfalt der Ansätze und Strategien spiegelt die unterschiedlichen Bedürfnisse, Prioritäten und Rahmenbedingungen der Gemeinden wider und unterstreicht die Bedeutung lokaler Lösungen für komplexe raumplanerische Herausforderungen.
Die Arbeit fokussiert sich auf einen Überblick und konnte einigen bedeutsamen Themen nicht weiter nachgehen. Ausgehend davon wären für zukünftige Forschungen folgende Aspekte interessant:
- Einfluss der Grundstücksgröße auf die Anwendung der Konzeptvergabe: Untersuchung, ob Konzeptvergaben eher für kleine oder große Projektentwicklungen bevorzugt werden und welche Faktoren diese Präferenz beeinflussen.
- Regionale Unterschiede in der Anwendung von Konzeptvergaben: Eine detaillierte Analyse der Anwendung von Konzeptvergaben in verschiedenen Regionen bzw. in einer dieser Regionen Nordrhein-Westfalens, wie dem Ruhrgebiet, dem Rheinland, dem Münsterland und ländlichen Gebieten um Ballungsgebiete herum, um die regionalen Besonderheiten und Herausforderungen zu verstehen.
- Entstehung und Verbreitung des Konzeptverfahrens: Eine tiefere Untersuchung von Fallbeispielen, wie und warum das Konzeptverfahren in den nordrhein-westfälischen Kommunen entstanden ist und wie es sich verbreitet hat, ob durch die Nachfrage von Wohnungssuchenden oder durch konzeptionelle Empfehlungen und Initiativen der Kommunen. auch um Aspekt des voneinander Lernens, Leitfäden oder regionaler Zusammenarbeit zu beleuchten.
- Beratungsangebote seitens der Kommunen: Eine Analyse der Art und Effektivität der Beratungsangebote, die von den Kommunen im Zusammenhang mit Konzeptvergaben bereitgestellt werden, und wie diese die Umsetzung und den Erfolg von Konzeptvergaben beeinflussen.
- Einfluss der Kommunengröße und Haushaltsstruktur auf die Nutzung von Konzeptvergaben: Untersuchung, welche Art von Kommunen (klein, mittel, groß) Konzeptvergaben durchführen und aus welchen Gründen sie sich für dieses Instrument entscheiden, unter Berücksichtigung ihrer Haushaltsstruktur und finanziellen Ressourcen.
Die Konzeptvergabe ist eingebettet in eine große bodenpolitische Diskussion, die auch weitere interessante Forschungsvorhaben erlaubt. Die hier angerissene kommunale Handlungsfähigkeit durch bestimmte Gesetze und Instrumente könnte im Zentrum weiterer Untersuchungen stehen. Insbesondere die BauGB Novelle oder Baulandmobilisierungsgesetz könnten auf ihre Wirksamkeit und Potenziale untersucht werden, da sie dafür sorgen sollen, mehr kommunale Bodenverfügbarkeit zu schaffen (vhw 2023). Das würde allerdings einen größeren, vor allem zeitlichen, Umfang voraussetzen.
Kommunen handeln in einem relativ kleinen Maßstab, verfügen jedoch grundsätzlich über ein erhebliches Gestaltungspotenzial innerhalb ihrer eigenen Grenzen sowie im Rahmen bundesweiter Initiativen. Angesichts der zunehmenden Bedeutung gemeinwohlorientierter Stadtentwicklung und gemeinschaftlicher Wohnprojekte ist die Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit unerlässlich, um die Herausforderungen der urbanen Entwicklung erfolgreich anzugehen und lebenswerte, nachhaltige Städte für ihre Bewohner zu gestalten.
Literaturverzeichnis
Adrian, Luise; Bunzel, Arno; Michalski, Daniela; Pätzold, Ricarda (2021): Aktive Bodenpolitik: Fundament der Stadtentwicklung. Bodenpolitische Strategien und Instrumente im Lichte der kommunalen Praxis. Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin.
Architektenkammer Rheinland-Pfalz (2019): Mehr Konzept. Orientierungshilfe zur Vergabe öffentlicher Grundstücke nach Konzeptqualität. Verfügbar unter: https://www.diearchitekten.org/fileadmin/csv-upload/user_upload/Brosch_Konzeptvergabe_WEB_K.pdf [abgerufen 16.04.2024].
BBSR - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2019): Gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik. Stiftungen und weitere gemeinwohlorientierte Akteure: Handlungsfelder, Potenziale und gute Beispiele, 2019. Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR), Bonn.
BBSR - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2020a): Baukultur für das Quartier. Prozesskultur durch Konzeptvergabe: Kurzfassung der Forschungsergebnisse, 2020. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Bonn.
BBSR - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hrsg.) (2020b): Glossar zu gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung. Verfügbar unter: https://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSPWeb/Shared-Docs/Publikationen/DE/Publikationen/glossar-zur-gemeinwohlorientier-ten-stadtentwicklung.html;jsessio-nid=9917154626912845C04CDA7626B08935.live11294?nn=2930660 [abgerufen a 16.04.2024].
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hrsg.) (2021): Neue Leipzig-Charta. Die transformative Kraft der Städte für das Gemeinwohl. Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Bonn.
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hrsg.) (2023): Handlungsempfehlungen für die Umsetzung integrierter Stadtentwicklungskonzepte. Eine Arbeitshilfe für Kommunen, 2022. Aufl. Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Bonn.
BBSR - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2024): Stadt- und Gemeindetypen in Deutschland. Verfügbar unter: https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumbeobach- tung/Raumabgrenzungen/deutschland/gemeinden/StadtGemeinde- typ/StadtGemeindetyp.html [abgerufen am 16.04.2024].
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (2023). Aktuelle Entwicklungen auf dem Deutschen Wohnungsmarkt. Verfügbar unter: https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/stadt-wohnen/wohnungswirtschaft/fakten-wohnungsmarkt/fakten-wohnungs-markt-node.html [abgerufen am 16.04.2024].
Cheong, He-in et al. (2023): Secondary Qualitative Research Methodology U- sing Online Data within the Context of Social Sciences. International Journal of Qualitative Methods, 22. 160940692311801.
Demografieportal (2024): Regionale Bevölkerungsentwicklung in NordrheinWestfalen. Verfügbar unter: Demografieportal (2024): Regionale Bevölkerungsentwicklung in Nordrhein-Westfalen. [abgerufen am 16.04.2024].
Destatis - Statistisches Bundesamt (2024): Mitten im demografischen Wandel. Verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/De-mografischer-Wandel/demografie-mitten-im-wandel.html [abgerufen am 16.04.2024].
Deutschlandatlas (2023): Wie wir wohnen. Baulandpreise: So viel kostet der Quadratmeter in Ihrer Region. Verfügbar unter: https://www.deutschlan-datlas.bund.de/DE/Karten/Wie-wir-wohnen/043-Baulandpreise.html [abgerufen am 16.04.2024].
Dransfeld, Egbert & Hemprich, Christian (2017): Kommunale Boden- und Liegenschaftspolitik. Wohnbaulandstrategien und Baulandbeschlüsse auf dem Prüfstand. Forum Baulandmanagement NRW, Dortmund.
Dürr, Susanne; Kuhn, Gerd (Hrsg.) (2017): Wohnvielfalt. Gemeinschaftlich wohnen - im Quartier vernetzt und sozial orientiert, 2. Aufl. Wüstenrot Stiftung, Ludwigsburg.
Etezadzadeh, Chirine (Hrsg.) (2020): Smart City - Made in Germany. Die Smart-City-Bewegung als Treiber einer gesellschaftlichen Transformation. Springer Vieweg, Wiesbaden, Heidelberg.
Faller, Bernhard; Wilmsmeier, Nora; Beyer, Colin; Steinbach, Franziska; Ritter, Jennifer (2021): Soziale Wohnungspolitik auf kommunaler Ebene. Reihe: vhw - Schriftenreihe, Bd. 25. vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V, Berlin.
Fedrowitz, Micha & Gailing, Ludger (2003): Zusammen wohnen. Gemeinschaftliche Wohnprojekte als Strategie sozialer und ökologischer Stadtentwicklung. Reihe: Blaue Reihe, Bd. 112. IRPUD, Dortmund.
FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V.: Checkliste. 7 Meilensteine auf dem Weg zum Wohnprojekt. Verfügbar unter: https://win.fgw-ev.de/media/7_ms_zum_wohnprojekt_1.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V. (Hrsg.) (2016): Grundstücksvergabe für gemeinschaftliches Wohnen. Konzeptverfahren zur Förderung sozialen Zusammenhalts, bezahlbaren Wohnraums und lebendiger Quartiere. Verfügbar unter: https://verein.fgw-ev.de/media/forum_konzept-verfahren.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V. (2020): Abschlussdokumentation " Potenziale gemeinschaftlicher Wohnformen - eine Bilanz". Verfügbar unter: https://wohnprogramm.fgw-ev.de/media/2020-02b_forum_bro-schuere_abschlussdoku_modellprogramm_pdf-ua.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V. (2024): FAQs Gemeinschaftliches Wohnen. Verfügbar unter: https://verein.fgw-ev.de/service-und-informationen/faqs-gemeinschaftliches-wohnen/ [abgerufen am 16.04.2024].
Gennies, Mona (2021): Konzeptverfahren als Instrument einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung. Reihe: ISR Impulse Online Bd. 68, Berlin.
Gennies, Mona (2022): Dokumentation. 5. bundesweiter Erfahrungsaustausch. Konzeptverfahren für gemeinschaftliche Wohnprojekte. Verfügbar unter https://www.gemeinschaftliches-wohnen.de/wp-content/uploads/2023/03/5BundesweiterAustauschKonzeptverfahren2022_Doku_fi- nal.pdf.
Ginski, Sarah; Schmitt, Gisela (2014): Gemeinschaftliche Wohnformen - Ein Beitrag zur Wohnungsversorgung? Forum Wohnen und Stadtentwicklung, 6, S. 292-296.
Glatter, Jan; Mießner, Michael (Hrsg.) (2021): Gentrifizierung und Verdrängung. Aktuelle theoretische, methodische und politische Herausforderungen. Reihe: Interdisziplinäre Wohnungsforschung, Band 3. transcript Verlag, Bielefeld.
Hagbert, Pernilla; Larsen, Henrik Gutzon; Thörn, Hakan; Wasshede, Cathrin (Hrsg.) (2020): Contemporary Co-housing in Europe. Towards Sustainable Cities? Taylor & Francis.
Häußermann, Hartmut & Siebel, Walter (2000): Soziologie des Wohnens. Eine Einführung in Wandel und Ausdifferenzierung des Wohnens. Reihe: Grundlagentexte Soziologie, 2. Aufl. Juventa-Verl., Weinheim, München.
Heinz, Werner & Belina, Bernd (2019): Die kommunale Bodenfrage. Hintergrund und Lösungsstrategien. Berlin: Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hertweck, Florian; Löhr, Dirk; zur Nedden, Martin; Pätzold, Ricarda; Reiß- Schmidt, Stephan; Rettich, Stefan; Strauß, Christian; Tastel, Sabine; Thomas, Monika (Hrsg.) (2021): Die Bodenfrage. Klima, Ökonomie, Gemeinwohl. JOVIS Verlag GmbH, Berlin.
Herwig, Lotte (2018): Rechtsformen für Baugruppen und gemeinschaftliches Wohnen / Legal Forms for Collective Custom Build Projects and Co-hou- sing Projects. In: Becker, Annette; Kienbaum, Laura; Ring, Kristien; Ca- chola Schmal, Peter (Hrsg.): Bauen und Wohnen in Gemeinschaft. Ideen, Prozesse, Architektur = Building and living in communities : ideas, pro- cesses, architecture. Birkhäuser, Basel. S. 162-169.
Hettich, Franziska & Ritter, Jennifer (2020): Gemeinwohlorientierte Initiativen als Akteure in der Quartiersentwicklung. vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. S. 77-80.
Holm, Andrej (2022): Projekte, Instrumente und Konzepte einer alternativen Wohnungspolitik. WSI-Mitteilungen, 75 (3). S. 243-250.
Holm, Andrej; Kravets, Anna; Laimer, Christoph; Steinfeld, Jana (2021): Bausteine für ein Neues soziales Wohnen. In: Gemeinschaftliches Wohnen und selbstorganisiertes Bauen. TU Wien Academic Press, Wien. S. 229244.
Kasper, Birgit (2018): Gemeinschaftliche Wohnprojekte - der soziale Aspekt / Community-oriented Housing Projects - the Social Aspect. In: Becker, Annette; Kienbaum, Laura; Ring, Kristien; Cachola Schmal, Peter (Hrsg.): Bauen und Wohnen in Gemeinschaft. Ideen, Prozesse, Architektur = Building and living in communities: ideas, processes, architecture. Birkhäuser, Basel. S. 16-21.
KommunalWiki (2023): Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT 2023. Verfügbar unter: https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Cyberan-griff_auf_die_S%C3%BCdwestfalen-IT_2023#:~:text=In%20der%20Nacht%20auf%20den,einige%20wei-tere%20Kund%3Ainnen%20betreibt. [abgerufen am 16.04.2024].
LWL-Statistik (2024): Hochschulen und Studierende. Verfügbar unter: https://www.statistik.lwl.org/de/zahlen/hochschulen/ [abgerufen am 16.04.2024].
Metzger, Joscha (2016): Gemeinschaftliches Wohnen: Ansatz zur Lösung der Wohnungsfrage? ARL-Nachrichten. S. 18-22.
Montag Stiftung (2024): Gemeinwohlorientierte Konzeptverfahren. Verfügbar unter https://www.montag-stiftungen.de/handlungsfelder/chancenge- rechte-stadtteilentwicklung/gemeinwohlorientierte-konzeptverfahren.
Netzwerk Immovielien (Hrsg.) (2021): Viele Stimmen für mehr Gemeinwohl.
Immovielien-Heft 2021. Verfügbar unter: https://www.netzwerk-immo-vielien.de/wp-content/uploads/2021/08/210429_Immovielien-Heft_web.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Netzwerk Leipziger Freiheit (2019): Von der Idee zur Umsetzung - ein kleiner Leitfaden für Wohnprojektinitiativen. Verfügbar unter https://www.netz- werk-leipziger-freiheit.de/media/2019/12/datenblatt-von-der-idee-zum- projekt-2019-12-09.pdf.
NRW.Bank (2023): Wohnungsmarktbericht Nordrhein-Westfalen 2023. Verfügbar unter https://www.nrwbank.de/export/.galleries/downloads/wohnraumfoerderung/wohnungsmarktbeobachtung/Wohnungs-marktbericht-NRW-2023.pdf.
OpinioIuris (2024): BVerfG, 12.01.1967 - 1 BvR 169/63. Verfügbar unter: https://opinioiuris.de/entscheidung/1436 [abgerufen am 16.04.2024].
Peters, Gertrudis (2020): Konzeptvergabe - Baustein einer sozial gerechten Stadtentwicklung. In: Etezadzadeh, Chirine (Hrsg.): Smart City - Made in Germany. Die Smart-City-Bewegung als Treiber einer gesellschaftlichen Transformation. Springer Vieweg, Wiesbaden, Heidelberg. S. 415-423.
RegioKontext (2022): Gutachten zur Bestimmung von Gebieten mit Gutachten zur Bestimmung von Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalen. Verfügbar unter: https://www.mhkbd.nrw/system/files/media/document/file/2022-11-22_mhkbd_rvo-baumobg_gutachten.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Reimer, Romy; Röder, Stefanie; Kaiser, Maren (2020): "Potenziale gemeinschaftlicher Wohnformen - eine Bilanz". Reihe: Modellprogramm Gemeinschaftlich wohnen, selbstbestimmt leben, 2020. Aufl. Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V. Bundesvereinigung, Hannover.
Schader Stiftung (2011): Gemeinschaftliches Wohnen - eine Einführung, 2024 (letzte Aktualisierung). Verfügbar unter https://www.schader-stiftung.de/individuelle-auswahl/fokus/gemeinschaftliches-wohnen/arti-kel/gemeinschaftliches-wohnen-eine-einfuehrung [abgerufen am 16.04.2024].
Schipper, Sebastian; Vollmer, Lisa (2020): Wohnungsforschung. transcript Verlag, Bielefeld.
Schmid, Susanne (2021): Typologie des gemeinschaftlichen Wohnens. In: Holm, Andrej; Laimer, Christoph (Hrsg.) Gemeinschaftliches Wohnen und selbstorganisiertes Bauen. TU Wien Academic Press, Wien. S. 167178.
Schmidt, Gabriele & Pätzold, Ricarda (2023): Bodenpolitik von unten - ein utopisches Projekt? Zwei Jahre Bündnis Bodenwende. Forschungsjournal Soziale Bewegungen, 36 (1). S. 129-134.
Schönig, Barbara & Vollmer, Lisa (2020): Wohnungsfragen ohne Ende?! transcript Verlag, Bielefeld.
Schweitzer, Eva (Hrsg.) (2021): Die neue Leipzig-Charta: Entstehungsprozess und Ergebnis. Gemeinsam für gemeinwohlorientierte und handlungsfähige Kommunen in Europa; Dokumentation des nationalen und europäischen Dialogprozesses. Reihe: Nationale Stadtentwicklungspolitik, 2021. Aufl. Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR), Bonn.
Spellerberg, Annette (Hrsg.) (2018): Neue Wohnformen - gemeinschaftlich und genossenschaftlich. Erfolgsfaktoren im Entstehungsprozess gemeinschaftlichen Wohnens. Reihe: SpringerLink Bücher. Springer VS, Wiesbaden.
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (2023): Grundstücksmartk- bericht NRW 2023. Verfügbar unter: https://www.kommunen.nrw/informationen/mitteilungen/datenbank/detailansicht/dokument/grundstu-ecksmarktbericht-nrw-2023.html [abgerufen am 16.04.2024].
Statista (2021): Anzahl der Personen in Deutschland, die das Internet zur Informationssuche (Suchmaschinen) nutzen, nach Häufigkeit von 2018 bis 2021. Verfügbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/183133/umfrage/nachrichten-und-informationen-internetnut- zung/#:~:text=Umfrage%20zu%20Nutzung%20von%20Suchmaschi- nen%2FInformationssuche%20im%20Inter net%20bis%202021&text=Rund%2025%2C2%20Millionen%20deutsch- sprachige,zehn%20Millionen%20Personen%20mehr. [abgerufen am 16.04.2024].
Statista (2023): Anteil der Deutschen, die sich ein freistehendes Einfamilienhaus wünschen. Verfügbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1262760/umfrage/umfrage-zum-wunsch-nach-dem-eigenen einfamilienhaus/#:~:text=Um frage%20zum%20Wunsch%20der%20Deutschen%20nach%20ei- nem%20Einfamilien haus%20bis%202023&text=Der%20Traum%20vom%20Eigen- heim%20br%C3%B6ckelt,befragten%20Deutschen%20ein%20freiste- hendes%20Einfamilienhaus. [abgerufen am 16.04.2024].
Thommen, Jean-Paul et al. (2017): Marktforschung. In: Thommen, Jean-Paul; Achleitner, Ann-Kristin; Gilbert, Dirk Ulrich; Hachmeister, Dirk; Kaiser, Gernot (Hrsg.): Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Umfassende Einführung aus managementorientierter Sicht. Reihe: Lehrbuch, 8. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden. S. 69-80.
Töllner, Andrea (2016): Gemeinschaftliche Wohnformen fördern - Die Rolle der Kommune. ARL Nachrichten (1). S. 27-30.
vhw - Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung (2023): Baulandmobilisierung: NRW-Verordnung in Kraft getreten.Verfügbar unter: https://www.vhw.de/nachricht/baulandmobilisierung-nrw-verordnung-in-kraft-getreten/ [abgerufen am 16.04.2024].
Anhang
Anhang 1: Auswertungstabelle Datenerhebung
Anhang 2: Internetquellenverzeichnis Auswertung
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Quelle Auflistung Gemeinden: https://www.kommunen.nrw/der-verband/mitqlieder-des-stqb-nrw.html
Quelle für Einwohnerzahlen: https://www.it.nrw/de/statistik/eckdaten/bevoelkerunq-nach-qemeinden-315 (letzter Zugriff 15.3.2024)
Internetquellenverzeichnis der Erhebung
Aachen
Aachen (2024a): Aktuelles. Flyer Konzeptvergabe. Verfügbar unter: https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/Wohnen/Wohnraumentwicklung/wohnen_neue_wohnformen/Aktuelles/flyer_konzeptvergabe.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Aachen (2024b). Aktuelles. Verfügbar unter: https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/Wohnen/Wohnraumentwicklung/wohnen_neue_wohnformen/Aktuelles/index.html [abgerufen am 16.04.2024].
Aachen (2024c): Konzeptverfahren. Verfügbar unter: https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/politik_verwaltung/immobilienangebote/Konzeptverfahren/index.html [abgerufen am 16.04.2024].
Aachen (2024d) Ausschreibung Vergabe von Baugrundstücken im Konzeptverfahren. Verfügbar unter: https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/politik_verwaltung/immobilienangebote/Konzeptverfahren/Ausschreibung---miteinander-klimafreundlich-wohnen.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Aachen (2024e): Präsentation Vorankündigung Konzeptverfahren. Verfügbar unter: https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/politik_verwaltung/immobilienangebote/Konzeptverfahren/2022_06_21_Vorankuendigung_BF9-10.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Aachen (2024f):. Präsentation Maria-Montessori-Kita und Wohnungsbau. Verfügbar unter: https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/politik_verwaltung/immobilienangebote/Konzeptverfahren/abgeschlossen/1_-Praesentationsmappe-Wettbewerb-Kita-Eilendorf1.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Aachen (2024g): Laufende Konzeptverfahren. Verfügbar unter: https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/politik_verwaltung/immobilienangebote/Konzeptverfahren/Laufende-Konzeptverfahren/Brand/index.html [abgerufen am 16.04.2024].
Aachen (2024h): Handlungskonzept Wohnen. Verfügbar unter: https://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/wohnen/Handlungskonzept-Wohnen/index.html [abgerufen am 16.04.2024].
Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft (SWG) (2024). Bezahlbarer, inklusiver Wohnraum für den Kölner Süden. Verfügbar unter: https://www.aachener-swg.de/aktuell/detail/bezahlbarer-inklusiver-wohnraum-fuer-den-koelner-sueden [abgerufen am 16.04.2024].
Ahaus
post welters + partner mbB (2023): Konzeptvergabe »Mikrohaussiedlung« in Ahaus. Verfügbar unter: https://www.post-welters.de/wettbewerbsmanagement/projekt/konzeptvergabe- mikrohaussiedlung-in-ahaus/ [abgerufen am 16.04.2024].
Alfter
Wirtschaftsförderung Alfter GmbH (2024a): Die Vergabeverfahren für das Buschkauler Feld. Verfügbar unter: https://wfalfter.de/bkf/vergabeverfahren/ [abgerufen am 16.04.2024].
Wirtschaftsförderung Alfter GmbH (2024b): Das Quartier im Buschkauler Feld.
Verfügbar unter: https://wfalfter.de/bkf/quartier/ [abgerufen am 16.04.2024].
Altenbeken
Altenbeken (2024): WOHNPARK EGGE. Verfügbar unter: https://www.altenbeken.de/de/gemeinde/bauen-und-wohnen/wohnpark-egge.php#anchor_f2a36737_Accordion-24.03.2022---Wohnpark-Egge-wird-REGIONALE-Projekt [abgerufen am 16.04.2024].
UrbanLand OstWestfalenLippe GmbH (2024): Wohnpark Egge - Landquartier der Zukunft. Vielfältig und flächensparend wohnen. Verfügbar unter: https://www.urbanland-owl.de/projekte/wohnpark-egge/ [abgerufen am 16.04.2024].
Altenberge
Altenberge (2024a): Ohne Titel. Verfügbar unter: https://altenberge.de/de/investor-fuer-die-errichtung-der-kita-bahnhofshuegel-im-rahmen-einer-konzeptvergabe-gesucht-anmeldung-bis-zum-26-03-2024-moeglich [abgerufen am 16.04.2024].
Altenberge (2024b): Konzeptvergabe für die Kita „Am Bahnhofshügel“
Aufgabenbeschreibung. Verfügbar unter: https://altenberge.de/images/upload/file/aufgabenbeschreibung-konzeptvergabe-kita-bahnhofshuegel.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Bad Driburg
Bad Driburg (2024a): Veräußerung der ehemaligen Eggelandklinik (Grundstück mit Bestandsgebäude) mittels Konzeptvergabe. Verfügbar unter: https://www.bad-driburg.de/de/wohnen/Konzeptvergabe-Folgenutzung-Eggelandklinik.php [abgerufen am 16.04.2024].
Bad Driburg (2024b): Konzeptverfahren Eggeland-Zentrum. Vergabekonzept.
Verfügbar unter: https://www.bad-driburg.de/de-wAssets/docs/Wohnen/Vergabe-der-Grundstuecke-auf-dem-Areal-der-ehemaligen-Eggelandklinik/Uebergeordneter_Downloadbereich/2.Eggelandzentrum_Vergabekonzept_Teil-2.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Bad Driburg (2024)c: Bewerbermatrix. Verfügbar unter: https://www.bad-driburg.de/de-wAssets/docs/Wohnen/Vergabe-der-Grundstuecke-auf-dem-Areal-der-ehemaligen-Eggelandklinik/Uebergeordneter-
Downloadbereich/Ausschreibung-Konzeptvergabe_Folgenutzung- Eggelandklinik_Bewerbermatrix.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Bielefeld
Bielefeld (2024a): Leitfaden für Bielefelder Wohnprojekt-Initiativen. Verfügbar unter: https://bielefelder-netzwerk-wohnprojekte.de/leitfaden/#toggle-id-13 [abgerufen am 16.04.2024].
Bielefeld (2024b): Konzeptvergabe/Vergabe von Grundstücken. Verfügbar unter: https://www.bielefeld.de/node/24102 [abgerufen am 16.04.2024].
Bielefeld (2024c): Gemeinschaftliche Wohnformen. Verfügbar unter: https://www.bielefeld.de/gemeinschaftlich-wohnen [abgerufen am 16.04.2024].
Bielefeld (2022): Konzept „Gemeinschaftliches Wohnen“ als Handlungsempfehlung, u. a. für die Baulandstrategie. Verfügbar unter: https://anwendungen.bielefeld.de/bi/to0050.asp?__ktonr=210227 [abgerufen am 16.04.2024].
Bielefeld (2019): Grundsatzbeschluss. Verfügbar unter: https://anwendungen.bielefeld.de/bi/to0050.asp?__ktonr=168254 [abgerufen am 16.04.2024].
Westfalen-Blatt (2023): Hier sollen Bielefelder Wohnprojekte ein Zuhause finden.
Verfügbar unter: https://www.westfalen-blatt.de/owl/bielefeld/wohnprojekte-grundstueck-konzept-vergabe-amerkamp-2813099?pid=true [abgerufen am 16.04.2024].
Bochum
Bochum (2024a): Handlungskonzept Wohnen. Zusammenfassung. Verfügbar unter: https://www.bochum.de/C125830C0042AB74/vwContentByKey/W2BJYB4S738B_OCMDE/$FILE/Handlungskonzept_Wohnen_Bochum_2018.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Bochum (2024b): Allgemeine Hinweise des Liegenschaftsmanagement. Verfügbar unter: https://www.bochum.de/Amt-fuer-Geoinformation-Liegenschaften-und-Kataster/Liegenschaftsmanagement-Amt-fuer-Geoinformation-Liegenschaften-und-Kataster/Allgemeine-Hinweise-Liegenschaftsmanagement [abgerufen am 16.04.2024].
Bochum (2024c): Ostpark. Neue urbane Wohnquartiere im Grünen. Verfügbar unter: https://www.bochum.de/Amt-fuer-Stadtplanung-und-Wohnen/Ostpark [abgerufen am 16.04.2024].
Bochum (2024d): Bestgebotsverfahren für Investoren im Ostpark. Verfügbar unter: https://www.bochum.de/Amt-fuer-Geoinformation-Liegenschaften-und-Kataster/Aktuelle-Grundstuecksangebote/Ostpark-Bestgebotsverfahren-1 [abgerufen am 16.04.2024].
Bochum (2024e): Grundstück für Wohnprojektgruppen im Quartier Feldmark. Interessensbekundungsverfahren. Verfügbar unter: https://www.bochum.de/C125830C0042AB74/vwContentByKey/W2BNQGWQ62_9BOCMDE/$File/Interessenbekundungsverfahren.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Bochum (2024f): Anlage 6: Beschreibung des Vermarktungsverfahrens an gemeinschaftliche Wohnprojekte (Entwurf). Verfügbar unter: https://bochum.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZf_gIVugmSE9hhISxdSX-eYCb5BOjgIFLQr1_va0Ej5y/Anlage_6-__Vermarktungsverfahren_Wohnprojekte.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Bochum (2024g): Bestgebotsverfahren. Wasserstraße 444. Verfügbar unter: https://www.bochum.de/C125830C0042AB74/vwContentByKey/W2CUXGPX521B_OCMDE/$File/Exposee_Wasserstr_444_V2.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Bochum (2024h): Vorgang 20193187. Verfügbar unter: https://bochum.ratsinfomanagement.net/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExj_ZUy1BdznM5oc3z8m2ATbL80 [abgerufen am 16.04.2024].
Bochum (2024i): Bestgebotsverfahren Kronenstraße in Bochum. Verfügbar unter: https://www.kroneforum.de/wp-content/uploads/2021/05/2015-11-24_Bestgebotsverfahren-Kronenstrasse-in-Bochum.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Bochum (2024j): Bestgebotsverfahren Voedestraße in Bochum-Wattenscheid.
Verfügbar unter: https://competitionline-content.com/300xx/30093_Broschuere_Bestgebotsverfahren%20Voedestra%C3%9Fe.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Nattler Architekten BDA (2022): Voedestraße in Bochum-Watenscheid https://nattlerarchitekten.de/aktuelles/voedestrasse-arbeiten-auf-der-baustelle/ [abgerufen am 16.04.2024].
Westdeutsche Allgemeine Zeitung (2018): Wohnprojekt soll in ehemalige Schule Bertramstraße einziehen. Verfügbar unter: https://www.waz.de/staedte/wattenscheid/article215305851/wohnprojekt-soll-in-ehemalige-schule-bertramstrasse-einziehen.html [abgerufen am 16.04.2024].
Stiftung Trias (2022): Neues Leben in einer alten Schule. Bunter Block Bochum.
Portrait. Verfügbar unter: https://www.stiftung-trias.de/projekte/projektportraits/bochum-bunter-block/ [abgerufen am 16.04.2024].
Bonn
Bonn (2024a): Innovative Wohnformen. https://www.bonn.de/themen-entdecken/soziales-gesellschaft/innovative-wohnformen.php [abgerufen am 16.04.2024].
Bonn (2024b): Erbbaurecht: Informationen zu Baugrundstücken. Verfügbar unter: https://www.bonn.de/themen-entdecken/wirtschaft-wissenschaft/erbbaurecht-informationen-zu-baugrundstuecken.php [abgerufen am 16.04.2024].
Bonn (2024c): Vergabe von städtischen Grundstücken. Verfügbar unter: https://www.bonn.de/themen-entdecken/wirtschaft-wissenschaft/vergabe-von-staedtischen-grundstuecken.php [abgerufen am 16.04.2024].
Bonn (2024d): Wohn- und Wissenschaftspark Bonn/Sankt Augustin. Verfügbar unter: https://www.bonn.de/themen-entdecken/planen-bauen/wohn-und-wissenschaftspark-bonn-sankt-augustin.php [abgerufen am 16.04.2024].
Bonn (2023): Neue Grundlage für die städtische Liegenschaftspolitik beschlossen.
Verfügbar unter: https://www.bonn.de/pressemitteilungen/juni-2023/neue-grundlagen-fuer-die-staedtische-liegenschaftspolitik-beschlossen.php [abgerufen am 16.04.2024].
Bonn (2022): Wohnpark II: Generationengerechts und preiswertes Wohnen fördern.https://www.bonn.de/pressemitteilungen/august-2022/wohnpark-ii-generationengerechtes-und-preiswertes-wohnen-foerdern.php [abgerufen am 16.04.2024].
Bonn (o.J.): Anlage 1 Neue Richtlinie. Verfügbar unter: https://www.bonn.sitzung-online.de/public/vo020?0--attachments-expandedPanel-content-body-rows-1-cells-2-cell-link&VOLFDNR=2011484&refresh=false&TOLFDNR=2041913+ [abgerufen am 16.04.2024].
NRW.URBAN Service GmbH (2024): Grundstück kaufen. Verfügbar unter: https://wohngebiete-vilich-mueldorf.de/wohnpark-2/wp2-grundstueck-kaufen/[abgerufen am 16.04.2024].
General-Anzeiger (2023): Stadt wird eigene Grundstücke nicht mehr verkaufen.
Verfügar unter: https://ga.de/bonn/stadt-bonn/bonn-stadt-will-grundstuecke-nicht-mehr-verkaufen_aid-92312351 [abgerufen am 16.04.2024].
General-Anzeiger (2023): Interessengemeinschaft will in Vilich-Müldorf schnelere bebauung erzielen. Verfügbar unter: https://ga.de/bonn/beuel/interessengemeinschaft-will-in-vilich-mueldorf-schnellere-bebauung-erzielen_aid-92469149 [abgerufen am 16.04.2024].
Borken
Borkener Zeitung (2022). Butenstadt-Entwürfe sind im Farb zu sehen. Verfügbar unter: https://www.borkenerzeitung.de/lokales/borken/Butenstadt-Entwuerfe-sind-im-Farb-zu-sehen-430751.html [abgerufen am 16.04.2024].
WoltersPartner Architekten GmbH (2022): Konzeptvergabe „Butenstadt“ Stadt Borken. Verfügbar unter: https://www.wolterspartner.de/projekte/konzeptvergabe-butenstadt/ [abgerufen am 16.04.2024].
Bottrop
IKS Mobilitätsplanung & bläser jansen partner (2023): Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept Rathausviertel, Hansaviertel und westliche Innenstadt Bottrop. Verfügbar unter: https://www.bottrop.de/downloads/innestadtdialog-isek/202310_31_Rahmenisek.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Bottrop (2023): Beschlussvorlage. Verfügbar unter: https://ratsinfo-bottrop.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZc1ZeJ7VDTQF8tPjSkI2paq6kaXMfqnjP_haQOh4JIl3/Beschlussvorlage_2023-0315.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Castrop-Rauxel
Castrop-Rauxel (2024): Konzeptvergabe Schillerstraße. Verfügbar unter: https://www.castrop-rauxel.de/Inhalte/Wohnen_Wirtschaft/Stadtentwicklung/Konzeptvergabe.php [abgerufen am 16.04.2024].
Immobilienscout24 (2024): Konzeptvergabe „Schillerstraße“ in 44575 CastropRauxel. Verfügbar unter: https://www.immobilienscout24.de/expose/147739480#/ [abgerufen am 16.04.2024].
Coesfeld
Coesfeld (2022): Bewerbungsfrist für die Konzeptvergabe endet am 10. Oktober.
Verfügbar unter:
https://www.coesfeld.de/buergerservice/stadtinfo/presseservice/aktuelles/detaila_nsicht?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News_&tx_news_pi1%5Bnews%5D=7030&cHash=4273bdb9b04f53209381039ee7f08b65 [abgerufen am 16.04.2024].
Coesfeld (2024): Planungsrecht für das Innenstadt-projekt. Verfügbar unter: https://www.coesfeld.de/aktuelles/artikel?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=7744&cHash=bd0e13baf732fc0af1704bdc3b20b6bc [abgerufen am 16.04.2024].
MS Plus Architekten BDA (2023): Kapuzinerquartier Coesfeld. Verfügbar unter: https://msplus-architekten.de/kopie-von-wohnquartier-moldrickx [abgerufen am 16.04.2024].
Detmold
Detmold (2024): Konzeptwettbewerb Wolfgang-Hirth-Straße.
https://www.detmold.de/index.php?id=2454 [abgerufen am 16.04.2024].
Detmold (2022): Konzeptvergabe Wolfgang-Hirth-Straße | 2022_005. Verfügbar unter: https://vorhaben.detmold-mitgestalten.de/de/vorhaben/4733 [abgerufen am 16.04.2024].
Lippische Landes-Zeitung (2022): Neue Wohnungen in Detmold: Wettbewerb für Wolfgang-Hirth-Straße ausgeschrieben. Verfügbar unter:
https://www.lz.de/lippe/detmold/23435412_Neue-Wohnungen-in-Detmold-Wettbewerb-fuer-Wolfgang-Hirth-Strasse-ausgeschrieben.html [abgerufen am 16.04.2024].
Dortmund
Dortmund (2021): Investition in die Zukunft. Der Fachbereich Liegenschaften.
Verfügbar unter:
https://www.dortmund.de/dortmund/projekte/rathaus/verwaltung/liegenschaften/downloads/imagebroschuere_liegenschaftsamt_web.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Dortmund (2019): Beschlussvorlage Drucksache Nr.: 15267-19. Verfügbar unter: https://rathaus.dortmund.de/dosys/gremrech.nsf/0/54040F926D9E4864C125849C0047CDA2/$FILE/VorlageDS%2315267-19.doc.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Mieterverein Dortmund und Umgebung (2019): Erbbaurecht: Eine Frage des Bodens. Verfügbar unter: https://www.mieterverein-dortmund.de/news- detail.html?-&tx_ttnews%5Btt_news%5D=526&cHash=4577e37f052bc6b940a3045 ab37b0303 [abgerufen am 16.04.2024].
Braun, Ralf (2020): Alternatives Wohnprojekt für Wickede geplant. Verfügbar unter: https://www.lokalkompass.de/dortmund-ost/c-politik/alternatives-wohnprojekt- fuer-wickede-geplant_a1478309 [abgerufen am 16.04.2024].
Drensteinfurt
Drensteinfurt (2020): Stadt vermarktet Baugrundstücke im Baugebiet
„Mondscheinweg“. Verfügbar unter:
https://www.drensteinfurt.de/portal/meldungen/stadt-vermarktet- baugrundstuecke-im-baugebiet-mondscheinweg-900000083- 26830.html?rubrik=900000005 [abgerufen am 16.04.2024].
Drensteinfurt (2023): Baupätze im Baugebiet „Mondscheinweg“ verfügbar.
Verfügbar unter: https://www.drensteinfurt.de/portal/meldungen/bauplaetze-im- baugebiet-mondscheinweg-verfuegbar-900000616- 26830.html?rubrik=900000005 [abgerufen am 16.04.2024].
Westfälische Nachrichten (2020): Konzeptvergabe für Mehrfamilienhäuser. Soziales bekomtm mehr Gewicht. Verfügbar unter: https://www.wn.de/muensterland/kreis- warendorf/drensteinfurt/soziales-bekommt-mehr-gewicht-860209 [abgerufen am 16.04.2024].
Duisburg
Christoph Kohl Stadtplaner Architekten GmbH (2020): Duisburg-Huckingen.
Beginn der Arbeiten am ersten Bauabschnitt. Verfügbar unter: https://cksa.de/duisburg-huckingen-beginn-der-arbeiten/ [abgerufen am 16.04.2024].
GEBAG Duisburger Baugesellschaft (2019): Am Alten Angerbach. Konzeptvergabe entschieden. Verfügbar unter:
https://www.gebag.de/metamenu/presse/detail/am-alten-angerbach- konzeptvergabe-entschieden [abgerufen am 16.04.2024].
GEBAG Duisburger Baugesellschaft (2024): 10-Punkte-Vereinbarung. Verfügbar unter: https://www.6-seen-wedau.de/fuer-investoren/vermarktungsprinzip [abgerufen am 16.04.2024].
Düsseldorf
Düsseldorf (o.J.): Neue gemeinschaftliche Wohnformen. Leitfaden. Verfügbar unter:
https://www.duesseldorf.de/fileadmin/files/wohnen/pdf/broschuere_wohnformen _leitfaden.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Düsseldorf (2024a): Handlungsfeld Bodenpolitik aktiv mitgestalten. Verfügbar unter:
https://www.duesseldorf.de/stadtplanungsamt/baulandmodell/handlungsfeld- bodenpolitik [abgerufen am 16.04.2024].
Düsseldorf (2024b): Wohnprojekte und Initiativen in Düsseldorf. Verfügbar unter: https://www.duesseldorf.de/wohnen/wohnprojekte-in-duesseldorf [abgerufen am 16.04.2024].
Düsseldorf (2024c): Koordinierung Wohnen in Gemeinschaft - Neue Wohnformen.
Verfügbar unter: https://www.duesseldorf.de/wohnen/wohnberatung-angebote [abgerufen am 16.04.2024].
Düsseldorf (2024d): Liegenschaftsamt. Verfügbar unter: https://www.duesseldorf.de/liegenschaften [abgerufen am 16.04.2024].
Düsseldorf (2020a): Am Gansbruch, Düsseldorf Wersten. Anhandgabeverfahren.
Wohnbebauung durch Baugemeinschaft. Verfügbar unter:
https://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt80/liegenschaften/pdf/am_gansbruch/a m_gansbruch_verfahrensbeschreibung.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Düsseldorf (2020b): An der Eselfurt - Wohnbebauung durch
Baugemeinschaft.Konzeptbewerbung. Verfügbar unter:
https://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt80/liegenschaften/pdf/an_der_eselsfurt /verfahrensbeschreibung_an_der_eselsfurt_17022020.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Düsseldorf (o.J.): Regerstraße Wohnbebauung durch Baugemeinschaften.
Zweistufige Konzeptbewerbung. Verfügbar unter:
(https://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt65/liegenschaften/pdf/Regerstrasse/2 0240308_Regerstrasse_Baugemeinschaft_Verfahrenbeschreibung.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Rheinische Post (2022): Baugemeinschaft für Grundstück gesucht. Verfügbar unter: https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/duesseldorf-wersten-stadt-vergibt- grundstueck-an-baugemeinschaft_aid-66159897 [abgerufen am 16.04.2024].
Rheinische Post (2020): Stadt vergibt Baugrund an Gemeinschaften. Verfügbar unter: https://rp-
online.de/nrw/staedte/duesseldorf/stadtteile/wersten/duesseldorf-wersten-stadt- vergibt-baugrund-an-gemeinschaften_aid-51880517 [abgerufen am 16.04.2024].
Essen
Essen (2024): Erbbaurecht. So funktioniert ein Erbbaurecht. Verfügbar unter: https://www.essen.de/leben/planen_bauen_und_wohnen/essen_plant_und_baut_ /grundstuecke_und_quartiersentwicklung/immobilienangebote/erbbaurecht__info rmationen.de.html [abgerufen am 16.04.2024].
SPD Essen (o.J.): Ein wohnungspolitisches Leitbild für unsere Stadt - Die Kernanliegen der SPD Essen für die Stadtentwicklung. Verfügbar unter: https://www.spdessen.de/wp-content/uploads/sites/332/2022/08/2022-08- 25_Leitantrag_Wohnen.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Frechen
Vonester, Birgit (2019): Antrag zur Sitzung des Rat am 10.9.2019 hier: Konzeptvergabe von städtischen Grundstücken. Verfügbar unter: https://www.gruene-frechen.de/2019/08/27/antrag-zur-sitzung-des-rat-am-10-9- 2019-hier-konzeptvergabe-von-staedtischen-grundstuecken/ [abgerufen am 16.04.2024].
Geilenkirchen
SPD Geilenkirchen (2020): Betont rot. Weitergedacht für Gelsenkirchen. Verfügbar unter: https://www.spd-geilenkirchen.de/wp-
content/uploads/sites/219/2020/08/Betont_Rot._Weitergedacht_f__r_Geilenkirche n_Ausgabe_06-2020_.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Geldern
SPD Geldern (2020): Eine starke SPD: Für geldern schon immer gut.
Wahlprogramm zur Kommunalwahl 2020. Verfügbar unter: https://www.spd- geldern.de/wp-content/uploads/2020/08/Wahlprogramm-dd.-31.07.2020.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Gescher
Gescher (2022): Baufreigabe im Baugebiet Schultenrott ab 01.04.2022. verfügbar unter: https://www.gescher.de/portal/meldungen/baufreigabe-im-baugebiet- schultenrott-ab-01-04-2022-900000746-28140.html [abgerufen am 16.04.2024].
Grundstücksgesellschaft Gescher mbH (2022): Bewerbungsunterlagen Konzeptvergabe Mehrfamilienhausgrundstücke Plangebiet Schultenrott. Verfügbar unter: https://schultenrott.de/wp-content/uploads/2022/02/2022-02- 23_Bewerbung-Teil-1_Seite-1-5_Final.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Gummersbach
Gummersbach (2019): Ackermann-Areal: Quartier 3 steht zum Verkauf. Verfügbar unter: https://www.gummersbach.de/de/aktuelles/ackermann-areal-quartier-3- steht-zum-verkauf.html?=Konzeptvergabe [abgerufen am 16.04.2024].
Stadtimpuls Gummersbach (2020): FFI baut auf Ackermann-Areal. Verfügbar unter: https://www.stadtimpuls-gummersbach.de/stadtimpuls/aktuelles/artikel/ffi-baut- auf-ackermann-areal/ [abgerufen am 16.04.2024].
Hamm
Hamm (2020): Wohnbaulandinitiative Hamm Ergebnisdokumentation 2020.
Verfügbar unter:
https://www.hamm.de/fileadmin/user_upload/Medienarchiv_neu/Dokumente/Sta dtplanungsamt/Stadt_Region/Wohnbaulandinitiative_Hamm_Ergebnisdokumentat ion_2020.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Scheuvens + Wachten Plus (2019): Grundstücksverkauf Teilfläche Wilhelmstr. 19 in
Hamm. Verfügbar unter: https://www.scheuvens-
wachten.de/projekte/grundstuecksverkauf-teilflaeche-wilhelmstr-19-in-hamm [abgerufen am 16.04.2024].
Wettbewerbe aktuell (2024): Auschreibung. Verfügbar unter:
https://www.wettbewerbe-aktuell.de/ausschreibung/grundstucksverkauf- ritterstrasse-40-hamm-253503 [abgerufen am 16.04.2024].
Heiden
Heiden (2024): Konzeptverfahren - Quartiersentwicklung „an der Mühle“.
Verfügbar unter: https://www.heiden.de/portal/seiten/konzeptverfahren- quartiersentwicklung-an-der-muehle-900000127-28170.html [abgerufen am 16.04.2024].
L. Stroetman (2024): Heiden. Verfügbar unter: https://www.stroetmann.de/immobilien/projekt-heiden [abgerufen am 16.04.2024].
Hilden
Hilden (2018): Fortschreibung des Vermarktungskonzepts für die Mehrgenerationensiedlung: Vorschlag für eine Bewertungsmatrix für eine Konzeptvergabe. Verfügbar unter:
https://gi.hilden.de/bi/getfile.asp?id=60560&type=do [abgerufen am 16.04.2024].
Hilden (2018): TOP Ö 7: Mehrgenerationensiedlung auf dem Grundstück der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule: Fortschreibung des Vermarktungskonzepts.
Verfügbar unter: https://gi.hilden.de/bi/to0050.asp?__ktonr=27511 [abgerufen am 16.04.2024].
Rheinische Post (2020): Altes Schulland wird neues Wohngebiet. Verfügbar unter: https://rp-online.de/nrw/staedte/hilden/altes-schulgelaende-wird-zu-neuem-wohnquartier_aid-54513207 [abgerufen am 16.04.2024].
Hövelhof
Hövelhof (2023): Grundstücksvergaberichtlinie 2023. Verfügbar unter: https://www.hoevelhof.de/de/hoevelhof/bauen-und-wohnen/baugrundstuecke/Grundstuecksvergaberichtlinie-2023.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Hövelhof (2024): Beiträge zur Konzeptvergabe. Verfügbar unter:
https://www.hoevelhof.de/de/hoevelhof/bauen-und-wohnen/Erweiterung-Schlossgarten/konzeptvergabe.php [abgerufen am 16.04.2024].
Hövelhof (2022): Konzeptvergabe für eine teilfläche im bereich der Shclossachse. Sennegemeinde Hövelhof. Aufgabenstellung. Verfügbar unter:
https://www.hoevelhof.de/de/hoevelhof/bauen-und-wohnen/Erweiterung-Schlossgarten/Expos-_Konzeptvergabe-Hoevelhof_April-2022.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Westfalen-Blatt (2022): Drei Ideen für die Hövelhofer Schlossachse. Verfügbar unter: https://www.westfalen-blatt.de/owl/kreis-paderborn/hoevelhof/drei-ideen-fur-die-hovelhofer-schlossachse-2620693 [abgerufen am 16.04.2024].
Kaarst
Rheinische Post (2020): GWG baut geförderte Wohnungen. Verfügbar unter: https://rp-online.de/nrw/staedte/kaarst/kaarst-gwg-baut-gefoerderte-wohnungen-an-der-astrid-lindgren-strasse_aid-55258061 [abgerufen am 16.04.2024].
Oxen Architekten (2024): Spatenstich GWG Kaarst. Verfügbar unter:
https://www.oxen.de/projects/spatenstich-fuer-genossenschafts-wohnungen-an-astrid-lindgren-strasse/ [abgerufen am 16.04.2024].
Kerpen
Kerpen (2021): Öffentliche Bekanntmachung. Verfügbar unter: https://www.stadt-kerpen.de/media/custom/1708_15105_1.PDF?1626677640 [abgerufen am 16.04.2024].
Kevelaer
Kevelaer (2020): Konzeptvergabe Marktstraßenhäuser. Verfügbar unter: https://www.kevelaer.de/de/inhalt/konzeptvergabe-marktstrassenhaeuser-3697239/ [abgerufen am 16.04.2024].
Kevelaer (2022): Vorgaben zur Konzeptvergabe der Gebäude „Marktstraße 39-43).
Verfügbar unter: https://www.kevelaer.de/C1258258004C3A69/files/11_dokumentation_der_politischen_willensbildung.pdf/$file/11_dokumentation_der_politischen_willensbildung. pdf?OpenElement [abgerufen am 16.04.2024].
Kleve
Kleve (2022): Richtlinien für die Vergabe von städtischen Baugrundstücken an private Bewerber. Verfügbar unter: https://www.kleve.de/system/files/2023- 03/richtlinie_fuer_die_vergabe_von_staedtischen_baugrundstuecken.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Rheinische Post (2021): Zwei mögliche Investoren fürs Hallenbad. Verfügbar unter: https://rp-online.de/nrw/staedte/kleve/kleve-hauptausschuss-beraet-ueber-die-zwei-moeglichen-investoren-fuer-das-hallenbad_aid-59163771 [abgerufen am 16.04.2024].
Neue Rhein/Neue Ruhr Zeitung (2021): Kleve: Verkauf des alten Stadtbades steht an. Verfügbar unter: https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/article232466029/kleve-verkauf-des-alten-stadtbades-steht-an.html [abgerufen am 16.04.2024].
Köln
Köln (o.J.a): Muster. Konzeptvergabe - Bewertungsmatrix für das Grundstück.
Verfügbar unter: https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=572522&type=do [abgerufen am 16.04.2024].
Köln (o.J.b): Leitfaden zur Konzeptvergabe städtischer Grundstücke. Verfügbar unter: https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=572523&type=do [abgerufen am 16.04.2024].
Köln (2015): Stadtentwicklungskonzept Wohnen. Verfügbar unter: https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf15/stadtentwicklungskonzept_wohnen_2015.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Köln (2024a): Vermarktung unbebauter Grundstücke. Verfügbar unter: https://www.stadt-koeln.de/artikel/00777/index.html [abgerufen am 16.04.2024].
Köln (2024b): Soziales und Innovatives Wohnen. Verfügbar unter: https://www.stadt-koeln.de/service/produkt/innovative-neue-wohnformen [abgerufen am 16.04.2024].
Köln (2024c): Kooperatives Bauland Köln. Verfügbar unter: https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/stadtentwicklung/kooperatives-baulandmodell-koeln [abgerufen am 16.04.2024].
Kreuztal
Kreuztal (2021a): Konzeptverfahren. Neue Ortsmitte Buschhütten. Verfügbar unter: https://www.kreuztal.de/media/21124-expos_om_buschhtten.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Kreuztal (2021b): Rückfragen zum Konzeptverfahren OM Buschhütten. Verfügbar unter: https://www.kreuztal.de/media/21165-faq-om-buschhtten-ergnzung-23-9-2021.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Kreuztal (2024): Neue Ortsmitte Buschhütten. Verfügbar unter: https://www.kreuztal.de/leben-in-kreuztal/stadtplanung/neue-ortsmitte- buschhuetten/ [abgerufen am 16.04.2024].
Leichlingen
Leichlingen (2020): Stadt erwägt Wohnungen anstelle der „Parkpalette“. Verfügbar unter: https://rp-online.de/nrw/staedte/leichlingen/leichlingen-stadt-erwaegt-wohnungen-anstelle-der-parkpalette_aid-51556065 [abgerufen am 16.04.2024].
Lemgo
Lemgo (2018): Beschlussvorlage Baulandbeschluss. Verfügbar unter: https://www.lemgo.de/fileadmin/user_upload/Beschlussvorlage-Baulandbeschluss.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Lemgo (2018): Baulandbeschluss. Verfügbar unter: https://www.lemgo.de/bauen-umwelt/bauen-stadtplanung/wohnraumentwicklung [abgerufen am 16.04.2024].
Leverkusen
Leverkusen (2024): Infos Erbbaurecht. Verfügbar unter:
https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/bauen-und-wohnen/grundstuecke/infos-zum-erbbaurecht.php [abgerufen am 16.04.2024].
Neue Bahnstadt Opladen (2019): Experten besuchen die nsbo. Konzeptverfahren und Baukultur am Beispiel der Bahnstadt. Verfügbar unter: https://www.neue-bahnstadt-opladen.de/experten-besuchen-die-nbso-konzeptverfahren-und-baukultur-am-beispiel-der-bahnstadt/ [abgerufen am 16.04.2024].
BÜNDNIS/DIE GRÜNEN Leverkusen (2019): Antrag. Sozialer Wohnungsbau in Leverkusen muss gestärkt werden. Verfügbar unter: https://gruene- lev.de/volltext/-6e3fb21a88/ [abgerufen am 16.04.2024].
Lienen
Lienen (2022): Auslobungstext. Konzeptvergabe Mehrfamilienhaus-Bebauung im
Baugebiet “Nördlich Schwarzer Weg“. Verfügbar unter:
https://www.lienen.de/fileadmin/dateien/Dateien_nach_Jahren/2022/2022_06_20_Auslobungstext_Ratsbeschluss.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Lienen (2023): Pressemitteilung. Errichtung von Mehrfamilienhäusern im
Neubaugebiet „Nördlich Schwarzer Weg“ in Kattenvenne. Bürgerversammlung am 01.03.2023. Verfügbar unter:
https://www.lienen.de/fileadmin/dateien/Dateien_nach_Jahren/2023/PM_Buerger_versammlung.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Westfälische Nachrichten (2022a): Investor gefunden- Bezahlbare Mietwohnungen.
Verfügbar unter: https://www.wn.de/muensterland/kreis-steinfurt/tecklenburg/bezahlbare-mietwohnungen-2668545 [abgerufen am 16.04.2024].
Westfälische Nachrichten (2022b): Bürgerversammlung zur geplanten Errichtung von Mehrfamilienhäusern. Verfügbar unter:
https://www.wn.de/muensterland/lienen-kattenvenne-noerdlich-schwarzer-weg-mehrfamilienhaeuser-2713695 [abgerufen am 16.04.2024].
Lippstadt
Lippstadt (2022): Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK).
Verfügbar unter: https://www.qsa-lippstadt.de/wp-content/uploads/LP_QSA_ISEK_Entwurf_05-05-21.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Lotte
Lotte (2022): Vermarktungskonzept für das Baugebiet „Schafwinkel“ in der
Gemeinde Lotte. Verfügbar unter:
https://www.lotte.de/fileadmin/Dokumente/Ortsrecht/Bauverw/Schafwinkel_Baug_ebiet/2022_10_Vermarktungskonzept_Schafwinkel_Lotte.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Lotte (2023): Vermarktungskonzept 2. Auflage. Verfügbar unter:
https://www.lotte.de/fileadmin/Dokumente/Ortsrecht/Bauverw/Schafwinkel_Baug ebiet/2023_08_10_Vermarktungskonzept_Schafwinkel_Lotte_2.Auflage.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
NRW.URBAN (2022): Lotte: Kooperative Baulandentwicklung. Verfügbar unter: https://nrw-urban.de/projekte/lotte-kooperative-baulandentwicklung/ [abgerufen am 16.04.2024].
Beteiligung NRW (2023): Gemeinde Lotte - Baugebiet Schafwinkel: Konzeptvergabe für Mehrfamilienhäuser. Verfügbar unter:
https://beteiligung.nrw.de/portal/nrw-urban/beteiligung/themen/1002044 [abgerufen am 16.04.2024].
Marl
Marl (2023): Neue Wohnbebauung und neue Straßen für Marl. Verfügbar unter: https://marl.info/aktuelles/2023-12-04_neue_wohnbebauung_und_neue_strassen_fuer_marl [abgerufen am 16.04.2024].
Mechernich
Mechernich (2024): Wohngebiete und Bauland. Verfügbar unter:
https://www.mechernich.de/wirtschaft-und-bauen/wohngebiete-und-bauland [abgerufen am 16.04.2024].
Minden
Minden (2019): Memorandum des Bündnisses für Wohnen. Verfügbar unter: https://www.minden.de/dokumente/praesentationen-konzepte-berichte/memorandum-ohne-unterschriften.pdf?cid=dpp [abgerufen am 16.04.2024].
Schulten Stadt-und Raumentwicklung (2016): Handlungskonzept Wohnen Minden. Verfügbar unter: https://www.minden.de/dokumente/praesentationen-konzepte-berichte/enbericht-hkw-minden.pdf?cid=dpm [abgerufen am 16.04.2024].
Minden (2022): Sitzungsdrucksacke. Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen des Haupt-und Finanzausschusses. Verfügbar unter: https://minden.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZbz_MEaI4A7L7ptIvBLt1Zj7c68jEui91T3RQ2xdbtbY4/Allgemeine_Vorlage_218-2022_1._Ergaenzung.pdf#search=Rampenloch%20Rampenlochs%20Rampenloch areals [abgerufen am 16.04.2024].
Minden (2021): Detaillierte Planungen für das „Rampenloch“ vorgelegt. Verfügbar unter https://www.minden.de/aktuelles/pressearchiv/2021/januar/detaillierte-planungen-fuer-das-rampenloch-vorgelegt/ [abgerufen am 16.04.2024].
Minden (2020): Vorgang 265/2020. Verfügbar unter: https://minden.ratsinfomanagement.net/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExj ZZvAVOMsJinz8QgelY2ayU8 [abgerufen am 16.04.2024].
Minden (2020): Beschluss der Sitzung Ausschusses für Bauen, Umwelt, und
Verkehr. Verfügbar unter:
https://www.mt.de/_em_daten/_redweb_po_mtrelaunch/2020/07/26/200726_1708_93445240.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Hallo Minden (2018): Neuigkeit zum Baugebiet Dützen. Verfügbar unter: https://www.hallo-minden.de/nachrichten/neuigkeiten-zum-baugebiet-in-duetzen-29919.html [abgerufen am 16.04.2024].
Hallo Minden (2019): Bündnis für Wohnen: bedarfsgerechten Wohnraum in Minden schaffen verfügbar unter: https://www.hallo-minden.de/blog/immobilienundfinanzen/buendnis-fuer-wohnen-bedarfsgerechten-wohnraum-in-minden-schaffen-12086.html [abgerufen am 16.04.2024].
Mönchengladbach
Mönchengladbach (2024): Abteilung Bauleitplanung und Stadtgestaltung. REME-Gelände. Verfügbar unter:
https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/buergerinfo-a-z/planen-bauen-mobilitaet-umwelt-dezernat-vi/fachbereich-stadtentwicklung-und-planung-61/abteilung-bauleitplanung-und-stadtgestaltung/impulsprojekte-der-strategie-mg-wachsende-stadt/reme-gelaende [abgerufen am 16.04.2024].
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach (EWMG) (2024): REME-Gelände. Verfügbar unter: https://ewmg.de/projekte/reme-gelaende/ [abgerufen am 16.04.2024].
Mülheim
Mülheim (2019): Wollen Sie anders wohnen? Wie wäre es mit einem mehrgenerationen-Wohnprojekt? Verfügbar unter: https://www.muelheim-ruhr.de/cms/wollen_sie_anders_wohnen_wie_waere_es_mit_einem_mehrgenerati onen-wohnprojekt.html [abgerufen am 16.04.2024].
Münster
Münster (2024a): Bauen und Wohnen in Gemeinschaft. Projekte in Umsetzung.
Verfügbar unter: https://www.stadt-muenster.de/gemeinschaftliches-wohnen-in-muenster/projekte-in-umsetzung [abgerufen am 16.04.2024].
Münster (2024b): Immoblilienangebote. Konzeptverfahren der Stadt Münster.
Rumphorst.Verfügbar unter: https://www.stadt-muenster.de/immobilien/gw-rumphorst [abgerufen am 16.04.2024].
Münster (2010): Haus Coerde. Verfügbar unter: https://www.wbb-nrw.de/fileadmin/red_dateien/Download/Wohnprojekte-
Tage_NRW/12_wpt_material_vergabeverfahren_haus_coerde.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Münster (2024c): Handlungskonzept Wohnen. Verfügbar unter: https://www.stadt-muenster.de/stadtplanung/handlungskonzept-wohnen.html [abgerufen am 16.04.2024].
Münster (2024d): Sozialgerechte Bodennutzung. Verfügbar unter: https://www.stadt-
muenster.de/immobilien/wohnbaupotenzialflaechen/sozialgerechte-bodennutzung [abgerufen am 16.04.2024].
Münster (2024e): Bauen und Wohnen in Gemeinschaft. Grundstücke, Immobilien.
Verfügbar unter: https://www.stadt-muenster.de/wohnungsamt/bauen-und-wohnen-in-gemeinschaft/grundstuecke-immobilien [abgerufen am 16.04.2024].
Münster (2024f): Immobilienangebote. Verfügbar unter: https://www.stadt-muenster.de/immobilien/immobilienangebote [abgerufen am 16.04.2024].
Münster (2022): Grundsätze für die Vergabe städtischer Grundstücke.
Mehrfamilienhäuser, Gemeinschaftswohnformen. Verfügbar unter: https://www.stadt-muenster.de/fileadmin/user_upload/stadt-muenster/23_immobilien/pdf/Immobilienangebote/Mefa_05_2022.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Münster (2022): Gemeinschaftliches Wohnen. Konzeptvergaben und zukünftige
Standorte. Verfügbar unter: https://www.stadt-
muenster.de/fileadmin/user_upload/stadt-
muenster/23_immobilien/pdf/Immobilienangebote/Themenabend_Konzeptverga ben_23_0_22022.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Münster (2022): Gasometer Münster. Zweistufiges Konzeptvergabeverfahren.
Verfügbar unter: https://www.stadt-muenster.de/fileadmin/user_upload/stadt-muenster/61_stadtplanung/pdf/bauen/626_verfahrensschema_konzeptvergabe.p df [abgerufen am 16.04.2024].
Westfälische Nachrichten (2024): Fehlende Investoren: Bau von Wohnsiedlungen in Münster ausgebremst. Verfügbar unter: https://www.wn.de/muenster/muenster-konversion-kasernen-modellquartier-krise-2949666?pid=true [abgerufen am 16.04.2024].
Nettersheim
Nettersheim (2016): Immobilien-und Leerstandmanagement. Verfügbar unter: https://www.nettersheim.de/wohnen-gewerbe.html [abgerufen am 16.04.2024].
Neukirchen-Vluyn
Neukirchen-Vluyn (2024): Städtebauliche Projekte. Verfügbar unter: https://www.neukirchen-vluyn.de/wirtschaft-standort/flaechen-stadtentwicklung/staedtebauliche-projekte [abgerufen am 16.04.2024].
Neukirchen-Vluyn (2023): Großes Interesse am Neukirchener Ring. Verfügbar unter: https://www.neukirchen-vluyn.de/pressemeldungen/grosses-interesse-am-neukirchener-ring [abgerufen am 16.04.2024].
Neukirchen-Vluyn (2022): Wohnhäuser an der Drüenstraße werden saniert.
Verfügbar unter: https://www.neukirchen-
vluyn.de/pressemeldungen/wohnhaeuser-der-drueenstrasse-werden-saniert [abgerufen am 16.04.2024].
NRW.URBAN (2024): Neukirchen-Vluyn: nachhaltiges Wohnen im Zukunftsquartier „Auf der Blie“. Verfügbar unter: https://nrw-urban.de/projekte/neukirchen-vluyn-nachhaltiges-wohnen-im-zukunftsquartier-auf-der-blie/ [abgerufen am 16.04.2024].
Neue Rhein/Neue Ruhr Zeitung (2020): Attraktive Umgebung: Schöner wohnen in Neukirchen-Vluyn. Verfügbar unter: https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/article231003094/attraktive-umgebung-schoener-wohnen-in-neukirchen-vluyn.html [abgerufen am 16.04.2024].
Neuss
Neuss (2020): Beratungsunterlage. Verfügbar unter: https://www.o-sp.de/download/neuss/298253 [abgerufen am 16.04.2024].
Rheinische Post (2021): Neuss verkauft Grundstück unter Marktwert. Verfügbar unter: https://rp-online.de/nrw/staedte/neuss/neuss-verkauft-innenstadt-grundstueck-unter-marktwert_aid-61691059 [abgerufen am 16.04.2024].
Niederkrüchten
Plan-lokal (2019): Masterplan Wohnen für die Gemeinde Niederkrüchten.
Verfügbar unter: https://www.niederkruechten.de/system/files/2023-01/190425_Masterplan_Wohnen_kleines_Dateiformat_0.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Nottuln
Nottuln (2022): Beschlussvorlage. Verfügbar unter: https://www.nottuln.de/sessionnet/sessionnetbi/vo0050.php?__kvonr=200603262 4 [abgerufen am 16.04.2024].
Oelde
Oelde (2024): Der „rote Faden“ in der Stadtentwicklung. Verfügbar unter: https://www.oelde.de/de/rathaus/stadtentwicklung/entwicklungskonzepte/#accor dion-1-10 [abgerufen am 16.04.2024].
Oelde (2022): Handlungsleitfaden Wohnen. Verfügbar unter:
https://www.oelde.de/medien/rathaus/stadtentwicklung-konzepte/2022-02-21-handlungsleitfaden-wohnen-beschlossen.pdf?cid=1zgv [abgerufen am 16.04.2024].
Olsberg
Competionline (2019): Zweistufiges Konzeptverfahren mit anschließender Grundstücksveräußerung „Eine Neue Mitte im Quartier“. Verfügbar unter: https://www.competitionline.com/de/ausschreibungen/337181 [abgerufen am 16.04.2024].
Paderborn
Paderborn (2023): Alanbrooke Quartier. Bauen und Wohnen in Gemeinschaft.
Konzeptvergabe Baufeld 15. Verfügbar unter: https://www.paderborn.de/wohnen-soziales/bauen-wohnen/staedtische-grundstuecke.php.media/202968/Expos-_Baufeld-15_20220124_Final.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Paderborn (2024a): Alanbrooke Quartier. Verfügbar unter: https://paderborner-konversion.de/alanbrooke [abgerufen am 16.04.2024].
Paderorn (2024b): Alanbrooke Quartier -Aktuelle
Exposés.https://www.paderborn.de/wohnen-soziales/bauen-wohnen/staedtische-grundstuecke.php [abgerufen am 16.04.2024].
https://www.paderborn.de/wohnen-soziales/bauen-wohnen/vermarktungsrichtlinien.php
Baugruppe Helene Lange (2024): Website. Verfügbar unter: https://bg-helene-lange.de/ [abgerufen am 16.04.2024].
Petershagen
Complan Kommunalberatung (o.J.): Maßnahmensteckbriefe. Verfügbar unter: https://www.petershagen.de/media/custom/2703_1896_1.PDF?1591712505 [abgerufen am 16.04.2024].
Mindener Tageblatt (2020): Wohnen statt Fußball: Für die „neue Mitte“ könnte der Sportplatz verschwinden. Verfügbar unter:
https://www.mt.de/lokales/petershagen/Wohnen-statt-Fussball-Fuer-die-Neue-Mitte-koennte-der-Sportplatz-verschwinden-22879548.html [abgerufen am 16.04.2024].
Radevormwald
Radevormwald (2024a): Wohngebiet Karthausen. Verfügbar unter: http://wordpress-karthausen.p608774.webspaceconfig.de/ [abgerufen am 16.04.2024].
Radevormwald (2023): Offizieller Spatenstich für das Neubaugebiet Karthausen.
Verfügbar unter: https://www.radevormwald.de/offizieller-spatenstich-fuer-das-neubaugebiet-karthausen/ [abgerufen am 16.04.2024].
Rheinische Post (2019a): Baugebiet Karthausen könnte sich verzögern. Verfügbar unter: https://rp-online.de/nrw/staedte/radevormwald/radevormwald-erschliessung-des-baugebiets-karthausen-koennte-sich-verzoegern_aid-47401425 [abgerufen am 16.04.2024].
Rheinische Post (2019b): Karthause-Debatte über neue Wohnformen oder
Häuschen. Verfügbar unter: https://rp-
online.de/nrw/staedte/radevormwald/karthausen-debatte-neue-wohnformen-oder-haeuschen_aid-47489907 [abgerufen am 16.04.2024].
Remscheid
Remscheid (2024): Bauen am Schützenplatz in Lüttringhausen. Verfügbar unter:
https://www.remscheid.de/wirtschaft-
stadtentwickung/liegenschaften/4.13.2baugrundstueck-schuetzenplatz.php [abgerufen am 16.04.2024].
Westdeutsche Zeitung (2023): Neues Wohngebiet Eisernstein in Remscheid: Viele Bauherren sagen ab. Verfügbar unter: https://www.wz.de/nrw/remscheid/neues-wohngebiet-eisernstein-in-remscheid-viele-bauherren-sagen-ab_aid-88679635 [abgerufen am 16.04.2024].
Waterboelles. Kommunalpolitisches Forum für Remscheid (2022): Erschließung des Neubaugebiets ab 3. Quartal. Verfügbar unter:
https://www.waterboelles.de/archives/31202-Erschliessung-des-Neubaugebiets-ab-3.-Quartal.html [abgerufen am 16.04.2024].
FDRP Remscheid (2021): Vorausschauend nachhaltig gestalten.
Gestaltungsvereibarung zwischen Sozialdemokraten, Grünen und Freie Deokraten zur Zusammenarbeit in der 16. Wahlperiode des Rates der Stadt Remscheid.
Verfügbar unter: https://www.fdp-remscheid.de/wp-content/uploads/2021/02/20210215-Gestaltungsvereinbarung-PK.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Rheda-Wiedenbrück
Die Glocke (2022): Stadt will Baupreise in Rheda-Wiedenbrück einfangen.
Verfügbar unter: https://www.die-glocke.de/kreis-guetersloh/rheda-wiedenbrueck/artikel/richtlinie-sollen-baulandpreise-eindaemmen-1662737584?bo_pwl=1&cHash=7a5d8f1944718e38d6640cec487bd789 [abgerufen am 16.04.2024].
Westfalen-Blatt (2022): Planer nehmen am Moorweg in Rheda den Druck vom Kessel. Verfügbar unter: https://www.westfalen-blatt.de/owl/kreis-guetersloh/rheda-wiedenbrueck/planer-nehmen-am-moorweg-in-rheda-den-druck-vom-kessel-2654515 [abgerufen am 16.04.2024].
SPD Rheda-Wiedenbrück (2020): Wir kümmern uns -Wahlprogramm 2020.
Verfügbar unter: https://www.spd-rheda-wiedenbrueck.de/wahlprogramm-kommunahlwahl-2020/ [abgerufen am 16.04.2024].
Rheinbach
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (2024): Unser Programm für eine gute Zukunft.
Verfügbar unter: https://www.gruene-rheinbach.de/politische-ziele/politische-ziele [abgerufen am 16.04.2024].
Rheine
Rheine (2024): Konzeptvergabe Laugestraße. Verfügbar unter: https://www.rheine.de/stadtentwicklung-
wirtschaft/stadtentwicklung/7740.Konzeptvergabe-Laugestrasse.html [abgerufen am 16.04.2024].
Rheine (o.J.): Konzeptvergabe Laugestraße Auslobungstext. Verfügbar unter: https://www.rheine.de/media/www.rheine.de/org/med_733/13883_auslobungste xt_konzeptvergabe_laugestrasse.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Senden
Senden (2024a): Vergabeverfahren des Grundstücks „B2“ in Huxburg. Verfügbar unter: https://www.senden-westfalen.de/vergabeb2 [abgerufen am 16.04.2024].
Senden (2024b): Gemeinde Senden. Exposé zur Konzeptvergabe zur Vermarktung des baufelds B2 im Baugebiet „Huxburg“. Verfügbar unter: https://www.senden-westfalen.de/fileadmin/Dateien/Dateien/4_Wirtschaft_und_Bauen/Investorenausw ahlverfahren/Expose___Huxburg_B2.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Senden (2022): Beschluss des Exposés. Verfügbar unter: https://sessionnet.krz.de/gemeinde-senden/bi/vo0050.asp?__kvonr=3130 [abgerufen am 16.04.2024].
Siegburg
Quaestio Forschung & Beratung (2022): Wohnungspolitisches handlungskonzept für die Kreisstadt Siegburg. Verfügbar unter: https://cdu-
siegburg.de/download/Wohnungspolitisches_HK_Siegburg_April2022.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Siegburg (2024): Wohnungspolitisches Handlungskonzept. Verfügbar unter: https://siegburg.de/bauen-klima/planen-bauen/wohnungspolitisches-handlungskonzept/index.html [abgerufen am 16.04.2024].
Simmerath
BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN (2020): Grün ist heute das Morgen gestalten. Unser
Wahlprogram für Simmerath 2020. Verfügbar unter: https://www.gruene-simmerath.de/fileadmin/media/simmerath/Wahlprogramm_GRN_OV_SIM_2020__ 2_.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Solingen
InWIS Forschung & Beratung (2018): Handlungskonzept Wohnen Solingen.
Verfügbar unter: https://wohnbauoffensive-solingen.de/wp-content/uploads/Handlungskonzept-Wohnen-Solingen-1.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Sprockhövel
Schmidt Planung (2021): Konzeptausschreibung Mehrgenerationen Wohnen.
Verfügbar unter: https://www.schmidt-planung.de/wohnprojekte-1/sprockh%C3%B6vel/ [abgerufen am 16.04.2024].
Westdeutsche Zeitung (2020): Was passiert mit dem Grundstück der freiwilligen Feuerwehr? https://www.wz.de/nrw/sprockhoevel/was-passiert-mit-dem-grundstueck-der-freiwilligen-feuerwehr_aid-51473063 [abgerufen am 16.04.2024].
Steinhagen
Grüne Steinhagen (2024): Wohnen. Verfügbar unter: https://gruene-steinhagen.de/wohnen-attraktiver-gestalten/ [abgerufen am 16.04.2024].
SPD Steinhagen (2024): Wir gestalten Steinhagen. Verfügbar unter: https://www.spd-steinhagen.de/soziales/
Telgte
Telgte (2024): Ausschreibungen. Verfügbar unter:
https://www.telgte.de/portal/seiten/ausschreibungen-900000132-26900.html [abgerufen am 16.04.2024].
NRW.URBAN (2024): Telgte: Kooperative Baulandentwicklung. Verfügbar unter: https://nrw-urban.de/projekte/telgte-kooperative-baulandentwicklung/ [abgerufen am 16.04.2024].
Westfälische Nachrichten (2022): Investoren für Mehrfamilienhäuser gesucht.
Verfügbar unter: https://www.wn.de/muensterland/kreis-warendorf/telgte/investoren-fur-mehrfamilienhauser-gesucht-2523292 [abgerufen am 16.04.2024].
Tönisvorst
Rheinische Post (2021): Weg frei für besonderen Wohnkomplex in St. Tönis.
Verfügbar unter: https://rp-online.de/nrw/staedte/toenisvorst/weg-frei-fuer-mehrgenerationenwohnen-an-der-schelthofer-strasse-in-st-toenis_aid-64647647 [abgerufen am 16.04.2024].
Verl
Verl (2024): Weitere Konzepte. Verfügbar unter: https://www.verl.de/stadt-zukunft/stadtentwicklung/weitere-baukonzepte.html [abgerufen am 16.04.2024].
Verl (2022): Auslobungstext für die Konzeptvergabe für das grundstück des ehemaligen „Elli-markts“ in Kaunitz. Verfügbar unter:
https://www.verl.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Dateien/01_Service/14_Fo rmularservice/Auslobungstext_Fuerstenstrasse_7.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Verl (2023): Ehemaliger Elli-markt: Baukonzept gesucht. Verfügbar unter: https://www.verl.de/aktuelles/konzeptvergabe-fuer-das-grundstueck-des-ehemaligen-elli-marktes-in-kaunitz-startet.html [abgerufen am 16.04.2024].
Viersen
Viersen (2021): Handlungskonzept Wohnen Stadt Viersen: II. Aktualisierung der
Wohnraumbedarfsprognose. Verfügbar unter:
https://viersen.de/c125716c0029a475/files/aktualisierung_wohnraumbedarfsprog nose_institut_gewos_29_11_2021.pdf/$file/aktualisierung_wohnraumbedarfsprog nose_institut_gewos_29_11_2021.pdf?openelement [abgerufen am 16.04.2024].
StadtUmBau (2024): Aktuelles. April 2024. Verfügbar unter: https://stadtumbau-gmbh.de/aktuelles [abgerufen am 16.04.2024].
Voerde
Schulten Stadt-und Raumentwicklung (2019): Handlungskonzept Wohnen.
Verfügbar unter: https://ris.voerde.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZcqj-lECukW54mBifGmsGyYcLDKjoKi4PzEGhjJsAxQK/Handlungskonzept_Wohnen_Voerde.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Voerde (2024): Wohnquartier Pestalozzischule. Verfügbar unter:
https://www.voerde.de/C125729800344FE4/files/16ds0439_wohnquartier_pestalozzischule_komplett.pdf/$file/16ds0439_wohnquartier_pestalozzischule_komplett.pdf?OpenElement [abgerufen am 16.04.2024].
Goldstein und Tratnik Architekten GmbH (2024): Wettbewerbe. Verfügbar unter: https://www.goldstein-tratnik.de/index.php/projekte/wettbewerbe [abgerufen am 16.04.2024].
Neue Rhein/Neue Ruhr Zeitung (2016): Stadt Voerde wartet auf kaufangebote für Schulgelände. Verfügbar unter: https://www.nrz.de/staedte/dinslaken-huenxe-voerde/article12345027/stadt-voerde-wartet-auf-kaufangebote-fuer-schulgelaende.html [abgerufen am 16.04.2024].
SPD Voerde (2020): Pestalozzi Gelände -SPD Voerde nimmt Stellung zu den CDUIrrflügen. Verfügbar unter: https://www.spd-voerde.de/2020/06/04/pestalozzi-gelaende-spd-voerde-nimmt-stellung-zu-den-cdu-irrfluegen/ [abgerufen am 16.04.2024].
Wachtberg
Grüne Wachtberg (2020): Koalitionsvertrag 2020. Verfügbar unter: https://www.gruene-wachtberg.de/koalitionsvertrag-2020/ [abgerufen am 16.04.2024].
General-Anzeiger (2018): Bauhof soll Wohnhäusern weichen. Verfügbar unter: https://ga.de/region/voreifel-und-vorgebirge/wachtberg/bauhof-soll-wohnhaeusern-weichen_aid-43919963 [abgerufen am 16.04.2024].
Waltrop
InWis Forschung und Beratung (o.J.): Handlungskonzept Wohnen. Verfügbar unter: https://www.o-sp.de/waltrop/pdf/handlungskonzept_wohnen_waltrop.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Wenden
Beteiligung NRW (2024): Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Zukunftsquartier
Rothemühle -Wohnen“. Verfügbar unter:
https://beteiligung.nrw.de/portal/wenden/beteiligung/themen/1005087 [abgerufen am 16.04.2024].
Wenden (2024): Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Zukunftsquartier Rothemühle -Wohnen“. Verfügbar unter: https://www.gemeinde-wenden.de/Beteiligungen/Zukunftsquartier-Rothemuehle-Wohnen/ [abgerufen am 16.04.2024].
Westfalenpost (2022): Wenden: Zukunfsquartier“ auf dem Balcke-Dürr-Gelände.
Verfügbar unter: https://www.wp.de/staedte/kreis-olpe/wenden-zukunftsquartier-auf-balcke-duerr-gelaende-id234537983.html [abgerufen am 16.04.2024].
LokalPlus (2022): Ergebnis der Konzeptvergabe für Balcke-Dürr-Gelände steht fest.
Verfügbar unter: https://www.lokalplus.nrw/wenden/ergebnis-der-konzeptvergabe-fuer-balcke-duerr-gelaende-steht-fest-59422 [abgerufen am 16.04.2024].
Sauerlandkurier (2021): Gemeinderat beschließt Konzeptvergabe mit zweistufigem Verfahren für ehemaliges Balcke-Dürr-Gelände. Verfügbar unter: https://www.sauerlandkurier.de/kreis-olpe/wenden/gemeinderat-beschliesst-konzeptvergabe-mit-zweistufigem-verfahren-fuer-ehemaliges-balcke-duerr-gelaende-90823734.html [abgerufen am 16.04.2024].
CDU Wenden (2023): Zur Diskussion um die Vergabe des Geländes Balcke Dürr.
Verfügbar unter: https://cdu-wenden.de/zur-diskussion-um-die-vergabe-des-gelaendes-balcke-duerr/ [abgerufen am 16.04.2024].
Pyramis (2024): Leben. Arbeiten. Wohnen. Zukunftsquartier Rothemühle. Verfügbar unter: https://pyramis-gruppe.de/zukunftsquartier-rothemuehle/ [abgerufen am 16.04.2024].
Wermelskirchen
Wermelskirchen (2019): Mittel-bis langfristige Entwicklung der Stadt
Wermelskirchen. Verfügbar unter: https://freie-waehler-
wermelskirchen.de/3080/mittel-bis-langfristige-entwicklung-der-stadt-wermelskirchen/ [abgerufen am 16.04.2024].
Wiehl
Kölnische Rundschau (2021): Wiehl will sozialen und ökologischen Wohnungsbau fördern. Verfügbar unter: https://www.rundschau-online.de/region/oberberg/wiehl/per-konzeptvergabe-wiehl-will-sozialen-und-oekologischen-wohnungsbau-foerdern-152814 [abgerufen am 16.04.2024].
MUST Städtebau (o.J.): Dreifache Innenentwicklung. Reallabor Seequartier Wiehl.
Handlungsempfehlungen. Verfügbar unter: https://www.agglomerationsprogramm.de/fileadmin/agglomerationsprogramm/Entwicklungspfade/Mehrfache_Innenentwicklung/3FI_Raumdossier_Wiehl_DEF.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE (2022): Die Konzeptvergabe in der Stadtplanung.
Verfügbar unter: https://www.gruene-wiehl.de/konzeptvergabe/ [abgerufen am 16.04.2024].
Wilnsdorf
Wilnsdorf (2024): Schaffung Wohnraum für Werksangehörige im Baugebiet
Dutenbach. Verfügbar unter: https://www.gemeinde-wilnsdorf.de/wp-
content/uploads/2024/02/HFA_Vorlage_TOP_12.1_Stellungnahme-zur-Schaffung-Wohnraum-fuer-Werksangehoerige.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Winterberg
Winterberg (o.J.): Konzeptverfahren Zukunft „Hof Giersen“. Verfügbar unter: https://www.winterberg.de/fileadmin/winterberg/winterberg.de/Service___Kontak t/Stadtmarketing/Quartiersmanagement/Konzeptverfahren_Zukunft_Hof_Giersen_ __END_Kopie.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Winterberg (2023): Hof Giersen in Niedersfeld -Planungen für eine neue Dorfmitte mit hoher Aufenthaltsqualität vorgestellt. Verfügbar unter: https://www.presse-service.de/data.aspx/static/1126733.html [abgerufen am 16.04.2024].
Witten Witten (2018): Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt Witten.
Verfügbar unter: https://www.mitten-witten.de/wp-content/uploads/2022/09/ISEK_Innenstadt_Witten_2018_web.pdf [abgerufen am 16.04.2024].
Xanten
Xanten (o.J.): Konzeptvergabe für insgesamt zwei mehrfamilienhausgrundstücke in Xanten-Vynen. Verfügbar unter: https://www.xanten.de/c12570f8004e8139/files/konzeptvergabe_mehrfamilienhaeuser_vynen_stand_03.05.pdf/$file/konzeptvergabe_mehrfamilienhaeuser_vynen_stand_03.05.pdf? [abgerufen am 16.04.2024].
Rheinische Post (2022a): Politik berät über Verkaufsbedingungen für Fläche im Lüttinger Feld. Verfügbar unter: https://rp-online.de/nrw/staedte/xanten/bauen-in-xanten-politik-legt-verkaufsbedingungen-fuer-flaeche-im-luettinger-feld-fest_aid-80266687 [abgerufen am 16.04.2024].
Rheinische Post (2022b): Investor für 11.087 Quadratmeter gesucht. Verfügbar unter: https://rp-online.de/nrw/staedte/xanten/xanten-investor-fuer-11087-quadratmeter-gesucht_aid-70749977 [abgerufen am 16.04.2024].
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Forschungsgegenstand der Arbeit "gemeinschaftliche Wohnprojekte durch Konzeptvergabe. Eine Bestandsaufnahme der Konzeptvergaben in NRW."?
Der zentrale Forschungsgegenstand sind Konzeptvergaben im Rahmen einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung und als Instrument zur Umsetzung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten in Nordrhein-Westfalen (NRW).
Welche Hauptforschungsfrage wird in der Arbeit behandelt?
Die Hauptforschungsfrage lautet: "Welche Kommunen in NRW haben bereits Erfahrung mit Konzeptvergaben und gemeinschaftlichen Wohnprojekten gemacht?"
Welche Unterfragen werden gestellt?
Die Unterfragen sind:
- Welche Schwerpunkte werden bei der Vergabe gesetzt und auf welcher Grundlage finden Konzeptvergaben statt?
- Wie werden gemeinschaftliche Wohnprojekte in das Verfahren einbezogen?
Wie werden gemeinschaftliche Wohnprojekte definiert?
Gemeinschaftliche Wohnprojekte umfassen eine Personengruppe, “die freiwillig und bewusst bestimmte Bereiche ihres Lebens räumlich und zeitlich miteinander teilen.“, also gemeinschaftlich wohnen möchte (Schader Stiftung: 2024). Diese Gruppe schließt sich möglichst dauerhaft zusammen und erarbeitet gemeinsam eine Vorstellung von ihrem zukünftigen Zusammenleben.
Was ist eine Konzeptvergabe?
Die Konzeptvergabe ist eine Verfahrensart, bei der die Kommune das Grundstück an die Interessenten veräußert, die das beste Konzept vorlegen. Der angebotene Preis spielt, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle und steht damit konträr zum Höchstpreisverfahren.
Was bedeutet "gemeinwohlorientiert" im Kontext dieser Arbeit?
Gemeinwohlorientiert bedeutet, dass eine gute Stadtentwicklungspolitik in der Lage ist, gesamtgesellschaftliche und private Interessen in Einklang zu bringen und die öffentliche Daseinsvorsorge für alle sicher, bezahlbar und inklusiv zu gewährleisten.
Warum wird Nordrhein-Westfalen (NRW) als Untersuchungsgebiet gewählt?
NRW ist mit 18,1 Millionen Menschen das einwohnerstärkste Bundesland Deutschlands und steht unter enormem Druck bezüglich einer angemessenen Daseinsvorsorge. Es gibt wachsende Ballungsräume und Städte gegenüber schrumpfenden, strukturschwachen Regionen, was sich auch innerhalb des Bundeslands NRW beobachten lässt.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Es wird eine strukturierte webbasierte Datenerhebung durchgeführt, die in Tabellenform festgehalten wird. Die Datenerhebung folgt den Prinzipien einer “Desk Research”, oder auch Desktop Recherche, im Rahmen einer Sekundäranalyse.
Was ist das Ziel der Bestandsaufnahme?
Das Ziel ist, einen Überblick darüber zu geben, welche Kommunen in Nordrhein-Westfalen (NRW) das Instrument Konzeptvergabe bereits durchführen und inwiefern gemeinschaftliche Wohnprojekte ein Teil dieses Verfahrens sind.
Welche Kommunen in NRW haben Erfahrung mit Konzeptvergaben?
51 von den 396 Kommunen in NRW haben bereits Erfahrung mit Konzeptvergaben gemacht. Eine Liste mit Namen der Kommunen ist im Dokument enthalten.
Welche Kommunen in NRW planen, das Instrument Konzeptvergabe einzusetzen?
10 Kommunen planen, das Instrument Konzeptvergabe einzusetzen.
Was ist die häufigste Vergabeart, die von den Kommunen genutzt wird?
15 Kommunen vergeben rein nach Konzeptqualität und 15 nach einer Kombination von Konzept und Preisangebot.
Welche Nutzungen werden bei den Konzeptvergaben angestrebt?
Es wird hauptsächlich zwischen Mischnutzung, Wohnnutzung, Gewerbenutzung und soziale Infrastruktur unterschieden.
Welche Rolle spielt eine Strategie oder ein Konzept für Konzeptvergaben in den Kommunen?
In 13 Kommunen werden Konzeptvergaben auf Grundlage einer weitreichenden Strategie angewandt, wie z.B. Handlungskonzepte für den Bereich Wohnen oder Integrierte Stadtentwicklungskonzepte (ISEK).
Wie werden gemeinschaftliche Wohnprojekte in die Konzeptvergaben einbezogen?
Von den 51 Städten mit Konzeptvergabe haben 19 in ihrer Ausschreibung oder Kriterien gemeinschaftliche Wohnformen angesprochen.
Welche Kommunen haben eine Beratungsstelle für gemeinschaftliche Wohnprojekte und führen Konzeptvergaben durch?
Aachen, Bielefeld, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Münster.
Was sind die zentralen Herausforderungen für gemeinschaftliche Wohnprojekte?
Die zentralen Herausforderungen sind Selbstorganisation, Partizipation, und Finanzierung/Förderung, insbesondere steigende Bodenpreise, steigende Baukosten und der Wegfall der KfW Förderung.
Wie können Kommunen gemeinschaftliche Wohnprojekte durch Konzeptvergabe fördern?
Durch Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Bereitstellung von Grundstücken, sowie Festlegung von Bewertungskriterien, die auf Nutzung, Gestaltung, Ökologie und Klimaschutz abzielen. Es ist auch wichtig, Vorgaben bezüglich des Anteils öffentlich geförderter oder preisgedämpfter Wohnungen zu machen.
Details
- Titel
- Gemeinschaftliche Wohnprojekte durch Konzeptvergabe. Eine Bestandsaufnahme aller Konzeptvergaben in NRW
- Hochschule
- Technische Universität Dortmund (Fakultät Raumplanung)
- Note
- 1,6
- Autor
- Carmen Mühle (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2024
- Seiten
- 100
- Katalognummer
- V1503165
- ISBN (Buch)
- 9783389070802
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- gemeinschafltiche Wohnprojekte Wohnen Boden Baulandmodell Konzeptvergabe Kommune Grundstücksvergabe
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 39,99
- Arbeit zitieren
- Carmen Mühle (Autor:in), 2024, Gemeinschaftliche Wohnprojekte durch Konzeptvergabe. Eine Bestandsaufnahme aller Konzeptvergaben in NRW, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1503165
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-