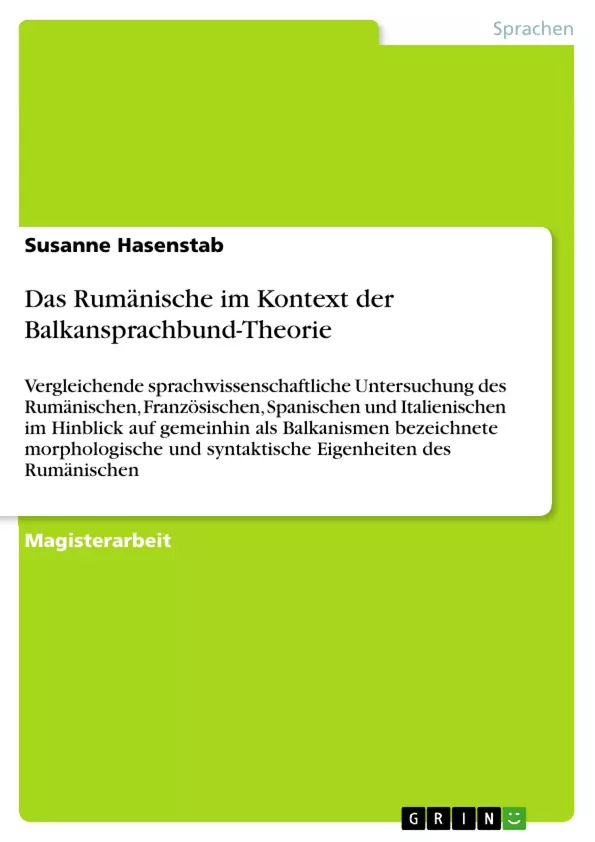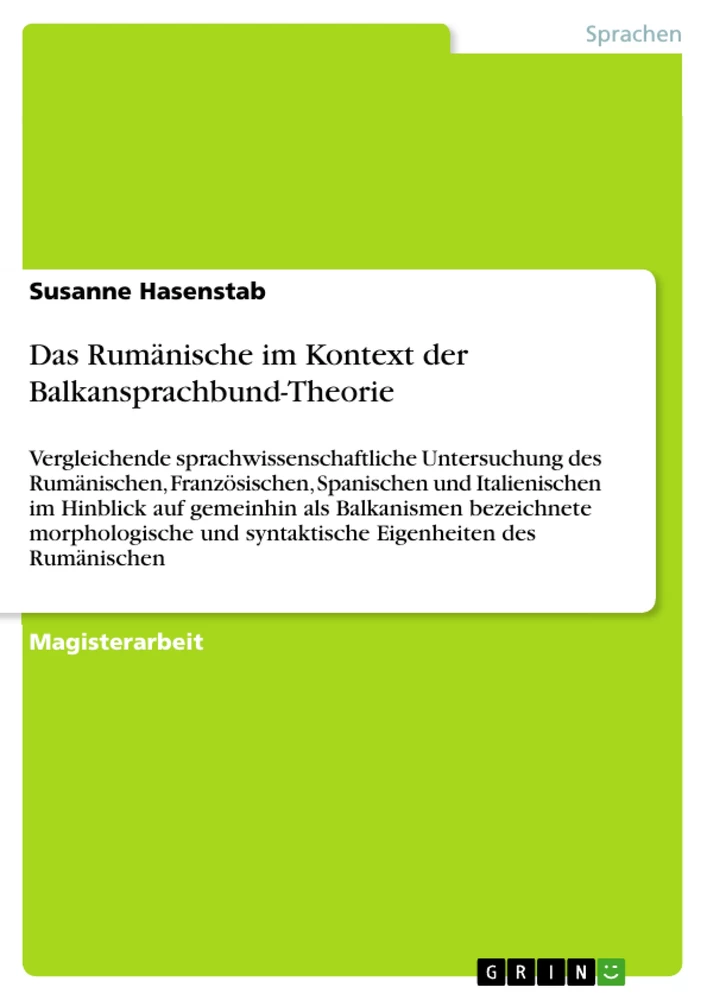
Das Rumänische im Kontext der Balkansprachbund-Theorie
Magisterarbeit, 2010
107 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Die Sonderstellung des Rumänischen innerhalb der Romania
- 2. Die rumänische Sprache und der Balkansprachbund
- 2.1 Begriffsdefinitionen
- 2.2 Die Balkansprachbund-Theorie und ihre Entwicklung
- 2.3 Rumänisch eine romanische Sprache als Mitglied des Balkansprachbunds
- 3. Vergleichende sprachwissenschaftliche Untersuchung: Balkanische Strukturen des Rumänischen in Morphologie und Syntax und die Äquivalenz entsprechender Strukturen im Französischen, Spanischen und Italienischen
- 3.1 Der nachgestellte bestimmte Artikel
- 3.2 Zusammenfall von Genitiv und Dativ
- 3.3 Die analytische Komparation
- 3.4 Das Zahlsystem von 11 bis 19
- 3.5 Eingeschränkter Infinitivgebrauch
- 3.6 Analytische Bildung des Futurs mit dem Hilfsverb „wollen“
- 3.7 Verdopplung des Objekts
- 3.8 Verwendung von Personalpronomen in der Funktion von Possessivpronomen
- 4. Zwischenfazit
- 5. Zur Bedeutung der Balkansprachbund-Theorie in Bezug auf die untersuchten morphologischen und syntaktischen Phänomene
- 5.1 Das Vorhandensein entsprechender Strukturen auch in anderen romanischen Sprachen oder Dialekten
- 5.2 Uneinigkeit der Forschung über die Ursprünge vieler Balkanismen
- 5.3 Der Einfluss des Lateins auf dem Balkan
- 5.4 Jahrhundertelanger Sprachkontakt zwischen den Balkansprachen
- 6. Schlussfolgerung: Berücksichtigung der lateinischen Wurzeln des Rumänischen bei der Betrachtung seiner balkanischen Strukturen
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sonderstellung des Rumänischen innerhalb der romanischen Sprachen im Kontext der Balkansprachbund-Theorie. Ziel ist es, vergleichend sprachwissenschaftliche Aspekte der Morphologie und Syntax des Rumänischen mit Französisch, Spanisch und Italienisch zu analysieren, um die sogenannten „Balkanismen“ zu identifizieren und deren Ursprung zu beleuchten.
- Die Sonderstellung des Rumänischen innerhalb der Romania
- Der Einfluss des Balkansprachbunds auf das Rumänische
- Vergleichende Analyse morphologischer und syntaktischer Strukturen
- Untersuchung der Ursprünge der „Balkanismen“
- Bedeutung des Sprachkontakts auf dem Balkan
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Sonderstellung des Rumänischen innerhalb der Romania: Die Einleitung stellt die besondere Position des Rumänischen innerhalb der romanischen Sprachfamilie heraus. Obwohl seine Ursprünge im Vulgärlatein liegen und es seinen romanischen Charakter bewahrt hat, unterscheidet es sich in grammatischen und lexikalischen Aspekten von anderen romanischen Sprachen. Diese Besonderheit resultiert aus der geographischen Isolation des rumänischen Sprachraums, der von nicht-romanischen Sprachen umgeben ist. Die Arbeit fokussiert auf die Untersuchung der „Balkanismen“ im Rumänischen im Kontext des Balkansprachbunds.
2. Die rumänische Sprache und der Balkansprachbund: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie „Sprachbund“, „Balkansprachen“ und „Balkansprachbund“, besonders im Hinblick auf die Arbeit von Schaller und seine Unterscheidung von „primären Balkanismen“. Es beleuchtet die Entwicklung der Balkansprachbund-Theorie, von frühen Forschungen bis zu den Beiträgen von Trubetzkoy und Sandfeld, inklusive der anhaltenden Diskussionen um den Begriff und die Einordnung des Rumänischen. Der Schwerpunkt liegt auf der Einordnung des Rumänischen als romanische Sprache innerhalb des Balkansprachbundes und die damit verbundenen sprachlichen Besonderheiten.
3. Vergleichende sprachwissenschaftliche Untersuchung: Balkanische Strukturen des Rumänischen in Morphologie und Syntax und die Äquivalenz entsprechender Strukturen im Französischen, Spanischen und Italienischen: Dieser zentrale Teil der Arbeit vergleicht spezifische morphologische und syntaktische Strukturen des Rumänischen (z.B. den nachgestellten bestimmten Artikel, den Zusammenfall von Genitiv und Dativ, die analytische Komparation, das Zahlsystem von 11-19, den eingeschränkten Infinitivgebrauch, die analytische Futurbildung mit „wollen“, die Objektdoppelierung und die Verwendung von Personalpronomen als Possessivpronomen) mit den entsprechenden Strukturen in Französisch, Spanisch und Italienisch. Es werden mögliche Erklärungen für die balkanischen Eigenheiten des Rumänischen diskutiert und deren Herkunft beleuchtet, unter Berücksichtigung möglicher Einflüsse aus anderen Balkansprachen.
4. Zwischenfazit: Dieses Kapitel bietet eine zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse der vergleichenden sprachwissenschaftlichen Untersuchung. Es fasst die wichtigsten Erkenntnisse zu den analysierten „Balkanismen“ zusammen und bereitet den Weg zur abschließenden Diskussion.
5. Zur Bedeutung der Balkansprachbund-Theorie in Bezug auf die untersuchten morphologischen und syntaktischen Phänomene: Das Kapitel diskutiert die Bedeutung der Balkansprachbund-Theorie im Lichte der Ergebnisse. Es thematisiert die Uneinigkeit in der Forschung über die Ursprünge von Balkanismen, die Problematik der Rekonstruktion früherer Sprachzustände und die Rolle des Lateins und des Griechischen als potenzielle Einflussfaktoren. Die langjährigen Sprachkontakte auf dem Balkan und deren Auswirkungen auf die syntaktischen Gemeinsamkeiten der Balkansprachen, inklusive des rumänisch-slawischen Sprachkontakts und der Bedeutung der Transhumanz werden beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Sonderstellung des Rumänischen innerhalb der Romania und der Balkansprachbund
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die besondere Stellung des Rumänischen innerhalb der romanischen Sprachen. Sie konzentriert sich auf den Einfluss des Balkansprachbundes auf das Rumänische, indem sie morphologische und syntaktische Strukturen des Rumänischen mit denen des Französischen, Spanischen und Italienischen vergleicht.
Welche Aspekte des Rumänischen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert spezifische morphologische und syntaktische „Balkanismen“ im Rumänischen. Dazu gehören der nachgestellte bestimmte Artikel, der Zusammenfall von Genitiv und Dativ, die analytische Komparation, das Zahlsystem von 11 bis 19, der eingeschränkte Infinitivgebrauch, die analytische Futurbildung mit „wollen“, die Objektdoppelierung und die Verwendung von Personalpronomen als Possessivpronomen.
Wie wird die Untersuchung durchgeführt?
Die Untersuchung erfolgt durch einen vergleichenden sprachwissenschaftlichen Ansatz. Die genannten rumänischen Strukturen werden mit den entsprechenden Strukturen im Französischen, Spanischen und Italienischen verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und den Ursprung der „Balkanismen“ zu erforschen.
Welche Sprachen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das Rumänische mit dem Französischen, Spanischen und Italienischen.
Was ist der Balkansprachbund?
Der Balkansprachbund beschreibt ein Areal sprachlicher Gemeinsamkeiten, die sich in verschiedenen, nicht verwandten Sprachen des Balkans finden. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Balkansprachbund-Theorie und deren Relevanz für das Rumänische.
Welche Rolle spielt das Lateinische?
Die Arbeit berücksichtigt die lateinischen Wurzeln des Rumänischen und untersucht, wie diese mit den balkanischen Einflüssen interagieren.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über den Ursprung der „Balkanismen“ im Rumänischen und diskutiert die Bedeutung des Sprachkontakts auf dem Balkan für die Entwicklung der rumänischen Sprache. Sie beleuchtet die Uneinigkeit in der Forschung über die Ursprünge von Balkanismen und die Rolle des Lateins und des Griechischen als potenzielle Einflussfaktoren.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Rumänisch und Balkansprachbund, Vergleichende sprachwissenschaftliche Untersuchung, Zwischenfazit, Bedeutung der Balkansprachbund-Theorie, Schlussfolgerung und Zusammenfassung. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt des Themas, beginnend mit der Einführung des Problems und endend mit einer umfassenden Zusammenfassung der Ergebnisse.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen morphologischen und syntaktischen Merkmalen?
Detaillierte Informationen zu den einzelnen morphologischen und syntaktischen Merkmalen finden sich im Kapitel 3 ("Vergleichende sprachwissenschaftliche Untersuchung"). Dieses Kapitel analysiert die im Rumänischen gefundenen Balkanismen im Detail und vergleicht sie mit den entsprechenden Strukturen in Französisch, Spanisch und Italienisch.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die zentralen Punkte und Ergebnisse jedes Kapitels prägnant zusammenfasst.
Details
- Titel
- Das Rumänische im Kontext der Balkansprachbund-Theorie
- Untertitel
- Vergleichende sprachwissenschaftliche Untersuchung des Rumänischen, Französischen, Spanischen und Italienischen im Hinblick auf gemeinhin als Balkanismen bezeichnete morphologische und syntaktische Eigenheiten des Rumänischen
- Hochschule
- Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
- Note
- 1,0
- Autor
- Susanne Hasenstab (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 107
- Katalognummer
- V150998
- ISBN (eBook)
- 9783640630189
- ISBN (Buch)
- 9783640630509
- Dateigröße
- 933 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Rumänisch Italienisch Spanisch Französisch Balkan Sprachbund Sprachvergleich Balkansprachbund Magisterarbeit Sprachwissenschaft Vergleich Morphologie Syntax Verdoplung des Objekts bestimmter Artikel Sprachkontakt Bulgarisch Albanisch Serbokroatisch Griechisch Mazedonisch Zahlsystem Vulgärlatein Zusammenfall von Genitiv und Dativ Futur Infinitivgebrauch
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Susanne Hasenstab (Autor:in), 2010, Das Rumänische im Kontext der Balkansprachbund-Theorie, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/150998
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-