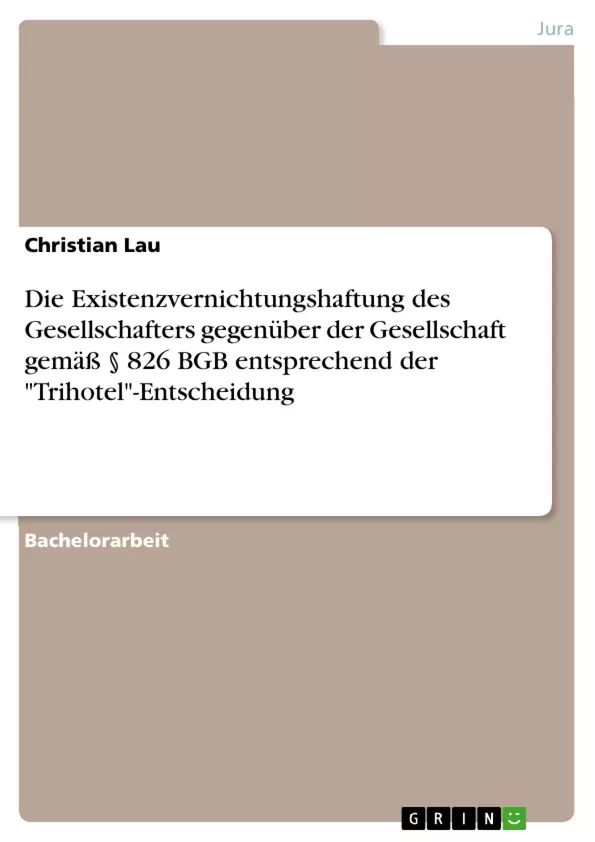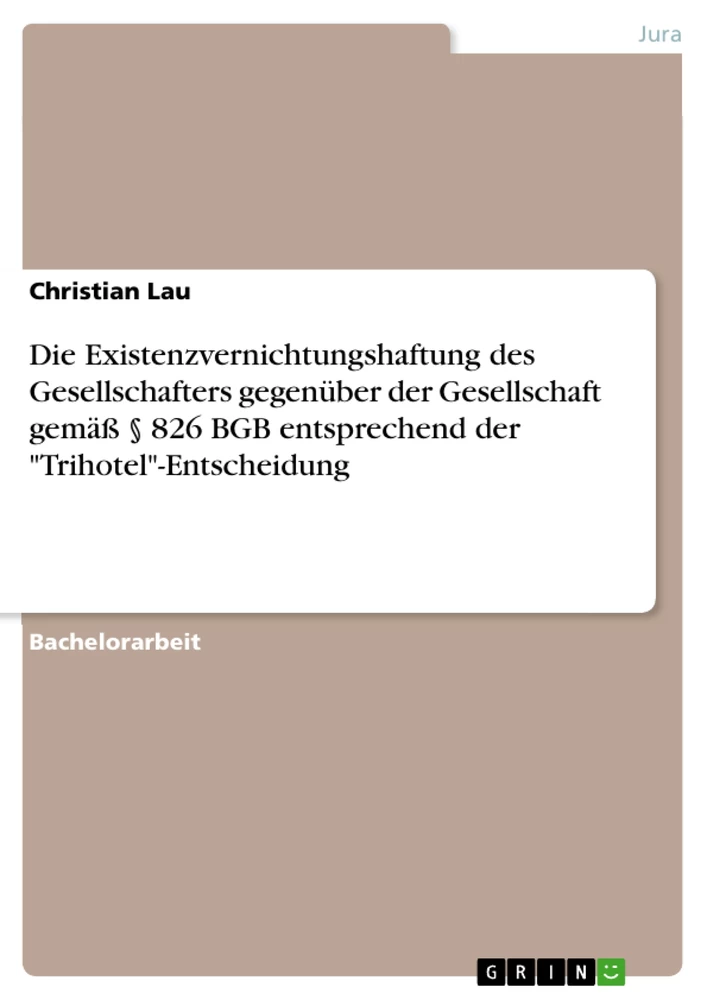
Die Existenzvernichtungshaftung des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft gemäß § 826 BGB entsprechend der "Trihotel"-Entscheidung
Bachelorarbeit, 2009
55 Seiten, Note: 2,0
Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- A. EINLEITUNG.
- B. WANDEL DER EXISTENZVERNICHTUNGSHAFTUNG IN DER RECHTSPRECHUNG.
- I. VON DER HAFTUNG IM QUALIFIZIERT FAKTischen KonzerN ZUR DURCHGRIFFSHAFTUNG WEGEN EXISTENZVERNICHTUNG......
- II. VON DER DURCHGRIFFSHAFTUNG wegen ExistENZVERNICHTUNG ZUR EXISTENZVERNICHTUNGSHAFTUNG GEMÄẞ § 826 BGB.
- III. DIE EXISTENZVERNICHTUNGSHAFTUNG ALS DELIKTISCHE INNENHAFTUNG GEMÄẞ § 826 BGB
- C. DIE EXISTENZVERNICHTUNGSHAFTUNG GEMÄẞ § 826 BGB ENTSPRECHEND DER „TRIHOTEL“-ENTSCHEIDUNG.
- I. SACHVERHALT „Trihotel“
- II. ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE DES BGH
- III. RECHTSGRUNDLAGE
- IV. TATBESTANDSMERKMALE DER EXISTENZVERNICHTUNGSHAFTUNG ALS FALLGRUPPE DES § 826 BGB
- 1. Sittenwidrigkeit.
- 2. Vorsatz........
- 3. Schaden.....
- V. VERHÄLTNIS ZU §§ 30, 31 GMBHG.
- VI. RECHTSFOLGEN
- 1. Anspruchsgegner..
- 2. Anspruchsinhaber.
- 3. Darlegungs- und Beweislast.
- VII. ABGRENZUNG
- D. KONSEQUENZEN FÜR DIE ATTRAKTIVITÄT DER RECHTSFORM GMBH ...........
- I. ATTRAKTIVITÄT FÜR GESELLSCHAFTSGLÄUBIGER..
- II. ATTRAKTIVITÄT FÜR GESELLSCHAFTER
- III. ÜBERTRAGUNG AUF ANDERE RECHTSFORMEN.
- E. FAZIT
- ANHANG...
- 1. GRÜNDUNG DER A-GMBH (1991)..
- 2. VORRATSGESELLSCHAFT J-GMBH (1996).
- 3. VORRATSGESELLSCHAFT W-GMBH (1998) ...
- LITERATURVERZEICHNIS.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Existenzvernichtungshaftung des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft gemäß § 826 BGB, insbesondere im Kontext der „Trihotel“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH). Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Rechtsprechung zur Existenzvernichtungshaftung und untersucht die dogmatischen Grundlagen der Haftung im Deliktsrecht.
- Die Entwicklung der Rechtsprechung zur Existenzvernichtungshaftung von der Haftung im faktischen Konzern zur Durchgriffshaftung und schließlich zur deliktischen Haftung gemäß § 826 BGB.
- Die „Trihotel“-Entscheidung des BGH als wegweisendes Urteil zur Existenzvernichtungshaftung.
- Die Tatbestandsmerkmale der Existenzvernichtungshaftung gemäß § 826 BGB, insbesondere Sittenwidrigkeit, Vorsatz und Schaden.
- Die Rechtsfolgen der Existenzvernichtungshaftung, einschließlich der Anspruchsinhaber, Anspruchsgegner und der Darlegungs- und Beweislast.
- Die Auswirkungen der Existenzvernichtungshaftung auf die Attraktivität der Rechtsform GmbH für Gesellschaftsgläubiger und Gesellschafter.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Existenzvernichtungshaftung in der GmbH ein und erläutert die Problematik des Kapitalerhaltungsschutzes gemäß §§ 30, 31 GmbHG. Sie stellt die „Trihotel“-Entscheidung des BGH als Ausgangspunkt der Arbeit vor und beleuchtet die Bedeutung des Trennungsprinzips zwischen Gesellschaft und Gesellschafter.
Kapitel B beleuchtet die Entwicklung der Rechtsprechung zur Existenzvernichtungshaftung. Es werden die verschiedenen Phasen der Haftung, von der Haftung im faktischen Konzern über die Durchgriffshaftung bis hin zur deliktischen Haftung gemäß § 826 BGB, dargestellt. Die Arbeit analysiert die Gründe für die Veränderung der Rechtsprechung und die damit verbundenen dogmatischen Herausforderungen.
Kapitel C widmet sich der „Trihotel“-Entscheidung des BGH. Es werden der Sachverhalt des Falles, die Entscheidungsgründe des BGH und die Rechtsgrundlage der Existenzvernichtungshaftung gemäß § 826 BGB erläutert. Die Arbeit untersucht die Tatbestandsmerkmale der Haftung, insbesondere die Sittenwidrigkeit, den Vorsatz und den Schaden.
Kapitel D analysiert die Folgen der Existenzvernichtungshaftung für die Attraktivität der Rechtsform GmbH. Es werden die Auswirkungen der Haftung auf die Interessen von Gesellschaftsgläubigern und Gesellschaftern untersucht. Die Arbeit beleuchtet die Frage, ob die Existenzvernichtungshaftung die GmbH als Rechtsform für Unternehmen weniger attraktiv macht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Existenzvernichtungshaftung, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), das Trennungsprinzip, § 826 BGB, die „Trihotel“-Entscheidung, die Durchgriffshaftung, der Kapitalerhaltungsschutz, die §§ 30, 31 GmbHG, die Attraktivität der Rechtsform GmbH, der Gläubigerschutz und die Interessen von Gesellschaftern.
Details
- Titel
- Die Existenzvernichtungshaftung des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft gemäß § 826 BGB entsprechend der "Trihotel"-Entscheidung
- Hochschule
- Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg
- Note
- 2,0
- Autor
- Christian Lau (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 55
- Katalognummer
- V152600
- ISBN (Buch)
- 9783640649501
- ISBN (eBook)
- 9783640649815
- Dateigröße
- 715 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Haftung des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft (GmbH)
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 30,99
- Arbeit zitieren
- Christian Lau (Autor:in), 2009, Die Existenzvernichtungshaftung des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft gemäß § 826 BGB entsprechend der "Trihotel"-Entscheidung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/152600
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-