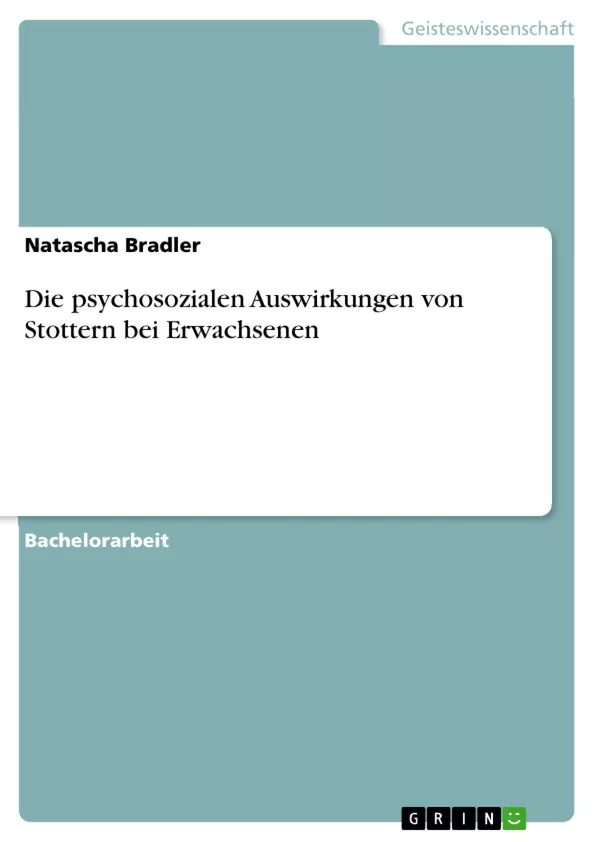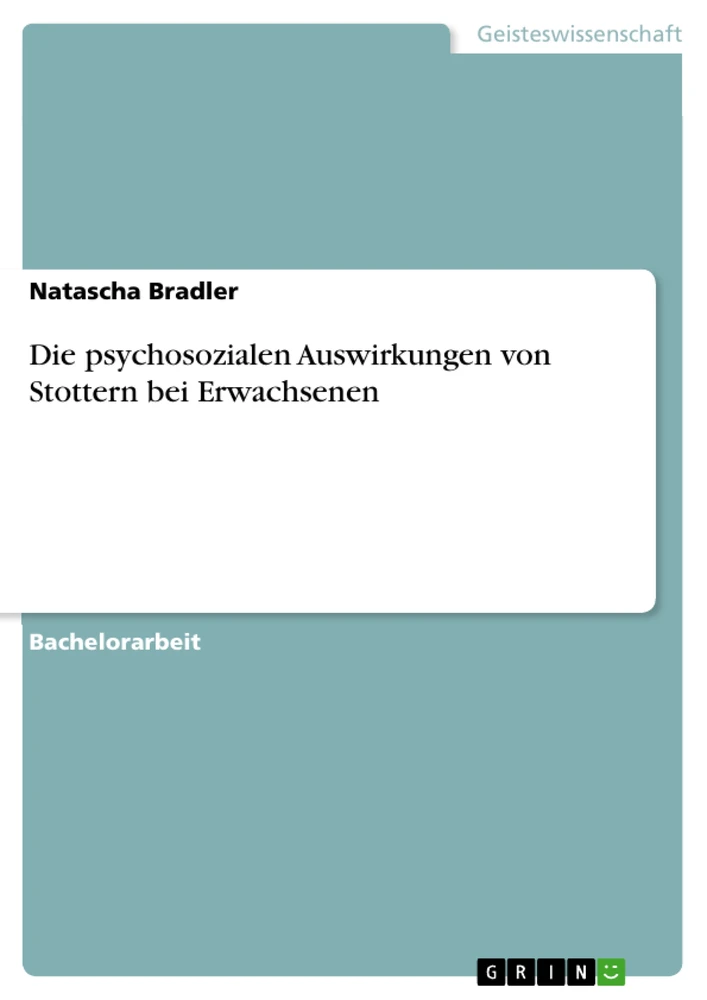
Die psychosozialen Auswirkungen von Stottern bei Erwachsenen
Bachelorarbeit, 2010
39 Seiten, Note: Sehr gut
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen zum Thema Stottern
- Ätiologie des Stotterns
- Die Symptome des Stotterns
- Der Entstehungsmechanismus von Stottern
- Therapiemethoden bei Erwachsenen
- Sozialpsychologische Aspekte des Stotterns
- Stottern - ein dialogisches Problem
- Stottern aus Sicht Sprachgesunder
- Stottern aus Sicht chronisch Stotternder
- Methode
- Die Online-Befragung
- EESE – Erfassung der Erfahrungen von stotternden Erwachsenen
- Was untersucht der EESE?
- Wozu wurde der EESE entwickelt?
- Wie wird der EESE durchgeführt und ausgewertet?
- Welche Abschnitte hat der EESE?
- Ergebnisse
- Allgemeine Informationen
- Reaktionen auf das Stottern
- Kommunikation in täglichen Situationen
- Lebensqualität
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die psychosozialen Auswirkungen von Stottern bei Erwachsenen. Sie zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Erfahrungen und Herausforderungen stotternder Menschen zu entwickeln, um logopädische Interventionen zu optimieren und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.
- Wahrnehmung der Stottersymptomatik durch stotternde Erwachsene
- Reaktionen auf Stottern in verschiedenen Lebensbereichen
- Kommunikationsprobleme im Alltag
- Auswirkungen von Stottern auf die Lebensqualität
- Die Bedeutung einer ganzheitlichen Therapieansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Stottern ein und stellt die Forschungsfrage der Arbeit dar. Das erste Kapitel befasst sich mit den Grundlagen des Stotterns, einschließlich der Ätiologie, Symptome und des Entstehungsmechanismus. Kapitel 2 beleuchtet die sozialpsychologischen Aspekte des Stotterns und untersucht die Erfahrungen von stotternden Personen sowie die Perspektiven sprachgesunder Menschen. In Kapitel 3 wird die Methode der Online-Befragung mit dem EESE-Fragebogen beschrieben, um die Erfahrungen stotternder Erwachsenen zu erfassen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in Kapitel 4 präsentiert, wobei die Reaktionen auf Stottern, Kommunikationsprobleme im Alltag und die Lebensqualität der Betroffenen analysiert werden. Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse der Arbeit und zeigt die Relevanz der Erkenntnisse für die logopädische Praxis.
Schlüsselwörter
Stottern, Redeflussstörung, psychosoziale Auswirkungen, Lebensqualität, Kommunikationsprobleme, EESE, Logopädie, ganzheitliche Therapie.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Stottern die Lebensqualität von Erwachsenen?
Stottern wirkt sich individuell stark aus und kann zu erheblichen Belastungen in sozialen Interaktionen, im Berufsleben und im allgemeinen Wohlbefinden führen.
Was ist das EESE-Instrument?
EESE steht für „Erfassung der Erfahrungen von stotternden Erwachsenen“. Es ist ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung der Symptomatik und der psychosozialen Folgen.
Welche Kommunikationsprobleme treten im Alltag häufig auf?
Betroffene berichten oft von Schwierigkeiten in täglichen Gesprächssituationen, negativen Reaktionen der Umwelt und daraus resultierenden Vermeidungsstrategien.
Warum ist eine ganzheitliche Therapie beim Stottern wichtig?
Da Stottern ein komplexes Krankheitsbild ist, muss die Therapie nicht nur die Sprechtechnik, sondern auch die psychischen und sozialen Auswirkungen einbeziehen.
Unterscheiden sich die Reaktionen auf Stottern zwischen den Betroffenen?
Ja, die Untersuchung zeigt, dass jeder Erwachsene seine persönliche Stotterproblematik hat und in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedlich stark belastet ist.
Details
- Titel
- Die psychosozialen Auswirkungen von Stottern bei Erwachsenen
- Hochschule
- FH Joanneum Graz (Studiengang Logopädie)
- Veranstaltung
- Redeflussstörungen
- Note
- Sehr gut
- Autor
- Natascha Bradler (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 39
- Katalognummer
- V153297
- ISBN (eBook)
- 9783640655618
- ISBN (Buch)
- 9783640656028
- Dateigröße
- 640 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Stottern psychosoziale Auswirkungen Lebensqualität EESE
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Natascha Bradler (Autor:in), 2010, Die psychosozialen Auswirkungen von Stottern bei Erwachsenen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/153297
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-