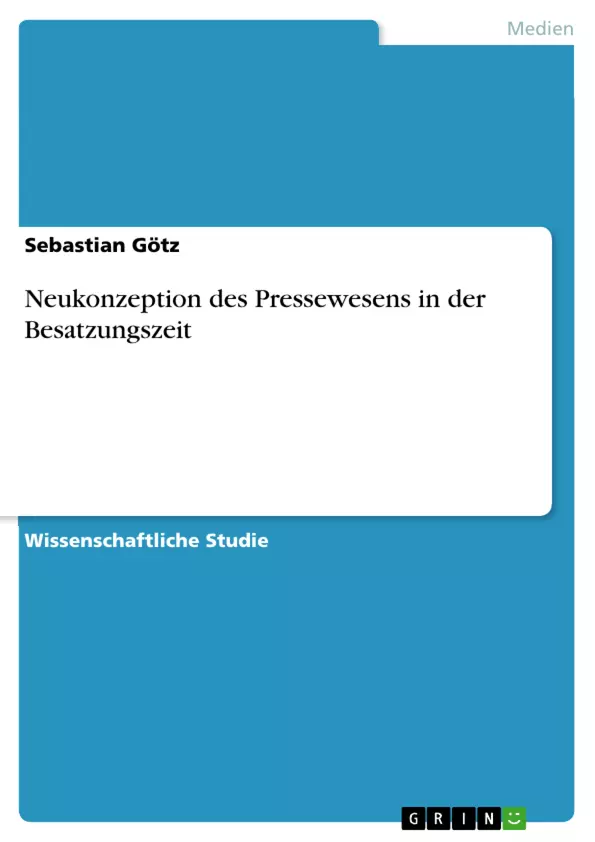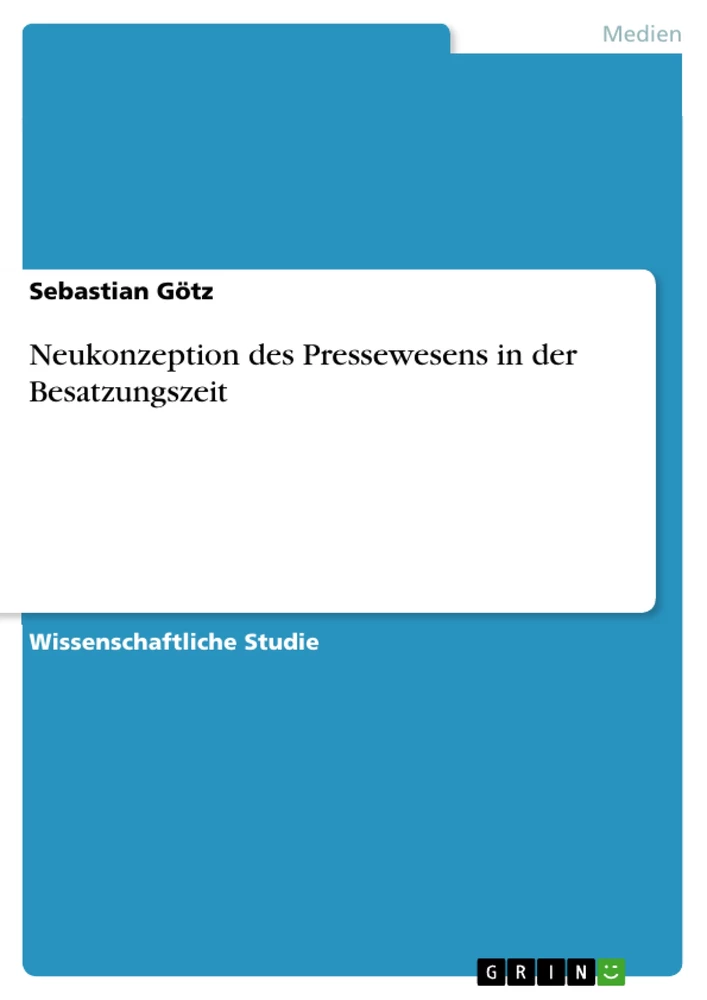
Neukonzeption des Pressewesens in der Besatzungszeit
Wissenschaftliche Studie, 2010
19 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Alliierte Planungen vor Kriegsende
- Re-Education Konzept der Briten und Amerikaner
- Französische Nachkriegsplanung
- Sowjetische Nachkriegsplanung
- Presseentwicklung in Deutschland unter alliierter Kontrolle
- Die Anfänge der Besatzungspresse
- Die Lizenzphase
- Lizenzphase im amerikanischen Sektor
- Lizenzphase im britischen Sektor
- Lizenzphase im französischen Sektor
- Lizenzphase im sowjetischen Sektor
- Übergabe der Presse in deutsche Hände
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Neugestaltung des deutschen Pressewesens während der Besatzungszeit. Sie untersucht die Hintergründe der Alliierten Intervention, die Ziele und die Umsetzung der Pressepolitik in den verschiedenen Besatzungszonen. Insbesondere die Lizenzphase und die spätere Übergabe der Presse in deutsche Hände stehen im Fokus.
- Alliierte Pressepolitik in den verschiedenen Besatzungszonen
- Re-Education und Demokratisierung als Zielsetzung der Alliierten
- Einführung neuer Printmedien und deren Einfluss auf die deutsche Presselandschaft
- Die Lizenzphase als Übergangsphase zur Übergabe der Presse an deutsche Kontrolle
- Die Herausforderungen der deutschen Presse in der Besatzungszeit und die Entwicklung hin zu einem eigenständigen Pressewesen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die Neustrukturierung des deutschen Pressewesens nach dem Zweiten Weltkrieg und zeigt die Bedeutung der Presse für die Umerziehung und Demokratisierung Deutschlands auf.
- Alliierte Planungen vor Kriegsende: Die Arbeit untersucht die gemeinsame Pressepolitik der Alliierten, insbesondere das Re-Education-Konzept der Briten und Amerikaner und die Rolle der Psychological Warfare Division (PWD). Außerdem wird die mangelnde Planung der französischen Militärregierung beleuchtet.
- Presseentwicklung in Deutschland unter alliierter Kontrolle: Der Abschnitt beschreibt die Einführung der Besatzungspresse, die Lizenzphase in den verschiedenen Sektoren und die Herausforderungen für die deutsche Presse in der Besatzungszeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der deutschen Pressegeschichte, insbesondere der Neugestaltung des Pressewesens in der Besatzungszeit. Schlüsselbegriffe sind: Re-Education, Demokratisierung, Besatzungspresse, Lizenzphase, Zonenzeitungen, Entnazifizierung, Propaganda, Objektivität, Pressefreiheit.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde die deutsche Presse nach 1945 neu gestaltet?
Die Besatzungsmächte schafften die Propagandapresse ab und führten ein Lizenzsystem ein, um ein demokratisches Pressewesen nach ihren Vorstellungen aufzubauen.
Was war das Ziel der "Re-Education"?
Die Presse sollte als Mittel zur Umerziehung der Deutschen dienen, um sie von nationalsozialistischen Ideologien zu lösen und demokratische Werte zu vermitteln.
Was unterschied die Besatzungszonen bei der Lizenzvergabe?
Die USA setzten früh auf überparteiliche Zeitungen, während in der britischen Zone eher Parteizeitungen lizenziert wurden. In der sowjetischen Zone stand die ideologische Ausrichtung im Vordergrund.
Was war die Lizenzphase?
In dieser Phase durften Zeitungen nur mit ausdrücklicher Genehmigung (Lizenz) der Militärregierung erscheinen. Die Lizenzträger wurden streng auf ihre politische Vergangenheit geprüft.
Wann wurde die Presse wieder in deutsche Hände übergeben?
Die Übergabe erfolgte schrittweise bis zur Gründung der Bundesrepublik 1949, wobei viele der damals gegründeten Zeitungen bis heute existieren.
Details
- Titel
- Neukonzeption des Pressewesens in der Besatzungszeit
- Hochschule
- Universität Passau
- Note
- 1,0
- Autor
- Sebastian Götz (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 19
- Katalognummer
- V153838
- ISBN (Buch)
- 9783640659975
- ISBN (eBook)
- 9783640660049
- Dateigröße
- 740 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Presse Besatzungszeit Deutschland 1945 1949 Presewesen Neukonzeption Reeducation Zeitung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 14,99
- Preis (Book)
- US$ 17,99
- Arbeit zitieren
- Sebastian Götz (Autor:in), 2010, Neukonzeption des Pressewesens in der Besatzungszeit, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/153838
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-