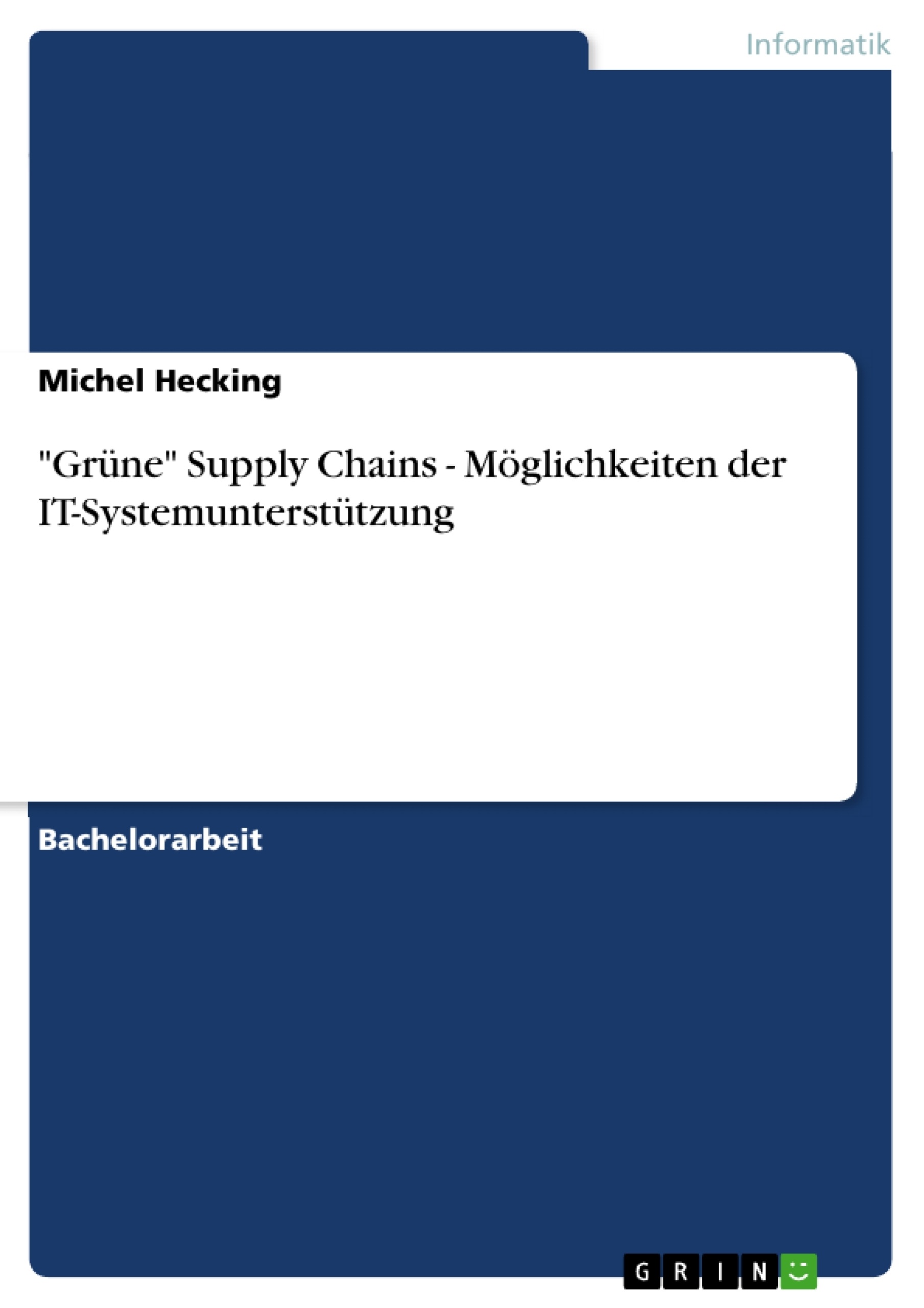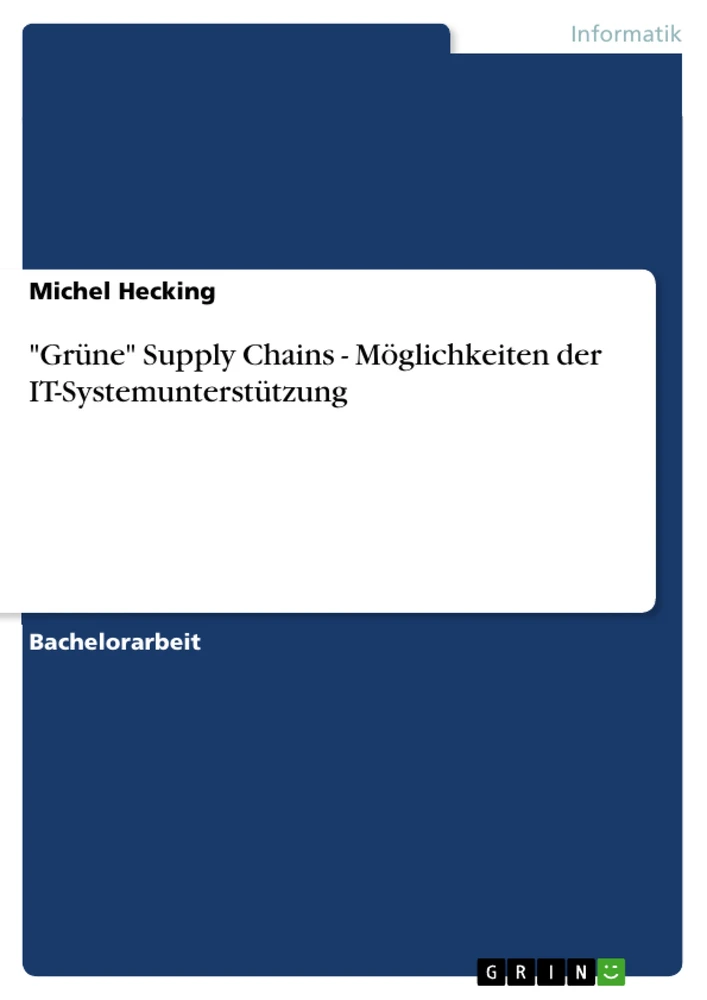
"Grüne" Supply Chains - Möglichkeiten der IT-Systemunterstützung
Bachelorarbeit, 2010
56 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- IT-Systeme als Basis einer ökologischen Logistik
- Ökologische Logistik
- Definition
- Ökologische Auswirkungen der Logistik auf die Umwelt
- Externe Kosten als Folge ökologischer Auswirkungen der Logistik auf die Umwelt
- Maßnahmen zum Erreichen einer ökologischen Logistik
- IT-Systeme für eine ökologische Logistik
- Anforderungen an eine IT-Systemunterstützung
- Systemklassifikation
- Transportplanung
- Anforderungen
- IT-System Beispiel: Map&Guide
- Lagerplanung
- Anforderungen
- IT-System Beispiel: viad@t
- Produktionsplanung
- Anforderungen
- IT-System Beispiel: Simapro
- Verpackungsplanung
- Anforderungen
- IT-System Beispiel: UNIT
- Netzwerkplanung
- Anforderungen
- IT-System Beispiel: 4flow vista
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Rolle von IT-Systemen in der ökologischen Logistik. Ziel ist es, die Möglichkeiten der IT-Systemunterstützung im Kontext „grüner“ Supply Chains zu analysieren und aufzuzeigen, wie IT-Systeme zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit in der Logistik beitragen können.
- Definition und Bedeutung der ökologischen Logistik
- Ökologische Auswirkungen der Logistik auf die Umwelt
- Anforderungen an IT-Systeme für eine ökologische Logistik
- Beispiele für IT-Systeme zur Unterstützung der Transport-, Lager-, Produktions-, Verpackungs- und Netzwerkplanung
- Bewertung des Potenzials von IT-Systemen für eine nachhaltige Logistik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 behandelt die grundlegende Rolle von IT-Systemen in der ökologischen Logistik. Es wird die Notwendigkeit und Bedeutung von IT-Systemen für eine nachhaltige Supply Chain betont.
Kapitel 2 analysiert die ökologische Logistik im Detail. Die Definition der ökologischen Logistik, die ökologischen Auswirkungen der Logistik auf die Umwelt und die externen Kosten werden untersucht.
Kapitel 3 fokussiert sich auf die IT-Systeme, die zur Unterstützung einer ökologischen Logistik eingesetzt werden können. Es werden Anforderungen an die IT-Systeme gestellt und verschiedene Systemkategorien vorgestellt. Darüber hinaus werden konkrete Beispiele für IT-Systeme in den Bereichen Transportplanung, Lagerplanung, Produktionsplanung, Verpackungsplanung und Netzwerkplanung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Ökologische Logistik, IT-Systeme, Supply Chain Management, Nachhaltigkeit, Umweltaspekte, Transportplanung, Lagerplanung, Produktionsplanung, Verpackungsplanung, Netzwerkplanung, Softwarewerkzeuge, Emissionsreduktion, Ressourceneffizienz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer „grünen“ Supply Chain?
Ziel ist die Minimierung ökologischer Einflüsse wie CO2-Ausstoß, Energieverbrauch und Abfall entlang der gesamten Lieferkette.
Wie unterstützen IT-Systeme die ökologische Logistik?
Sie schaffen Transparenz durch die Erfassung von Emissionsdaten und ermöglichen die Planung sowie Optimierung logistischer Prozesse hinsichtlich ökologischer Kennzahlen.
Wieviel Energie lässt sich durch optimierte Logistik einsparen?
Laut Untersuchungen des Fraunhofer-Instituts lassen sich bis zu 20 Prozent des Energieverbrauchs und der damit verbundenen Schadstoffe einsparen.
Welche IT-Systeme werden als Beispiele für die Transportplanung genannt?
In der Arbeit wird beispielhaft das System „Map&Guide“ für die ökologisch optimierte Transportplanung angeführt.
Warum fordern Kunden zunehmend eine ökologische Produktion?
Das gestiegene Umweltbewusstsein führt dazu, dass Kunden nachhaltige Verpackungen und umweltfreundliche Lieferketten als Qualitätsmerkmal und Kaufkriterium ansehen.
Details
- Titel
- "Grüne" Supply Chains - Möglichkeiten der IT-Systemunterstützung
- Hochschule
- Universität Münster (Lehrstuhl für WI und Logistik)
- Note
- 2,0
- Autor
- Bachelor Michel Hecking (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 56
- Katalognummer
- V153951
- ISBN (eBook)
- 9783640662302
- ISBN (Buch)
- 9783640666294
- Dateigröße
- 1634 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- grüne logistik logistik grün green logistics carbon footprint grüne it-systeme grüne supply chain ökologische logistik ökobilanz nachhaltige logistik Umberto Simapro Software logistiksoftware
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Bachelor Michel Hecking (Autor:in), 2010, "Grüne" Supply Chains - Möglichkeiten der IT-Systemunterstützung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/153951
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-