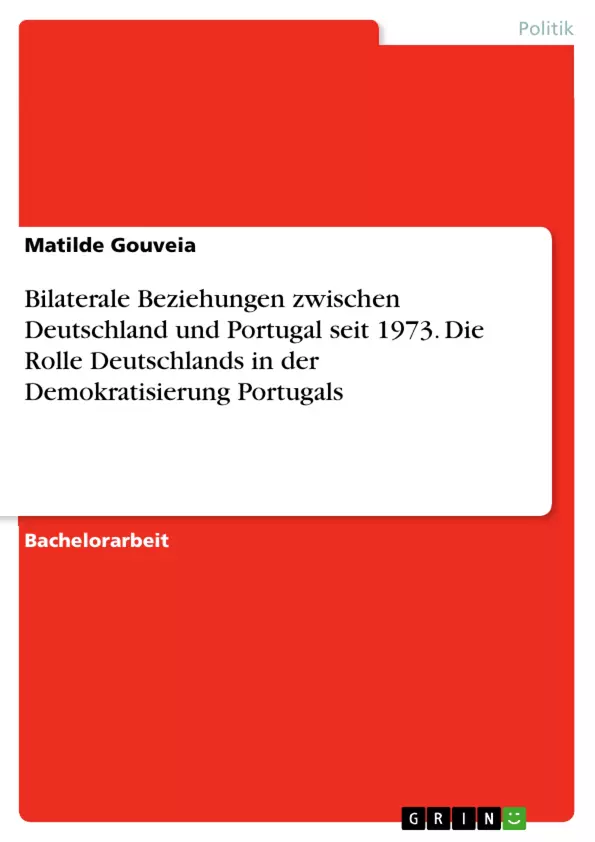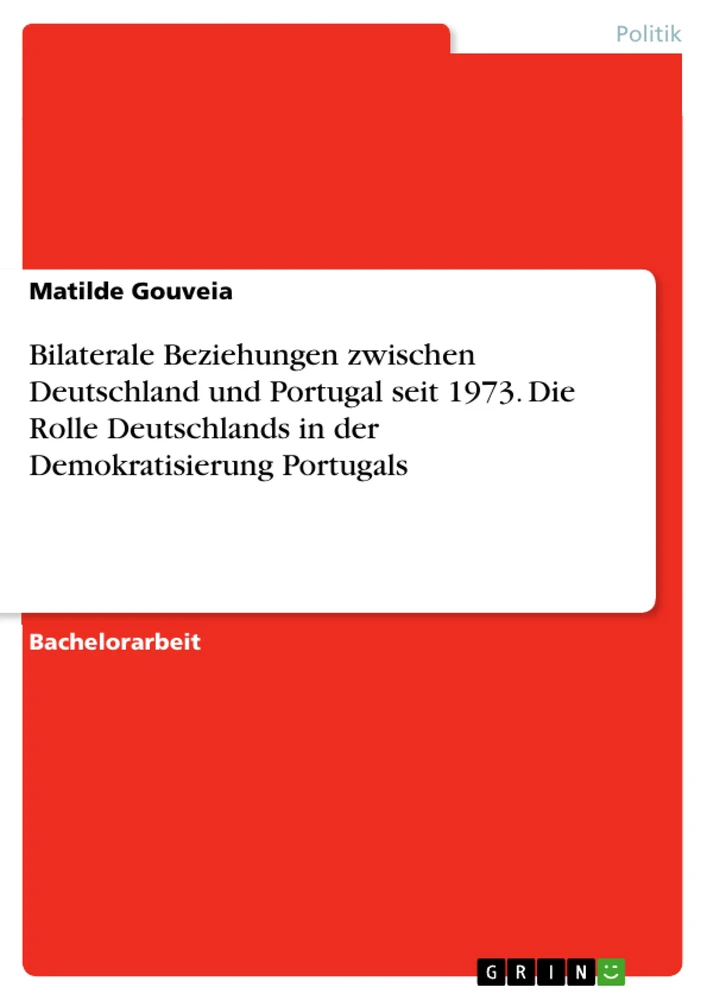
Bilaterale Beziehungen zwischen Deutschland und Portugal seit 1973. Die Rolle Deutschlands in der Demokratisierung Portugals
Bachelorarbeit, 2024
59 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort des Botschafters
1. Einleitung
2. Theoretischer Kontext der Sozialdemokratie
3. Faschismus in Europa
3.1 Die politische Situation Deutschlands vor 1973
2.2 Die politische Situation Portugals vor 1973
3.3 Exilanten
3.3.1 Willy Brandt
3.3.2 Mário Soares
4. Die Wurzeln der portugiesischen Demokratie
4.1 Zusammenarbeit der Sozialisten
4.2 Gründung der Sozialistischen Partei Portugals
4.3 Zwischen Revolution und Konsolidierung
5. Die Rolle Deutschlands in der dritten Republik
5.1 Unterstützung für die demokratischen Kräfte in Portugal
5.2 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe
5.3 Beiträge zur Bildung, Forschung und Kultur
6. Der Weg zur Demokratie
6.1 Stärkung der demokratischen Institutionen
6.1.1 Verfassung
6.1.2 Die ersten demokratischen Wahlen
6.2 Die politische Entwicklung
6.2.1 Die Europäische Gemeinschaft
6.2.2 Die Regierungsstabilität
7. Entwicklung der deutsch-portugiesischen Beziehungen
7.1 Bewertung des Beitrags der bilateralen Beziehungen
7.2 Bewertung des Beitrags der Sozialdemokraten
8. Schlussfolgerung
9. Quellen- und Literaturverzeichnis
9.1 Quellen
9.2 Literatur
10. Anhang
10.1 Abbildungsverzeichnis
10.2 Interview mit Sabine Eichhorn
Abkürzungsverzeichnis
AD = Aliança Democrática (Demokratische Allianz)
AdsD = Archiv der sozialen Demokratie
ASP = Acção Socialista Portuguesa
CDS = Centro Democrático e Social (Demokratisches und Soziale Volkspartei)
EG = Europäische Gemeinschaft
EU = Europäische Union
FES = Friedrich-Ebert-Stiftung
NATO = North Atlantic Treaty Organization
PAAA = Politisches Archiv Auswärtiges Amt
PCP = Partido Comunista Português
PPM = Partido Popular Monárquico (Monarchistische Volkspartei)
PS = Partido Social (Sozialistische Partei)
PSD/PPD = Partido Social Democrata (Sozialdemokratische Partei)
RRS = Resistência Republicana e Socialista
SI = Sozialistische Internationale
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
WBA = Willy Brandt Archiv
Vorwort des Botschafters
The 50th anniversary of the Nelkenrevolution, that changed Portugal overnight on 25 April 1974, was celebrated throughout Germany. Several initiatives were organized and coordinated by the Embassy, the Consulates and our cultural networks. Many others, nonetheless, were undertaken by German authorities and entities from the civil society, with genuine enthusiasm and considerable press coverage.
As I sought to convey back to Lisbon the essence of what had been said in Germany about the Revolução dos Cravos in the course of that thrilling week, two important aspects emerged – the degree of knowledge of the historical significance of that earlier Zeitenwende in Portugal displayed by our interlocutors and speakers, and the high degree of awareness of the decisive contribution of German actors to the ultimate success of Portugal´s transition to democracy and to our full membership of the European integration movement. The links established by the two nations half a century ago have proved to be long-lasting, meaningful and mutually beneficial.
The academic work of Matilde Ferro de Gouveia seeks to address those critical times while posing – and answering – the right questions. It is well-known that Portugal´s Socialist Party was founded in Germany, in Bad Münstereifel, in April 1973, and that the friendship that united Mário Soares and Willy Brandt, and later to Helmut Schmidt, was translated into practice, through Government channels and the assistance provided by the Ebert Stiftung. It is also well-known that the Adenauer and Naumann Foundations soon followed suit, all of them helping our fledgling political parties to face the daunting challenges of the revolutionary period and, after 1976, when our Constitution was enacted, by actively supporting our bid for membership of the then European Communities. In addition, the Federal Republic deployed its diplomatic weight to ensure that our transition process would be free from external interferences. Portugal owes a debt of gratitude to Germany, and to close partners such as France, Sweden, Austria and Italy. That what happened in my country in 1974 initiated a wave of democratisation in our continent is perhaps part of our historical thank you letter. This thesis tackles a complex narrative from all the right angles. I am very happy to see that this unique chapter of Europe´s historical path continues to deserve attention, through the dedicated talent of Matilde Ferro Gouveia.
A final word on the German-Portuguese relationship – it is balanced, mature, thriving, creative and forward-looking. There is great mutual interest and curiosity, translated into ever-rising numbers of visitors and cultural exchanges. Our bilateral trades and investments follow (or quite possibly lead) that trend. We have joined forces on the energy and digital transitions, we are committed to multilateralism. It is very difficult to identify major transnational issues over which we might disagree. This reality surely brings us comfort in troubled times, and its roots hark back to 1974.
Francisco Ribeiro de Menezes
Ambassador of Portugal
Berlin, August 2024.
1. Einleitung
Die persönliche Geschichte eines Menschen ist oft eng mit der Geschichte seines Herkunftslandes und seiner Familie verbunden. Als Tochter portugiesischer Migranten, die sowohl in Bonn als auch in Lissabon aufgewachsen ist, habe ich seit meiner Kindheit die Bedeutung von Demokratie und Freiheit erfahren. Dieses Privileg war für meine Familie und meine Nation nicht immer selbstverständlich.
Der 25. April 1974 markierte einen Wendepunkt nicht nur für Portugal, sondern auch für viele Familien, wie meine eigene. Meine Familie konnte nach 10 Jahren Kolonialkrieg nach Portugal zurückkehren, sodass meine Großeltern sowie auch meine Mutter zum ersten Mal erfahren durften, was es heißt, in einer Demokratie zu leben. Im Folgenden eine Arbeit über das Ende des Estado Novo und den Sieg der Demokratie.
„O povo unido/ jamais será vencido”. –
“Das vereinte Volk wird niemals besiegt werden.“
In der Nacht vom 24. auf den 25. April 1974 erklang gegen 00:20 Uhr im Rádio Renascença in Portugal das antifaschistische Lied des Sängers Zeca Afonso. „Grândola, braungebrannte Stadt, Heimat der Brüderlichkeit. Das Volk ist, wer am meisten bestimmt in Dir, o Stadt“.1 Das Lied wurde zweimal hintereinander gespielt, was selbst den nicht eingeweihten Bürgern signalisierte, dass sich etwas Großes anbahnte. Es diente als vereinbartes Zeichen der „Movimento das Forças Armadas“, um einen Staatsstreich einzuleiten. Infolgedessen marschierte das Militär landesweit nach Lissabon vor, um Ministerien, Rundfunk- und Fernsehanstalten sowie Flughäfen unter ihre Kontrolle zu bringen. Eine rote Nelke, von einer Kellnerin in den Lauf eines Gewehrs gesteckt, wurde zum Symbol einer friedlichen Revolution.
Am 25. April 1974 endete nach fast 50 Jahren die Ära des letzten faschistischen Staates in Westeuropa. Nach der Revolution herrschte zunächst weiterhin die politische Instabilität in Portugal. Es folgten zwei Jahre eines Machtstreites mit sechs verschiedenen provisorischen Regierungen. Erst am 25. April 1976 kam die „Dritte Republik“ Portugals zustande. Der langjährige Prozess der Demokratisierung endete jedoch erst mit dem Beitritt von Portugal zur Europäischen Gemeinschaft in 1986. Ein Prozess, welcher aufmerksam durch die Bundesrepublik Deutschland, die Friedrich-Ebert-Stiftung und die deutschen Sozialdemokraten verfolgt und unterstützt wurde.
Mittlerweile feiern wir dieses Jahr den 50. Jahrestag der Nelkenrevolution. Ein Tag, welcher Portugal von Faschismus und Terror befreite. Ein Thema, welches angesichts des wachsenden Rechtsextremismus, sowohl in Deutschland wie auch in Portugal, nicht aktueller sein könnte. Portugal und Deutschland verbindet eine langjährige Beziehung, die weit über Handel oder auch Kultur hinausgeht. Beide sind langjährige Partner der nordatlantischen Allianz und arbeiten auf „intensive und fruchtbare“ Art und Weise zusammen.2 Zwischen dem deutschen und portugiesischen Volk besteht eine feste, herzliche Freundschaft.3 Vor allem die Freundschaft zwischen zwei Politikern und die Unterstützung zwischen deutschen und portugiesischen Parteien ebneten Portugal den Weg zur Demokratie. Willy Brandt, Vorsitzender der SPD, und Mário Soares, Vorsitzender des Partido Socialista, spielten dabei eine herausragende Rolle. „Diese beruht auf gemeinsamen Wertvorstellungen und Interessen, auf dem Bewusstsein einer gemeinsamen europäischen Identität sowie auf Jahrhunderten erlebter und erlittener europäischen Geschichte.“4
Daraus ergibt sich für diese Abschlussarbeit die folgende Forschungsfrage: „Welchen Beitrag haben die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Portugal seit 1973 zur Demokratisierung Portugals geleistet und welche Rolle spielten die deutschen Sozialdemokraten dabei?“
Dabei wird folgende Forschungshypothese aufgestellt: Die umfassende politische und wirtschaftliche Unterstützung Portugals durch die Bundesrepublik Deutschland hat maßgeblich zur Entwicklung und Demokratisierung in Portugal beigetragen.
Der Forschungsstand zu dem Thema, das in dieser Bachelorarbeit behandelt wird, ist bisher relativ begrenzt. Es existiert nur eine geringe Menge an öffentlich zugänglicher Literatur, die sich mit dieser Thematik befasst. Insbesondere sind deutschsprachige Quellen selten. Es konnte kein bedeutender deutscher Autor identifiziert werden, der sich ausführlich mit den untersuchten Aspekten auseinandergesetzt hat. Obwohl einige Bücher über die Nelkenrevolution existieren, scheinen die Hintergründe dieser historischen Ereignisse nur oberflächlich erforscht zu sein. Im Gegensatz dazu bietet die portugiesische Literatur bereits eine umfangreichere Basis für die Untersuchung der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Portugal. Die relevantesten Autoren auf diesem Gebiet sind Prof. Dr. Ana Mónica Fonseca und Dr. António Muñoz Sánchez. Fonseca thematisierte 2011 in ihrer Dissertation „É preciso regar os cravos!“ („Die Nelken brauchen jetzt Wasser“) die Rolle Deutschlands im Demokratisierungsprozess von Portugal in den Jahren 1974-1976. Auch in anderen Publikationen setzte sie sich mit der Bonner Regierung und den Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Portugal auseinander. Der Forscher Sánchez thematisierte in einem Kapitel des Buches „Partnerschaft für die Demokratie“ die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Portugal. Diese Abschlussarbeit vereint verschiedene Forschungsfelder der Politikwissenschaften, Internationalen Beziehungen und Geschichte.
Vor diesem Hintergrund zielt diese Bachelorarbeit darauf ab, eine umfassende Analyse der Hintergründe der Demokratisierung in Portugal vorzunehmen und dabei insbesondere die Rolle der deutschen Sozialdemokraten in diesem Prozess herauszuarbeiten. Durch die Zusammenführung von verschiedenen Quellen und die Einbindung von Primärliteratur aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amts, den Archiven der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem Parlamentsarchiv des Bundestags, sowie der Fundação Mário Soares und dem Nachlass von Tito de Morais, strebt diese Arbeit an, neue Erkenntnisse zu schaffen und einen Beitrag zum Verständnis der bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern zu leisten.
In dieser wissenschaftlichen Arbeit wird ein theoretischer und qualitativer Ansatz verfolgt. Die angewandte Methodik umfasst eine breitgefächerte Literaturrecherche sowie eine detaillierte Inhaltsanalyse unter Einbeziehung sowohl von Primär- als auch Sekundärquellen. Zur Gewinnung zusätzlicher Einsichten und zur Unterstützung der Forschungshypothese wurde auch ein Experteninterview mit Frau Sabine Eichhorn, der damaligen Portugiesisch-Dolmetscherin des Auswärtigen Amts, durchgeführt. Eichhorn dolmetschte unter anderem für prominente Persönlichkeiten wie Willy Brandt, Mário Soares, Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Genscher. Die Mehrheit der untersuchten Archivdokumente wurde von ihr verfasst. Sie fungiert nicht nur als Zeitzeugin, sondern stellt auch ein entscheidendes Bindeglied zwischen der deutschen und portugiesischen Regierung dar, wodurch sie eine zentrale Rolle in den bilateralen Beziehungen einnahm.
Die Forschungsmethode orientiert sich an der induktiven Forschung, bei der zunächst eine Theorie aufgestellt wird, die innerhalb der Arbeit empirisch überprüft wird. Die Bewertung der Theorie erfolgt anhand verschiedener Gütekriterien. Die Validierung der Hypothese erfolgt durch die Gütekriterien Transparenz, Intersubjektivität und Reichweite. Transparenz wird durch die klare Dokumentation aller Forschungsschritte gewährleistet. Die Ergebnisse werden so präsentiert, dass sie für die Leserinnen und Leser nachvollziehbar sind, was die Intersubjektivität sicherstellt. Bei einer Wiederholung der Studie würden dieselben Ergebnisse erzielt werden, und dadurch die Reichweite bestätigt. Die Wahl dieser Methoden ergibt sich aus der Komplexität und dem Umfang des Forschungsgebiets sowie dem aktuellen Stand der Forschung. Zunächst wurde ein gründlicher Überblick über das Thema verschaffen und Schlüsselbegriffe, wie „Nelkenrevolution“, „Portugal 1973“, oder auch Kombinationen aus verschiedenen Begriffen, wie „Brandt Soares“, „SPD PS“ definiert. Anschließend wurde in verschiedenen Archiven, darunter dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amts und dem Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung, recherchiert. Zusätzlich wurden wissenschaftliche Datenbanken wie Google Scholar, SpringerLink und die Hochschul-Bibliothek unter Verwendung der definierten Schlüsselbegriffe nach relevanten Dokumenten durchsucht. Im nächsten Schritt wurden die gesammelten Dokumente sorgfältig gelesen und mittels einer Inhaltsanalyse untersucht sowie auch die Ergebnisse interpretiert. Die aufgestellte Hypothese wurde anhand von festgelegten Gütekriterien überprüft und validiert.
Die Bachelorarbeit ist in acht Kapitel untergliedert, die jeweils spezifische Unterkapitel enthalten. Um einen Bezug zu politikwissenschaftlichen Theorien der internationalen Beziehungen herzustellen, wird das Thema zunächst in den theoretischen Rahmen der Sozialdemokratie eingebettet. Dadurch wird erklärt, wie sozialdemokratische Ideen die Förderung der Demokratie in Portugal beeinflusst haben könnten.Formularende Im weiteren Verlauf wird der Fokus auf den Faschismus in Europa gelegt und dabei die politische Situation Deutschlands und Portugals vor 1973 vertieft. Besondere Aufmerksamkeit wird den Exilanten gewidmet, insbesondere Willy Brandt und Mário Soares, deren Einfluss auf die politische Landschaft ihrer jeweiligen Heimatländer bedeutend war. Anschließend wird die Entstehung der portugiesischen Demokratie näher beleuchtet. Hierbei werden die Zusammenarbeit der Sozialisten, die Gründung der Sozialistischen Partei Portugals und die bedeutsame Nelkenrevolution analysiert, die den Weg zur Demokratie in Portugal maßgeblich beeinflussten. Darüber hinaus wird die Rolle Deutschlands in der dritten Republik Portugals untersucht. Dabei werden die Unterstützung für demokratische Kräfte in Portugal, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe sowie Beiträge zur Bildung, Forschung und Kultur betrachtet. Im weiteren Verlauf werden die Stärkung der demokratischen Institutionen, die politische Entwicklung sowie die Integration Portugals in die Europäische Gemeinschaft und die damit verbundene Regierungsstabilität genauer untersucht. Abschließend erfolgt eine Bewertung der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Portugal im Jahr 1973 im Vergleich zur aktuellen Dynamik. Formularende.
2. Theoretischer Kontext der Sozialdemokratie
Die politische Ideologie der Sozialdemokratie ist eine vergleichsweise junge politische Bewegung (19. Jahrhundert), die entstand, als der „Widerstand gegen die Macht von Adel und Kapital“ wuchs.5 Sie hat ihren Ursprung in der linken politischen Richtung und widmet sich heute der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit.
In Deutschland spielte die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) im Jahr 1863 durch Ferdinand Lassalle eine entscheidende Rolle.6 Lassalle setzte sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter durch staatliche Intervention und die Schaffung von Produktionsgenossenschaften ein. Fast zeitgleich gründeten August Bebel und Wilhelm Liebknecht 1869 die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP), die später zur Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) wurde.7 Beide Organisationen fusionierten 1875 zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP), die sich 1890 in SPD umbenannte.8 Ein wichtiger Vertreter dieser Partei war Friedrich Ebert, der von 1913 bis 1919 die SPD leitete und von 1919 bis 1925 als erster Reichspräsident der Weimarer Republik amtierte.9 Ebert spielte eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung der jungen Republik. Sein frühes Ableben im Februar 1925 mit nur 54 Jahren markierte einen bedeutenden Wendepunkt für die Weimarer Republik.10 Kurz nach seinem Tod wurde die nach ihm benannte Friedrich-Ebert-Stiftung gegründet, welche der „politischen und gesellschaftlichen“ Erziehung dienen soll.11
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat sich in diesem Sinne nicht nur der politischen Bildung, sondern auch der Förderung der Sozialen Demokratie verschrieben. Laut dem deutschen Politikwissenschaftler Thomas Meyer umfasst die „Theorie der Sozialen Demokratie“ die gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Legitimität moderner Demokratien, die auf universellen Grundrechten basieren.12 Diese Theorie betont die Bedeutung sozialer und politischer Inklusion der Bürger sowie die Notwendigkeit demokratischer Effektivität und Stabilität, wie Meyer in einem Artikel der Politischen Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung erläutert. Er argumentiert in zehn Schritten, und führt aus, dass moderne Demokratien sowohl negative als auch positive Freiheit gewährleisten müssen, um ihre Grundrechte voll zu realisieren. Meyer betont, dass soziale Risiken die Grundrechte beeinträchtigen und definiert soziale Inklusion als Maßstab zur Bewertung der Effektivität sozialer Demokratien.
Durch die Bemühungen der Friedrich-Ebert-Stiftung, der SPD und diverser Sozialdemokraten, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, hat sich die Bundesrepublik für die demokratische Selbstbestimmung Portugals eingesetzt. Die Außenpolitik Brandts, die den Grundsatz “Mehr Demokratie wagen” verfolgte, verkörpert somit den Inbegriff einer sozialdemokratischen Politik. Die Fortführung durch Helmut Schmidt trug zur Stabilität Portugals bei, was sowohl für Deutschland als auch für die Europäische Gemeinschaft von strategischer Bedeutung war. Portugal wurde als potenzieller wirtschaftlicher Partner und stabilisierender Faktor in Europa gesehen, was die sozialdemokratische Vision von Frieden und gegenseitigem wirtschaftlichen Vorteil unterstreicht.
3. Faschismus in Europa
Der Begriff des Faschismus lässt sich ursprünglich auf das autoritäre, antidemokratische Regierungssystem zurückführen, das Mussolini in Italien aufgebaut hat.13 Der Begriff selbst leitet sich vom lateinischen Wort „fasces“ ab, welches „Bund“ bedeutet.14 Faschismus kann also als „Bundismus“ übersetzt werden.15 Der Begriff ist vieldeutig und steht nicht nur für eine extreme politische Ideologie und Herrschaftsprogrammatik, sondern auch für einen Politikstil.16 Im Kontext dieser Bachelorarbeit wird gezielt der Begriff des Faschismus verwendet, da er sich differenzieren lässt. Die Historiker Wörsching und Häusler beschreiben dies wie folgt: „Jede*r Nazi ist ein*e Faschist*in, doch nicht jede*r Faschist*in ist auch nazistisch.“17 Innerhalb dieser Arbeit wird Faschismus als antidemokratisches, autoritäres und nationalistisches Regime definiert, in dem der Bevölkerung eines Landes auf unmenschliche Weise die Grundrechte und die Menschenwürde aberkannt werden. In den Jahren vor 1973 erlebte Europa einen Wechsel zwischen demokratischen Strukturen und faschistischen Regimen, der die politische Landschaft der Region prägte. Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden in ganz Europa faschistische Staaten, die die traditionellen demokratischen Werte herausforderten. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs fielen die meisten autoritären Regime, während sich der Estado Novo behauptete und weiterbestand.
3.1 Die politische Situation Deutschlands vor 1973
Die politische Situation Deutschlands vor 1973 war geprägt von einem Wechsel zwischen Demokratie und autoritären Regimen. Nach dem ersten Weltkrieg etablierte sich zunächst die Demokratie in Deutschland. Sie begann mit der Proklamation der Republik am 9. November 1918.18 Die Weimarer Verfassung regulierte den liberalen Staat und galt als fortschrittlich.19 Aufgrund der Wirtschaftskrise zum Ende der 1930er Jahre kam es zu einer Abwärtsspirale innerhalb der Gesellschaft sowie aber auch der Politik. Im Jahre 1930 gab es keine Reichstagsmehrheit mehr und mit den kommenden Wahlen kam es zum Aufstieg der NSDAP unter dem Parteivorsitzenden Adolf Hitler.20 Der Parteivorsitzende der NSDAP wurde am 30. Januar 1933 von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt.21 Bereits zwei Tage nach seinem Amtsantritt löste Hitler den Reichstag auf.22 Unter der Führung der Nationalsozialisten wurden schrittweise die Grundrechte beseitigt. In Folge eines Brandanschlags auf das Reichstagsgebäude in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933, wurde die Reichstagsbrandverordnung erlassen.23 Diese schränkte die Meinungs- und Versammlungsfreiheit der Bevölkerung ein. Jeglicher Widerstand gegen das Regime wurde verboten, und Hitler etablierte einen neuen Reichstag. Mit Zustimmung des neugewählten Reichstags verabschiedete Hitler das Ermächtigungsgesetz, das ihm diktatorische Befugnisse verlieh.24 Nur anderthalb Jahre nach dessen Machtergreifung verstarb Hindenburg, und Hitler ernannte sich selbst zum „Führer und Reichskanzler“.25 Mit dem Angriff der deutschen Wehrmacht auf Polen brach am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg aus.26 Hitler präsentierte den Angriff aus propagandistischen Gründen als einen Akt der Selbstverteidigung und behauptete, dass der Angriff von Polen ausgegangen sei. Hitlers Außenpolitik verfolgte das Ziel, Deutschland als Weltmacht zu etablieren und den deutschen Lebensraum zu erweitern. Die Nationalsozialisten etablierten in Deutschland ein Regime, das für die Errichtung von Konzentrations- und Vernichtungslagern bekannt war. Es kam zu systematischen Völkermorden sowie zur Verfolgung und Ermordung von Oppositionellen sowie Andersdenkenden jeglicher Art.
Die Auflösung des NS-Staates erfolgte erst im Jahr 1945 durch die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht am Ende des von Deutschland verursachten Zweiten Weltkriegs. Deutschland wurde durch die Siegermächte des Krieges regiert und war in vier Besatzungszonen aufgeteilt.27 Im Jahr 1945 wird Deutschland letztendlich in West- und Ostdeutschland aufgeteilt.28 Diese Aufteilung führte zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Westen und der Deutschen Demokratischen Republik im Osten. Die deutsche Teilung wurde zu einem zentralen Element des Kalten Krieges. Bis 1973 amtierte Walter Ulbricht als Vorsitzender des Staatsrates in der DDR29, während Willy Brandt das Amt des Bundeskanzlers in der BRD innehatte.30
2.2 Die politische Situation Portugals vor 1973
Die politische Lage Portugals vor 1973 war geprägt von einer innenpolitischen Krise, ausgelöst durch das Scheitern mehrerer Regierungen. Zuvor wurde die portugiesische Monarchie 1910 in Porto aufgelöst und durch die erste Republik abgelöst.31 Die erste Republik wurde durch politische Instabilität, dem ersten Weltkrieg und 45 verschiedenen Regierungen gekennzeichnet.32 Die wirtschaftliche und soziale Struktur des Landes glich einem Entwicklungsland.33
Am 28. Mai 1926 gelang es General Gomes da Costa, die erste Republik zu stürzen und somit die Ära der Diktatur in Portugal zu implementieren.34 Bereits zwei Jahre nach seiner Amtsübernahme, ernannte er den damaligen Ökonomieprofessor António de Oliveira Salazar zum Finanzminister mit besonderen Vollmächten.35 Diese Vollmächte wurden ihm aufgrund der tiefergreifenden wirtschaftlichen Krise, in der Portugal sich befand, genehmigt. In 1932 wurde er zum Premierminister ernannt und gründete das autoritäre Regime des „Estado Novo“/ „Neuer Staat“.36 Der Estado Novo legte einen besonderen Wert auf die Glaubensgrundsätze der katholischen Kirche, welche unter dem Motto „Deus, Pátria e Família“/ „Gott, Nation und Familie“ zusammengefasst wurden.37 In einem Regime, welches durch Unterdrückung und Repression gekennzeichnet war, erhielt die Geheimpolizei PIDE den Auftrag, Oppositionelle aufzuspüren und zu bestrafen.38 Im Jahre 1936 waren insgesamt 8.293 Regierungsgegner inhaftiert.39 Die nationale Situation war durch erhebliche humanitäre und wirtschaftliche Krisen geprägt, begleitet von weit verbreitetem Analphabetismus und Armut. Diese Herausforderungen manifestierten sich deutlich in einer sehr hohen Kindersterblichkeitsrate, welche im Jahr 1961 mit einem Höchststand von 88,8% ihren Gipfel erreichte.40 Dies geschah parallel zu einem propagierten Kult um die Verehrung des Machthabers. Anfang der 1960er Jahre begannen sich Unabhängigkeitsbewegungen in Angola, Mosambik und Guinea-Bissau für ihre Souveränität einzusetzen. Salazar klammerte sich an die Vorstellung des portugiesischen Reiches. Er führte aussichtlose und brutale Kriege gegen die Unabhängigkeitsbewegungen. Später berichtete General Spínola dem Vorsitzenden der Sozialistischen Partei Portugals, Mário Soares, dass 52% des Staatshaushaltes für den Krieg in den Kolonien ausgegeben wurden.41 Laut einem Bericht, welcher 2019 vom portugiesischen Wirtschaftsministerium veröffentlicht wurde, gab Portugal umgerechnet 21,8 Mrd. Euro nur für den Kolonialkrieg aus.42
Am 24. September 1968 wurde der frühere Kolonialminister Marcelo Caetano vom Staatspräsidenten Américo Tomaz zum neuen Ministerpräsidenten ernannt, aufgrund schwerer Erkrankung von Salazar.43 Zunächst scheint es so als würde die Diktatur unter Caetano aufgelockert werden, da er die „Zensus-Demokratie“ in Portugal vormals abschafft und Frauen ein aktives Wahlrecht zubilligt.44 Caetano kündigte selbst vor der Nationalversammlung an, Maßnahmen zur Lockerung des innenpolitischen Klimas einzuleiten.45 Auch das portugiesische Volk erhoffte sich nach Berichten der Deutschen Botschaft in Lissabon vom 01.Oktober 1968 eine „größere Freiheit und soziale Gerechtigkeit“ sowie auch eine „Öffnung Portugals in Richtung auf eine parlamentarische Demokratie.“46 Trotzdem wurde vor allem an der Überseepolitik von Salazar festgehalten, denn die alte Feststellung „Wer das Meer beherrscht, beherrscht die Welt“ galt immer noch.47 Caetano führte Reformen durch, die den "Estado Social"/ „Sozialstaat“ einführten, und ermöglichte Mário Soares' Rückkehr nach Portugal.48 Auch die Macht der PIDE wurde eingeschränkt.49 Jedoch wurde bald offensichtlich, dass Caetano keine wirkliche Demokratisierung anstrebte, sondern lediglich das Salazar-System „verbessern“ wollte.50
3.3 Exilanten
Im vorherigen Kapitel wurde bereits angeführt, unter welchen menschenverachtenden Umständen die faschistischen Regime in Deutschland und Portugal herrschten. In beiden Ländern sahen sich Menschen mit Verfolgung konfrontiert, wenn sie sich gegen die herrschenden Regime stellten. Diese gemeinsame Erfahrung verbindet Willy Brandt und Mário Soares. Beide Männer mussten aufgrund ihrer politischen Überzeugungen und ihres Widerstandes gegen die Regierungen ihrer Heimatländer ins Exil fliehen. Sie waren überzeugte Antifaschisten und wurden bekannt für ihre sozialdemokratische Politik, die sie später in führende Positionen ihrer jeweiligen Länder brachte.
3.3.1 Willy Brandt
Herbert Ernst Karl Frahm wurde bereits mit 14 Jahren Teil der sozialistischen Jugendbewegung in Lübeck und fand innerhalb der Partei einen „Familienersatz“.51 Er trat 1930 der SPD bei, wechselte aber nach einem Jahr zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP).52 Im Jahr 1933 floh er vor den Nationalsozialisten ins norwegische Exil.53 Dort gab er sich den Decknamen Namen „Willy Brandt“.54
Im norwegischen Exil sah Brandt sich „im Außendienst“ seiner Partei und publizierte Artikel in der norwegischen Zeitung, um über das NS-Regime zu informieren.55 Brandt strebte keine akademische Karriere an, sondern wollte sich lediglich der „antinazistischen Aufgabe“ widmen.56 Im Sommer 1936 kehrte Brandt mit gefälschten Papieren unter dem Namen Gunnar Gaasland nach Berlin zurück.57 Im Mai 1937 wurde Brandt von einem Gestapo-Spitzel in Paris enttarnt.58 Daraufhin wurde er 1938 aufgrund von „Hochverrat“ durch den NS-Staat ausgebürgert und erhielt die norwegische Staatsangehörigkeit.59
Erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 kehrte Brandt als norwegischer Korrespondent nach Deutschland zurück. Nur knapp vier Jahre später wurde er wiedereingebürgert und ließ sich daraufhin amtlich zu „Willy Brandt“ umbenennen.60 Seine Tätigkeit innerhalb der SPD nahm er im Januar 1948 wieder auf, als Beauftragter des Parteivorstands. Nur ein Jahr später wurde Brandt als Berliner Abgeordneter in den ersten Deutschen Bundestag entsandt. Am 03. Oktober 1957 wurde er zum Regierenden Bürgermeister von West-Berlin und zudem Landesvorsitzender der Berliner SPD.61 Von 1964 bis 1987 war er schließlich Vorsitzender der SPD.62 Im Jahr 1969 erreichte Willy Brandt den Höhepunkt seiner politischen Laufbahn, als er zum ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler gewählt wurde.63 Mit dem Beginn seines Amts wurde schnell deutlich, dass seine wahre Leidenschaft der Deutschland- und Außenpolitik galt.64 Seine Politik zielte insbesondere auf die Entspannung zwischen den Ost- und Weststaaten ab. Das Konzept „Wandel durch Annäherung“ wurde 1963 von Brandt und seinem Kollegen Egon Bahr entwickelt.65 Am 12. August 1970 unterzeichneten die Bundesrepublik Deutschland und die Sowjetunion den „Moskauer Vertrag“, der den internationalen Frieden fördern und die Lage in Europa normalisieren sollte.66 Deutschland erkannte die Nachkriegsgrenzen an, hielt aber an der Möglichkeit einer Wiedervereinigung fest.67 Bei der Vertragsunterzeichnung übergab Brandt dem Kremlchef den „Brief zur deutschen Einheit“.68 Am 07. Dezember 1970 unterzeichneten Polen und Deutschland den Warschauer Vertrag, welcher der erste Schritt zur Aussöhnung der beiden Länder sein sollte.69 Bevor der Vertrag unterschrieben wurde, besuchte Kanzler Brandt das Mahnmal für die im Warschauer Ghetto ermordeten Juden.70 Er legte einen Kranz nieder und kniete sich hin.71 Dieser symbolische Akt, bekannt als der „Warschauer Kniefall“, wurde zu einem historischen Meilenstein und zum Symbol seiner Politik. Als Anerkennung für seine Versöhnungspolitik und seine Verdienste um den Frieden erhielt er 1970 den Friedensnobelpreis.72 Unter Willy Brandt wurden auch das Viermächteabkommen über Berlin unterzeichnet, sowie der Grundlagenvertrag zwischen der DDR und der Bundesrepublik.73
3.3.2 Mário Soares
Mário Alberto Nobre Lopes Soares gilt als „Vater der portugiesischen Demokratie“.74 Soares absolvierte sein Studium der Geschichte und Philosophie, bevor er sich an der Universität Lissabon dem Jurastudium zuwandte.75 Bereits während seines Studiums im Jahr 1944 trat er der Kommunistischen Partei PCP bei und war zwei Jahre maßgeblich an der Gründung der Jugendorganisation der Bewegung der Vereinigten Demokraten (MUD) beteiligt.76 Daraufhin wurde er zum ersten Mal von der Geheimpolizei PIDE verhaftet.77 Als Soares 1949 die Kandidatur von General Norton de Matos für das Amt des Staatspräsidenten organisierte, wurde er bereits zum dritten Mal verhaftet.78 Im Jahr 1953 gründete er gemeinsam mit anderen Oppositionellen die Resistência Republicana e Socialista (RRS) und trat aus der PCP aus.79 Es sollte nur der erste Schritt für eine Alternative zur Kommunistischen Partei sein, denn daraus sollte später die Acção Socialista Portuguesa (ASP) resultieren. Soares war Mitglied des Demokratisch-Sozialen Direktoriums, und gehörte der Kommission zur Unterstützung der Präsidentschaftskandidatur von General Humberto Delgado an.80 Als Anwalt verteidigte er politische Gefangene in zahlreichen Prozessen vor dem Plenargericht und dem Militärsondergericht.81 Er vertrat die Familie von General Humberto Delgado bei der Untersuchung von dessen Ermordung durch die politische Polizei Salazars (PIDE) und trug zur Aufklärung der Umstände und zur Anprangerung der Verantwortlichen bei.82 Aufgrund seines politischen Engagements gegen die Diktatur wurde er 12 Mal von der PIDE verhaftet.83
In 1968 wurde er schließlich ins Exil deportiert.84 Soares wurde zunächst für acht Monate nach São Tomé deportiert, bevor er nach Lissabon zurückkehren konnte.85 Zwei Jahre später erfolgte eine erneute gewaltsame Deportation, bei der er nach Frankreich geschickt wurde86. Im französischen Exil veröffentlichte er sein Buch „Le Portugal baillonné“ („Geknebeltes Portugal“), welches ein historisches Zeugnis des Faschismus in Portugal ist.87 Er beendete das Buch mit einem Versprechen, welchem er später noch alle Ehre machen würde:
„Ich werde nach Portugal zurückkehren, sobald die Umstände es erlauben. Dann werde ich mit Gelassenheit und einem Vertrauen in die Zukunft, das ich nie verloren habe, meinen Richtern und möglicherweise meinen Henkern gegenübertreten. Dies ist ein Akt der Treue, den ich meinem Land, dem Ideal, dem ich diene, und mir selbst schulde.“88
4. Die Wurzeln der portugiesischen Demokratie
Nachdem im vorherigen Kapitel die Exilerfahrungen von Brandt und Soares behandelt wurden, richtet das folgende Kapitel den Blick auf die Ursprünge der portugiesischen Demokratie. Diese wurzeln in der Zusammenarbeit deutscher und portugiesischer Sozialisten, insbesondere durch die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Gründung der Sozialistischen Partei Portugals, wobei Mário Soares eine bedeutende Rolle spielte. Im Anschluss wird die Nelkenrevolution skizziert, die als Ausgangspunkt für die Entstehung der portugiesischen Demokratie gilt.
4.1 Zusammenarbeit der Sozialisten
Schon in den 1960er Jahren knüpfte die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) enge Beziehungen zu den portugiesischen Sozialisten.89 Insbesondere Elke Esters, Leiterin des Lateinamerika-Referats, pflegte diese Kontakte intensiv. Obwohl die Bundesrepublik als NATO-Mitglied mit Portugal verbündet war, suchte die FES, gemeinsam mit den Sozialdemokraten, den Kontakt zu den Freiheitsbewegungen in den Kolonialgebieten, um diese zu unterstützen.90 Im Jahre 1964 trat der „Umbruch“ ein, und Mário Soares, Manuel Tito de Morais und Francisco Ramos da Costa gründeten die Acção Socialista (ASP).91 Die Hauptmotive für die Gründung der ASP seien für Soares das Ziel gewesen die „nicht kommunistische Linke ins Blickfeld der europäischen sozialistischen Parteien zu rücken.“92 Soares erhielt während seiner Zeit im Exil eine dreimonatige Subvention von 5.000 DM, gezahlt von der FES.93 Der Geschäftsführer der FES, Grunwald, sah diese finanzielle Unterstützung als „moralische Pflicht“ gegenüber einem Freund an.94 Der Sozialist bot daraufhin der FES an, als informeller Mitarbeiter für Portugal und Lateinamerika tätig zu sein.95 Dem Historiker Antonio Muñoz Sánchez zufolge sollte dies die Grundlage für eine zukünftige Zusammenarbeit zwischen den portugiesischen Sozialisten und deutschen Sozialdemokraten bilden.96 Als die ASP im Jahre 1972 zum Mitglied der Sozialistischen Internationale (SI) wurde, knüpfte sie auch den Kontakt zur SPD und anderen sozialdemokratischen Parteien Europas. „Es ging dort […] um mehr als Geldspenden, Unterstützung für Exilanten, Protestschreiben an autoritäre Regierungen und Grußadressen an Verfolgte.“97 Die europäischen Sozialdemokraten seien bereit gewesen sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen.98 Mit dem Amtsantritt von Ex-Kanzler Brandt als Präsident der SI intensivierte sich der Kontakt zwischen SI und Portugal.
In einer Rede am 25. November 1982 im Bundestag lobte der Sozialdemokratische Abgeordnete Horst Haase die Bemühungen von Brandt und den deutschen Sozialdemokraten und betonte dabei konkret, dass die Leistungen deutscher Sozialdemokraten für Europa unbestreitbar seien.99 Er hob hervor, dass es die führenden Sozialdemokraten waren, die sich für dieses Europa eingesetzt haben.100 Zu Brandt und seiner Portugal-Politik äußerte er sich wie folgt: „Die Verdienste von Herrn Brandt, als es darum gegangen ist, Portugal für die EG zu erhalten, als andere Portugal nach der Revolution längst aufgegeben hatten, können doch nicht weggeleugnet werden. Das war doch eine echte sozialdemokratische Initiative.“101 Mit diesen Worten wird erneut die bedeutende Rolle hervorgehoben, die Willy Brandt bei der Demokratisierung Portugals gespielt hat.FormularbeginnFormularende.
4.2 Gründung der Sozialistischen Partei Portugals
Im Januar 1973 wurde erstmals über die Möglichkeit gesprochen, aus der ASP eine politische Partei zu bilden.102 Die Kontakte zwischen der ASP und der FES vertieften sich mit dem Beginn der Amtszeit von Caetano, als damit die Rückkehr von Soares aus dem Exil ermöglicht wurde. Die Gründungsmitglieder der ASP waren davon überzeugt, nur ernstgenommen zu werden, wenn sie als Partei auftreten würden.103 Die Mitglieder aus Portugal hingegen hielten es für absurd aus einer „Handvoll Freunde“ eine Partei zu gründen.104 Doch die FES hatte die Vorstellung aus der Organisation eine Partei zu gründen, schon länger in Absicht.105
Am 19.04.1973 wird die Sozialistische Partei Portugals, der Partido Socialista (PS) in Bad Münstereifel gegründet. Gemeinsam mit der FES und den portugiesischen Sozialisten wurde ein ASP-Kongress in Bad Münstereifel organisiert. Die FES übernahm die Reisekosten für die portugiesischen Sozialisten, einschließlich derer, die sich im Exil befanden. Der Kongress fand vom 16. bis zum 21. April 1973 statt und wurde geheim gehalten, um mögliche Passentzüge zu vermeiden. Die Mitglieder, welche direkt aus Lissabon anreisten, mussten mit Zwischenstopp fliegen, um keine Aufmerksamkeit bei Polizei und Zoll zu erregen. Insgesamt 27 Mitglieder nahmen teil, und trotz Bemühung seitens der FES, erschien kein Mitglied der SPD zum Kongress.106 Am 17. April 1973 hielt Soares dort eine Rede, in der er die Krise in Portugal ansprach und die Dringlichkeit der Gründung einer sozialistischen Partei betonte.107 Gegen 18 Uhr Nachmittag wurde schließlich abgestimmt.108 Eine Mehrheit von 20 Delegierten stimmte für die Umwandlung in eine Partei. „Begeistert stimmten die Genossen die portugiesische Nationalhymne an, unterzeichneten die Gründungsakte der Partei und brachten einen Toast auf die Neugeburt aus.“109 Nach dem Ende der Tagung hinterließ Soares folgenden Eintrag im Gästebuch der Kurt-Schumacher Akademie:
„Mit herzlicher Anerkennung der Portugiesischen Sozialistischen Partei für alles, was die Friedrich-Ebert-Stiftung im Blick auf die Demokratie und den Sozialismus in Freiheit in Portugal getan hat.“110
Im Jahr 1974 bestand immer noch eine gewisse Distanz zwischen der SPD und dem PS, bis Esters den Geschäftsführer der FES, Grunwald, bat, bei der SPD anzufragen, ob eine Delegation des PS empfangen werden könnte.111 Die SPD nahm endlich den Vorschlag an, und Soares kam am 23. April 1974 in Bonn an.112 Am 25. April 1974 sollte sich der Generalsekretär des PS endlich mit Brandt treffen.113 Jedoch kam es nie zu diesem Treffen, da am selben Morgen Soares die Nachricht erhielt, dass in Portugal eine Revolution im Gange sei.114
4.3 Zwischen Revolution und Konsolidierung
Die eigentliche Revolution begann viel eher als durch den tatsächlichen Militärputsch am 25.04.1974. Die katastrophale und aussichtslose Lage der Kolonialkriege Portugals wirkte sich nicht nur auf die wirtschaftliche Lage des Landes selber, sondern auch auf die Stimmung des Militärs aus. Es breitete sich die Überzeugung aus, dass ein aussichtsloser Krieg geführt werde. Die Dienstzeit wurde um weitere 5 Jahre erhoben, und das Höchstalter für die Einberufung auf 45 Jahre angehoben.115 Portugal wies damit den zweithöchsten Anteil an wehrpflichtigen Männern weltweit auf.116 Schließlich führte diese Unzufriedenheit zur Intervention der MFA (Movimento das Forças Armadas/Bewegung der Streitkräfte). Im März 1973 trafen sich erstmals Offiziere aus Guinea-Bissau, Angola und Mosambik, um Erfahrungen auszutauschen.117 Ab Juli 1973 folgten weitere, teilweise geheime, Treffen zur Diskussion über die Regierung Caetano.118 Im Dezember 1973 wurden die Pläne konkreter, und ein Thesenpapier mit dem Titel „O Movimento, as Forças Armadas e a Nação“ („Die Bewegung, die Streitkräfte und die Nation“) von den Streitkräften veröffentlicht.119
Ein Wendepunkt war die Veröffentlichung von Marechal António de Spínolas Buch "Portugal e o Futuro" („Portugal und die Zukunft“), im Februar 1974, in dem er die Regierung Caetano und ihre Kolonialpolitik kritisierte und für neokoloniale Lösungen und die Unabhängigkeit der Kolonien plädierte.120 Spínola war ehemaliger Befehlshaber der portugiesischen Truppen in Guinea-Bissau und hatte durch militärische, und politische Erfolge an Popularität gewonnen.121 Seine Ideen gewannen daher, vor allem innerhalb der portugiesischen Armee, schnell an Zustimmung. Caetano selber las das Buch zwei Tage vor dessen Veröffentlichung.122 In seinem Werk „Depoimento“ reflektiert er eingehend über den Augenblick, als er das Buch von Spínola zum ersten Mal las. Es sei der Moment gewesen, in dem ihm klar geworden sei, dass seine Regierung einem Putsch gegenüberstünde.123 Am 14.03.1974 wurde Spínola schließlich von Caetano seines Postens enthoben.124 Diese Absetzung stieß überwiegend in den militärischen Kreisen auf Unruhe, und die Existenz der „Bewegung der Streitkräfte“ zeigte sich erstmal bei einem gescheiterten Putsch am 16.03.1974.125
Nur zwei Monate nach der Publikation von Spínolas Buch kam es dann zum erfolgreichen Staatsstreich. Zwei Lieder kündigten den bevorstehenden Putsch an: „E depois do Adeus“ um 22.55 am 24. April, und das verbotene antifaschistische Lied „Grândola Vila Morena“ um 0.20 am 25. April, spielten im Rádio Renascença.126 Daraufhin brachen Militärfahrzeuge aus dem gesamten Land in die Hauptstadt Lissabon auf. Dort kam es zur Besetzung von Ministerien, Runkfunk- und Fernsehanstalten, sowie von Flughäfen. Gegen 4.00 Uhr erfolgte die erste Mitteilung der MFA über den Sender „Rádio Clube Português“:
„Hier ist der Kommandoposten der Bewegung der Streitkräfte. Die portugiesischen Streitkräfte appellieren an alle Einwohner der Stadt Lissabon, in ihre Häuser zurückzukehren und dort so ruhig wie möglich zu bleiben […] wir appellieren an die Vernunft der Kommandeure des Militärs, jegliche Konfrontation mit den Streitkräften zu vermeiden. […] Ungeachtet unserer ausdrücklichen Sorge, dass bei keinem Portugiesen auch nur ein Tropfen Blut fließt […]."127
Der Putsch verlief im ganzen Land und auch die Bürger strömten auf die Straßen, um gemeinsam an diesem historischen Ereignis teilzunehmen. Die Streitkräfte und Demonstranten belagerten das Hauptquartier der Guarda Nacional Republicana (GNR), in dem sich Caetano verschanzt hatte, und zwangen ihn schließlich zur Abdankung. Gegen Nachmittag war Caetano bereit, die Macht zu übergeben. In einem Drahtbericht über die Situation in Portugal informiert der deutsche Botschafter in Lissabon am 25.04.1974 das Auswärtige Amt über die Geschehnisse: „Movimento gibt über Rundfunk bekannt, Staatspräsident, Ministerpräsident und Mitglieder der Regierung seien im Hauptquartier der GNR umstellt und ultimativ zur Übergabe aufgefordert worden.“128 Die Zentrale der Geheimpolizei PIDE sollte der letzte Halt sein. Hunderte von Agenten verschanzten sich im Gebäude, und gegen 20 Uhr öffneten sie das Feuer auf die Demonstranten.129 Dabei starben insgesamt vier Menschen, es waren die einzigen Opfer des Coups.130 Kurze Zeit darauf kapitulierte auch die PIDE.131
Nach dem Umsturz folgten zwei Jahre des Machtkampfs in Portugal. Die Revolutionäre, zunächst vereint gegen das alte Regime, zeigten bald ihre unterschiedlichen politischen Ansichten. Es wurde eine provisorische Regierung, die „Junta de Salvação Nacional“ (Nationale Rettungsfront), bekannt gegeben. General Spínola wurde vorübergehend zum Präsidenten erklärt und Mário Soares als Außenminister ernannt. Spínola sei es gelungen den gesamten militärischen, politischen und administrativen Apparat Portugals und seine Überseeprovinzen unter ihre Kontrolle zu bringen.132 Es bildeten sich drei große politische Gruppierungen, deren Anhänger sowohl im Militär als auch unter den Bürgern vertreten waren.
Darunter waren im Juni 1974, die „Militärjunta unter Spínola“ und seine eher rechtszentrierten Anhänger, die „anonyme Bewegung der Streitkräfte“, die Linksparteien (darunter auch die Sozialdemokraten und Kommunisten), die „Rechte“ und die Kirche.133 Die zivile Regierung war auf ein Jahr angesetzt und sollte das Programm der Militärjunta ausführen. Diese bestand aus einem Ministerpräsidenten und 14 Ministern.134 Konflikte, besonders über die Zukunft der Kolonien, führten zu Spannungen und Rücktritten. Spínola trat im September 1974 zurück, und General Vasco Gonçalves übernahm die Regierung, setzte radikale Reformen um und verstaatlichte Großbetriebe. Nach einem gescheiterten Putschversuch durch die konservativen Rechten unter Spínola im März 1975, verließen er und seine Anhänger das Land. Das am längsten bestehende Kolonialreich Europas zerfiel kurze Zeit später und die Kolonien erlangten ihre Unabhängigkeit.135
In der Bundesrepublik machte sich das Auswärtige Amt zum gleichen Zeitpunkt Sorgen um die politische Zukunft Portugals. Es hieß, dass die provisorische Regierung, besonders die Sozialisten unter Mário Soares, das „Überseeproblem“ lange schleifen gelassen haben.136 Die wirtschaftliche Situation sei schlecht, und die zuvor gehegten hohen Erwartungen an eine rasche Verbesserung der sozialen Verhältnisse seien enttäuschend.137 Es wurde damit gerechnet, dass die Bundesregierung Deutschlands sich eines Tages erklären müsse, was sie getan habe, um einer solchen Entwicklung entgegenzuwirken.138 Trotz der Besorgnis der Bundesrepublik war Soares laut einer Meinungsumfrage aus dem März 1975 der beliebteste Politiker in ganz Portugal.139
5. Die Rolle Deutschlands in der dritten Republik
Aufbauend auf die Darstellung der Zusammenarbeit der Sozialisten und der Wurzeln der portugiesischen Demokratie, insbesondere im Kontext der Nelkenrevolution, richtet sich dieses Kapitel auf die Rolle Deutschlands in der postrevolutionären Phase Portugals. Historiker António Muñoz Sánchez erklärte in der ZDF-Dokumentation „Mit Nelken gegen die Diktatur“, dass noch nie zuvor ein Land einer politischen Partei so viel geholfen habe. Dies geschah, weil es verstanden habe, dass diese Partei strategisch wichtig sei, um eine politische Entwicklung zu verhindern, konkret die Möglichkeit, dass Portugal kommunistisch werde.140 Um dieser Entwicklung bestmöglich entgegenzuwirken, beteiligte sich die Bundesrepublik Deutschland aktiv durch politische Maßnahmen, Kapitalhilfe und Kulturförderung.
5.1 Unterstützung für die demokratischen Kräfte in Portugal
Am 3. Mai 1974 empfing Kanzler Willy Brandt den Generalsekretär der PS Mário Soares in Bonn. An diesem Tag war Sabine Eichhorn, Dolmetscherin für Portugiesisch im Auswärtigen Amt, für die Übersetzung des Gesprächs zwischen Soares und Brandt verantwortlich.141 Zum Zeitpunkt dieses Besuchs war Eichhorn bereits auf Rumänisch umgeschult worden, da in der Bundesrepublik Deutschland keine Notwendigkeit mehr für portugiesische Dolmetscher gesehen wurde.142 Dies deutet darauf hin, dass weder die portugiesische noch die deutsche Regierung mit diesem Umbruch gerechnet hatten. Eichhorn wurde aus Rumänien wieder nach Bonn entsandt, um das Gespräch zu begleiten.143 „Dass es sich um ein historisches Treffen handelte, war deutlich spürbar. Man begegnete sich mit großem Ernst, mit gegenseitigem Respekt und auch mit Vertrauen.“, so Eichhorn.144 Es sollte der letzte ausländische Besuch sein, den Brandt noch in seinem Amt als Kanzler empfing. Kurz nach der Nelkenrevolution, trat Willy Brandt aufgrund einer Spionageaffäre von seinem Amt zurück, und der Sozialdemokrat Helmut Schmidt wurde am 16. Mai 1974 zum fünften Kanzler der Bundesrepublik.145 Ähnlich wie Brandt verfolgte auch Schmidt das übergeordnete Ziel eines geeinten Europas, welches sich auch auf seine Haltung gegenüber Portugal auswirkte.
Im Juni 1974 wurden erste Vorschläge des Auswärtigen Amtes bezüglich des weiteren Vorgehens der Bundesrepublik in Hinsicht auf die politische Situation in Portugal an den Staatssekretär weitergeleitet.146 Aufgrund der instabilen politischen Lage sollte die Unterstützung der demokratischen Kräfte in Portugal zunächst über inoffizielle Stellen, wie Parteien oder Stiftungen, laufen.147
Abb.1: Mário Soares, Sabine Eichhorn und Helmut Schmidt
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Fotoalbum Sabine Eichhorn (Mai 1974)
Der Ex-Bundeskanzler Willy Brandt und Mário Soares haben sich bereits über „Wirtschaftsfragen“ unterhalten, und der gemischte Ausschuss für wirtschaftliche Angelegenheiten solle wiederbelebt werden, gab das Auswärtige Amt durch.148 Im Oktober 1974 berichtete das Auswärtige Amt über die politischen Gruppierungen in Portugal und über die bisherigen Versuche der Bundesrepublik, die Demokratie in Portugal zu stärken. Kurz darauf war Willy Brandt, als Vorsitzender der SPD auf Einladung von Mário Soares, in Portugal zu Besuch.149 Dieser Besuch sollte laut Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten (Auswärtiges Amt) den Einfluss der Sozialdemokratie in Portugal stärken, aber auch unter Kontrolle halten.150 Brandt habe sich direkt in die inneren Angelegenheiten Portugals eingemischt, indem er auf einer Pressekonferenz feststellte, dass sich in Portugal keine kommunistische Regierung bilden werde.151 Man befürchtete in Deutschland, dass die finanziell besser ausgestattete Kommunistische Partei innerhalb der Regierungskoalition, und innerhalb der Streitkräfte immer mehr Gewicht erhalte.152 Es erfolgte eine Gemeinsame Erklärung von Brandt anlässlich des Besuches der SPD-Delegation in Portugal:
„Die SPD begrüßt und unterstützt den entscheidenden Beitrag, den die Sozialistische Partei Portugals beim Aufbau der demokratischen Strukturen des Landes leistet und erneuert ihre Bereitschaft, die Bemühungen ihrer portugiesischen Bruderpartei zu unterstützen.“153
Bundeskanzler Schmidt führte am 10. April 1975 ein Gespräch mit dem amerikanischen Außenminister Kissinger, in welchem er die Lage in Portugal thematisiert.154 Er berichtete von drei Zielen, die die Bundesrepublik verfolge, um die Demokratie in Portugal zu stärken. Die Bundesrepublik wird später auch den folgenden übergeordneten Zielen nachkommen: Über die politischen Parteien und die von ihnen getragenen Stiftungen wurden Mittel direkt zur Unterstützung der entsprechenden portugiesischen Parteien geleitet.155 Darüber hinaus wurden in einem bilateralen Unterstützungsprogramm von Regierung zu Regierung Rüstungsaufträge und Kapitalhilfe nach Portugal vergeben.156 Im multilateralen Bereich strebte die Bundesregierung ein größeres Entgegenkommen seitens der Europäischen Gemeinschaft gegenüber den portugiesischen Wünschen an.157 Kissinger sei selbst davon überzeugt gewesen, dass Portugal im nächsten Jahr kommunistisch werde.158 In weiteren Gesprächen am 20. und 21. Mai in Bonn erklärt er deshalb, dass es ihm lieber wäre, wenn Portugal nicht mehr in der NATO wäre.159 Genscher sei es jedoch gelungen, dem US-Außenminister die deutsche Haltung gegenüber Portugal zu erklären und ihn zu einem Treffen mit dem portugiesischen Außenminister Ernesto Melo Antunes zu bewegen.160 Noch während seines Besuches in Bonn traf sich Kissinger daraufhin mit Melo Antunes, um die Situation in Portugal zu besprechen.161 Die Treffen zwischen dem deutschen, portugiesischen und amerikanischen Außenminister haben sich eine Woche vor dem NATO Gipfel am 29. Mai 1975 zugetragen.
Nur knapp 3 Monate später, am 05. September 1975, wurde das „Komitee für Freundschaft und Solidarität mit Demokratie und Sozialismus in Portugal“ von der Sozialistischen Internationale (SI) mit Vorsitz von Willy Brandt ins Leben gerufen.162 Dieses Komitee sollte als Brücke zwischen den internationalen Sozialdemokraten und der Sozialistischen Partei Portugal dienen. Generalsekretär Soares hielt anlässlich der Gründung dieses Komitees eine Rede, in welcher er den Wunsch und das Bestreben der Portugiesen äußerte, Teil der Europäischen Gemeinschaft zu sein. „Wir sind Europäer, wir fühlen uns als Europäer und wir Portugiesen wollen, dass unser Land endlich seine Stimme erhebt und aktiv am Aufbau Europas teilnimmt.“ 163 Auch Brandt appellierte in einer Pressemitteilung vom Oktober 1975 an die Europäische Gemeinschaft der neuen portugiesischen Regierung ihr Vertrauen zu zeigen und somit den Weg für eine demokratische Zukunft zu ebnen.164 Über Monate hinweg wurden die wichtigsten Informationen, welche die deutschen Sozialdemokraten über Portugal gesammelt hatten, mit den Mitgliedern geteilt. Das Jahr 1976 sollte schließlich das Ende des revolutionären Prozesses und den Beginn der Stabilisierung der politischen Situation Portugals, sowohl national als auch international, kennzeichnen.
5.2 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe
Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) unterstützte von 1966 bis 1971 die portugiesischen Sozialisten bereits mit mehr als 100.000 DM.165 Diese finanzielle Unterstützung war Teil der breiteren wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Portugal, die bereits vor der Revolution in Portugal begann und einen bedeutenden Aspekt der bilateralen Beziehungen darstellte. Noch zu Zeiten von Salazar beteiligte sich Deutschland mit finanziellen Mitteln, insbesondere für Waffen während der Kolonialkriege Portugals.
Nach der Revolution verstärkte sich das deutsche Engagement mit dem Ziel, die Demokratie in Portugal zu festigen. Bereits im August 1974 stellte die Bundesrepublik Portugal 1,7 Millionen DM für "Staatsbürgerliche Erziehung" zur Verfügung, um den Aufbau gesellschaftspolitischer Organisationen wie Parteien und Gewerkschaften zu unterstützen.166 Es folgte eine weitere Kapitalhilfe in Höhe von 70 Millionen, um verschiedene Bereiche der Massenmedien, Sozialtstrukturhilfe und Genossenschaften zu unterstützen.167 Im Januar 1976 erfolgte ein durch Gold gesicherter Zahlungskredit von 250 Millionen Dollar über die Bundesbank.168
Ab März 1976 wurde zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Portugal über einen möglichen Investitionsförderungsvertrag verhandelt. Ziel dieses Vertrages, sollte die Anregung von privaten deutschen Investitionen in Portugal sein.169 Portugal sei für die Unternehmen aufgrund eines sehr niedrigen Lohnniveaus, niedriger Arbeitskosten und einem geographisch günstigen Standort attraktiv.170 Verglichen mit anderen Niedriglohnländern, konnte Portugal wesentliche Frachtkosten- und Zollvorteile bieten.171
Der Vertrag wurde schließlich am 16. September 1980 unterzeichnet.172 Bundesminister des Auswärtigen Genscher erhoffte sich durch diesen Vertrag eine „Signalwirkung auf die in letzter Zeit stagnierenden deutschen Investitionen in Portugal und damit einen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärkung und politischen Stabilisierung Portugals im Vorfeld seines EG-Beitritts.“173
Abb. 2: Die wichtigsten ausländischen Kreditzusagen im Jahre 1979
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Politisches Archiv Auswärtiges Amt – B 52 ZA 121355
Bis Ende 1980 erhielt Portugal insgesamt 630 Millionen DM von Deutschland, um Projekte im Bereich Landwirtschaft und Infrastruktur zu finanzieren.174 Fünf Jahre später belief sich die Gesamtsumme, die Deutschland Portugal zur Verfügung gestellt hatte, auf 995 Millionen DM.175 Wie man der obigen Abbildung über die wichtigsten ausländischen Kreditgeber 1979 entnehmen kann, war die Bundesrepublik Deutschland das europäische Land, welches umgerechnet die höchste Summe an Krediten an Portugal vergab.
5.3 Beiträge zur Bildung, Forschung und Kultur
Deutsche und portugiesische Bildungseinrichtungen haben Austauschprogramme für Studierende und Lehrkräfte etabliert, die es ihnen ermöglichen, einige Zeit im jeweils anderen Land zu verbringen. Diese Programme bieten den Teilnehmern die Gelegenheit, die Kultur und Lebensweise des Gastlandes aus erster Hand kennenzulernen und interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln. Sie tragen auch zur langfristigen Partnerschaft zwischen deutschen und portugiesischen Bildungseinrichtungen bei und fördern den akademischen Austausch. Seit 1965 besteht ein Kulturabkommen zwischen Deutschland und Portugal, das den Schwerpunkt auf den Austausch im Bereich der Wissenschaft und Hochschulbildung legt.176
In Portugal haben sich mittlerweile zahlreiche deutsche Institutionen etabliert, die sich der Förderung der deutschen Sprache, Kultur und des Austauschs widmen. Besonders hervorzuheben ist das Goethe-Institut mit Standorten in Lissabon und Porto, wo insgesamt 2200 Schüler nicht nur Deutsch lernen, sondern auch Einblicke in modernes Deutschland, Postkolonialismus und Demokratie erhalten.177 Die Deutschen Schulen in Lissabon, Porto und der Algarve bieten das Internationale Abitur an, das den Zugang zu deutschen und portugiesischen Hochschulen ermöglicht. Weitere bedeutende deutsche Institutionen in Portugal sind die Deutsch-Portugiesische Industrie- und Handelskammer (AHK), die Friedrich-Ebert-Stiftung, Fraunhofer Portugal Research, der Deutsche Verein in Lissabon sowie deutschsprachige Kirchengemeinden.178 Im portugiesischen Parlament entsteht am 8. März 1990 die „Grupo Parlamentar de Amizade Portugal – República Federal da Alemanha“ („Freundschaftsgruppe Portugal – Bundesrepublik Deutschland“).179 Die Freundschaftsgruppe verfolgt das Ziel, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen deutschen und portugiesischen Parlamentariern zu fördern.
Kurz nach der Revolution erwog die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ein Engagement in Portugal mit besonderem Fokus auf den Fischerei- und Landwirtschaftssektor.180 Die Stiftung plante, Genossenschaftsberater nach Portugal zu entsenden und Ausbildungsprogramme anzubieten, die sowohl in Deutschland als auch in Portugal durchgeführt werden sollten.181 Zugleich beriet sich die Stiftung über mögliche Forschungsstipendien für Portugal und auch für portugiesische Studenten in der Bundesrepublik.182 Im Jahr 1977 eröffnete sie anschließend ihr erstes Büro in Lissabon.183
In Deutschland entstanden sowohl zu Zeiten Salazars als auch während der Teilung Deutschlands die Deutsch-Portugiesische Gesellschaft e.V. (DPG) und die Freundschaftsgesellschaft DDR-Portugal. Im Jahr 1990 fusionierten sie zu einer Einheit.184 Auch diese Gesellschaft dient dazu, die Zusammenarbeit mit Deutschland, im europäischen Rahmen zu fördern. Hierzu werden bundesweite Veranstaltungen organisiert, darunter auch spezielle Portugal-Abende.185 Ergänzend dazu publiziert die DPG regelmäßig die Zeitschrift 'Portugal Report', die detailliert über die deutsch-portugiesischen Beziehungen berichtet.186 Es sind diese vielfältigen kulturellen und wissenschaftlichen Kooperationen, die eine solide Grundlage für die politische Zusammenarbeit und die gemeinsame Förderung demokratischer Werte bilden.
6. Der Weg zur Demokratie
Im vorausgegangenen Kapitel wurde die Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland im Demokratisierungsprozess Portugals nach der Revolution illustriert. Das nachfolgende Kapitel beleuchtet den schleichenden Prozess der Demokratisierung in Portugal nach der Nelkenrevolution. Beginnend mit den provisorischen Regierungen, der Verabschiedung der ersten postrevolutionären Verfassung am 2. April 1976 und den ersten demokratischen Wahlen am 25. April 1976, zeichnet dieses Kapitel die politischen Entwicklungen des Landes bis zur Institutionalisierung der Demokratie nach.
6.1 Stärkung der demokratischen Institutionen
Insgesamt haben nach dem 25. April 1974 in Portugal sechs provisorische Regierungen fungiert.187 Die portugiesische Wählerschaft schien eine sehr unsichere und konfliktbehaftete zu sein, vermutlich aufgrund der sozio-ökonomischen und sozio-kulturellen Unterschiede im Land.188 Der Norden des Landes tendierte eher zu konservativen Ansichten, während in urbanen Zentren wie Porto oder Lissabon die Sozialdemokraten im Fokus standen.189 Doch auch innerhalb der Parteien herrschte ein Zwiespalt.190
Abb. 3: Die provisorischen Regierungen Portugals
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an von Rahden, Manuel (1997)
Daten entnommen aus: República Portuguesa – Governos Anteriores
6.1.1 Verfassung
Am 2. April 1976 wurde die erste portugiesische Verfassung verabschiedet, deren Inkrafttreten für den 25. April 1976, den Tag der ersten freien Wahlen nach dem Estado Novo, geplant war.191 Die Präambel der Verfassung betont die grundlegende Bedeutung von Freiheit, Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Zudem wird auf die symbolträchtige Bedeutung des Tags der Nelkenrevolution hingewiesen.192 Die Präambel hat bis heute unverändert Bestand, was darauf abzielt, die Bedeutung und Aktualität des 25. April 1974 zu bewahren. In Artikel 3 der Verfassung wurde festgelegt, dass die Souveränität beim portugiesischen Volk liegt, und dass den Parteien die Grundsätze der politischen Demokratie zugrunde liegen.193 Die Verfassung verankert Grundrechte und Grundpflichten wie den Gleichheitsgrundsatz, die Pressefreiheit, die Religionsfreiheit sowie Arbeits-, Sozial- und Kulturrechte. Die Gebiete Portugals umfassen neben dem europäischen Portugal auch die portugiesischen autonomen Regionen Madeira und Azoren.
Die Verfassung war sozialistisch geprägt und gab dem direkt gewählten Staatspräsidenten eine starke Stellung.194 Die Regierung bestand gleichermaßen aus ihm und dem Parlament, der Assembleia da República (Versammlung der Republik).195 Weiterhin gab es den „Revolutionsrat“, welcher aus 19 Offizieren besteht, und als „Garant der Revolution“ den Staatspräsidenten berät und die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze überprüft.196 Der Präsident musste die Verkündung eines Gesetzes ablehnen, falls der Revolutionsrat dieses als verfassungswidrig bezeichnete.197 Diese Einschränkung führte zu einer breiten Übereinstimmung unter allen politischen Parteien Portugals:
„Unter allen politischen Parteien Portugals besteht Konsensus, dass diese Verfassung für den weiteren demokratischen Weg nicht praktikabel ist.“198 Folglich musste der Revolutionsrat abgeschafft werden. Mit der Regierungsreform von September 1982 wurden die marxistischen Aspekte der Revolutionsverfassung überwunden, das Militär unterliegt nun der zivilpolitischen Gewalt, der Revolutionsrat wurde abgeschafft und die Regierungsform der semipräsidentiellen Republik eingeführt.199 Für die demokratischen Kräfte im Land stellte die Verfassungsreform das Ende der nachrevolutionären Ära dar und markiert den Beginn eines normalen politischen Lebens.200
In Portugal herrscht bis dato eine semipräsidentielle Republik. Diese politische Struktur vereint Aspekte sowohl des parlamentarischen als auch des präsidentiellen Systems. Hierbei wird ein Präsident direkt vom Volk gewählt und darf die Regierung bilden, sowie auch den Premierminister ernennen. Der Premierminister, dessen Amt von der Zustimmung des Parlaments abhängt, übernimmt die Rolle des Regierungschefs.
6.1.2 Die ersten demokratischen Wahlen
Genau zwei Jahre nach dem Militärputsch, fanden am 25. April 1976 die ersten freien Wahlen, nach knapp 50 Jahren Diktatur, statt. Die Wahlordnung erschien bereits zu Beginn des Jahres im Januar.201 Es gab Änderungen im Wahlrecht für portugiesische Bürger im Ausland und eine neue Wahlkreiseinteilung.202 Insgesamt nahmen 14 Parteien an den Wahlen teil.203 Die Freude über das Ende des Estado Novo spiegelte sich in einer Wahlbeteiligung von 91,6% wider.204 Die Sozialistische Partei gewann die Wahlen mit einer Mehrheit von 34,88%. Entgegen aller Erwartungen wird Mário Soares, nach nur drei Jahren seit der Gründung der PS, zum ersten Premierminister des demokratischen Portugals ernannt.205 Die PPD belegte mit 24,35% der Stimmen den zweiten Platz, gefolgt von der CDS mit 15,97%, die zur drittgrößten parlamentarischen Kraft wurde und die PCP überholte, die im Vergleich zu den Stimmen, die sie bei der verfassungsgebenden Versammlung erhalten hatte, zulegte (14,39%).206 Auch die UDP konnte ihre Stimmenzahl erhöhen (1,68%) und behielt ihren einzigen Abgeordneten.207 Der PS nominierte António Ramalho Eanes zu ihrem Kandidaten für die Präsidentschaftswahl.208 Soares erklärt dem deutschen Staatsminister Wischneswki, dass Eanes die Unterstützung des Militärs genieße, und sich dadurch ausgezeichnet habe, dass er den kommunistischen Infiltrations- und Putschversuchen energisch entgegentreten sei.209 Schließlich wurde Eanes am 27. Juni 1976 zum ersten demokratisch gewählten Präsidenten nach der Revolution.210 Damit war ein weiterer entscheidender Schritt zur Institutionalisierung der Demokratie in Portugal getan, der Ende des Jahres mit den Kommunalwahlen gefestigt werden sollte.
Im August 1976 stellte Premierminister Soares das neue 'Sieben-Punkte-Programm' der portugiesischen Regierung vor.211 Er erklärte, dass er die Demokratie in Portugal durch die Verwirklichung der Bürgerrechte festigen werde.212 In Bezug auf die Außenpolitik strebte er eine Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft an.213 Soares definierte die folgenden sieben Punkte als die Grundlage des ersten Regierungsprogramms des demokratischen Portugals:
1. Aufbau eines demokratischen Staates
2. Wirtschaftliche Planung und Reorganisation
3. Sicherstellung finanzieller Stabilität
4. Konsolidierung der Produktionsstrukturen und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
5. Förderung gerechter Einkommensverteilung
6. Verbesserung der Lebensqualität und Befriedigung der Grundbedürfnisse
7. Politik der nationalen Unabhängigkeit und internationalen Zusammenarbeit für den Frieden214
Mit der Verabschiedung dieses Programms wurde die Basis für die politische und wirtschaftliche Stabilität des Landes geschaffen. Das Programm legte den Schwerpunkt auf die Konsolidierung der Demokratie, wirtschaftliche Reformen und soziale Gerechtigkeit, während es gleichzeitig die außenpolitischen Ambitionen Portugals skizzierte, insbesondere den Wunsch nach einer Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft.
In den folgenden Jahren stand Portugal vor der Aufgabe, diese Programme erfolgreich umzusetzen und gleichzeitig seine Rolle in der internationalen Arena zu festigen. Daher wird im nächsten Abschnitt die politische Entwicklung Portugals weiter beleuchtet, insbesondere die Bestrebungen, die europäische Integration voranzutreiben.
6.2 Die politische Entwicklung
Nach der Revolution von 1974 begannen umfassende Veränderungen in Portugal, die das Land auf einen neuen politischen Kurs brachten. Genau zwei Jahre nach dem Militärputsch fanden am 25. April 1976 die ersten freien Wahlen nach Jahrzehnten der Diktatur statt. Diese Wahlen führten zur Ernennung von Mário Soares zum Premierminister und dem Sieg der Sozialistischen Partei. Soares stellte ein 'Sieben-Punkte-Programm' vor, das sowohl die Konsolidierung der Demokratie als auch die Ambitionen zur europäischen Integration umriss. Diese Entwicklungen ebneten den Weg für Portugals Integration in die Europäische Gemeinschaft und beeinflussten die politische Stabilität des Landes.
6.2.1 Die Europäische Gemeinschaft
Bereits im Jahr 1971 nahm Portugal Verhandlungen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft auf, um eine mögliche Mitgliedschaft zu erlangen. Diese Bestrebungen wurden jedoch aufgrund des bestehenden totalitären Regimes und der wirtschaftlichen Rückständigkeit des Landes, das zu dieser Zeit als das ärmste in Europa galt, zunächst abgelehnt. Nach dem Umsturz des Estado Novo wurde das Ziel einer Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft greifbarer. Das Auswärtige Amt beschrieb diese Bemühungen wie folgt:
„Der von der Sozialistischen Partei unter Mário Soares gebildeten Regierung kommt das große Verdienst zu, bereits kurz nach der Revolution eine weitsichtige und vorausschauende Politik in Richtung auf Europa, zur Entwicklung und Stärkung der Beziehungen Portugals zur Europäischen Gemeinschaft eingeleitet zu haben […].“215
Anfang März 1976 organisierte das von Brandt ins Leben gerufene Komitee eine Konferenz in Porto mit dem Titel „Europa mit uns“, in welcher es hauptsächlich um die (wirtschaftliche) Unterstützung der Sozialistischen Partei Portugals ging.216 Portugal war auf dem Wege der politischen Stabilität, welche den Weg zur Europäischen Gemeinschaft erleichtern sollte. Die erste außenpolitische Priorität der portugiesischen Regierung sei der EG-Beitritt.217 Die Vorbeitrittshilfe der zukünftigen Partner sollte die wirtschaftlichen Voraussetzungen verbessern und Übergangsschwierigkeiten verringern.
Im Jahr 1977 reichte das portugiesische Außenministerium dann einen erneuten Antrag auf den Beitritt Portugals zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) ein.218 Mit dem Einzug der Demokratie in Griechenland, Portugal und Spanien sei es, laut Sánchez, nur eine Frage der Zeit gewesen, bis diese Länder an die Tür der EWG klopften.219 Dank der wirtschaftlichen Unterstützung der Bundesrepublik konnte Portugal seine wirtschaftlichen Verhältnisse an die von der Europäischen Gemeinschaft geforderten Bedingungen angleichen.
Sozialdemokrat Hans-Jürgen Wischnewski erinnert am 07.12.1984 in einer Rede im Bundestag an Deutschlands Versprechen gegenüber Portugal.220 Er betonte, dass Deutschland sich immer dafür ausgesprochen hätten, Portugal und Spanien in die Europäische Gemeinschaft aufzunehmen.221 Er führte weiter aus, dass beide Länder zur Demokratie gefunden hätten und es gelungen sei, den Demokratisierungsprozess zu festigen.222 Wischnewski erklärte zudem, dass sie sich in diesem Fall selbstverständlich daran beteiligen würden die notwendigen Lasten zu tragen, da sie wüssten, dass dies mit Lasten verbunden sei.223 Wie in Kapitel 5.2 erwähnt, leistete die Bundesrepublik einen großen finanziellen Beitrag. Mithilfe dieser Finanzleistungen konnte Portugal sein wirtschaftliches Entwicklungsniveau an die Bedingungen der EWG angleichen.
Insgesamt erstreckten sich die Verhandlungen über einen möglichen Beitritt von 1977 bis 1985. Am 08. Mai 1985 entschied sich die Europäische Gemeinschaft, Portugal und Spanien zum Januar 1986 in die EWG aufzunehmen.224 Der Vertrag wurde am 12. Juni 1985 feierlich in Lissabon unterzeichnet. Diese Entscheidung war von der Überzeugung getragen, „dass die dritte Erweiterung der Gemeinschaft ihrem Gründungsauftrag voll entspricht“.225 Durch einen engeren Zusammenschluss der europäischen Völker, soll weiterhin Frieden und Freiheit auf dem Kontinent gewahrt werden.226
Der Beitritt Portugals zur Europäischen Gemeinschaft erfolgte schließlich am 1. Januar 1986 und festigte nicht nur die Demokratie in Portugal, sondern stärkte auch die demokratischen Werte in ganz Europa. Dieser Schritt markierte das finale Kapitel in Portugals Übergang zum demokratischen Rechtsstaat und sicherte die Zukunft dieser neuen politischen Ordnung. Auch die FES entschied sich für den schrittweisen Abbau ihrer Projekte auf der Iberischen Halbinsel.227 Ana Mónica Fonseca betont in ihrer Doktorarbeit die Bedeutung des Komitees für Freundschaft und Solidarität mit Demokratie und Sozialismus in Portugal, bei der Beeinflussung europäischer Regierungen und der Sicherstellung wirtschaftlicher Unterstützung für Portugal. Sie hebt hervor, wie dieses Komitee einen maßgeblichen Einfluss auf politische Entscheidungsträger und die wirtschaftliche Dimension hatte, die für den Beitritt zur EWG erforderlich waren.228
Auch Sabine Eichhorn stellt fest, dass der größte Erfolg in der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Portugal der Beitritt Portugals zu der Europäischen Gemeinschaft war.229 Die Unterzeichnung wurde „mit einer beeindruckenden Zeremonie“ im Mosteiro dos Jerônimos, in Lissabon besiegelt.230 Als Staatspräsident war Mário Soares einer der Unterzeichner. Von deutscher Seite war ebenfalls Außenminister Genscher anwesend.231
6.2.2 Die Regierungsstabilität
In den frühen Jahren der konstitutionellen Regierungen gab es eine hohe politische Instabilität, die zu einer kurzen Amtszeit der Regierungen führte. Ende Juni 1976 wird General Ramalho Eanes, unterstützt von PS, PSD und CDS, zum Staatspräsidenten Portugals gewählt.232 Am 8. Dezember 1977 wurde Premierminister Soares mit der Bildung der ersten verfassungsmäßigen Regierung als Minderheitsregierung beauftragt.233 Diese Regierung konzentrierte sich auf die Festigung der demokratischen Einrichtungen und die internationale Unterstützung zur Bewältigung der Wirtschafts- und Finanzkrise.234 Am 30. Januar 1978 bildete Soares die zweite Regierung in Zusammenarbeit mit dem CDS.235 Doch am 23. Juli 1978 zog der CDS seine Minister zurück, weil der Landwirtschaftsminister der PS eine Agrarreformpolitik verfolgte, die den Kommunisten zu sehr entgegenkommt.236 Präsident Eanes entließ daraufhin Soares und ernannte den unabhängigen Nobre da Costa zum Premierminister.237 Diese Expertenregierung scheiterte jedoch am Widerstand des Parlaments. Am 22. November 1978 übernahm die vierte Regierung unter dem unabhängigen Premierminister Mota Pinto ihr Amt.238 Dennoch scheiterte auch diese Regierung an mangelnder Unterstützung im Parlament und trat am 6. Juni 1979 zurück.239 Präsident Eanes ernannte daraufhin Lurdes Pintasilgo zur Premierministerin, um bis zu den Wahlen am 2. Dezember 1979 zu regieren.240 Die Regierungskrisen von 1978 waren das Resultat aus der Unfähigkeit der Parteien zur Koalition. Erst vor den Wahlen am 2. Dezember 1979 schloßen sich PSD, CDS und PPM zur "Aliança Democrática" (AD) zusammen und gewannen die absolute Mehrheit.241 Premierminister Sá Carneiro strebte eine politische Polarisierung an, um die Wähler zwischen der "freiheitlichen und demokratischen" AD und der "marxistischen" Wahlfront "Frente Republicana Socialista" (FRS) wählen zu lassen.242 Kurz vor den Präsidentschaftswahlen starb Sá Carneiro bei einem Flugzeugabsturz.243 Am 7. Dezember 1980 wählten die Portugiesen mit großer Mehrheit General Ramalho Eanes für eine zweite Amtsperiode.244 Mit Beginn des Jahres 1981 trat Portugal in eine neue Phase der politischen Entwicklung ein. Zum ersten Mal seit der Revolution hatte das Land eine stabile Regierung mit solider Mehrheit. Der Staatspräsident war ebenfalls mit überzeugender Mehrheit wiedergewählt worden und galt als „Garant der Demokratie“.245 Die erste außenpolitische Priorität der portugiesischen Regierung sei der EG-Beitritt.246 Die Vorbeitrittshilfe der zukünftigen Partner sollte die wirtschaftlichen Voraussetzungen verbessern und Übergangsschwierigkeiten verringern. Die scheinbare Stabilität war jedoch nur von kurzer Dauer. Am 10. August 1981 trat Premierminister Francisco Pinto Balsemão wegen innerparteilicher Konflikte in der Sozialdemokratischen Partei zurück.247 Die achte Regierung wurde am 4. September 1981 gebildet und bestand aus einer Koalition der Sozialdemokratischen Partei, des Sozialdemokratischen Zentrums und der Monarchistischen Volkspartei.248 Auch diese Regierung endete mit dem Rücktritt Balsemãos im Juni 1983.249 Im Juni 1983 trat Mário Soares sein Amt als Premierminister an.250 Die Regierung bestand aus einer Koalition zwischen der Sozialistischen Partei und der Sozialdemokratischen Partei.251 Diese wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Wahlen vom 25. April 1983 gebildet.252 Im November 1985 stürzte die Regierung nach Unstimmigkeiten zwischen Parteien.253 Die politische Situation stabilisierte sich mit der neuen Regierung unter Aníbal Cavaco Silva254 und dem Beitritt Portugals zur Europäischen Union. Die Parteienlandschaft zeigte eine gewisse Kontinuität, obwohl es auch Veränderungen gab, insbesondere in den Koalitionen.
Abb. 4: Konstitutionelle Regierungen Portugals
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an von Rahden, Manuel (1997)
Daten entnommen aus: República Portuguesa – Governos Anteriores
Aktuell herrscht in Portugal eine bemerkenswerte politische Instabilität, die durch jüngste Ereignisse verschärft wurde. Die dritte Regierung unter Premierminister António Costa war im Jahr 2023 von verschiedenen politischen Skandalen geprägt. Im November eskalierten die Ereignisse, als die Polizei im Rahmen der „Operation Influencer“ die Residenz des Premierministers sowie 42 weitere Orte, darunter mehrere Ministerien, durchsuchte.255 Dabei wurden fünf Personen festgenommen, darunter der Kabinettschef von António Costa.256 Minister João Galamba wurde als formeller Verdächtiger benannt, und Costa selbst wurde wegen Korruption im Zusammenhang mit Lithiumabbau, einem grünen Wasserstoffprojekt und einem Rechenzentrumsprojekt in Sines untersucht.257 Nach einem Treffen mit Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa im Palácio de Belém entschied sich Costa am 08. Dezember 2023 zum Rücktritt und erklärte, nicht erneut kandidieren zu wollen.258 Der Rücktritt des Premierministers António Costa infolge der schwerwiegender Korruptionsvorwürfe hat eine bedeutende Lücke in der politischen Führung des Landes hinterlassen. Staatspräsident Rebelo de Sousa zog die Wahlen vor und am 10. März 2024 gab es neue Wahlen für die Assembleia da República.259
Abb. 5: Anzahl der Nichtwähler bei Wahlen der Assembleia da República
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Quelle: PORDATA
Die jüngste Wahl hat einen deutlichen Anstieg der Rechtsextremisten ins Parlament gebracht. Ihre Sitzanzahl hat sich von 12 auf 48 vervierfacht, wodurch sie nun als dritte politische Kraft im Land agieren.260 Die neue Regierung unter der Aliança Democrática AD (Demokratische Allianz) ist eine Minderheitsregierung. Die politische Instabilität wird von einem kontinuierlichen Rückgang der Wahlbeteiligung begleitet.261 Im Jahr 2019 erreichte die Zahl der Nichtwähler ihren Höhepunkt.262 Infolgedessen steht Portugal vor großen Herausforderungen in Bezug auf die Wahrung der politischen Stabilität und die Gewährleistung eines demokratischen Regierungssystems.
7. Entwicklung der deutsch-portugiesischen Beziehungen
Im vorherigen Kapitel wurde detailliert der Weg Portugals zur Demokratie nach der Nelkenrevolution beleuchtet, einschließlich der politischen, verfassungsrechtlichen und institutionellen Entwicklungen, die das Land bis zur Etablierung einer semipräsidentiellen Republik führten. Die Beziehung zwischen Deutschland und Portugal spielte dabei eine wesentliche Rolle. Die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Portugal haben eine lange Geschichte, die durch eine Vielzahl politischer, wirtschaftlicher und kultureller Interaktionen geprägt ist. Im Verlauf dieser Beziehung hat die Partnerschaft zwischen Deutschland und Portugal aktiv zum Demokratisierungsprozess von Portugal beigetragen. Nun gilt es, diese einflussreiche Partnerschaft genauer zu betrachten, insbesondere ihre Entwicklung seit den 1970er Jahren und ihren Beitrag zur Demokratisierung Portugals, während sowohl politische als auch kulturelle Interaktionen zwischen den beiden Ländern einen bedeutenden Einfluss ausübten.
7.1 Bewertung des Beitrags der bilateralen Beziehungen
Die diplomatischen Beziehungen zwischen dem deutschen Reich und Portugal wurden erstmals im Jahre 1871 etabliert.263 Mit dem Beginn des ersten Weltkrieges wurden die diplomatischen Beziehungen zunächst wieder aufgehoben, und erst im August 1952 wieder aufgenommen.264 Es handelte sich vor allem um wirtschaftlich und militärische Handelsbeziehungen.265 Das Verteidigungsministerium bot seine Hilfe an, um die portugiesischen Streitkräfte durch die Bereitstellung von Flugzeugen, Schiffen und anderem Equipment zu modernisieren.266 Zusätzlich bot Deutschland logistische Unterstützung sowie technische und taktische Schulungen für portugiesische Streitkräfte an. Die politischen Beziehungen litten vor der Revolution unter den undemokratischen Verhältnissen in Portugal und besonders unter der Weigerung, den Überseegebieten die Selbstbestimmung zu gewähren. Nach der Revolution fielen diese Hindernisse jedoch, was den Weg für eine langsame Annäherung ebnete.
Diese Annäherung begann zunächst auf indirektem Wege, insbesondere durch den Austausch zwischen Parteien und Stiftungen. Das gute Verhältnis zwischen Willy Brandt und Mário Soares sollte grundlegend für die Aufnahme der bilateralen Beziehungen sein. In einem Gespräch mit Brandt, Staatssekretär Frank, Hans-Jürgen Wischnewski, dem amerikanischen Botschafter Hillenbrand, dem sowjetischen Botschafter Falin und dem jugoslawischen Botschafter am 03. Mai 1974 erklärte Soares, dass Portugal an einer der engsten Beziehungen zur Bundesrepublik interessiert sei. Dabei seien die Kontakte, die die SPD seit Jahren mit ihm unterhalte, eine gute Grundlage.267
Der Referatsleiter, der Politischen Abteilung 2 des Auswärtigen Amts, Dr. Munz verfasste am 28. April 1975 einen Brief, in welchem er die „Portugalpolitik“ der Bundesrepublik thematisierte. Er berichtete unter anderem über den Besuch des anderen Referatsleiters Dr. Laub Ende April 1975 in Lissabon. Es sei seine Aufgabe gewesen mit der Botschaft über Maßnahmen zur Stärkung der demokratischen Kräfte zu sprechen.268
Das Referat 203 des Auswärtigen Amtes äußerte sich am 27. April 1981 wie folgt zu dem Stand der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Portugal: „[…] Seit der Revolution vom 25.4.74 in Portugal hat sich ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Portugal herausgebildet. […] Meinungsverschiedenheiten auf politischem Gebiet gibt es praktisch nicht. Portugal erkennt dankbar Interesse und tatkräftigen Beistand der Bundesrepublik in der kritischen Phase nach seiner nachrevolutionären Entwicklung an.“
Im Juni 1981 betonte der portugiesische Premierminister Francisco Pinto Balsemão in einem Gespräch mit Hans-Dietrich Genscher, dass Deutschland als erster Alliierter die Lage Portugals verstanden und schnell gehandelt habe.269 Andere hätten viel länger gebraucht, was unvergesslich sei.270 Im weiteren Verlauf des Gespräches habe er noch herausstellen wollen, dass die Bundesrepublik Deutschland sich am stärksten für einen Beitritt Portugals für die Europäische Gemeinschaft einsetzt habe.271
Mittlerweile sind Deutschland und Portugal enge Partner, sowohl bilateral als auch innerhalb der EU. Im Jahr 2007 wurde der „Vertrag von Lissabon“ verabschiedet, welcher unter anderem während der deutschen Ratspräsidentschaft vorbereitet wurde.272 Bis heute folgen die deutsche und portugiesische EU-Ratspräsidentschaft aufeinander, welches einen Rahmen für eine enge Zusammenarbeit bildet.273 Seit 2019 gibt es einen „deutsch-portugiesischen Aktionsplan“, der darauf abzielt, gemeinsame Projekte zu entwickeln, von Europapolitik bis hin zu Mobilität und Verkehr.274 Das Deutsch-Portugiesische Forum findet seit 2013 statt und fördert den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, mit Schwerpunkten auf Migration und Wettbewerbsfähigkeit im Zusammenhang mit dem Klimawandel.275 Seit 2021 vergeben beide Länder jährlich den „Deutsch-Portugiesischen Journalismuspreis“, der besondere journalistische Beiträge über die jeweiligen Länder auszeichnen soll.276
7.2 Bewertung des Beitrags der Sozialdemokraten
Auch gegenwärtig wird die Rolle der deutschen Sozialisten in der Demokratisierung Portugals noch in Portugal thematisiert. Noch im November 2023 besuchte der ehemalige Premierminister António Costa Bad Münstereifel, um an die „Freundschaft“ zwischen Mário Soares und Willy Brandt, sowie an die Gründung der Sozialistischen Partei zu erinnern. Er bedankte sich bei der SPD und der Friedrich-Ebert-Stiftung und betonte die Bedeutsamkeit der Unterstützung durch die Bundesrepublik, für Portugal nach dem 25. April. Die Gründung der Sozialistischen Partei Portugals sei einer der Träger für die Demokratie in Portugal und Europa gewesen.277 Es seien Werte, wie sie von Mário Soares und Willy Brandt stets verteidigt wurden, weil sie es „gespürt haben in einer Diktatur zu leben, die Freiheit zu verlieren und im Exil lebten“.278 Es sei eine Generation gewesen, welche den Wert von Demokratie und Freiheit wirklich verstanden und verspürten.279
Der Historiker Antonio Muñoz Sánchez ist einer der wenigen Fachexperten im Bereich der Rolle der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Portugal, und die daraus resultierende Demokratie. In seinem Buch, geschrieben gemeinsam mit Peter Birle schreibt er: „ Man ist sich darüber einig, dass der deutschen Sozialdemokratie mit ihrer konzertieren Aktion der Bundesregierung, der SPD und der FES ein Ehrenplatz gebührt in dieser in Europa unvergleichlichen Geschichte ausländischer Hilfe für eine politische Organisation, die beim Sieg der Demokratie in ihrem Land eine Schlüsselrolle gespielt hat.“280
Die enge Zusammenarbeit zwischen deutschen und portugiesischen Sozialdemokraten hatte langfristige Auswirkungen auf die politische Stabilität und die demokratische Entwicklung Portugals. Durch die Vermittlung demokratischer Werte und politischer Strategien half die SPD der PS, eine moderne, demokratische Partei zu werden, die maßgeblich zur Konsolidierung der Demokratie in Portugal beitrug. Diese Beziehung setzte sich in den folgenden Jahrzehnten fort und führte zu einem intensiven politischen und kulturellen Austausch zwischen beiden Ländern.
8. Schlussfolgerung
Abschließend lässt sich sagen, dass die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Portugal seit 1973 maßgeblich zur Demokratisierung Portugals beigetragen haben. Die umfassende politische und wirtschaftliche Unterstützung durch die Bundesrepublik Deutschland ermöglichte es Portugal, einen erfolgreichen Übergang zur Demokratie zu vollziehen und sich als stabiler demokratischer Staat in Europa zu etablieren. Diese Partnerschaft zeigt, wie wichtig internationale Zusammenarbeit für die Förderung von Demokratie und Stabilität sein kann.
Die Fragestellung „Welchen Beitrag haben die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Portugal seit 1973 zur Demokratisierung Portugals geleistet und welche Rolle spielten die deutschen Sozialdemokraten dabei?“, wurde anhand einer umfassenden Literaturrecherche und einer ausführlichen Inhaltsanalyse beantwortet.
Zunächst wurde die Theorie der Sozialdemokratie und deren Hintergründe im Kontext der Abschlussarbeit erläutert. Danach erfolgte eine Einführung in den Begriff des Faschismus und ein Vergleich der politischen Umstände in beiden Ländern. Zwei zentrale Persönlichkeiten wurden identifiziert, die im weiteren Verlauf der Arbeit von Bedeutung waren. Mithilfe von Quellen und Literatur wurde die Zusammenarbeit zwischen den deutschen und portugiesischen Sozialisten dargestellt. Die Rolle Deutschlands nach dem Regimeumsturz in Portugal wurde anhand von Archivmaterial des Auswärtigen Amtes beleuchtet und die Begleitung im Transitionsprozess analysiert. Abschließend wurde ein Vergleich der bilateralen Beziehungen von damals und heute gezogen. Die Ergebnisse der Literaturrecherche und Inhaltsanalyse bestätigen die Hypothese, dass die umfangreiche politische und wirtschaftliche Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung und Demokratisierung Portugals geleistet hat.
Bereits ein Jahr vor der Revolution wurde in Bad Münstereifel die Sozialistische Partei Portugals gegründet. Am 25. April 1974 kam es schließlich zur Revolution. Nach der Nelkenrevolution befand sich Portugal in einer politisch unsicheren Phase, die durch die Unterstützung Deutschlands stabilisiert werden konnte. Die deutsche Bundesregierung, insbesondere die Sozialdemokraten und die Friedrich-Ebert-Stiftung, leisteten dabei einen entscheidenden Beitrag. So wurde Portugal durch finanzielle Mittel und politische Unterstützung auf den Weg zur Demokratie gebracht. Dieser Prozess wurde mit dem Beitritt Portugals in die Europäische Gemeinschaft in 1986 gefestigt.
Aktuell steht Portugal jedoch vor erheblicher politischer Instabilität. Die Skandale rund um Ex-Premierminister Costa und sein Rücktritt im Dezember 2023 haben das politische System erschüttert. Die vorgezogenen Wahlen im März 2024 führten zu einem signifikanten Anstieg der rechtsextremen Parteien im Parlament und zur Bildung einer Minderheitsregierung. Diese Entwicklungen haben zu einer Zunahme der politischen Unsicherheit beigetragen. Zusätzlich spiegelt sich in einem Rückgang der Wahlbeteiligung ein besorgniserregender Trend wider. Innerhalb der Gesellschaft gibt es zunehmend antidemokratische Positionen, die potenziell eine Bedrohung für die demokratischen Strukturen darstellen könnten.
Die aktuellen Herausforderungen in Portugal unterstreichen die fortdauernde Relevanz internationaler Unterstützung und Zusammenarbeit. Die Lehren aus der deutschen Unterstützung für die Demokratisierung Portugals könnten wertvolle Einsichten für die Bewältigung der gegenwärtigen politischen Krise bieten. Trotz dieser neuen Erkenntnisse, die in dieser Arbeit dargelegt wurden, bleiben mehrere Fragen offen, die zukünftige Forschung, eventuell im Rahmen einer Master- oder Doktorarbeit, adressieren sollte. Eine zentrale Forschungslücke besteht in der detaillierten Untersuchung, wie die Deutsche Demokratische Republik oder auch andere Länder die Demokratisierung in Portugal beeinflusst haben. Dabei könnte der Fokus auf einem Vergleich mit der Rolle der Bundesrepublik Deutschland liegen, um ein umfassenderes Bild der internationalen Unterstützung und deren Effizienz zu erhalten. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gab es in den Ansätzen der verschiedenen unterstützenden Staaten, und welche Lehren können daraus für zukünftige Demokratisierungsprozesse gezogen werden?
Die Frage nach der Rolle der portugiesischen Zivilgesellschaft bleibt ebenfalls weitgehend unbeantwortet. Künftige Forschungen könnten sich darauf konzentrieren, wie lokale Akteure und Organisationen in den Demokratisierungsprozess eingebunden waren. Zudem wäre es wichtig zu untersuchen, inwieweit sie durch die internationale Unterstützung gestärkt oder möglicherweise in ihrer Autonomie eingeschränkt wurden. Methodisch könnten zukünftige Studien von einer Kombination aus qualitativen und quantitativen Ansätzen profitieren. Während qualitative Interviews und Fallstudien tiefergehende Einblicke in die individuellen und institutionellen Erfahrungen bieten könnten, würden quantitative Analysen helfen, die breiteren gesellschaftlichen Trends und Entwicklungen zu erfassen.
Die praktischen Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Insbesondere könnten internationale Organisationen und politische Akteure, die an der Förderung von Demokratisierungsprozessen beteiligt sind, von den Ergebnissen profitieren. Ein besseres Verständnis der effektiven Unterstützungsmethoden könnte zur Entwicklung gezielterer und effizienterer Strategien in anderen Ländern beitragen, die sich in einer ähnlichen Übergangsphase befinden.
Schließlich bleibt auch die theoretische Weiterentwicklung ein wichtiges Ziel. Zukünftige Forschung könnte sich darauf konzentrieren, wie die Erkenntnisse über die Unterstützung der Demokratisierung in Portugal zur Weiterentwicklung theoretischer Modelle der internationalen Demokratieförderung beitragen können. Dabei könnte untersucht werden, ob und wie bestehende Theorien angepasst oder erweitert werden müssen, um die spezifischen Dynamiken und Herausforderungen solcher Prozesse angemessen abzubilden.
Die Erhaltung der Demokratie stellt sowohl Deutschland als auch Portugal vor bedeutende Herausforderungen. Eine zunehmende Anzahl von Wählern entscheidet sich für populistische und extremistische Parteien und gefährdet damit unsere Demokratie. Als Kind habe ich die Bedeutung von Demokratie und Freiheit erfahren – ein Privileg, welches meine Familie nicht immer genießen durfte. Es ist die Pflicht unserer Gesellschaft, die Vergangenheit lebendig zu halten und aus ihr zu lernen. Die Erinnerungen an den langjährigen Kampf um Demokratie müssen bewahrt werden, denn nur durch die Wertschätzung der Geschichte können die Fehler der Vergangenheit vermieden werden.
„25 de Abril sempre, fascismo nunca mais!”-
“25. April für immer, Faschismus nie wieder!“
9. Quellen- und Literaturverzeichnis
9.1 Quellen
Archiv der sozialen Demokratie (Friedrich-Ebert-Stiftung):
- FES-HA: 12783
- FES-HA: 2972
- FES-HA: 2907
Espólio Documental Manuel Alfredo Tito de Morais:
- Caixote XIX/Pasta XII/Doc XLVI
Parlamentsarchiv – Deutscher Bundestag:
- BT-Plenarprotokoll 09/130, S. 8070-8071
- BT-Plenarprotokoll 10/109 S. 8155
Politisches Archiv des Auswärtigen Amt:
- B 26-ZA/101436
- B 26-ZA/101437
- B 26-ZA/110242
- B 26-ZA/123286
- B 26-ZA/124902
- B 26-ZA/173595
- B 26-ZA/123286
- B 52-ZA/121355
- B 52-ZA/121358
- BAV 209-ROMDIP/26110
- B 26-REF. 206_IA4_408
- B 26-ZA/1249002
- B 2-B STS/224
- B 150_0506
9.2 Literatur
AHK Portugal - Deutsch-Portugiesische Industrie- und Handelskammer (2022): 60 Jahre Goethe-Institut Lissabon: mit Blick in die Zukunft, [online] https://www.ccila-portugal.com/infothek/news/news-details/60-jahre-goethe-institut-lissabon-mit-blick-in-die-zukunft. [abgerufen am 24.07.2024]
Almeida, R. (2023): António Costa presta “agradecimento e tributo” na Alemanha aos fundadores do PS | Partido Socialista, Portal PS, [online] https://ps.pt/antonio-costa-presta-agradecimento-e-tributo-na-alemanha-aos-fundadores-do-ps/. [abgerufen am 16.06.2024]
Arquivo Histórico: VII Governo constitucional [online] https://www.historico.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-constitucionais/gc07.aspx. [abgerufen am 24.06.2024]
ARTE: Portugal - Mit Nelken gegen die Diktatur [online] https://www.arte.tv/de/videos/116022-000-A/portugal-mit-nelken-gegen-die-diktatur/. [abgerufen am 20.05.2024]
Assembleia da República: As legislaturas da Assembleia da República: [online] https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/dias-democracia-art4.aspx. [abgerufen am 20.06.2024]
Assembleia da República: Primeiras Eleições 1976: [online] https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/primeiras-eleicoes-ar-1976.aspx. [abgerufen am 20.06.2024]
Auswärtiges Amt: Deutschland und Portugal: bilaterale Beziehungen, Auswärtiges Amt, [online] https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/portugal-node/bilateral/210200. [abgerufen am 10.07.2024]
Azevedo, C. et al (2021): Entre Salazar e Caetano: A ação política e propagandística do Estado Novo na RTP . Livros ICNOVA, (2)
Bandeira, A. R. (1976). The Portuguese Armed Forces Movement: Historical Antecedents, Professional Demands, and Class Conflict. Politics & Society, 6(1), 1-56.
Birle, P. & Sánchez, A. (2020): Partnerschaft für die Demokratie. Die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Brasilien und Portugal.
Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung: Biografie, [online] https://www.helmut-schmidt.de/helmut-schmidt/biografie. [abgerufen am 08.06.2024]
Bundeszentrale für Politische Bildung (2021): Deutsche Teilung, bpb.de, [online] https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-in-einfacher-sprache/298917/deutsche-teilung/. [abgerufen am 20.05.2024]
Bundeszentrale für Politische Bildung (2024): Etappen der Parteigeschichte der SPD | Parteien in Deutschland | bpb, bpb.de, [online] https://www.bpb.de/themen/parteien/parteien-in-deutschland/spd/42082/etappen-der-parteigeschichte-der-spd/. [abgerufen am 24.05.2024]
Caetano, Marcelo (1974): Depoimento
Deutsch-Portugiesische Gesellschaft e.V. – Allgemeine Infos: [online] https://dpg.berlin/deutsch-portugiesische-gesellschaft-allgemeine-informationen/. [abgerufen am 01.07.2024]
Deutsche Botschaft Lissabon, [online] https://lissabon.diplo.de/pt-de/themen/01-Willkommen. [abgerufen am 02.08.2024]
Diário da República: Mapa Oficial n.º 2-A/2024, de 23 de março
Eisfeld, Rainer (1984): Sozialistischer Pluralismus in Europa: Ansätze und Scheitern am Beispiel Portugals.
Eisfeld, Rainer (2023): Portugals EG-Beitritt. Politische und wirtschaftliche Probleme,bpb.de,[online] https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/archiv/532722/portugals-eg-beitritt-politische-und-wirtschaftliche-probleme/. [abgerufen am 19.06.2024]
Ferraz, R. (2019): Grande Guerra e Guerra Colonial: Quanto Custaram aos Cofres Portugueses? in: Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia
Fonseca, Ana Mónica (2011): É Preciso Regar os Cravos!: A República Federal da Alemanha e a Transição democrática portuguesa: 1974-1976.
Fonseca, Ana Mónica/Universidade NOVA de Lisboa (2006): Dez anos de relações luso-alemãs 1958-1968: POLÍTICA EXTERNA PORTUGUESA:
Frank, Mario (2003): Walter Ulbricht: eine deutsche Biografie.
Friedrich-Ebert-Stiftung: Friedrich Ebert - Biographie, Friedrich-Ebert-Stiftung, [online] https://www.fes.de/stiftung/friedrich-ebert/friedrich-ebert-biographie. [abgerufen am 24.05.2024]
Fundação Mário Soares: [online] https://fmsoaresbarroso.pt/mario_soares/biografia/ [abgerufen am 21.06.2024]
Fundação Mário Soares: A Europa connosco: [online] https://soares-europa.fmsoaresbarroso.pt/pt/europe_with_us_exhibit. [abgerufen am 19.06.2024]
Gallagher, T. (1984): Salazar’s Portugal: The "Black Book" on Fascism
Herr, Richard/António Costa Pinto (2012): The Portuguese Republic at One Hundred.
Jornal De Negócios (2023): É oficial: Marcelo formaliza demissão de Costa, [online] https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/e-oficial-marcelo-formaliza-demissao-de-costa. [abgerufen am 04.07.2024]
Kaiser, W., & Salm, C. (2009): Transition und Europäisierung in Spanien und Portugal Sozial-und christdemokratische Netzwerke im Übergang von. Archiv für Sozialgeschichte, 49, 259.
Kieninger, M. (2013): Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland : Wissenschaftliche Leiterin: Ilse Dorothee Pautsch. 1975 (M. Kieninger, M. Lindemann, & D. Taschler, Eds.). De Gruyter
Krell, Christian (2009): Sozialdemokratie und Europa: Die Europapolitik von SPD, Labour Party und Parti Socialiste, Springer-Verlag.
Louçã, António (2024): Uma ingerência discreta: a Alemanha federal e a revolução dos Cravos.
Meyer, Thomas (2005): Die Theorie der Sozialen Demokratie, in: Online Akademie Friedrich-Ebert-Stiftung.
Ministério Público (2023): Buscas e detenções | Departamento Central de Investigação e Ação Penal [online] https://dciap.ministeriopublico.pt/pagina/buscas-e-detencoes. [abgerufen am 04.07.2024]
Noack, Hans-Joachim (2013): Willy Brandt: Ein Leben, ein Jahrhundert
Office of the Historian: [online] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve15p2/d153. [abgerufen am 19.06.2024]
Pordata: Eleitores nas eleições para a Assembleia da República: total, votantes e abstenção [online] http://pordata.pt/portugal/eleitores+nas+eleicoes+para+a+assembleia+da+republica+total++votantes+e+abstencao-2181-178121 [abgerufen am 13.05.2024]
Pordata: Taxa bruta de mortalidade e taxa de mortalidade infantil: [online] https://www.pordata.pt/portugal/taxa+bruta+de+mortalidade+e+taxa+de+mortalidade+infantil-528. [abgerufen am 04.06.2024]
Portal Diplomático, Relações bilaterais / países / Alemanha: [online] https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/relacoesbilaterais/paises-geral/alemanha. [abgerufen am 24.07.2024]
Rádio Renascença (2023): Caso do lítio. Que negócios levaram Galamba a arguido e Costa a demitir-se? [online] https://rr.sapo.pt/especial/pais/2023/11/08/caso-do-litio-que-negocios-levaram-galamba-a-arguido-e-costa-a-demitir-se/354169/. [abgerufen am 04.07.2024]
República Portuguesa: Governo de Portugal, [online] https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/governos-anteriores. [abgerufen am 20.06.2024]
Rosas, F., & Moisel, C. (1997): Vom Ständestaat zur Demokratie : Portugal im zwanzigsten Jahrhundert (F. Rosas, Ed.)
Rother, B. (2021): Sozialdemokratie global Willy Brandt und die Sozialistische Internationale in Lateinamerika, S. 41-42
RTP Ensina (2021): Primeiro comunicado do Movimento das Forças Armadas: RTP Ensina, [online] https://ensina.rtp.pt/artigo/primeiro-comunicado-do-movimento-das-forcas-armadas/. [abgerufen am 16.05.2024]
Sablosky, J. (1995): Transnational Party Activity and Portugal‘s relations with the European Community
Sequeira, Rebecca/Friedrich-Ebert-Stiftung: Mário Soares - A Politician and President of Unwritten Constitutional Competences.
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Die SPD. Über uns und unsere Geschichte.: [online] https://www.spd.de/partei/geschichte. [abgerufen am 24.05.2024]
von Rahden, Manuel (1997): Portugiesische Zeitgeschichte: von der Nelkenrevolution bis zum Jahr 1997
Wildt, Michael (2012): Nationalsozialismus: Aufstieg und Herrschaft, in: Informationen Zur Politischen Bildung, Nr. 314.
Wörsching, M., Häusler, A. (2024): Faschismus: Begriff, Geschichte, Forschung. In: Virchow, F., Hoffstadt, A., Heß, C., Häusler, A. (eds) Handbuch Rechtsextremismus, S. 2-4
10. Anhang
10.1 Abbildungsverzeichnis
1. Mário Soares, Sabine Eichhorn und Helmut Schmidt in Bonn
2. Die wichtigsten ausländischen Kreditzusagen im Jahre 1979 in Millionen
3. Die provisorischen Regierungen Portugals
4. Konstitutionelle Regierungen Portugals
5. Anzahl der Nichtwähler bei den Wahlen der Assembleia da República
10.2 Interview mit Sabine Eichhorn
1. Was verbindet Sie mit der deutsch-portugiesischen Geschichte und warum ist diese Beziehung wichtig?
1972 nach Abschluss meines Studiums an der Universität Heidelberg bewarb ich mich als Dolmetscherin beim Sprachendienst des Auswärtigen Amtes. Interesse an einem Portugiesisch-Dolmetscher bestand dort nicht (Salazar-Diktatur in Portugal, Krieg in den Kolonien, Militärregime in Brasilien). Ich wurde 1973 als Dolmetscherin für Englisch eingestellt. Als der vorgesehene Einsatz bei den MBFR-Gesprächen in Wien nicht zustande kam, schlug der Leiter des Sprachendienstes meine Umschulung auf die rumänische Sprache vor. Die betreffende Sprachausbildung (Uni Linz, Uni Bukarest) war bereits im Gange, als die Revolution in Portugal ausbrach. Das Auswärtige Amt war nun froh, eine Dolmetscherin für Portugiesisch zu haben, und ich konnte in einem historischen Moment mit „meiner“ Fremdsprache arbeiten und mich mit meinen Kenntnissen einbringen – ein großes Glück!
2. Wie sind Sie Dolmetscherin geworden?
Nach dem Abitur verbrachte ich ein Jahr in den USA bei meiner amerikanischen Familie und studierte an der University of North Texas. Ich wurde ab und zu gebeten zu dolmetschen – z.B. bei Texas Instruments. Diese Tätigkeit schien mir zu liegen. Ich entschied mich für eine Ausbildung als Diplom-Dolmetscherin an der Universität Heidelberg (Deutsch: A = Muttersprache, Portugiesisch: B = 1.Fremdsprache, Englisch: C = 2. Fremdsprache).
An meiner amerikanischen Uni hatte ich Kontakt zu brasilianischen Studenten. Daher die Sprachkombination. Durch die Revolution in Portugal und die darauf folgende Unabhängigkeit der Kolonien (später auch das Ende des Militärregimes in Brasilien) bekam meine Tätigkeit als einzige Portugiesisch-Dolmetscherin des Sprachendienstes des Auswärtigen Amtes (der auch der Sprachendienst des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers/der Bundeskanzlerin ist) eine besondere Dimension und einen einzigartigen Sinn.
3. Welche Erinnerungen haben Sie an Mário Soares und Willy Brandt/Helmut Schmidt? Wie prägten sie die deutsch-portugiesischen Beziehungen?
Das Gespräch zwischen Mário Soares und Willy Brandt war das erste Treffen dieser Art nach der Revolution der Nelken und mein erster Dolmetscheinsatz auf dieser Ebene. Dass es sich um ein historisches Treffen handelte, war deutlich spürbar. Man begegnete sich mit großem Ernst, mit gegenseitigem Respekt und auch mit Vertrauen (die Sozialistische Partei Portugals war ja bereits im Jahr zuvor in Bad Münstereifel mit Unterstützung der SPD gegründet worden). Es war das letzte Treffen dieser Art von Bundeskanzler Willy Brandt, er trat wegen der Guillaume-Affäre wenige Tage später zurück. (In seinem Buch „Begegnungen und Einsichten“ erwähnt er Mário Soares auf Seite 629.)
Während der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt setzte sich die o.a. Einstellung gegenüber Portugal fort.
Der Glaube der deutschen Politik an eine demokratische Entwicklung in Portugal einschließlich eines Beitritts zu den Europäischen Gemeinschaften – verbunden mit entsprechendem Handeln - hat zur Stabilisierung der Lage nach der Revolution wesentlich beigetragen.
Nicht zu vergessen:
Bundeskanzler Helmut Schmidt traf Anfang August 1975 den damaligen portugiesischen Präsidenten Costa Gomes auf der KSZE-Konferenz in Helsinki (Verdolmetschung SE)
Ebenfalls im August 1975 führte der Bundeskanzler ein Gespräch mit dem damaligen Ministerpräsidenten der Provisorischen Regierung Vasco Gonçalves am Rande eines NATO-Gipfels in Brüssel (Verdolmetschung SE).
4. Wie beeinflussten die bilateralen Beziehungen langfristig die Demokratie in Portugal?
Dadurch dass Portugal durch die Weltbank der Status eines Entwicklungslandes zuerkannt wurde, wurden Projekte der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit durchgeführt (z.B. Hafenerweiterung), damals waren GTZ (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit) und KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) regelmäßig in Portugal vor Ort, auch die Parlamentarier (Bundestag und Assembleia da República) besuchten sich gegenseitig – einschließlich ihrer Präsidenten.
Die Liste der gegenseitigen Besuche von Kanzlern bzw. Premierministern und Präsidenten beider Länder ist ein weiterer eindrucksvoller Beleg für diesen intensiven Austausch.
Besonders hervorzuheben ist der Staatsbesuch von António Ramalho Eanes, des ersten demokratisch gewählten portugiesischen Präsidenten (76 – 86), bereits im Jahr 1977 in der Bundesrepublik Deutschland. (Dolmetscher SE)
Konkretes Handeln (s.o.) und die Aufwertung der Deutsch-Portugiesischen Industrie – und Handelskammer und ihrer Mitglieder, die Präsenz der politischen Stiftungen in Portugal und – nicht zu vergessen – die Arbeit des Goethe-Instituts in Lissabon haben ebenfalls zu der positiven politischen Entwicklung beigetragen.
Auch das von der Bundesregierung organisierte Treffen zwischen dem portugiesischen Außenminister Melo Antunes (während seines Bonn-Besuchs 1975 – Dolmetscher SE) und dem amerikanischen Außenminister Henry Kissinger auf Schloß Gymnich dürfte ein entscheidender Beitrag zur Demokratisierung in Portugal gewesen sein.
In Zeiten des Kalten Krieges bestand einige Zeit die Befürchtung, Portugal könne kommunistisch werden, auch weil die KP eine ernstzunehmende politische Kraft war.
5. Welche Erfolgsbeispiele gibt es in der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Portugal?
Der größte Erfolg ist die Etablierung der Demokratie in Portugal und deren Krönung durch den Beitritt Portugals zu den Europäischen Gemeinschaften im Jahr 1986 – mit einer beeindruckenden Zeremonie im Mosteiro dos Jerônimos. Mário Soares war - als Präsident - einer der Unterzeichner des Beitrittsvertrages. Von deutscher Seite war Außenminister Hans-Dietrich Genscher anwesend (Dolmetscher: SE)
Mário Soares – o pai da democracia, herói da liberdade e europeísta convicto – war zwei Mal Premierminister und zwei Mal Präsident seines Landes. Sein Staatsbesuch in der Bundesrepublik Deutschland 1988 war eine eindrucksvolle Würdigung seines Landes, seiner Person und der bilateralen Beziehungen. (Dolmetscher: SE)
Es folgten erfolgreiche EU-Ratspräsidentschaften Portugals, darunter als herausragender Erfolg der Abschluss des Vertrags von Lissabon. Die deutsche und die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft folgen stets aufeinander, so dass auch in diesem Rahmen eine enge Zusammenarbeit stattfand und bis heute stattfindet.
Der Bau des Centro Cultural de Belém (1992) als Sitz der portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft ist Ausdruck der Bedeutung, die Portugal seiner EU-Mitgliedschaft beimisst.
Bei den Treffen der EU-Mitgliedsstaaten sitzen die Vertreter Portugals und Deutschlands nebeneinander, ein Großteil der Kontakte zwischen beiden Ländern findet heute auf EU-Ebene statt.
6. Was kann man aus der deutsch-portugiesischen Geschichte lernen? Und warum sollte diese nicht in Vergessenheit geraten?
Rückblickend wird immer deutlicher, dass die portugiesische Revolution vom 25. April 74, die Nelkenrevolution, ein Glücksfall der Geschichte war. Mit Entschlossenheit, Mut und Besonnenheit gelang es, in einer äußerst kritischen Situation – in Portugal und in den Kolonien – eine Revolution zu planen, durchzuführen, ihre Folgen zu beherrschen und sie zum Erfolg zu führen – ein Land zurück in die Demokratie und in den Kreis der demokratischen Nationen – auf fast ganz und gar friedliche Weise. Die Menschen waren aufgefordert worden, zuhause zu bleiben, aber viele strömten in Lissabon auf die Straßen, um die Soldaten der Bewegung der Streitkräfte willkommen zu heißen – mit roten Nelken in der Hand. Ein beispielhaftes historisches Ereignis, das sich in diesem Jahr zum 50. Mal jährte und das es verdient, unabhängig von Jahrestagen auch außerhalb Portugals gewürdigt zu werden.
[...]
1 José Afonso (1964)
2 Vgl. PAAA - B 26 ZA 1249002, Portugal, die Bundesrepublik Deutschland und Europa
3 Vgl. Ebd.
4 Ebd.
5 Vgl. Die SPD. Über uns und unsere Geschichte.
6 Vgl. Krell (2009), S. 80
7 Vgl. Ebd. S. 80
8 Vgl. Ebd. S. 80; Bundeszentrale für politische Bildung; Etappen der Parteigeschichte der SPD (2024)
9 Vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung: Friedrich Ebert
10 Vgl. Ebd.
11 Vgl. Ebd.
12 Vgl. Meyer, T. (2005), S. 1-2
13 Vgl. Wörsching, M., Häusler, A. (2024), 2-4
14 Vgl. Ebd.
15 Vgl. Ebd.
16 Vgl. Ebd.
17 Ebd.
18 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung: Weimarer Republik
19 Vgl. Ebd.
20 Vgl. Deutscher Bundestag: Machtübernahme der Nationalsozialisten
21 Vgl. Ebd.
22 Vgl. Ebd.
23 Vgl. Ebd.
24 Vgl. Ebd.
25 Vgl. Ebd.
26 Vgl. Ebd.
27 Bundeszentrale für politische Bildung: Deutsche Teilung
28 Vgl. Ebd.
29 Vgl. Frank, Mario (2003), S. 234
30 Vgl. Noack, Hans-Joachim (2013), S. 161
31 Vgl. Herr/Pinto (2012, S. 2
32 Vgl. Azevedo et. al. (2021), S. 408
33 Vgl. PAAA – B26 ZA 101437: Portugal– binnenwirtschaftliche Lage (1974)
34 Vgl. Herr/Pinto (2012), S. 73
35 Vgl. Ebd. S. 7
36 Vgl. Ebd. S. 73
37 Vgl. Azevedo et. al. (2021), S. 408
38 Vgl. Ebd. S. 409
39 Vgl. Gallagher (1983), S. 486
40 Vgl. Pordata: Taxa bruta de mortalidade e taxa de mortalidade infantil
41 Vgl. PAAA- B26 ZA 101437: Gespräch zwischen Willy Brandt und Mário Soares am 03. Mai 1974 in Bonn
42 Vgl. Ferraz, R. (2019)
43 Vgl. PAAA – B 26-REF. 206_IA4_408: Drahtbericht Nr. 401 vom 27.11.1968
44 Vg. Ebd.
45 Vgl. Ebd.
46 Vgl. Ebd.
47 Vgl. Ebd.
48 Vgl. von Rahden, Manuel (1997), S.217
49 Vgl. Ebd. S. 217
50 Vgl. Ebd. S. 218
51 Vgl. Noack, Hans-Joachim (2013), S.43
52 Vgl. Ebd. S. 28 ff.
53 Vgl. Ebd. S.42
54 Vgl. Ebd. S.39
55 Vgl. Ebd. S. 43
56 Vgl. Ebd. S. 45
57 Vgl. Ebd. S. 54
58 Vgl. Ebd. S. 50
59 Vgl. Ebd. S. 43
60 Vgl. Ebd. S. 76
61 Vgl. Ebd. S. 89
62 Vgl. Ebd. S. 10-14
63 Vgl. Ebd. S.128
64 Vgl. Ebd. S.132
65 Vgl. Ebd. S. 132-133
66 Vgl. Ebd. S. 170-171
67 Vgl. Ebd. S. 170-171
68 Vgl. Ebd. S. 170-171
69 Vgl. Ebd. S. 172-173
70 Vgl. Ebd. S.173
71 Vgl. Ebd. S. 173
72 Vgl. Ebd. S. 183
73 Vgl. Ebd. S 188
74 PAAA - B 26 ZA 173595, Portug. Präsidentschaftswahlen am 13. Januar 1991
75 Vgl. PAAA – B 26 ZA 124902, Biographical Summary Mário Soares
76 Vgl. Ebd.
77 Vgl. Fundação Mário Soares
78 Vgl. Ebd.
79 Vgl. Sequeira/Friedrich-Ebert-Stiftung, S. 7
80 Vgl. Fundação Mário Soares
81 Vgl. Ebd.
82 Vgl.Ebd.
83 Vgl. Ebd.
84 Vgl. Ebd.
85 Vgl. PAAA – B 26 ZA 124902, Biographical Summary Mário Soares
86 Vgl. Ebd.
87 Vgl. Birle, P. & Sánchez, A. (2020), S.175
88 „Je retournerai au Portugal dès que les circonstances le permettront. Alors, avec sérénité et une confiance en l’avenir que je n’ai jamais perdue, j’affronterai mes juges et, éventuellement, mes bourreaux. C’est un acte de fidélité que je dois à mon pays, à l’idéal que je sers et à moi-même.“
89 Vgl. AdsD - FES-Hausakte 2972: Aktennotiz: PORTUGAL (1974)
90 Vgl. Birle, P. & Sánchez, A. (2020), S. 149
91 Vgl. Ebd. S. 152
92 Vgl. Ebd. S.152-153
93 Vgl. Ebd. S. 177
94 Vgl. Ebd. S. 177
95 Vgl. Ebd. S. 177
96 Vgl. Ebd. S. 177
97 Rother, B. (2021), S.41-42
98 Vgl. Ebd. S. 42
99 Vgl. Bundestag Plenarprotokoll 09/130
100 Vgl. Ebd.
101 Ebd.
102 Vgl. Birle, P. & Sánchez, A. (2020), S. 181
103 Vgl. Ebd. S. 181
104 Vgl. Ebd. S. 181
105 Vgl. Ebd. S. 183
106 Vgl. Ebd. S. 185
107 Vgl.Ebd. S. 182
108 Espólio Documental Manuel Alfredo Tito de Morais: Caixote XIX/Pasta XII/Doc XLVI
109 Birle, P. & Sánchez, A. (2020), S. 183
110 Gästebuch Kurt-Schumacher Akademie
111 Vgl. Birle, P. & Sánchez, A. (2020), S.186
112 Vgl. Ebd. S.186
113 Vgl. Ebd. S. 186
114 Vgl. Ebd. S. 187
115 Vgl. Bandeira, A. R. (1976), S. 34
116 Vgl. Ebd. S. 34
117 Vgl. Münster, A. (1975), S. 11
118 Vgl. Ebd. S. 11
119 Vgl. Bandeira, A. R. (1976), S. 44
120 Vgl. PAAA- B26 ZA 110242: Politischer Jahresbericht (1974)
121 Vgl. Ebd.
122 Vgl. Caetano, M. (1974), S. 191
123 Vgl. Ebd. S. 191 f.
124 Vgl. PAAA- B26 ZA 110242: Politischer Jahresbericht (1974)
125 Vgl. Ebd.
126 Vgl. Rosas, F., & Moisel, C. (1997), S. 91
127 Vgl. RTP Ensina
128 Drahtbericht 58 (1974)
129 Vgl. Münster, A. (1975), S. 39
130 Vgl. Ebd., S. 39
131 Vgl. Ebd., S. 39
132 Vgl. PAAA – B26 ZA 101437: Lage in Portugal (1974)
133 Vgl. Ebd.
134 Vgl. Ebd.
135 Vgl. PAAA- B26 ZA 110242: Politischer Jahresbericht (1974)
136 Vgl. PAAA- B26 ZA 101436: Brief an Herrn Staatssekretär: Verhältnis zu Portugal (1974)
137 Vgl. Ebd.
138 Vgl. Ebd.
139 Vgl. AdsD - FES-Hausakte 2972: Meinungsumfrage Portugal (1975)
140 "Noch nie in der jüngeren Geschichte hat ein Land einer politischen Partei so viel geholfen, weil es verstanden hat, dass diese Partei strategisch wichtig war, um eine politische Entwicklung zu verhindern – in diesem Fall die Möglichkeit, dass Portugal kommunistisch werden würde."
141 Vgl. Siehe Anhang, Interview mit Sabine Eichhorn
142 Vgl.Ebd.
143 Vgl. Ebd.
144 Ebd.
145 Vgl. Bundeskanzler Helmut-Schmidt-Stiftung: Biografie
146 Vgl. PAAA- B26 ZA 101436: Brief an Herrn Staatssekretär: Verhältnis zu Portugal (1974)
147 Vgl. Ebd.
148 Vgl. Ebd.
149 Vgl. PAAA – B 26 ZA 101437: Reise des SPD-Vorsitzenden nach Portugal vom 19. bis 21. Oktober (1974)
150 Vgl. Ebd.
151 Vgl. Ebd.
152 Vgl. Ebd.
153 AdsD - FES-Hausakte 2972: Gemeinsame Erklärung, Willy Brandt (1974)
154 Vgl. Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik, S. 355: Bundeskanzler Schmidt an Kissinger vom 10. April 1975
155 Vgl. Ebd.
156 Vgl. Ebd.
157 Vgl. Ebd.
158 Vgl. PA AA – B 150 0329 087: Gespräch mit Außenminister Dr. Kissinger in Gymnich am 20.Mai 1975
159 Vgl. Ebd.
160 Vgl. PA AA – B 150 0329 087: Gespräch mit Außenminister Dr. Kissinger in Gymnich am 20.Mai 1975
161 Vgl. Office of the Historian: Memorandum of conversation, May 20
162 Vgl. Eisfeld, Rainer (1984), S.129-130
163 Fundação Mário Soares, A Europa connosco: Reunião da Internacional Socialista para a fundação do Comité de Amizade e Solidariedade com a Democracia e o Socialismo em Portugal, em Estocolmo 1975
164 Vgl. Fonseca, A. (2011), S. 286
165 Vgl. Birle, P. & Sánchez, A. (2020), S. 172
166 Vgl. PAAA – B26 ZA 101436: Hausbesprechung über zukünftige Hilfeleistungen (1974)
167 Vgl. AdsD - FES-Hausakte 2907: Brief an den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit
168 Vgl. PAAA – B 2-B STS/224: Aufzeichnung des Ref. 420 vom 5.1.1976
169 Vgl. PAAA – B52 ZA 121355: Portugal braucht Auslandsinvestitionen
170 Vgl. Ebd.
171 Vgl. Ebd.
172 Vgl. PAAA – B52 ZA 121358: Deutsch-Portugiesischer Investitionsfördervertrag
173 Ebd.
174 Vgl. PAAA – B 26 ZA 123286: Stand der bilateralen Beziehungen (1981)
175 Vgl. Birle, P. & Sánchez, A. (2020), S. 273
176 Vgl. Portal Diplomático: Relações Bilaterais – República Federal da Alemanha
177 AHK Portugal: 60 Jahre Goethe-Institut Lissabon
178 Vgl. Deutsche Botschaft Lissabon: Deutsche Institutionen in Portugal
179 PAAA – B 266 ZA 173595: Portugiesisch-deutsche Parlamentariergruppe
180 Vgl. AdsD - FES-Hausakte 2972: Meine Portugalreise (1975)
181 Vgl. Ebd.
182 Vgl. AdsD - FES-Hausakte 2972: Abschlußbericht zur Situation in Portugal (1975)
183 Vgl. Birle, P. & Sánchez, A. (2020), S. 278
184 Deutsch-Portugiesische Gesellschaft e. V. (DPG)
185 Vgl. Ebd.
186 Vgl. Ebd.
187 Vgl. República Portuguesa – Governos Anteriores
188 Vgl. Eisfeld, Rainer: Portugals EG-Beitritt (2023)
189 Vgl. Ebd.
190 Vgl. Ebd.
191 Vgl. Assembleia da República: Primeiras Eleições 1976
192 Vgl. Constituição da República Portuguesa
193 Vgl. Ebd.
194 Vgl. PAAA- B 52 ZA 121355: Länderaufzeichnung Portugal, Geschichtliche Daten
195 Vgl. Ebd.
196 Vgl. Ebd.
197 Vgl. PAAA – B26 ZA 123286: Die verfassungsrechtliche Stellung des Staatspräsidenten
198 Ebd.
199 Vgl. PAAA - B26 ZA 124902: Politische Lage in Portugal, April 1982
200 Vgl. Ebd.
201 Vgl. Assembleia da República: Primeiras Eleições 1976
202 Vgl. Ebd.
203 Vgl. Ebd.
204 Vgl. Ebd.
205 Vgl. Ebd.
206 Vgl. Ebd.
207 Vgl.Ebd.
208 Vgl. AdsD - FES- Hausakte 12783: Gespräch zwischen Staatsminister Wischnewksi und Mário Soares (1976)
209 Vgl. Ebd.
210 Vgl. Assembleia da República: Primeiras Eleições 1976
211 Vgl. AdsD - FES-Hausakte 12783: Soares legt Sieben-Punkte-Programm vor (1976)
212 Vgl. Ebd.
213 Vgl. Ebd.
214 Ebd.
215 PAAA – B26 ZA 124902: Portugal - EG
216 Vgl. Fonseca, A. (2011), S. 295
217 Vgl. PAAA – B53 ZA 121355: Länderaufzeichnung Portugal 1981
218 Vgl. Sablosky, J. (1995), S. 4
219 Vgl. Birle, P. & Sánchez, A. (2020), S. 272
220 Vgl. Bundestag Plenarprotokoll 10/109
221 Vgl. Ebd.
222 Vgl. Ebd.
223 Vgl. Ebd.
224 Vgl. PAAA – BAV 209 ROMDIP 26110: Erweiterung der Gemeinschaft um Spanien und Portugal
225 Ebd.
226 Vgl. Ebd.
227 Vgl. Birle, P. & Sánchez, A. (2020), S. 279-280
228 Vgl. Fonseca, A. (2011), S. 298
229 Siehe Anhang, Interview mit Sabine Eichhorn: „Der größte Erfolg ist die Etablierung der Demokratie in Portugal und deren Krönung durch den Beitritt Portugals zu den Europäischen Gemeinschaften im Jahr 1986 – mit einer beeindruckenden Zeremonie im Mosteiro dos Jerônimos.“
230 Vgl. Ebd.
231 Vgl. Siehe Anhang, Interview mit Sabine Eichhorn
232 Vgl. PAAA – B53 ZA 121355, Länderaufzeichnung Portugal 1981
233 Vgl. Ebd.
234 Vgl. Ebd.
235 Vgl. Ebd.
236 Vgl. Ebd.
237 Vgl. Ebd.
238 Vgl. Ebd.
239 Vgl. Ebd.
240 Vgl. Ebd.
241 Vgl. Ebd.
242 Vgl. Ebd.
243 Vgl. Ebd.
244 Vgl. Ebd.
245 Vgl. Ebd.
246 Vgl. PAAA - B 26 ZA 124902: Länderaufzeichnung Portugal 1982
247 Vgl. Arquivo Histórico: VII Governo constitucional
248 Vgl. República Portuguesa – Governos Anteriores
249 Vgl. Diário da República: Decreto n.º 136-A/82, de 23 de dezembro
250 Vgl. As legislaturas da Assembleia da República
251 Vgl. Ebd.
252 Vgl. Ebd.
253 Vgl. Ebd.
254 Vgl. Ebd.
255 Vgl. Ministério Público: Buscas e detenções (07.11.2023)
256 Vgl. Rádio Renascença (07.11.2023)
257 Vgl. Rádio Renascença (07.11.2023)
258 Vgl. Jornal de Negócios (08.12.2023)
259 Vgl. Ebd.
260 Vgl. Diário da República: Mapa Oficial n.º 2-A/2024, de 23 de março
261 Vgl. Pordata: Eleitores nas eleições para a Assembleia da República
262 Vgl. Ebd.
263 Vgl. PAAA - B26 ZA 124902: Stand der bilateralen Beziehungen (1982)
264 Vgl. Ebd.
265 Vgl. Ana Mónica Fonseca (2006), S. 49
266 Vgl. Ebd., S. 49
267 Vgl. PAAA – B26 ZA 101437: Gespräche die der Vorsitzende der Sozialistischen Partei Portugals am 3. Mai in Bonn führte (1974)
268 Vgl. PAAA_B26 ZA 123286: Portugalpolitik (1975)
269 Vgl. PAAA_B150_0506: – Gespräch mit PM Balsemão
270 Vgl. Ebd.
271 Vgl. Ebd.
272 Vgl. Auswärtiges Amt: Deutschland und Portugal
273 Vgl. Siehe Anhang, Interview mit Sabine Eichhorn
274 Vgl. Auswärtiges Amt: Deutschland und Portugal
275 Vgl. Ebd.
276 Vgl. Ebd.
277 Vgl. Almeida, R., PS (2023)
278 Ebd.
279 Vgl. Ebd.
280 Vgl. Birle, P. & Sánchez, A. (2020), S. 353-354
Details
- Titel
- Bilaterale Beziehungen zwischen Deutschland und Portugal seit 1973. Die Rolle Deutschlands in der Demokratisierung Portugals
- Hochschule
- Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg
- Note
- 1,3
- Autor
- Matilde Gouveia (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2024
- Seiten
- 59
- Katalognummer
- V1544033
- ISBN (Buch)
- 9783389100158
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Nelkenrevolution Portugal Deutschland Europäische Union Diktatur Diplomatie Willy Brandt Mário Soares Helmut Schmidt SPD PS Sozialdemokratische Partei Deutschland FES Friedrich-Ebert-Stiftung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 30,99
- Arbeit zitieren
- Matilde Gouveia (Autor:in), 2024, Bilaterale Beziehungen zwischen Deutschland und Portugal seit 1973. Die Rolle Deutschlands in der Demokratisierung Portugals, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1544033
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-