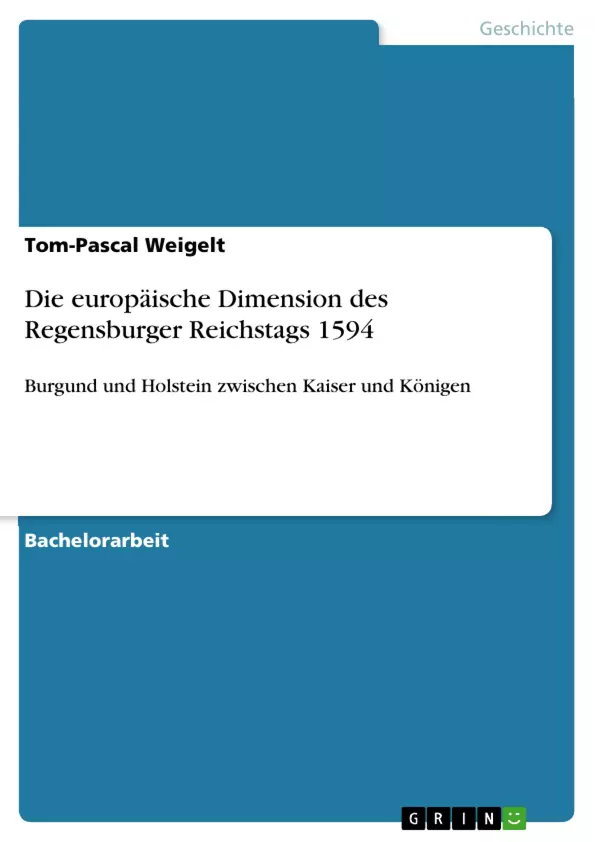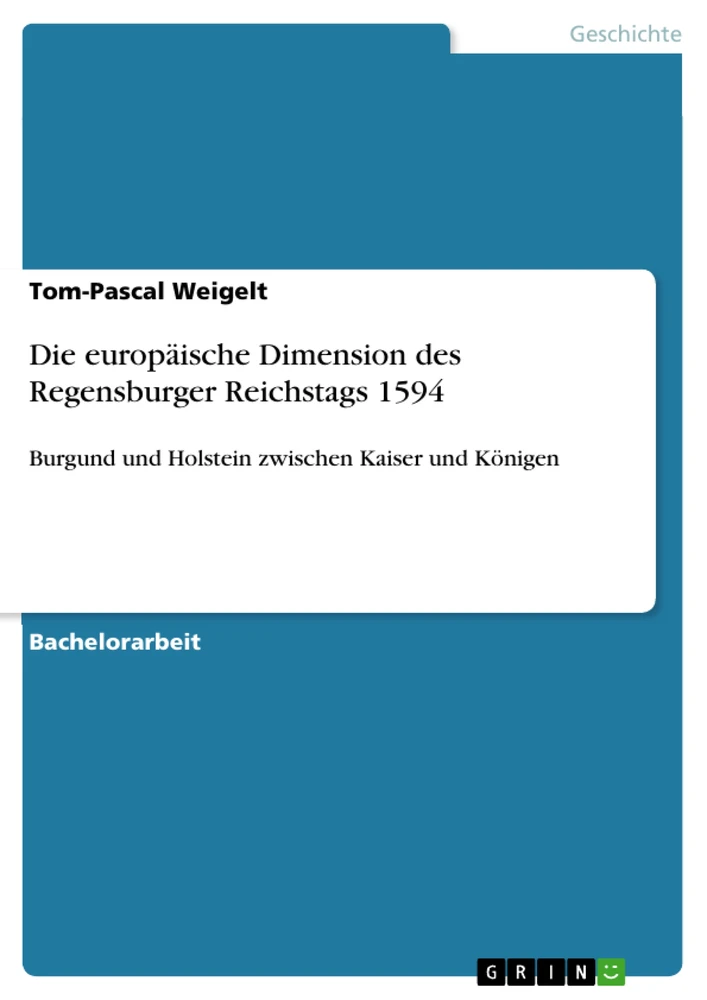
Die europäische Dimension des Regensburger Reichstags 1594
Bachelorarbeit, 2024
41 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Reich und Reichstag 1594
2.1 Die Struktur eines Reichstages
2.2 Der Reichstag 1594 zwischen Kriegen und Konfessionen
3. Die europäischen Akteure
3.1 Dänemark und Holstein
3.2 Burgund und Spanien
4. Die Gesandtschaften am Reichstag 1594
4.1 Die Akkreditierung – Herausforderungen vor den Verhandlungen
4.2 Die Verhandlungen
4.3 Da sein oder nicht da sein - Session und Anwesenheit
4.4 Supplizieren an den Kaiser
4.5 Vom Personellen zum Symbolischen – Die Repräsentation
5. Fazit
Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Das 16. Jahrhundert gestaltete sich für das Heilige Römische Reich als eine krisenreiche Zeit. Mit dem osmanischen Reich entwickelte sich für die Habsburger ein Feind, der regelmäßig in Ungarn und Österreich einfiel. Im Inneren waren die Fürsten in ihrer Konfession gespalten, was das Reich in vielen Krisen erschütterte. In all diesen Krisen waren die Reichstage eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen der Kaiser und die Reichsstände zusammenkamen. Als eine wichtige Reichsinstitution genoss der Reichstag auch internationale Aufmerksamkeit, wodurch neben den Reichsfürsten auch ausländische Gesandtschaften auf dem Reichstag vertreten waren. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts wurde die Beteiligung von ausländischen Mächten üblich, auch wenn besonders die Kurfürsten in Sorge um ihre Rechte gegen diese Beteiligung waren. Die Bedeutung der ausländischen Teilnahme ging seit dem Regierungsantritt Maximilian I. allerdings wieder zurück.1
Zwischen den nicht immer klar definierten Gruppen von Reichsangehörigen und externen Botschaftern gab es aber auch die Fürstentümer des Reiches, welche zwar dem Reich angehörten, als Lehnsherren aber ausländischen Königen verpflichtet waren. Mit ihrer Stellung „zwischen den Stühlen“ mussten sie einerseits die Interessen des Reiches als auch die ihrer Lehnsherren vereinbaren. Bei der Betrachtung der Reichskontributionen zeigt sich bereits, dass Stände an den Grenzen des Reiches diese seltener als andere Reichsstände zahlten.2 Eines der bekanntesten Fürstentümer ist das Herzogtum Burgund, bestehend aus Burgund und vor allem den Niederlanden, was seit 1555 von der spanischen Linie der Habsburger gehalten wurde. Ein weiteres ist das Herzogtum Holstein, welches seit 1490 von mehreren Herzögen des Hauses Oldenburg nebeneinander regiert wurde, einer davon als König von Dänemark.3 Beide waren 1594 in Regensburg auf dem Reichstag vertreten, was die Positionierung zwischen den eigenen ausländischen Interessen, sowie der Politik innerhalb des Reiches verdeutlicht. In dieser Arbeit soll anhand der Beispiele der Herzogtümer Burgund und Holstein die Doppelrolle solcher Fürstentümer in Hinblick auf ihre Einbindung, ihre Vertretung sowie ihr Auftreten auf den Reichstagen analysiert werden. So lässt sich bereits eine erste Tendenz erkennen, dass die Reichstage trotz ihrer Funktion als Reichsinstitution auch für die ausländischen Mächte von Interesse waren und diese durch die Doppelrolle ihrer Fürstentümer darin mitwirken wollten. Dadurch konnte dieser auch zum Austragungsort von internen Konflikten außerhalb des Reiches werden, wie es anhand von Spanien und Dänemark deutlich werden soll. Beide Reiche haben innere Probleme, welche auch auf dem Reichstag von 1594 deutlich werden. Somit soll hier der Frage nachgegangen werden, wie einerseits andere Reiche am Reichstag ihre Interessen durchzusetzen versuchten und andererseits, wie der Kaiser und die Reichsstände die ihren.
Seit vielen Jahren wird die Forschungsreihe der Reichstagsakten betrieben, welche sämtliche Schriftstücke zu den Verhandlungen einzelner Reichstage zusammenträgt und somit eine umfangreiche Edition für die Erforschung der Reichstage bietet. Mit dem neuesten Band aus diesem Jahr bearbeitete Josef Leeb eine Quellensammlung zum Regensburger Reichstag von 1594. Neben der Edition der Akten wird dort auch der aktuelle Forschungsstand zum Thema Reichstag herausgestellt und soll somit als zentrales Element dieser Arbeit dienen. Ergänzt wird dies durch die Arbeit von Lothar Gross und Robert von Lacroix, welche bereits 1944 eine umfangreiche Edition zu Urkunden und Akten zum Herzogtum Burgund zusammentrugen.4 Zusätzlich bietet die Forschungsreihe „Nuntiaturberichte aus Deutschland“, einer Quellenedition der Berichte der päpstlichen Gesandten, die Nuntien, einen Einblick aus päpstlicher Sicht in die Geschehnisse des Reiches und der Reichstage. Diese Berichte liefern nochmals vertiefende Details zu den Verhandlungen abseits der in den Akten festgehaltenen Sitzungen und zeigen die persönlichen Beziehungen und Ansichten der Reichstagsteilnehmer. Besonders in der konfessionell aufgeladenen Zeit zeigen die Berichte die Zusammenarbeit aber auch Schwierigkeiten der katholischen Seite. Diese waren besonders zahlreich auf dem Reichstag von 1594 vertreten. Auch der damalige Reichsherold Peter Fleischmann beschreibt in seinem Werk zum Reichstag andere Aspekte als die Akten, besonders zu zeremoniellen und feierlichen Angelegenheiten, welche auch die besonders wichtige Stellung des Symbolischen aufzeigt.5
Neben seinen eigenen Beitrag zu den Reichstagsakten forschte Maximilian Lanzinner bereits vorher zu den Reichstagen der frühen Neuzeit. Besonders hervorzuheben ist der Sammelband von 2006 in Zusammenarbeit mit Arno Strohmeyer, in welchem bereits sowohl die symbolische Kommunikation als auch die gesamteuropäischen Facetten hervorgehoben werden.6 Gerade die diplomatischen Geschäfte werden in dem 2024 erschienenen Handbuch von Dorothée Goetze und Lena Oetzel nochmal auf den neusten Stand beschrieben, in welchem die europäische Diplomatie im Vordergrund steht und somit auch die diplomatische Wirkung der Reichstage entsprechend gewürdigt werden.7 Für die Zeit der Türkenkriege, die besonders 1594 eine hohe Relevanz hatten, gab bereits 1978 Winfried Schulze einen Band heraus, welcher die Probleme des Kaisers und die Wichtigkeit des Reichstages von 1594 beschreibt und auch heute nicht an Aktualität verloren hat.8
Trotz der häufigen und prominenten spanischen Teilnahme auf den Reichstagen, besonders seit der Regierungszeit Karls V., und der Verknüpfung durch Burgund sind die Reichstage in der spanischen Geschichtswissenschaft von geringerem Interesse.9 Einen guten Überblick über die Behandlung Burgunds in Reichsversammlungen bietet aber der Aufsatz Hans-Wolfgang Bergerhausens von 1993 über die Reichsmünzordnung.10 Eines der grundlegendsten Werke über Spanien und die Niederlande, deren Konflikt den Reichstag von 1594 immens beschäftigte, ist der Aufsatz von Nicolette Mout.11 Dort werden die Schwierigkeiten rund um die Beziehung zum Reich besonders deutlich. Ergänzend dazu bietet auch Peter Rauscher einen Aufsatz zum Thema Kaiser, Niederlande und Philipp II.12 In der Literatur zu Holstein beziehungsweise Dänemark und den Reichstagen sind die Forschungen weniger gut zusammengetragen. Eine Besonderheit ist der Aufsatz von Martin Krieger aus dem Jahre 2000.13 Daneben lassen sich viele Informationen aus verschiedenen Aufsätzen von Oliver Auge finden. Auch das Buch Winfried Dotzauers zu den deutschen Reichskreisen bietet vieles über die Wirkung der ausländischen Lehnsherren auf verschiedenen Versammlungen auf Kreis- oder Reichsebene.14
Im ersten Teil der Arbeit wird ein Umriss über die Struktur eines Reichstages sowie über das Jahr 1594 für das Reich erfolgen. Anschließend wird die Doppelrolle der Herzogtümer, sowie ihr Wirken auf Reichsversammlungen genauer beleuchtet. Dabei erfolgt der Übergang zur Betrachtung des Regensburger Reichstags von 1594 und der holsteinischen und burgundischen Gesandtschaften. Im Besonderen werden die Gesandtschaften in der Anmeldung, den Verhandlungen, der Session und Anwesenheit bei selbigen, den Supplikationen sowie der Repräsentation abseits der Verhandlungen genauer analysiert.
2. Reich und Reichstag 1594
2.1 Die Struktur eines Reichstages
Der Reichstag der frühen Neuzeit entwickelte sich zu der Regierungszeit Maximilians I. aus den „Gemeinen Tagen“ des 15. Jahrhunderts. Eine wichtige Neuerung war die Vermeidung des Vertretungsprinzips hin zur persönlichen Anwesenheit von Herrscher und Fürsten. Anfänglich einen noch recht informellen Charakter innehabend, in dem die Fürsten noch zusammen verhandelten, differenzierten sich ab 1548 verschiedene Kurien heraus.15 Kurfürsten, Fürsten und Städte verhandelten ab dann getrennt voneinander und trugen erst abschließend ihre Abstimmung zusammen. Diese Art der Reichsversammlung übte eine stabilisierende Wirkung aus. Sie ermöglichte Verhandlungen, bei welchen betroffene Stände in die Beratung eingreifen konnten. Die Gesamtheit der versammelten Stände konnten somit auch einen mildernden Einfluss auf Aggressoren auswirken, sei dieser nun Kaiser oder Reichsfürst.16 Der Reichstag entwickelte sich durch seinen Verhandlungsaspekt zu einem friedensichernden Element des Reiches. Es ermöglichte der in vielen Aspekten heterogenen Gruppe an Fürsten in Kontakt zu treten und somit Konfliktbereiche zu dämpfen, wovon insbesondere kleinere und mindermächtige Fürsten profitierten. Es wurde somit einerseits der Frieden untereinander gesichert, es ermöglichte durch symbolische und praktische Geschlossenheit aber auch den Frieden nach außen.17
Der Reichstag genoss somit eine große Aufmerksamkeit bei den Fürsten des Reiches. Auf diesen konnten sie den propagandistischen Effekt ausnutzen, um ihre Rangkämpfe im Licht der Öffentlichkeit auszutragen.18 Dynastie und Konkurrenz war somit eine Triebfeder der Fürsten und ihre jeweilige Position im Adelsgefüge den Fürsten besonders wichtig.19 Neben den eigentlichen Verhandlungen war daher auch die Selbstpräsentation wichtig. Klagen über die teure Finanzierung eines solchen Lebensstils drehten sich vornehmlich um die lange Dauer und generellen Preisanstiege innerhalb einer Reichstagsstadt. Über eine Reduktion des Aufwandes dachte aber keiner ernsthaft nach, da die Reputation ein wichtiger Aspekt der Ständegesellschaft war.20 Durch diesen Gedanken kam es auf Reichstagen deshalb immer wieder zu Rangstreitigkeiten über die Session, den Platz innerhalb der Verhandlungen. Solche Sessionsstreitigkeiten wurden allerdings schon bei den Zeitgenossen als eine empfindliche Störung für den Verhandlungsverlauf einer Reichsversammlung gesehen. An solchen waren auffälligerweise oft kleinere oder weniger mächtige Fürsten beteiligt.21 Diese waren durch ihre geringeren finanziellen Möglichkeiten stärker unter Druck, um mit den größeren Fürsten mitzuhalten. Somit passten sie sich an diese in Prunk und Sprache an, um den Anschluss beizubehalten.22 Auch wenn dadurch viele Fürsten im 16. Jahrhundert bei Reichstagen anwesend waren, mussten diese um ihre Stellung streiten, weshalb die Verhandlungen meist von juristischen Beratern getätigt wurden. So stieg die Anzahl der Juristen auf bis zu 40-55% an.23 Größere Territorien sandten dabei eine gemeinschaftliche Delegation von Adligen und Juristen, während kleinere Fürsten meist nur Juristen entsandten.24 So sollten die Gesandtschaften der Reichsstände sowohl Status als auch Expertise kombinieren.
Ausländische Fürsten, welche nicht als Reichsstand auf dem Reichstag mitwirken konnten, wurden in der Regel von diplomatischen Gesandtschaften vertreten, welche für diesen Zweck ausgewählt wurden. Begrifflich sind diese häufig als Botschafter oder „Ambassador“ benannt.25 Jene Personen wurden von ihren jeweiligen Fürsten oftmals aufgrund ihrer Tüchtigkeit und Weltgewandtheit ausgewählt. Ihre Verhandlungsziele wurden ihnen in brieflichen Instruktionen mitgegeben, welche als Beglaubigungsschreiben zum Ausweisen als offiziellen Vertreter ihres Reiches dienten. Wichtig waren die Vollmachten, welche in zweifacher Ausführung sowohl dem Kaiser selbst als auch dem Kurfürsten von Mainz als Reichserzkanzler vorgelegt wurden. Am Reichstag selbst sollten diese Gesandtschaften hauptsächlich die Anliegen und Wünsche ihrer Herren vortragen – Geschenke und Bestechungsgelder wurden dabei zur handfesten Unterstützung mitgegeben. Des Weiteren schickten die Gesandtschaften regelmäßig Berichte zurück an ihre Fürsten.26 Das Sammeln und Weiterleiten von Informationen war somit eine der Hauptaufgabe eines Gesandten. Diese mussten entweder intern gesammelt werden oder konnten auch durch Kopien der Dokumente mittels persönlicher Treffen oder Bestechungen erfolgen.27
Die Reichstage gestalteten sich somit zum diplomatischen Forum Europas, bei dem keiner prinzipiell ausgeladen war und sich in offiziellem Rahmen ausgetauscht werden konnte. Am häufigsten waren Burgund, Venedig und andere italienische Städte, die römische Kurie, Frankreich, Polen und Preußen anwesend. Auch die skandinavischen und iberische Länder, England und Russland waren oft am Reichstag vertreten.28 Diese europäischen Begegnungen regten oftmals die Phantasie, aber auch die Stereotypisierung der Zeitgenossen an. Spanier beispielweise galten als stolz, Deutsche als trinkfest und Franzosen als launisch und expansiv.29 Dennoch konnte bei solcher Gelegenheit politisches Wissen über das Reich und Ereignisse der bekannten Welt gesammelt werden.30 Die internationalen Interessen bezogen sich meist auf militärische, ökonomische und dynastische Themen. So sollten je nach Fürst anti-habsburgische Tendenzen etabliert oder unterstützt, die Freiheit der Reichsstände geschützt, sowie Einflüsse auf Reichsfürsten in Bezug auf Bündnisse, Lobbyismus und Bestechungen ausgeübt werden.31
Üblicherweise konnten Gesandtschaften von ausländischen Mächten nur in speziell auf diesen Anlass zugeschnittenen Rahmen mit dem Kaiser und dessen Räten sowie den Ständen verhandeln. Für den Empfang von fremden Gesandtschaften war typischerweise der Kurfürst von Mainz verantwortlich.32 So wurde die übergebene Vollmacht zuerst von den Ausschüssen oder im Plenum beraten und dem Kaiser übergeben. An einen speziell dafür vergebenen Termin geleitete ein Ständevertreter die Abgesandten in den Ratssaal, wo sie ihr Anliegen vortragen konnten bzw. das Schreiben des Herrschers vom Mainzer Kanzler vorgelesen wurde. Nach einer Beratung innerhalb der Kurien, in welcher die Gesandtschaften normalerweise keinen Einfluss ausüben konnten, wurde ihnen die Antwort in einer weiteren Audienz bekanntgegeben.33 Durch den Ausschluss aus den Abstimmungen ging diesen Gesandten ein großer Eingriffsbereich verloren. Nichtsdestotrotz konnten diese ihre Ziele durch persönliche Ansprache und Überzeugungsarbeit oder das gezielte Ausspielen von Kaiser und Reichsständen erreichen, entweder durch offensichtliches Einmischen oder reine Beobachtung des Geschehens.34 Wesentlich einflussreicher gestaltete sich die Möglichkeit, mithilfe einer Supplikation an den Kaiser aktiver in den Reichstag einzugreifen.35 Auch ein persönliches Treffen mit dem Kaiser war möglich, sowie informelle Gespräche mit den einzelnen Ständen. Allerdings war diese direkte Form mit Risiken verbunden, war dies doch von Kaiser und Reichsständen ohne eine konkrete Verbindung innerhalb des Reichstages ungern gesehen.36 Eine Ausnahme bildete das Auftreten der römischen Kurie. Durch mittelalterliches Recht war dem Papst der Eingriff in Reichsangelegenheiten gestattet, seien es nun Krönungen oder die Reichstagsteilnahme. Neben den Gesandten im Reich, den sogenannten Nuntien, wurde für den Reichstag auch stets ein Legat aus dem Kardinalkollegium entsandt.37 Durch ihre Verbindungen zum Kaiser und den katholischen Fürsten konnten diese von allen außerreichlichen Ländern den besten Einblick in sämtliche Bereiche gewinnen und am detailliertesten über die Verhandlungen berichten.38 Deshalb konnten die Nuntien oftmals Akten der Kurien nach Rom schicken.39 Dennoch ergaben sich in dieser Form der Gesandtschaft Herausforderungen für die einzelnen Botschafter. Die sprachlichen und kulturellen Barrieren limitierten die Aktionen und Akzeptanz innerhalb der Stände. Die Selbstpositionierung war somit ein wichtiger, wenn auch schwieriger Bestandteil.40
2.2 Der Reichstag 1594 zwischen Kriegen und Konfessionen
Bereits im Vorfeld des Regensburger Reichstages von 1594 wurde dessen Planung insbesondere vom Papst genau beobachtet, fand der letzte immerhin zwölf Jahre vorher statt. So pochte der Nuntius Caesare Speciano mehrmals beim Kaiser auf einen neuen Reichstag.41 Bereits bei seiner Entsendung nach Wien wurde das Reichstagsbestreben thematisiert und der Ausschluss von protestantischen Ständen auf Seiten des Papstes geplant.42 Auch der Nuntius in Köln, Ottavio Mirto Frangipani, erwartete eine entsprechende Ankündigung.43 Ausschlaggebend für den neuen Reichstag war die finanzielle Überbelastung sowohl der habsburgischen Länder Österreich und Ungarn, sowie der bisherigen Partner Tirol, Salzburg und Bayern. Zwar gab es bereits Bewilligungen von 1582, diese waren aber nach zwölf Jahren inzwischen ausgelaufen und auch die Hofkammer war entsprechend leer.44 Da alles nach einem Krieg mit dem Osmanischen Reich aussah, konnte nach Ansicht der Habsburger nur ein Reichstag diesem Problem Abhilfe schaffen.45 Auch auf Seiten der Kurie und der Reichsfürsten war dieses Problem vordringlich und die Unabdingbarkeit des Reichstages wurde klar herausgestellt.46 Innerhalb des Kaiserhofes schien die Vorbereitung deshalb auch geschäftig zu laufen, um eine schnelle Ausschreibung zu gewährleisten.47 Das gute Informationsnetzwerk des Nuntius Speciano erlaubte es ihm, bereits Ende 1593 von der geplanten Ausschreibung berichten zu können.48
Der zentrale Verhandlungspunkt, im Sinne des Kaisers auch einzige Verhandlungspunkt, war die Bereitstellung von Geldmitteln zur Hilfe gegen den Einfall des Osmanischen Reiches in Ungarn. In diesem Sinne wurde bereits die Proposition gestaltet, welches die politischen Möglichkeiten Rudolfs II. enthielt und als maßgeblich für den Erhalt der Hilfen angesehen wurde. Dementsprechend wirkten auch führende Reichsstände an deren Gestaltung mit.49 Aufgrund der Wichtigkeit soll der Kaiser die Proposition sogar mit Spanien und dem Papst abgesprochen haben, besonders was die Hilfe der Reichsstände anbelangt.50 Die Darstellung der Türkengefahr sollte dabei mittels Überzeugungen und Argumente als besonders hoch angesehen werden und maximale Emotionalität hervorrufen. Als solches stand der Friedensbruch sowie ein in Gefangenschaft verstorbener Botschafter des Reiches im Mittelpunkt. Somit sollte diese Problematik sämtliche innenpolitische Probleme überlagern.51 In gewisser Hinsicht traf diese Einstellung auf fruchtbarem Boden. Dem sächsischen Kuradministrator Friedrich Wilhelm I. war die Dringlichkeit der Türkenabwehr zumindest ein wichtiges Anliegen, welches er hervorhob.52 Aus diesem Grund wurde auch Regensburg als Tagungsort ausgewählt. Durch die geringe Distanz zu Wien konnte Rudolf II. sowohl schnell Richtung Ungarn ziehen als auch die erhofften Steuern schnell einziehen und einsetzen.53 Die vom Nuntius Speciano vermutete Angst des Kaisers vor Regensburg, da dort dessen Vater verstarb, schien damit wohl kein auschlaggebendes Argument gewesen sein.54 Um die Reichsstände zu überzeugen, die Steuern zu bewilligen, wurde den Kurien viel Spielraum gegeben, indem keine konkreten Zahlen verlangt wurden. Stattdessen sollten einzelne Kontingente bewilligt und anschließend deren Kosten berechnet werden.55
Neben der Türkenhilfe waren die proponierten Hauptthemen des Reichstages der Landfrieden mit besonderen Bezug auf die Niederlande, die Reichsjustiz, das Reichsmünzwesen, die Reichsmatrikel sowie die Session.56 Nebenbei war ein besonderes Thema die Religionsverhandlungen mit den reformierten Hochstiften. Entsprechend dieser Themen genoss der Reichstag besondere Aufmerksamkeit auf katholischer Seite, insbesondere die des Papstes. Die römische Kurie sah die Reichstage bereits vorher als Orte der Produktion und Zirkulation von Wissen und somit als Chance zur Gewinnung von Einblicken über die Verhältnisse im Reich.57 So fand eine massenhafte Mobilisierung der päpstlichen Nuntien statt, welche auf dem Reichstag die Vertretung übernehmen sollten. Bereits im Februar konnte die Teilnahme aller im Reich tätigen Nuntien bestätigt werden.58 Ein Novum, welches auch von protestantischer Seite aus bemerkt wurde.59 Neben ihrer eigenen Anwesenheit sollten die Nuntien aber auch die möglichst vieler katholischer Fürsten sicherstellen. Dem Nuntius Frangipani wurde in diesem Sinne der Auftrag erteilt, mit einer Visitationsreise zu einigen katholischen Fürsten diese zur persönlichen Teilnahme zu überzeugen.60 Auch die Klagen des Kölner Kurfürsten Ernst über die hohen Preise bei einem Reichstag hielten dem Andrängen Frangipanis nicht statt.61 Ebenso bemühte sich Speciano um die zahlreiche Teilnahme der Katholiken, im Falle von strittigen Berechtigungen wurde sogar entsprechend nachgeholfen, damit die Kurie die Anwesenheit verteidigen konnte.62 Da päpstliche Gesandte während des Konfessionskonfliktes stark eingeschränkt waren, indem sie nur in katholischen Territorien agieren konnten, ermöglichte eine hohe katholische Teilnahme somit auch eine höhere Einflussmöglichkeit auf dem Reichstag.63
Bei dem päpstlichen Kadinallegaten Ludovico Madruzzo, der speziell für den Reichstag als Hauptgesandter der römischen Kurie berufen wurde, werden deren Reichstagsbestreben deutlich. Vor allem der Türkenkrieg, aber auch der Wille um eine katholische Liga, sowie die Session und Konfession bildeten die Eckpunkte der römischen Anliegen. In einer vor dem Reichstag übergebenen Eingabe des päpstlichen Legaten Madruzzo wird das Thema der Session und der Konfession deshalb bereits von päpstlicher Seite aufgegriffen.64 Deshalb war dieses Thema auch eine der wichtigsten Punkte in der Instruktion des Legaten und sorgte für die zahlreiche Teilnahme katholischer Stände.65 Auch im weiteren Verlauf des Reichstages wandte sich Madruzzo immer wieder an den Kaiser, um in dieser Angelegenheit zugunsten der katholischen Seite zu entschieden, auch wenn dieser eigentlich nur die Türkenhilfe zur Sache des Reichstages erklären wollte.66 Die Regelung der Nachfolge Rudolfs II. als römischer König war zwar gleichfalls angestrebt, wie aus den Berichten Madruzzos hervorgeht, wurde am Reichstag aber trotz der Versuche nicht vom Kaiser behandelt.67 In diesem konfessionell angespannten Sinne war die Zulassung protestantischer Stände, hauptsächlich der Hochstiftadministratoren, ein Streitpunkt. Der Papst sah den Kaiser in Verpflichtung, die Anwesenheit und Session jener Administratoren zu unterbinden, um die Rechte der katholischen Teilnehmer nicht zu beschneiden.68 Selbst Kompromissvorschläge wurden demensprechend abgewiesen.69 Im Zuge dieses Streites kam es auch immer wieder zu Handgreiflichkeiten und demonstrative Abzüge der verschiedenen Konfessionsgruppen und sorgte für Aufruhr am Reichstag.70 Generell hatten die protestantischen Stände ein schweres Standbein. Durch ihr stetiges Drängen auf Frieden mit den Türken war ihr Standpunkt von Anfang an deutlich, welcher mit entsprechenden Argumenten und Darstellung von katholischer Seite, welche die Angriffe der Türken als völkerrechtswidrig darstellten, gekontert wurde. Somit waren den Protastanten bereits im Vorfeld die Argumente genommen.71 Gleichzeitig war das Stimmverhältnis im Fürstenrat eher zur katholischen Seite geneigt, was mit der Verhinderung der Teilnahme protestantischer Stiftadministratoren weiter verschärft werden sollte.72 Die protestantischen Fürsten ihrerseits lehnten geschlossen die Türkenberatungen ab, bis die umkämpften Bistumsadministratoren eingeladen werden.73 Der Ausschluss der evangelischen Stiftsadministratoren wurde dabei vornehmlich auf dem Rücken der Magdeburger ausgetragen, deren Sessionsstreitigkeiten sich zu dem Konfliktpunkt der Konfessionen entwickelte, in dem sämtliche Probleme ausgetragen wurden.74 Der Reichstag von 1594 gestaltete sich somit zu einem Wendepunkt des konfessionellen Miteinanders des Reiches, bei dem ein Ausgleich nicht mehr möglich schien.75 Dies überschattete sämtliche Bereiche des Reichstages, es wurden also trotz der kaiserlichen Bestrebungen die konfessionellen Spannungen auf dem Reichstag ausgetragen. Um dem Kaiser dabei unter Druck zu setzen, wurden die Konfession und die Türkenfrage häufig zusammengeworfen, um dem Kaiser Zugeständnisse abzuringen – besonders häufig von katholischer Seite.76 Die geringen Erfolgsaussichten aufgrund dieser Sessionsstreitigkeiten fiel auch dem Erzherzog Ferdinand II. von Österreich auf.77 Diese Streitpunkte beeinflussten bereits vor der offiziellen Eröffnung den Reichstag, sodass dieser verschoben werden musste.78 Die eintreffenden Kriegsmeldungen aus Ungarn verzögerten den Beginn des Reichstages zusätzlich.79
Der Krieg gegen die Türken zwang den Kaiser, bei ausländischen Mächten abseits der Reichslehen Beihilfe zu ersuchen.80 Bereits 1592 sandte Rudolf II. dafür eine Abordnung nach Genua, um Geld gegen die Türken zu erbitten.81 Diese schickten auch einen Gesandten auf den Reichstag. Auch bei den Reichsständen bat der Kaiser vereinzelt um Beihilfe. Insgesamt stellten diese zwar eine ordentliche Summe von über 800.000 Florin bereit, tatsächlich ausgezahlt wurde aber bis 1594 nur ein Bruchteil.82 Einige der Reichsfürsten hoben die Beteiligung ausländischer Mächte lobend hervor, wie der Mainzer Kanzler im Fürstenrat.83 Andere wie der Administrator von Sachsen betrachteten diese Hilfsgesuche mit Sorge, da sie die Benachteiligung der Reichsfürsten befürchteten.84 Durch die hohe europäische Relevanz des Reichstages entsandten die einzelnen Reiche jeweils ihre Gesandtschaften mit einem bestimmten Ziel nach Regensburg. Spanien war vor allem an Berichten über die Religionspolitik von Kaiser und Reichsständen interessiert, während Frankreich hauptsächlich Anti-Habsburgische Beeinflussung nachgesagt wird. Die römische Kurie genoss aufgrund der Sonderstellung ihrer Nuntien und Legaten die größte Einflusssphäre. Für sie stand verständlicherweise die Religionsfrage im Mittelpunkt, aber auch die Türkenhilfe war im Sinne der Kreuzzugsidee ein wichtiger Verhandlungspunkt. Als die entscheidendsten Aspekte kristallisierten sich also die Beziehung zu den Habsburger, die Einflussnahme der verschiedenen Fürsten und die Abwehr der Türken heraus. Durch Agenten und Mittelsmänner konnten die ausländischen Mächte dabei stets auf ein gut informiertes Netzwerk zurückgreifen.85 In den Berichten, Akten und Protokollen der Reichstage spiegelt sich allerdings die Schwierigkeit wider, ab wann eine Gesandtschaft als die eines fremden Fürsten zählt. Dort wird ein großes Spektrum genannt und nicht jeder, wie beispielweiße die Österreicher, waren tatsächlich reichsfremd. Andere wie Italien genossen eine Mittelstellung, da sie formal zwar im Reich waren, aber ebenso wie andere Gesandtschaften nur über die Verhandlungen berichten konnten, anstatt bei diesen teilzunehmen.86 Auch der Kaiser nutzte so seine eigenen Gebiete, im Falle Ungarns auch außerhalb des Reiches, für seine Sache. So wurden Gesandtschaften von Österreich und Ungarn entsandt, mit dem Auftrag, die Situation rund um den Türkenkrieg eindrucksvoll zu schildern und um die Hilfe der Reichsstände zu bitten, um somit ein weiteres Argument zur Hand zu haben.87
Die europäische Dimension des Reichstags von 1594 und dessen Bedeutung für die Teilnehmer wird gleichfalls bei der Betrachtung der Anschreiben deutlich. Eine besondere Ehrung war die handschriftliche Einladung des Kaisers selbst, welches unter anderem der päpstliche Legat Madruzzo erhielt, wenn auch als Bischof von Trient, sowie König Christian IV. von Dänemark als Herzog von Holstein.88 Gleiches gilt für den spanischen König Philipp II. als Herzog von Burgund, deren Kopie er an den Erzherzog Ernst von Österreich als den Generalstatthalter der Niederlande schickte, um Burgund auf dem Reichstag zu vertreten.89 Daneben schickte der König aber auch einen offiziellen gesandten Spaniens, Don Guillén de San Clemente, um vor allem in der Frage um die Nachfolge als römischer König mitzuwirken.90 Auch Frankreich entsandte einen Gesandten, Guillaume Ancel, welcher vor allem Informationen über die Politik von Kaiser und Reichsstände in der Rheinregion sammeln sollte.91 Nebenbei war aber die Sorge Frankreichs groß, dass die Steuermittel nicht nur für die Abwehr der Türken genutzt werden, sondern auch mithilfe der dadurch aufgestellten Truppen Unterstützung für Spanien geleistet werden würde.92
3. Die europäischen Akteure
3.1 Dänemark und Holstein
Das Recht zur Reichstagsteilnahme erlangte Holstein erst 1548 unter Karl V., welcher es als Gesamtlehen anerkannte und somit den Herzögen auch Sitz und Stimme auf dem Reichstag zusicherte.93 Allerdings finden sich Gesandtschaften aus Holstein bereits seit 1471 regelmäßig auf den Reichstagen wieder und werden auch in den Heeresmatrikeln aufgeführt.94 Dort zwar bereits als Herzöge von Holstein aufgeführt, fand die Erhebung der vorherigen Grafschaft Holstein zum richtigen Herzogtum erst in dem Jahr 1474 statt. Bis 1495 stellten diese aber weder Truppen noch leisteten sie entsprechende Zahlungen zur Unterstützung des Kaisers. Im Laufe des 16. Jahrhundert hingegen werden die Herzöge von Holstein immer öfter in finanziellen Angelegenheiten auch auf den Reichstagen mitbesteuert.95 Dennoch konnten die Holsteiner auf eine enge Beziehung zu den Habsburgern blicken, da seit 1514 der dänische König Christian II. mit der Habsburgerin Isabella verheiratet war und dementsprechend unterstützten sie auch Karl V, trotz ihrer protestantischer Konfession.96 Durch das 1548 vergebene Recht auf Reichstagsteilnahme ergab sich gleichzeitig das Problem der angemessen Session im Fürstenrat und die Holsteiner sprachen entsprechend bei Kaiser und Ständen vor. 1594 war diese Frage allerdings noch nicht geklärt und Holstein fand sich in Differenz mit einigen Ständen bezüglich ihres Ranges wieder.97
Dass der Herzog von Holstein gleichzeitig König von Dänemark war, ergab sich aus der starken Stellung der dortigen Landstände. Die unter anderem durch die Beschäftigung des Kaisers mit dem Osmanischem Reich und Frankreich starke und selbständige Ständegesellschaft im Norden des Reiches wird bereits 1522 auf dem Reichstag thematisiert, indem es als reichsfernes Gebiet betitelt wird.98 Faktisch übten die lokalen Fürsten eine adelige Selbstherrschaft mit großen Privilegien aus.99 Diese Ständeprivilegien waren vornehmlich das Werk der dänische Könige sowie deren Landräte. Der Kaiser übte in dieser Entscheidung keine Mitsprache aus.100 Diese galten im Übrigen sowohl für das Herzogtum Holstein als auch für das benachbarte Herzogtum Schleswig. Der Fluss Eider zwischen Schleswig und Holstein, hatte sich seit dem Mittelalter als Grenze zwischen dem Heiligen Römischen Reich und dem Königreich Dänemark eingespielt und wurde bis in das 18. Jahrhundert auch nicht hinterfragt.101 Dennoch überschnitten sich die Grenzen durch die Herrschaft eines gemeinsamen Lehnsherren und führten zu ständig neuen, auch grenzübergreifenden Landteilungen innerhalb der Herzogtümer.102 Faktisch gestaltete sich der Fluss daher eher als eine Grenze von Zoll, Sprache und Ortsnamen - als Reichsgrenze wurde sie nicht verteidigt.103 Beide Teile sahen sich daher auch als ein ganzes Gebiet und wirkten politisch oftmals als Einheit. Seit 1460, als Christian I. von den Landständen sowohl als Herzog von Schleswig wie auch als Graf von Holstein gewählt wurde, hielten die Stände die Unteilbarkeit ihrer Fürstentümer durch das Motto „Up ewig ungedeelt“ in dem Ripener Privileg fest, welches im Zuge der Wahl aufgesetzt worden war.104 Diese festgehaltene Unteilbarkeit hielt die Fürsten zwar nicht von einer Landesteilung ab, die Ritterschaft blieb aber auch nachfolgend ideologisch zusammengehörig.105 So entwickelte sich bereits aus den früheren Versammlungen der Ritterschaft Landtage in Schleswig und Holstein.106 Trotz der zweifellos vorherrschenden Einheit und gemeinsamen Politik fand sich bei Fragen um das Reich aber lediglich der holsteinische Adel zusammen und agierte selbstständig. In der Binnenpolitik war aber klar der Lehnsherr, also Dänemark, die zentrale Instanz.107 Dennoch boten die gemeinschaftlich agierenden Räte von Schleswig und Holstein eine sehr große Machtstellung aus. Eine Union der beiden Fürstentümer ermöglichte von der eigenen Herzogwahl auch ein faktisches Mitbestimmungsrecht innerhalb Dänemarks, wie die Krönung ihres Herzogs, Christian III., zum dänischen König zeigt.108 Die enge Beziehung zwischen Schleswig, Holstein und Dänemark wird auch in der „Ewigen Union“ von 1533 deutlich, welche bis ins 17. Jahrhundert hinein bestand hatte.109
Diese freie Wahl des eigenen Herzogs gestaltete sich als eine Besonderheit in der Reichsgeschichte.110 Die Stände beanspruchten dabei das Wahlrecht, welches in den skandinavischen Gebieten genutzt wurde. Die dänischen Könige hingegen beanspruchten durch die im Reich wirkende Praxis des Erbrechts den Titel des Herzogs auch für ihre Nachkommen. Es kam also zu einer überkreuzenden Ausnutzung der gegenteiligen Herrschaftsrechte.111 Am Ende kam es zu einer Mittellösung für beide Seiten, bei der die Landstände zwar ihren Herzog wählen konnten, aber nur aus einem Mitglied des Oldenburger Hauses.112 Diese Vermischung der verschiedenen Ansichten sorgte im Laufe der Geschichte der Herzogtümer zu kleinteiligen Landteilungen. In der Frühen Neuzeit gliederte sich sowohl Schleswig als auch Holstein in einen von den dänischen Königen regierten „königlichen Teil“ als auch in einen aus einer Erbschaftsteilung herausgegangenen „herzoglichen Teil“ unter der Regierung der Schleswig-Holstein-Gottorfer. Beide wurden grundsätzlich einzeln verwaltet, lediglich in einem gemeinschaftlichen Anteil waren Räte beider Anteile vertreten. Für die Gottorfer ergab sich daraus eine besondere rechtliche Stellung, waren sie doch als Herzöge von Schleswig Lehnsmänner des dänischen Königs, wurden aber als Herzöge von Holstein vom Kaiser belehnt.113 Neben dieser Teilung waren die Gottorfer im Laufe der Zeit auch immer mehr an einer Differenzierung vom dänischen König interessiert und konnten durch eine ausgefeilte Heiratspolitik Einfluss außerhalb der Herzogtümer generieren.114 Durch ihre Nähe zum Kaiser und dessen Unterstützung konnten sie im Reich eigene Interessen durchsetzen sowie durch Hochzeiten mit dem schwedischen Königshaus, welches in Rivalität mit Dänemark stand, eine unabhängige Politik verfolgen.115 Generell lag deren Tendenz auf Hochzeiten mit überregionalen Mächten um ihre Stellung zu festigen.116 Die Standeserhöhung zum Herzoghaus brachte dabei neue Möglichkeiten in der Heiratspolitik bis hin zu überkontinentalen Ehen.117
Durch die starke Verschränkung von Dänemark und Holstein konnten die dänischen Könige bereits sehr früh im Reichsgeschehen mitwirken und sowohl Reichs- als auch Kreisrecht vorteilhaft nutzen. Als Kreisoberste konnte der Gottorfer Herzog Adolf von Holstein beispielsweise sein Amt zur territorialen Expansion nutzen und gleichzeitig gute Beziehungen zu Karl V. und dessen Sohn Philipp II. pflegen. Zusätzlich konnte er sich auf Kreiskosten gegen rivalisierende Fürsten zur Wehr setzen, welche nicht nur Holstein, sondern auch die dänische Krone zum Ziel hatten. Durch die familiäre Beziehung zum König griff dieser auch aktiv in innere Kreisstreitigkeiten auf Seiten Adolfs ein und dieser warb im Gegenzug Truppen für den dänischen Krieg gegen Polen, Schweden und Russland.118 Innerhalb des Reichskreises konnten die dänischen Könige generell eine unterschiedliche Politik ausüben. König Friedrich I. beispielweiße trat konfrontativ mit starker Expansion auf, wohingegen sein Nachfolger Christian III. eine diplomatische Tendenz mit den übrigen Fürsten des Kreises anstrebte.119 Auch Christian IV. nutzte seine Stellung als Reichsfürst im Niedersächsischen Kreis sowie als dortiger Kreisoberster, um die anderen Fürsten im Dreißigjährigen Krieg gegen den Kaiser auszuspielen.120 Neben des Kreistagen wurden Konflikte innerhalb Dänemarks auch auf Reichsversammlungen ausgetragen. Beim Reichstag 1570 in Speyer wurde über kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Friedrich II. und dessen Bruder Bischof Magnus in Lievland verhandelt und in einzelnen Sitzungen beraten. Die Reichsstände wollten dabei über Holstein Druck auf die dänische Königsfamilie ausüben.121 Auch bedrohten Parteigänger Dänemarks und Schwedens in Zeiten des siebenjährigen dänisch-schwedischen Krieges den Landfrieden des Reiches.122 Auf einem späteren Reichsdeputationstag 1586 nahm der König Friedrich II. als Herzog von Holstein teil. Dort berieten die Protestanten über die Unterstützung Dänemarks für den konfessionellen Konflikt innerhalb des Reiches und Friedrich II., obwohl als Reichsstand geladen, konnte als dänischer König auftreten und verhandeln.123 Insgesamt ist also die Stellung der dänischen Könige im Reich durch ihre Rolle als Herzöge von Holstein sehr einflussreich und ermöglichte ihnen einen großen Spielraum für ihre eigene Politik innerhalb des Reiches.
3.2 Burgund und Spanien
Neben Österreich gehörte Burgund seit den Zeiten Maximilians I. zu den sogenannten „habsburgischen Erblanden“ und genoss deshalb eine besondere Stellung im Reich. Bereits Karl V. betonte, dass er seine niederländischen Erblande zwar „sub imperio vel de imperio“ aber nicht „in imperio“ hielt, also bereits eine selbständigere Stellung unter dem Schutz des Reiches genoss.124 Während Karl V. sowohl Reich als auch Spanien zwar nicht unter einer Herrschaft, aber unter einer Person vereinte, ging an seinen Sohn Philipp II. nur Spanien. Hierbei zeigt sich, dass die spanische Krone vermutlich als die bedeutsamere für die Habsburger angesehen wurde. Zumindest taucht in der Instruktion Karl V. an seinen Sohn das Reich in den Hintergrund und es werden spanische Angelegenheiten wie die Steigerung der eigenen Einnahmen oder die Zusammensetzung des Kriegsvolkes sowohl an Land als auch zu Wasser geregelt. Allerdings werden bereits die Türken wie die Franzosen als gemeinsamer Feind der Habsburger aufgeführt und entsprechend wird Philipp II. um eine gemeinsame Arbeit gegen diese instruiert.125 Auch zeigte sich im Allgemeinen ein mangelndes Interesse Spaniens in Bezug auf das Reich und dessen Reichstage und stand nie sonderlich im Mittelpunkt spanischer Interessen. Im Gegenzug sei auch gesagt, dass die Bewohner des Reiches die Spanier auch nicht besonders schätzten oder willkommen hießen.126 Neben den bereits vorher geschilderten Vorurteilen wurden deshalb auch häufig negative Vorfälle der spanischen Gesandtschaften festgehalten, wie deren Beschädigung eines Prangers durch spanisches Gesindel.127 Neben der Beziehung zu den Reichsfürsten gestaltete sich auch die Beziehung zu den kaiserlichen Verwandten als schwierig. So waren die Verhandlungen zur Türkenhilfe zwischen dem Kaiser und Spanien angespannt und mussten deshalb vom Papst unterstützt werden. Diese waren zwar erfolgreich, die Auszahlung der vereinbarten Summe zog sich aber hin.128 Vereinfacht wurde das Ganze durch die überschneidenden Machtansprüche nicht. So waren die österreichischen Habsburger durch den Kaisertitel zwar aufgewertet und im Falle der Niederlande und Burgund Lehnsherr des spanischen Königs, allerdings durch finanzielle Zermürbung durch den anhaltenden Konflikt mit dem Osmanischen Reich von spanischen Geldmitteln und deren politischen Macht abhängig. Gleichzeitig waren die Niederlande auch eine wichtige wirtschaftliche Region und deshalb für beide Seiten von Interesse.129
Am 25. Oktober 1555 übertrug Karl V. vor den Deputierten der niederländischen Generalstände Philipp II. die burgundischen Provinzen.130 Bereits vier Jahre vorher wurde dieser bereits als Infant formal mit Burgund belehnt.131 Aus den zu diesen Anlässen erstellten Urkunden geht die Stellung Burgunds als Reichslehen nicht klar hervor. Als richtungsweisend gilt stattdessen eine Übereinkunft von 1548, der sogenannte „Burgundische Vertrag“, welcher einige Zugeständnisse zugunsten des Herzogtums erteilt.132 In diesem wird die Zugehörigkeit der Niederlande zum Reich betont und diese somit auch dessen Schutz unterstellt. Auch wird das Lehen weiterhin als Reichslehen vom Kaiser vergeben. Ebenso dürfen die Herzöge am Reichstag teilnehmen und Session und Stimme aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu den Habsburgern als Erzherzöge von Österreich führen. Gleichzeitig werden aber auch Freiheiten gegeben, indem die Generalstände der Niederlande von der Jurisdiktion des Reichskammergerichts befreit werden. Für all die Privilegien müssen diese aber einen zweifachen, im Falle der Türkenhilfe den dreifachen Steueranschlag eines Kurfürsten zahlen. Dieser Vertrag stellt ein Kompromiss zwischen den Interessen Karls V. und den Reichsständen dar, welcher besonders in Fragen der Türkenhilfe nötig war. Während Ferdinand I. noch 1542 deren Eintreibung drohte, betonte Karl V. die Befreiung der Niederlande von Reichsanschlägen.133 Diese Gegensätzlichen Interessenspunkte sollten also mit diesem Vertrag geregelt werden, indem eine festgelegte Zahlung vereinbart wurde. Im Sinne einer befriedigenden Lösung ließ der Vertrag noch einige Fragen offen, was beispielweise einige Bereiche betraf, die nicht formal zu den burgundischen Erblanden zählten.134 So konnte aber jede Seite den eigenen Standpunkt auf den Vertrag projizieren. Für die Reichsstände war dieser ein vom Kaiser verliehenes Privileg, welches zwar die Freiheit eines Reichsstandes betonte, aber immer noch vom Reich gegeben wurde und gegebenenfalls wieder annulliert werden konnte. Für die Generalstaaten stellte dieser jedoch vielmehr ein Defensivbündnis und die Vereinigung aller Gebiete zum burgundischen Kreis und zugleich die Einflussnahme auf Reichsgeschehen durch die Vertretung am Reichstag und dem Reichskammergericht dar. Dafür zahlten sie im Gegenzug die erwähnten Anschläge.135 Dieser ungelöste Konflikt zeigte sich im Kriegsfall gegen ausländische Mächte als ein schwieriges Hindernis. So verweigerten die Reichsstände den Niederlanden Hilfe gegen Frankreich, da sich diese nicht dem Reichskammergericht unterwarfen. Die Reichskontributionen wurden dennoch auferlegt, wenn auch nicht immer bezahlt.136
Diese außergewöhnliche Stellung Burgunds im Reich spiegelt sich auch auf den Reichsversammlungen wider. So war Burgund zwar Mitglied reichsständischer Versammlungen, trat aber in einigen Bereichen wie dem Münzwesen eher als gleichrangiger Partner der Reichsstände auf. Diese offene Rechtslage verwässerte sich immer weiter. Zugute kam Burgund sowohl als Reichsstand wie auch als Reichskreis dabei seine innere Geschlossenheit, da die burgundischen Landstände keine Reichsstände waren und somit Burgund stets mit einer Stimme auf den Reichstagen sprach, da die lokalen Fürsten keinen eigenen Sitze innehatten.137 Im Falle der Münzordnung zeigt sich dieser Umstand besonders gut, in welchem sowohl Burgund als auch die Reichsstände mit dieser Stellung verschieden umgehen konnten und mussten. So kam es in diesem Fall zu intensiven Verhandlungen, bei denen die Einführung dieser Ordnung nicht einfach durch die Stellung als Reichsstand sichergestellt werden konnte, sondern wie im Falle einer fremden Macht intensiv verhandelt werden musste.138 Aus dieser Besonderheit erging schon den zeitgenössischen Fürsten ein schwieriger Umgang, der in der Aussage „man muss mit Burgundt milt umbgehn wie man kont, nit, wie man wolt“139 seinen Anklang findet. Somit konnte der spanische König Philipp II. über Burgund Einfluss auf das Reichsgeschehen nehmen, beispielsweise am Reichsdeputationstag 1569, bei welchem burgundische Themen wie die niederländischen Konflikte behandelt werden sollten. Solche Deputationstage bisher nicht beachtend, wollte Philipp II. jetzt in den Kreis der Deputierten aufgenommen werden, um zu diesen Themen informiert zu werden und darin mitzuwirken.140 Durch enorme Geldmittel konnte sich der spanische König gleichfalls die Truppenunterstützung des bereits erwähnten niedersächsischen Kreisoberst und dänischen Herzogs Adolf von Holstein-Gottorf sichern.141 Auch 1570 beharrte Philipp II. durch Burgund auf sein Recht zur Teilnahme am Speyrer Reichstag. Ein Umschwung, um die Verbindung zum Reich und vor allem den Reichsständen nicht zu verlieren und so Sicherheit im Reich zu genießen. Dies wurde vor allem von Österreich unterstützt, in der Hoffnung, eine bessere Exekution von Reichstagsbeschlüssen durchsetzen zu können.142
Die Sonderstellung des spanischen Burgunds sorgte immer wieder für ein enormes Konfliktpotential in der Beziehung zwischen Spanien und dem Reich, primär in Sachen der Besteuerung. Die Zahlung von Reichssteuern wurde unter Philipp II. zunehmend vernachlässigt, genauso wie die Umsetzung verschiedener Beschlüsse der Reichsversammlungen wie die bereits genannte Reichsmünzordnung, welche allerdings auch bei einigen Reichsständen für Uneinigkeit sorgte.143 Dennoch einte der Widerstand bei dessen Umsetzung, die sich zwar nicht auf den burgundischen Vertrag berief, aber durchaus in dessen Geist geschehen konnte, die übrigen Reichskreise zu einer gemeinsamen Schlussschrift, in welcher sie die Umsetzung der Münzordnung von Burgund forderten.144 Bis 1594 war Philipp II. in Steuerrückständen in Höhe von 131.000 Gulden, welche zwar des Öfteren angemahnt, von Philipp II. aber mit der Begründung des Konflikts in den Niederlanden stets verschoben wurde.145 Bei den übrigen Reichsständen sorgte das für zunehmenden Missfallen in der gegenseitigen Beziehung mit Spanien. Der Lokaladel der Niederlande hingegen war stets mit dem restlichen Reichsadel verbunden geblieben und teilweise nebenbei noch Eigentümer von anderen Reichslehen. In der aufstrebenden Selbstständigkeit blieb die Niederlande daher immer ein Streitthema und mündete bis zur Verweigerung des von Spanien beschlossenen Statthalters von Seiten der niederländischen Landstände.146 So kam es auch, dass die Reichsstände im aufkommenden Niederlande-Konflikt eher zugunsten der Aufständischen intervenierten, auch wenn der Kaiser selbst einen versöhnlichen Ausgang bevorzugte.147 Dies sorgte mitunter dafür, dass burgundische Gesandte sich fühlten, „als wenn Burgonde under das reich nit gehoerich, sonder wie andere frembde lande davon abgesondert were.“148
Diese gesamten Zusammenhänge finden sich in dem Konflikt Spaniens mit den im späten 16. Jahrhundert aufständischen niederländischen Generalstaaten wieder. Bereits im Laufe des 15. Jahrhunderts waren die Niederlande nicht auf den Reichstagen vertreten, und arbeiteten eine immer weitere Autonomie vom Reich aus.149 Es kam ein bis ins 17. Jahrhundert reichende Prozess in Gange, bei dem die Verbindung zwischen den Niederlanden und dem Reich immer weiter gelöst wurde. In Zusammenhang mit ihren Privilegien ließen sie sich diese aber noch immer vom Kaiser bestätigen.150 Auch im Zuge des Aufstandes gegen die spanische Lehenshoheit pflegten die Generalstaaten weiterhin Beziehungen zum Reich. Auf dem Reichstag zu Speyer 1570 schicken die Niederländer eine eigene Gesandtschaft unabhängig der burgundischen Teilnehmer und vertraten ihre eigenen Politik, indem sie um eine Mitgliedschaft in den westfälischen Reichskreis ersuchten.151 Die spanisch zugewandten Burgunder waren klar gegen ein solches Eingreifen der Reichstände in den Konflikt. Die Position der Niederlande und die Reaktion des Reiches verliefen dabei zwiespältig. Während die Stände auf die Rechtsverbindlichkeit und Verpflichtungen der Niederlande als Mitglied des Reiches beharrten, beriefen sich die Burgunder durch den Burgundischen Vertrag auf Reichsunabhängigkeit in dieser Angelegenheit. So verfuhren weder Kaiser noch Stände konsequent.152 Dieses Problem zieht sich im Laufe der Jahre über mehrere Reichstage hinweg, auf denen weiterhin weder Kaiser noch Reichsstände richtig intervenieren wollten.153 Aus diesem Grund spielen die Reichstage aus niederländischer Sicht ab 1590 eine zunehmend untergeordnete Rolle, auch wenn die Kontakte nie gänzlich abnehmen. Dennoch bleibt die Vermittlung zwischen Spanien und den Niederlanden weiterhin Thema auf den Reichstagen, auch wenn wenig Handfestes beschlossen wurde.154 Die Reichsstände des westfälischen Kreises waren allerdings die größten Interessenten in niederländischen Themen, insbesondere der Schadensregulierung und Kompensation, waren sie durch ihre Grenze zu den Niederlanden doch am meisten von dem Konflikt betroffen. So drohten diese bereits am Deputationstag in Frankfurt 1569 mit einem Steuerboykott, welche zwar nicht durchgesetzt wurde, aber dennoch auch nachfolgend Thema blieb.155 Das Reich verfuhr also zur Entschärfung des niederländischen Brandherdes in einer Politik der Vermittlung und Nicht-Einmischung, um vor allem religiösen Spannungen keinen Nährboden zu geben. Es ist aber festzuhalten, dass der Kaiser tendenziell die spanischen Aktionen deckte.156 Die niederländischen Generalstaaten übten sich fortlaufend um eine eigenständige Außenpolitik, um Bündnisse gegen Spanien zu finden. Verbündete fanden sie dabei in Frankreich und England.157 Somit wurde der Konflikt selbst in Dänemark zum Thema des 1594 in Kopenhagen stattgefundenen Reichstages. Zu diesem wurden neben den niederländischen Ständen auch der spanische König geladen.158 Die Niederländer betonten dabei die guten Beziehungen zu England, Schottland und einigen deutschen Fürsten, in dessen Verbundenheit sie auch den dänischen König schließen wollten. Die Interessen Burgunds bezogen sich also vordringlich auf die Lösung des Problems mit den Niederlanden, für welches sie mitunter gegen einzelne Reichsstände agieren mussten.
4. Die Gesandtschaften am Reichstag 1594
4.1 Die Akkreditierung – Herausforderungen vor den Verhandlungen
Die Schwierigkeiten auf dem Reichstag 1594 ergaben sich aus dem frühen Tod des dänischen Königs Friedrich II. bevor sein Sohn, Christian IV., volljährig wurde. Aus diesem Grund wurde ein Regentschaftsrat aus dem Reichsrat Dänemarks gebildet, an welchem dessen Mutter, Königin Sophie, nicht beteiligt wurde. Durch ihren Anspruch als Witwe des einen und Mutter des anderen Königs entwickelte sich daraus ein jahrelanger Streit zwischen beiden Parteien.159 In der Folge wurde Sophie schließlich in die Verbannung gezwungen und konnte in der Politik Dänemarks nicht mehr in diesem Sinne mitwirken.160 Durch die Volljährigkeitserklärung des Kaiser wurde Christian IV. auch bereits 1593 als vollständiger König und Herzog gehuldigt, bei welchem auch kaiserliche Kommissare anwesend waren und die selbstständige Verwaltung und Administration des Königs erklärt wurde.161 Ab da lässt sich Christian IV. auch als selbstständiger König und Herzog im Reich greifen, unter anderem durch umfangreiche Delegationen in verschiedene Fürstentümer des Reiches sowie eine Heirat mit den Brandenburgern.162 Im Falle der Türkenhilfe wurde er auch abseits seiner Stellung als Reichsfürst bereits im Mai vor dem Reichstag um Beihilfe gebeten und um eine Allianz verhandelt.163 Eine Besonderheit ergibt sich aber aus der vorher beschriebenen Selbständigkeit der Herzogtümer und den dortigen Landständen. Von den örtlichen Landtagen wurde Sophie als Vormund all ihrer Söhne, zu Christian IV kamen noch seine minderjährigen Brüder Ulrich und Johann hinzu, bestätigt. Der dänische Reichsrat hatte in diesem Fall kein Mitspracherecht, besonders im Falle des Reichslehens Holstein.164 So war diese Wahl der Regentschaft zwar Anfangs schwierig durchzusetzen, konnte die Königin aber mithilfe von Verbündeten in den Landständen schließlich durchsetzen.165 Somit leitete Sophie auch nach der erklärten Volljährigkeit einen Herrschaftsanspruch ab, zumindest bis die Versorgung der Brüder mit Land geklärt worden sei.166 Ein Problem, welches auch beim Reichstag 1594 noch nicht gelöst war, was die Reichsräte bei der Einladung vor ein Problem stellte. Infolgedessen wurde im geheimen Rat die Einladung beider Parteien beschlossen, da Christian IV. zwar das Herzogtum nicht mit seinen Brüdern geteilt, Königin Sophie aber zum Vormund der jüngeren Brüder auch vom Kaiser anerkannt wurde. Allerdings wurde der König selbst mit einer handschriftlichen Einladung zum Reichstag geladen.167 Am 7. Juni akkreditierte so die Gesandtschaft von Christian IV., Benedikt von Alfeldt und der Jurist Veit Winsheimer, als Herzog von Holstein und verblieb bis zu ihrer Abreise am 16. Juli als Reichstand auf dem Reichstag.168 Königin Sophie schickte, anders als ihr Sohn, keine komplett eigene Delegation. Stattdessen wurde eine Vollmacht dem Gesandten des Gottorfer Herzogs, Hermann von der Becke, mitgegeben, um die königlichen Brüder zu vertreten.169 Dieser akkreditierte als Abgesandter des Bischofs von Lübeck, wie sich die Gottorfer Herzöge am Reichstag üblicherweise anmeldeten, am 3. Juni in Regensburg – also vor der Gesandtschaft Christians IV..170 Diese Problematik sollte die Verhandlungen auf Seiten Holsteins empfindlich stören. Es ist gleichsam festzughalten, dass Königin Sophie zumindest indirekt von den Gottorfer Herzögen unterstützt wurde, indem sie sich ihren Gesandten gewissermaßen teilten. Das gliedert sich gut in die bereits beschriebene Tendenz zur eigenen Politik des Hauses Gottorf abseits der dänischen Könige ein.
Wie bereits oben erwähnt, oblag die Auswahl der burgundischen Gesandten dem niederländischen Generalstatthalter Ernst von Österreich. Als Vertreter entsandte er Charles Philipp de Croy, den Marquise von Havre, sowie den luxemburgischen Regierungspräsidenten Jan Hattstein.171 Die Gesandtschaft wurde später nur noch Philipp II. berichtet und von diesem bestätigt.172 Auf dem Reichstag sollten sie anhand ihrer Instruktion die Reichsstände in Hinblick auf die Türkenhilfe vertrösten, indem sie zwar dessen Wichtigkeit für Philipp II. betonten, aber auch auf die Probleme in Bezug auf die Aufständischen hinweisen sollten.173 Hier wird bereits die Türkenhilfe mit internen Interessen verknüpft, indem Hilfe von den Reichsständen gegen die Niederlande erbeten wird, um im Gegenzug die Türkensteuer zahlen zu können. Dennoch muss festgehalten werden, dass Philipp II. bereits Anfang Juni in Madrid auf Anfrage des kaiserlichen Gesandten Maximilian von Dietrichstein eine Türkenhilfe in Höhe von 300.000 Dukaten bewilligte, deren Zahlung aber bis zur Ankunft der Silberflotten verschob.174 Zu dem Thema mit der Niederlande schrieb Herzog Ernst bereits im April persönlich an den Kaiser mit der Bitte, den Reichstag zum Beschluss einer friedensvermittelnden Delegation zu nutzen.175 Der Punkt des Landfriedens in den Niederlanden wurde somit auch Teil der Proposition und der Reichstagsverhandlungen. Auch in den Themen der Reichsmünzordnung wird über Burgund im Namen des spanischen Königs gesprochen.176 Als Teil der gesandtschaftlichen Aufgaben schickte de Croy auch immer wieder Berichte an den Statthalter Ernst. Dort wird der spanische König auch als eigener Herr genannt.177 Die burgundische Gesandtschaft akkreditierte am 3. Mai in Regensburg, allerdings noch ohne de Croy.178 Dieser meldete sich erst am 14. Mai beim Kurfürsten von Mainz an. Dabei wird auch schon die Bedeutung der niederländischen Angelegenheiten deutlich, indem der Gesandte bereits darum bat, die Eingaben der Aufständischen nicht ohne die Anhörung der Burgunder zu entscheiden.179 Neben der burgundischen Gesandtschaft war auch der spanische Langzeitbotschafter aus Prag, Don Guillén de San Clemente, auf dem Reichstag als spanischer Gesandter aktiv.180 Als solcher konnte dieser nicht an den offiziellen Reichstagsverhandlungen in den Kurien teilnehmen, aber im Gegenzug zu der Gesandtschaft aus Burgund berichtete dieser dem spanischen König direkt vom Reichstagsgeschehen und konnte mitunter Empfehlungen zum Umgang mit einigen Reichsständen, wie beispielweise dem Administrator von Kursachsen Friedrich Wilhelm, geben.181 Als Langzeitbotschafter galt er als ein spanischer Experte in Reichsangelegenheiten und wurde als solcher auch öfter zu Rate gezogen.182 Auch kannten sich der Erzherzog Ernst und de San Clemente bereits vom Kaiserhof in Prag und unterhielten ein freundschaftliches Verhältnis. So schenkte der Erzherzog dem Spanier von den Türken erbeutete Kamele aus Ungarn.183 Auf spanischer Seite konnte somit von zwei Seiten aus agiert werden, da beide Gesandtschaftsformen ihre eigenen Vorteile bieten konnten.
4.2 Die Verhandlungen
In den Verhandlungen im Fürstenrat zum Thema des niederländischen Landfriedens war die burgundische Stellung zwiegespalten. Bereits früh berieten die Stände über die Bildung eines Ausschusses aus der weltlichen und der geistlichen Bank des Fürstenrates, welcher über den niederländischen Krieg beraten sollte. Bereits dort machte das Fürstentum Pfalz-Lautern die Parteilichkeit Burgunds zum Thema für einen Ausschluss der Gesandten aus den Verhandlungen.184 Burgund hingegen betonte, nicht aus den Sitzungen ausgeschlossen werden zu wollen und stimmte für die Bildung eines Ausschusses. Auch in weiteren Verhandlungen, als die Bildung eines Ausschusses scheiterte und über eine andere Vorgehensweiße verhandelt werden musste, steht dieser Vorwurf noch im Raum. Burgund geht in diesem Fall auf die Parteilichkeit ein und erkennt diese an, nicht aber ohne auf einen Feldzug des Pfalzgrafen von Pfalz-Lautern von 1578 hinzuweißen. Dieser unterstützte damals die Generalstaaten gegen den Statthalter, woraus Burgund nun gleichfalls Pfalz-Lautern als parteiisch hinstellte und entsprechend gegen deren Mitwirken protestierte.185 Auch in anderen Angelegenheiten wird die Verbindung von Burgund und Spanien kommentiert. Pfalzgraf Johann von Zweibrücken vermutete die Probleme im Magdeburger Sessionsstreit im Zusammenwirken der päpstlichen Gesandten einerseits und den Spaniern und Burgundern andererseits.186 Nebenbei wird bei den Abstimmungen das Verhältnis zu Österreich deutlich. Beide Fürstentümer saßen durch ihren Rangstreit mit Bayern und Sachsen auf der geistlichen Bank und Österreich beanspruchte durch familiäre Nähe zum Kaiser den Vorsitz im Fürstenrat.187 Durch diese Stellung stimmten sie als erstes ab und die burgundischen Gesandten unterstützten deren Vorschläge.
In der Türkenhilfe zeichnet sich die Beeinflussung in der spanischen Politik besonders gut ab. Bereits sehr früh bringt die burgundische Gesandtschaft Klagen über die spanische Situation in Hinblick auf die aufständischen niederländischen Stände vor.188 Hierbei ersuchen sie auch gleichzeitig um Unterstützung der Reichsstände in dieser Angelegenheit. Im weiteren Reichstagsverlauf klagten die Burgunder auch weiterhin im Namen Philipps II., auch in der Frage nach einer niederländischen Friedensgesandtschaft oder der Anerkennung einer Reichsstandschaft von Gebieten an der Grenze zwischen Niederlande und dem restlichen Reich.189 Diese Argumentationsstruktur zieht sich weiter bis in die Ausarbeitung der konkret gestellten Summe der Türkensteuer. Bei dem ersten Vorschlag von 80 Römermonaten wird wieder auf die Probleme in den Niederlanden verwiesen.190 Allerdings zeigt sich auch die Bereitschaft Philipps II., im Türkenkrieg handfeste Hilfe zu leisten, indem die Burgunder im Falle von 50 Römermonaten auf eine zu gering ausfallende Hilfeleistung hindeuten.191 Dabei wird auch deutlich, dass Philipp II. grundsätzlich eine vermittelnde Verhandlung anstrebt, in dem immer wieder betont wird, sich nicht gegen die übrigen Reichsstände stellen zu wollen. So wird auch immer wieder die Zahlungswilligkeit im Sinne des Reichszusammenhaltes betont.192 Alles in allem will sich Spanien also nicht isolieren lassen, insbesondere, da die Verbündung mit den Generalstaaten verhindert werden soll. Die burgundischen Gesandten betonten also auch Trotz des Unwillens im Zuge einer Einmischung durch die Friedensvermittlung die Zugehörigkeit zum Reich.193 Im gleichen Zuge übten die Reichsstände über Burgund aber auch Druck auf Spanien aus. Das Fürstentum Nassau beispielweise ruft Erzherzog Ernst dazu auf, die Spanier vom Boden des Reiches fernzuhalten.194
Die Anwesenheit von den burgundischen Gesandten einerseits und dem offiziell von der ausländischen Macht Spanien entsandten de San Clemente ermöglichte es Spanien, in vielfältiger Hinsicht auf die Verhandlungen Einfluss zu nehmen. Laut auf protestantischer Seite verbreiteten spanischen Berichten stand der König Spaniens mit dem Kuradministrator Friedrich Wilhelm von Kursachsen in Verhandlung um Überlassung von Söldnern. Auf dem Reichstag wurden diese durch die Gesandten de San Clemente und Charles Philippe de Croy intensiviert. Da Friedrich Wilhelm unter anderem auch zu der später beschlossenen Friedensdelegation zwischen Niederlande und Spanien als Teilnehmer bestimmt wurde, erklärte er sich zur Interessensvertretung und Bereitstellung von Söldnern bereit.195 De San Clemente empfahl durch diese Teilnahme an der Friedensvermittlung in seinem Bericht an Philipp II. auch, den Kuradministrator sowie den Pfalzgrafen von Neuburg eine Pension zu geben.196 Trotz der Ablehnung der Friedensvermittlung arbeitete Spanien also an einem möglichst großen Einfluss innerhalb der Fürstengruppe. Auch im Falle der römischen Kurie arbeitete Spanien in enger Kooperation, insbesondere in der römischen Königswahl, welche beide Parteien in Katholischer Hand sehen wollten.197 Dementsprechend lauteten die Instruktionen der katholischen Reichsstände, sich ebenfalls in Religionsfragen mit den päpstlichen und spanischen Gesandten abzustimmen.198 So fand auch ein Gespräch des Bischofs Julius von Würzburg mit dem päpstlichen Legaten Madruzzo, dem Nuntius Speciano sowie de San Clemente statt.199 Die Möglichkeiten der Einflussnahme waren also auch abseits des Fürstenrates vielfältig. Insbesondere in der Frage zur Magdeburger Session arbeiteten beide Seiten möglichst zusammen. Beide sollen so zusammen den Kaiser zum Verweigern der Session überzeugt haben, nachdem Rudolf II. die Türkenhilfe erhalten hatte200
Die holsteinische Gesandtschaft ist durch ihre eigene Sessionsproblematik vor allem in den Verhandlungen der protestantischen Stände zu greifen. Dort werden die Religionsfragen aufgrund der Magdeburger Session sehr intensiv diskutiert. Die Holsteiner sprachen sich dabei auch, ihre eigene Situation bedenkend, für die Einnahme der Session aus. Erst im späteren Verhandlungsverlauf lassen sie die Forderungen für einen schnellen Abschluss des Reichstages fallen. Durch ihre eigenen immer weiteren Streitigkeiten mit den Abgesandten der Königin Sophie bleiben sie den übrigen Verhandlungen schließlich fern. Neben diesen Verhandlungen waren sie auch Teil von Repräsentanten beim Kaiser, um dort Fürsprache für die Magdeburger zu halten.201 Hermann von der Becke, der Gesandte Sophies, verhandelt innerhalb des Fürstenrates als Bischof von Bremen und Lübeck und nicht als Gesandter eines holsteinischen Herzogs oder im Namen der Königin Sophie.
4.3 Da sein oder nicht da sein - Session und Anwesenheit
Die Session bei festlichen Akten war eine komplizierte Sache. Ordentlich geregelt war lediglich die Session des Kaisers und der Kurfürsten, die anderen Fürsten sollten sich nach ihrer Rangordnung entsprechend einordnen. Diese wage Anordnung bereitete in sich bereits Probleme. Zum einen konnten die Session einiger Fürsten von anderen in Streitfällen nicht anerkannt werden. Zum anderen galt diese in Zeiten der personalen Symbolik nur für den Fürsten selbst, dessen Gesandter konnte auf diesen Anspruch nicht zurückgreifen.202 Es resultierte somit vor allem aus den eigenen Beziehungen und der Überzeugungsarbeit, die Session des entsendenden Fürsten einnehmen zu können. Bereits die Eröffnung des Reichstages verzögerte sich somit aufgrund des bereits geschilderten Streites um die Zulässigkeit der Session reformierter Hochstifte. Insbesondere die Administratoren der Erzstifte Magdeburg und Bremen sowie die Bischöfe von Halberstedt, Lübeck, Ratzeburg, Verden und Osnabrück bestanden auf ihr Sessionsrecht und stellten Abgesandte für den Reichstag bereit. Als besonderer Streitpunkt kam noch die Session Straßburgs hinzu, wo zwei auf das Recht zur Reichstagsteilnahme beharren.203 Einer von beiden, der Markgraf Johann Georg, wurde zwar mehrheitlich gewählt, hat aber weder die Bestätigung des Papstes noch die Regalien des Kaisers und wendet sich so an die einzelnen Reichsstände, um seine Sache zu unterstützen. Bei der Gesandtschaft Christians IV. gibt er auch ein an ihn adressiertes Schreiben mit, um dessen Unterstützung zu erlangen.204 Auch die Magdeburger wenden sich mit ihrem Gesuch an die Holsteiner.205 Beide Gesandtschaften bringen ihr Problem im Übrigen nur der Gesandtschaft Christians IV. vor, nicht jedoch die der Königin Sophie. Dieser Streitpunkt in Sachen Sessionsrecht zog sich bis in das kirchliche Pfingstfest, über welchen der venezianische Abgesandte Tommaso Contarini berichtet und einen Streit um die Session beim Weihwasser und Weihrauch schildert.206
Hermann von der Becke hatte als Gesandter des Bischofs von Bremen und Lübeck also eigene Probleme, die Session für Bremen durchzusetzen. Bereits bei dessen Akkreditierung am 3. Juni wurden die Probleme aufgrund der protestantischen Zugehörigkeit ein Thema.207 So ist er zwar auf die Sitzungen des Fürstenrates schon vor Ankunft des Kaisers eingeladen, will aber dessen Ankunft abwarten, um sich über einen Ausschluss aufgrund seiner Religion zu beschweren.208 Die Beschickung zum Reichstag erfolgte nämlich nicht durch das Domkapitel, sondern vom Bischof Johan Adolf, dessen Position zu dieser Zeit noch umstritten war und ihn zu einer Supplikation beim Kaiser veranlasste. Dennoch beharrte er weiterhin auf Grundlage des Augsburger Religionsfrieden auf die Session im Fürstenrat. Er droht sogar bei der Verweigerung des eigenen Platzes mit nicht weiter benannten Konsequenzen der Häuser Holstein und Braunschweig.209 Aufgrund dessen erklärte er sich auch nicht dazu bereits, jegliche andere Sessionskonflikte in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen.210 Zwar verzichtete von der Becke im späteren Verlauf auf Session, in der Gravamina der protestantischen Stände unterzeichnete er aber nicht.211 Neben den allgemeinen Problemen der Session kämpften die beiden verschiedenen Holsteiner Gesandtschaften zusätzlich noch untereinander durch den geschilderten Konflikt um die Anerkennung auf dem Reichstag. Bei der Anmeldung schilderten die Gesandten des Königs Christian IV. ihr Befremden über die Zulassung der Gesandten der Königin Sophie aufgrund der inzwischen erfolgten Volljährigkeit ihres Königs und Herzogs.212 Wurde dieser Einwurf zwar mehr oder weniger ignoriert, sprach man der Königin bei der Eröffnung des Reichstages jedenfalls keine Session zu und so wurden die Gesandten als nicht einzuberufender Stand behandelt, wie sämtliche der Sessionsproblematik unterworfenen Fürsten.213 Diese Streitigkeiten zwischen den beiden Gesandtschaften zog sich über den gesamten Reichstag hinweg durch und führte zu Problemen in der Teilnahme bei den Verhandlungen. Im Falle der königlichen Gesandten kam es in einem Fall zur Aufforderung der Kurpfälzer und Magdeburger zur Sitzungsteilnahme bei den evangelischen Ständen. In diesem Fall sollte sogar die Sitzung ohne jeglichen Vorrang stattfinden und die Gesandten der Königin nicht eingeladen werden, da sich die Holsteiner um die Session sorgten.214 Letztlich blieb der Konflikt am gesamten Reichstag allerdings unentschieden und führte schließlich dazu, dass die Gesandten des Königs den Sitzungen lieber fernblieben, als eine falsche Session einzunehmen. Die Gravamina der protestantischen Stände haben sie aber noch mitunterschrieben, Hermann von der Becke hingegen ist nicht zu finden.215 Durch die Probleme haben die Holsteiner den Reichstag bereits vor dem Reichsabschied und dem weiteren Protest der protestantischen Seite verlassen.216 Die eigenen Probleme überlagerten also die Interessen der gesamten protestantischen Seite. Dennoch zeigt sich, dass die Stände in der Regel lieber die Gesandtschaft Christians IV. zur Teilnahme ermunterten.
Die Burgunder mussten, anders als die Holsteiner, nicht um ihre Session fürchten. Im Gegenteil konnte de Croy bei der Reichstagseröffnung sowohl im Zug von der Messe am Dom bis zum Rathaus sowie in der Sitzung im Rathaus selbst seine Session einnehmen.217 Jedoch mussten die Gesandten im Falle der Verhandlungen um den Punkt des Landfriedens immer wieder um ihre Beteiligung ringen. So wollte der luxemburgische Präsident Hattstein an der Beratung zur Friedensvermittlung in den Niederlanden zugunsten Philipps II. teilnehmen und in dessen Namen gegen diese Form der Einmischung protestieren, wurde aber von mehreren der dort anwesenden Fürsten abgewimmelt.218 Bereits in der Proposition werden die Bestrebungen des Kaisers zum Frieden zwischen Niederlande und Spanien deutlich, auch um die Konfessionen innerhalb des Reiches zu beruhigen. Im Weiteren werden auch Verhandlungen mit dem spanischen Gesandten De San Clemente erwähnt.219 Dieser berichtete Philipp II. auch über die geplanten Teilnehmer der Friedensverhandlungen und welche Fürsten der spanischen Seite wohlgesonnen wären und deshalb entsprechend finanziert werden könnten.220 Auf dem Reichstag selbst zeigen die burgundischen Gesandten hingegen die Abneigung der Friedensvermittlung, indem sie vor der Verlesung des Beschlusses, bei welchem die Friedensdelegation offiziell verkündet wurde, demonstrativ den Saal verließen.221 Hierbei finden also zwei verschiedenen Taktiken im Umgang mit der Vermittlungsdelegation statt.
4.4 Supplizieren an den Kaiser
Im Falle der Session innerhalb der beiden Gesandtschaften von Holstein reichten die Gesandten des Königs Christian IV. dessen Supplikation an den Kaiser sowie die Reichsstände ein, um ihren Fall verhandeln zu lassen. Im Laufe der Verhandlungen, für welche extra eine kaiserliche Vermittlungskommission gebildet wurde, kam es allerdings zu keiner Einigung, weswegen die Gesandten des Königs den Verhandlungen am Reichstag fernblieben.222 Es zeigt sich hierbei die Tendenz des Kaiser, im Falle der verschiedenen Sessionen die Entscheidungen lieber zu vertagen, um keine der Seiten zu präkieren. Das steht ganz im Sinne der Bestrebung um die Türkenhilfe als vordringlichstes Ziel. Gleichzeitig würde eine Entscheidung im Verfahren um Holstein bedeuten, sich auch mit anderen Streitfragen auseinanderzusetzen, welche eine noch größeres Verfahrensausmaß hätten, wie beispielweiße die Session um Magdeburg. Aus dem gleichen Grund unterließen auch die Gesandten der Königin Sophie eine Bitte an den Kaiser.
In einem weiteren Konflikt um Spanien reichte die Stadt Aachen eine Beschwerde unter anderem gegen das Herzogtum Burgund ein. Dort klagen die Verantwortlichen über die seit dem Reichstag von 1582 entstandenen Schäden durch Einlagerungen und Truppenzüge Spaniens.223 Weiter wurden durch ein Edikt Philipps II. den Einwohnern Geld abgenötigt sowie Einwohner verbannt und Zollprivilegien suspendiert.224 Die Stadt verlangte nun vom Kaiser die Aufhebung des Edikts und eine Intervention in der spanischen Besetzung. Eine entsprechende Supplikation übergaben die Gesandten der Stadt auch den Reichsständen, in deren Verhandlungen es zu keinem Ergebnis kam und die Entscheidung stattdessen dem Kurfürstenrat überstellt wurde.225 Diese wiederum waren geteilter Meinung und überstellten das Verfahren ihrerseits an den Erzherzog Ernst sowie den Herzog von Jülich, damit diese sich um die Beendigung der Beschwerden kümmerten.226 Die katholischen Stände nutzten dies zu einer gemeinsamen Gegenerklärung zur Aachener Beschwerde und verlangten, dass die Gegenberichte der Angeklagten in der Beurteilung Berücksichtigung finden sollten.227 Die Gesandten Burgunds selbst forderten einen Bericht ihrer Regierung an, um diese dem Kaiser übergeben zu können.228 Das Problem um Aachen wurde also für den konfessionellen Streit ausgenutzt.
Eine der ärgsten Rivalitäten herrschte zwischen Burgund und den Ständen des westfälischen Kreises, insbesondere durch die gemeinsame Grenze sowie die Auswirkungen durch den niederländischen Krieg. Der Kreis sah sich durch diesen Konflikt besonders gefährdet und wollte deshalb seine Sorgen mit der Türkengefahr gleichsetzen.229 Bereits Anfang Juni berieten sich diese und legten dem Kaiser ein Gutachten mit der Bitte vor, in den Konflikt einzuschreiten und sich vor allem um Reparation zu bemühen.230 Nebenbei supplizierten sie auch beim Kaiser zusammen mit einigen Beilagen geschädigter Fürsten.231 In beiden Fällen klagen sie über die ausbleibende Hilfe in der Verteidigung von Reichsgütern und verlangen eine stärkere Behandlung am Reichstag sowie Maßnahmen gegen die spanische Besetzung des Rheins. Gleichzeitig machen sie deutlich, dass sie die Türkenhilfe nur leisten können und wollen, wenn diese Frage am Reichstag geklärt wird. Auch wollen sie als betroffene Seite an den Friedensverhandlungen mitwirken. In gewisser Hinsicht agieren sie also ähnlich wie Spanien selbst. In dieser Thematik wird nicht nur Philipp II. selbst angeklagt, sondern ebenso der Erzherzog Ernst als Generalstatthalter, die enge Verbundenheit also wieder hervorgehoben.232 Mit der Anklage des Statthalters, dessen Gesandtschaft am Reichstag teilnimmt, soll sicherlich so der Einfluss gezielter genutzt werden können. Es zeigt sich, dass den Ständen an der niederländischen Grenze deren eigenen Probleme eine mindestens genauso wichtige Stellung einnehmen wie die Gefahr von den Türken, welche bisher nur in Ungarn und Österreich einfielen.
4.5 Vom Personellen zum Symbolischen – Die Repräsentation
Neben den offensichtlichen Verhandlungen war die richtige Repräsentation des eigenen Standes eine der wichtigsten Aspekte auf den Reichstagen. Diese vorwiegend symbolischen Handlungen trugen maßgeblich zur Formierung und Konsolidierung der politischen und gesellschaftlichen Ordnung bei.233 Somit war das Interagieren mit anderen Fürsten Teil der Reichstagspolitik und zeigte sich mitunter dadurch, mit welchen Fürsten man sich traf. So sprach der burgundische Gesandte de Croy bei seiner Ankunft mit Speciano und Madruzzo im Namen Spaniens und teilte ihnen die Wünsche des Königs um die Beilegung in den Niederlande mit und zahlte dabei noch 20.000 Scudi für das Heer der heiligen Liga.234 Es wurde sich also direkt mit der katholischen Seite gut gestellt. Auch bei Maximilian von Bayern leistete de Croy am 15.5. eine Visitation ab.235 Zusätzlich sprachen die burgundischen Gesandten auch bei denen Österreichs vor, um deren Unterstützung in der Interessensdurchsetzung des spanischen Königs in der Verhandlung um den niederländischen Krieg zu bitten. Diese Unterstützung sollte heimlich mittels vertraulicher Korrespondenz und Mitteln geschehen.236 Neben den ganzen katholischen Fürsten und Delegationen reiste de Croy auch mit dem protestantischen Kuradministrator Friedrich Wilhelm von Kursachsen zu dessen Schloss, zusammen mit dem Kurfürsten von Köln. Dabei wurde auch über die Magdeburger Sessionsfrage geredet und verhandelt, wie de Croy dem Erzherzog Ernst berichten konnte.237 Die abseitigen Treffen wurden also auch zum überkonfessionellen Austausch genutzt. Dazu kam auch eine unversehene Einladung des burgundischen Gesandten bei seiner Unterkunft, bei der Vertreter beider Konfessionen eingeladen waren, wie der sächsische Kuradministrator und der Erzbischof von Salzburg.238 Diese Art der Beziehungspflege ermöglichte es de Croy in kleinen Kreisen neben dem komplett versammelten Fürstenrat aufzutreten, wie einer Beratung um die Türkenhilfe, bei der nur einige ausgewählte Fürsten anwesend waren.239 Auch bei anderen Gelegenheiten wie einer Delegation der katholischen Stände beim Kaiser oder einer Abordnung des Fürstenrates beim Kurfürstenrat konnte de Croy durch seine Beziehungen teilnehmen.240
Abseits der kleinen Treffen waren die Reichstage auch von einer Vielzahl von Banketten geprägt. Oft von päpstlicher Seite veranstaltet, dienten sie der leichten Kontaktaufnahme mit den Fürsten des Reiches und sollten eine fröhliche Stimmung ermöglichen, bei der eine Einigung bei schwierigen Verhandlungsfragen gefunden werden soll.241 So richtete auch der päpstliche Nuntius Speciano ein Bankett aus.242 Die Einigung gestaltete sich nicht immer als ein gelungenes Vorhaben, wie es ein Bericht des venezianischen Gesandten Contarini andeutet. Dort beschwert er sich über die Verhandlungsverzögerungen, welche sich aus den zahlreichen Festessen auf den Reichstagen ergeben.243 Zusätzlich gab es auch immer wieder Klagen über die immensen Kosten, welche sich aus der Veranstaltung und Teilnahme des gesamten sozialen Miteinanders der Bankette ergeben. Der spanische Abgesandte de San Clemente schreibt in seinen Bericht, dass ihn der baldige Ruin ob der Feste drohe.244 Dennoch war eine Teilnahme an den Banketten für die ausländischen Teilnehmer eine wichtige Möglichkeit der Reichstagsteilnahme, waren sie schließlich nicht zu den offiziellen Verhandlungen zugelassen. So finden sich diese Gesandten auf einigen Banketten wie einem Gastmahl des Kurfürsten von Köln wieder.245 Für die Teilnehmer anderer Reiche war dadurch eine Möglichkeit gegeben, ihre Meinung zu den laufenden Verhandlungen kundzutun. So konnte Madruzzo auf einem Gastmahl über ein geplantes Dekret des Kaisers zur Magdeburger Session klagen.246
Die burgundischen Gesandten waren somit aufgrund ihrer Wichtigkeit auf einigen Gastmählern vertreten.247 Die meisten Bankette, wie das de San Clementes oder des päpstlichen Legaten Madruzzo, waren konfessionell sehr einheitlich, indem hierbei nur katholische Teilnehmer geladen waren.248 Dennoch gab es auch immer wieder sowohl von katholischen als auch von protestantischen Fürsten ausgelegte Festessen, bei denen Gäste aus beiden Lagern eingeladen waren.249 Burgund konnte somit auf beiden Seiten Kontakte knüpfen. Die Gesandten des Königs von Dänemark waren wie auch in den Verhandlungen nur am Anfang vertreten. Bei einem Bankett Friedrich Wilhelms von Kursachsen waren sowohl burgundische als auch holsteinische Gesandte anwesend.250 Die Gesandten der Königin Sophie waren hingegen nicht geladen.
5. Fazit
Alles in allem zeigt sich, dass sich der Reichstag in Regensburg von 1594 für die beiden Reiche Dänemark und Spanien zu einer Bühne entwickelte, bei welchem ihre Konflikte vor den Fürsten des Reiches und dem Kaiser ausgetragen wurden. Bei den holsteinischen Gesandtschaften trug sich der Erbkonflikt rund um Holstein und Schleswig bis vor den Kaiser, auch wenn dieser für den lokalen Adel keine Entscheidungsbefugnis bei der Wahl des Herzogs hatte. Ebenso nutzten die burgundischen Gesandten ihre besondere Stellung als habsburgisches Erbland mit Nähe zum Kaiser im Fürstenrat, um die Verhandlungen rund um den Niederlandekonflikt zu beeinflussen. Es zeigt sich aber auch die hohe Relevanz von persönlichen Kontakten, was einerseits für die einseitige Einladung der Gesandten des Königs Christian IV. zu einzelnen Verhandlungssitzungen und andererseits zur Unterstützung der Burgunder bei der Supplikation Aachens führte. In diesem Fall wird das Problem des Herzogtums auch für die Ausfechtung des konfessionellen Konflikts genutzt, indem die katholische Seite gemeinsam agierte. Die regionalen Angelegenheiten gliederten sich also in das gesamte Reichsgeschehen ein. Deshalb wird die Supplikation Christian IV. rund um dessen Session vom Kaiser nicht angegangen, da bereits die Session reformierter Hochstifte ein Streitthema war, welches Rudolph II. gerne ausgeklammert hätte. Der Reichstag war also trotz der entgegenwirkenden Versuche des Kaisers und seiner Räte von internen Problemen geprägt, welche die Gefahr der Türken mitunter überschattete.
Schlussendlich lässt sich sagen, dass die Gesandtschaften Burgunds und Holsteins ganz im Sinne ihrer entsendenden Herren standen. Nicht nur wurden Konflikte innerhalb ihrer Reichslehen verteidigt, sondern auch gegenüber Problemen des gesamten Reiches, hier dem Krieg mit dem Osmanischen Reich, vorangestellt. Im Falle Holsteins wurde sogar komplett auf die Verhandlungsteilnahme verzichtet. So konnten sie durch bestimmtes Verhalten in den Verhandlungen oder bei anderen Aspekten eines Reichstages wie der Session durch die Vertretung ihrer Standpunkte den Verlauf des Reichstages direkt beeinflussen. Damit gliedert sich der Reichstag von 1594 in andere Reichsversammlungen ein, bei denen die Könige die verschiedenen Eigenheiten dieser Institutionen nutzen konnten. So zeigte es schon Philipp II. am Reichsdeputationstag 1569, indem er sich als Deputierter aufnehmen ließ, um über die Niederlande zu verhandeln. Die dänischen Könige konnten ihrerseits die Stellung als Kreisoberst im Niedersächsischen Kreis nutzen, um Truppen für Dänemark zu sammeln. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Gesandtschaften auf dem Reichstag sich ihrer Stellung als Reichsstand durchaus bewusst waren. So wurde selten ein Versuch gemacht, sich komplett gegen die andere Reichsfürsten zu stellen. Um nicht den Anschluss zu verlieren, machten die burgundischen Gesandten auch eigene Vorschläge zur Türkensteuer, auch wenn sie tendenziell nicht zahlen wollten. Auch bei der Sessionsstreitigkeit bei den holsteinischen Gesandtschaften gaben schließlich beiden Seiten nach, um die Reichstagsverhandlungen nicht übermäßig zu stören. Burgund und Holstein übten stattdessen beide eine demonstrative Abwesenheit aus, um ihren Standpunkt bei den jeweiligen Beschlüssen zu unterstreichen. Dennoch blieb die Vertretung der eigenen regionalen Interessen bei beiden Herzogtümern vor der Hilfeleistung für den Kaiser, da die Türkensteuer oftmals mit der eigenen Problemlösung verknüpft wurde. Es zeigt sich also, dass die Herzogtümer Burgund und Holstein gänzlich im Sinne einer Doppelrolle zwischen ihren jeweiligen Königen und dem Kaiser standen.
Quellen- und Literaturverzeichnis
Quellen
Aitzing, Michael, Annalis rerum gestarum histora. Das ist ein historische Relation gedenckwierdiger sachen, so jetzt ablauffendes Jahr 1594 unnd ein wenig zuvor sich […] zugetragen, Köln 1594.
Ehses, Stephan, Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Die Kölner Nuntiatur., Unveränd. Nachdr., Paderborn 1899.
Fleischmann, Peter, Kurtze und aigentliche Beschreibung, des zu Regenspurg in disem 94. Jar gehaltenen Reichstag. Sambt einverleibten Kay. Hofstadts und Corrigirten Tittulars […], Regensburg 1594.
Gross, Lothar/ Lacroix, Robert von, Urkunden und Aktenstücke des Reichsarchivs Wien zur reichsrechtlichen Stellung des burgundischen Kreises. Bd. 1, Wien 1944 (Veröffentlichungen des Reichsarchivs Wien).
Gross, Lothar/ Lacroix, Robert von, Urkunden und Aktenstücke des Reichsarchivs Wien zur reichsrechtlichen Stellung des burgundischen Kreises. Bd. 2, Wien 1945 (Veröffentlichungen des Reichsarchivs Wien).
Khevenhüller, Hans, Geheimes Tagebuch 1548-1605, Graz 1971.
Kohler, Alfred, Quellen zur Geschichte Karls V, Darmstadt 1990 (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte der Neuzeit 15).
Leeb, Josef, Der Reichstag zu Regensburg 1594, 3 Bde., Berlin/ Boston 2024 (Deutsche Reichstagsakten. Reichsversammlungen 1556-1662).
Lefèvre, Joseph, Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas. Partie 2: Recueil destiné a faire suite aux travaux de L.-P. Gachard 4 (1592 - 1598), Brüssel 1960.
Pazderová, Alena, Epistulae et acta Caesaris Speciani 1592-1598, 3 Bde., Prag 2016 (Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592-1628 Tomus 1).
Roberg, Burkhard, Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Die Kölner Nuntiatur, Bd. II,3: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani (1592 Juli - 1593 Dez.), München/ Schöningh 1971.
Roberg, Burkhard, Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Die Kölner Nuntiatur, Bd. II,4: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani (1594 Januar - 1596 August), Paderborn 1983.
Literatur
Auge, Oliver, Dynastiegeschichte als Perspektive vergleichender Landesgeschichte. Das Beispiel der Herzöge und Grafen von Schleswig und Holstein (Anfang 13. - Ende 17. Jahrhundert), in: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte (2010), S. 23–46.
Auge, Oliver, "Klein" trifft auf "Groß". Anhaltiner und andere "kleine" Fürsten auf Reichsversammlungen und Reichstagen, in: Auge, Oliver/ Hecht, Michael (Hrsg.), Kleine Fürsten im Alten Reich. Strukturelle Zwänge und soziale Praktiken im Wandel (1300–1800), Berlin 2022 (Zeitschrift für Historische Forschung. Beiheft 59), S. 73–94.
Auge, Oliver, The "Unions" between Sleswick, Holstia and Denmark in the Fifteenth and Sixteenth Centuries and Their Nordic Precursors, in: Srodecki, Paul/ Kersken, Norbert/ Petrauskas, Rimvydas (Hrsg.), Unions and divisions. New Forms of Rule in Medieval and Renaissance Europe, London/ New York 2023 (Themes in medieval and early modern history), S. 248–264.
Auge, Oliver, 'Vom Gegeneinander zum Miteinander'? Zur Deutung der Grenzregion zwischen Dänemark und Deutschland als Raum nationaler Konfrontation, in: Schröder, Lina/ Wegewitz, Markus/ Gundermann, Christine (Hrsg.), Raum- und Grenzkonzeptionen in der Erforschung europäischer Regionen, Dresden 2023, S. 111–127.
Aulinger, Rosemarie, Das Bild des Reichstages im 16. Jahrhundert. Beiträge zu einer typologischen Analyse schriftlicher und bildlicher Quellen, Göttingen 1980 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 18).
Bechtold, Jonas/ Braun, Guido, Diets as a Sphere of Diplomatic Interaction, in: Goetze, Dorothée/ Oetzel, Lena (Hrsg.), Early modern European diplomacy. A handbook, Berlin/ Boston 2024, S. 483–505.
Beiderbeck, Friedrich, Die Wahrnehmung des Reichstages in der Reichspolitik König Heinrichs IV. von Frankreich, in: Lanzinner, Maximilian/ Strohmeyer, Arno (Hrsg.), Der Reichstag 1486-1613. Kommunikation - Wahrnehmung - Öffentlichkeit, Göttingen 2006 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 73), S. 497–521.
Bergerhausen, Hans-Wolfgang, Die Stadt Köln und die Reichsversammlungen im konfessionellen Zeitalter. Ein Beitrag zur korporativen reichsständischen Politik 1555 - 1616, Köln 1990 (Veröffentlichungen des Kölnischen Geschichtsvereins e.V 37).
Bergerhausen, Hans-Wolfgang, „EXCLUSIS WESTPHALEN ET BURGUNDT“. Zum Kampf um die Durchsetzung der Reichsmünzordnung von 1559, in: Zeitschrift für Historische Forschung 2 (1993), S. 189–203.
Bohn, Robert, Geschichte Schleswig-Holsteins, 2., durchgesehene Auflage, München 2015 (Beck'sche Reihe 2615).
Braun, Guido, Reichstage und Friedenskongresse als Erfahrungsräume päpstlicher Diplomatie. Kulturelle Differenzerfahrungen und Wissensgenerierung, in: Braun, Guido (Hrsg.), Diplomatische Wissenskulturen der Frühen Neuzeit. Erfahrungsräume und Orte der Wissensproduktion, Berlin/ Boston 2018 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom Band 136), S. 89–112.
Dotzauer, Winfried, Die deutschen Reichskreise (1383 - 1806). Geschichte und Aktenedition, Stuttgart 1998.
Edelmayer, Friedrich, Söldner und Pensionäre. Das Netzwerk Philipps II. im Heiligen Römischen Reich, Wien/ München 2002 (Studien zur Geschichte und Kultur der iberischen und iberoamerikanischen Länder 7).
Findeisen, Jörg-Peter, Christian IV. Zwischen Mythos und Wahrheit, Kiel 2014.
Goetze, Dorothée, No Country for New Diplomatic History. Diplomacy within the Holy Roman Empire, in: Goetze, Dorothée/ Oetzel, Lena (Hrsg.), Early modern European diplomacy. A handbook, Berlin/ Boston 2024, S. 307–332.
Goetze, Dorothée/ Oetzel, Lena, A Diplomat Is a Diplomat Is a Diplomat? On How to Approach Early Modern European Diplomacy in Its Diversity: An Introduction, in: Goetze, Dorothée/ Oetzel, Lena (Hrsg.), Early modern European diplomacy. A handbook, Berlin/ Boston 2024, S. 1–24.
Gotthard, Axel, Der Augsburger Religionsfrieden, Münster 2004 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 148).
Greinert, Melanie, Heiratspolitik als bestimmender Faktor dynastischer Größe. Das Konnubium der Gottorfer Dynastie, in: Auge, Oliver/ Hecht, Michael (Hrsg.), Kleine Fürsten im Alten Reich. Strukturelle Zwänge und soziale Praktiken im Wandel (1300–1800), Berlin 2022 (Zeitschrift für Historische Forschung. Beiheft 59), S. 361–402.
Häberlin, Franz Dominicus, Neueste Teutsche Reichs-Geschichte. Vom Anfange des Schmalkaldischen Krieges bis auf unsere Zeiten 19, Halle 1786.
Jörgensen, Bent, Konfessionelle Selbst- und Fremdbezeichnungen. Zur Terminologie der Religionsparteien im 16. Jahrhundert, Berlin 2014 (Colloquia Augustana 32).
Kohler, Alfred, Bemerkungen zur Wahrnehmung von Reich und Reichstag in den spanischen Königreichen, in: Lanzinner, Maximilian/ Strohmeyer, Arno (Hrsg.), Der Reichstag 1486-1613. Kommunikation - Wahrnehmung - Öffentlichkeit, Göttingen 2006 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 73), S. 453–460.
Kohlndorfer-Fries, Ruth, Diplomatie und Gelehrtenrepublik. Die Kontakte des französischen Gesandten Jaques Bongars (1554-1612), Tübingen 2009 (Frühe Neuzeit 137).
Koller, Alexander, Representing Spiritual and Secular Interests. The Development of Papal Diplomacy, in: Goetze, Dorothée/ Oetzel, Lena (Hrsg.), Early modern European diplomacy. A handbook, Berlin/ Boston 2024, S. 143–166.
Krieger, Martin, Der südliche Ostseeraum und der Deutsche Reichstag (16. - 18. Jh.), in: Jörn, Nils/ North, Michael (Hrsg.), Die Integration des südlichen Ostseeraumes in das Alte Reich, Köln/ Weimar/ Wien 2000 (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 35), S. 275–309.
Lange, Ulrich, Stände, Landesherr und große Politik - vom Konsens des 16. zu den Konflikten des 17. Jahrhunderts, in: Lange, Ulrich/ Göttsch-Elten, Silke (Hrsg.), Geschichte Schleswig-Holsteins. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 2. Aufl., Neumünster 2003, S. 153–265.
Lanzinner, Maximilian, Der Aufstand der Niederlande und der Reichstag zu Speyer 1570, in: Angermeier, Heinz/ Meuthen, Erich (Hrsg.), Fortschritte in der Geschichtswissenschaft durch Reichstagsaktenforschung. Vier Beiträge aus der Arbeit an den Reichstagsakten des 15. und 16. Jahrhunderts, Göttingen 1988 (Bayerische Akademie der Wissenschaften München 35), S. 102–117.
Lanzinner, Maximilian, Friedenssicherung und politische Einheit des Reiches unter Kaiser Maximilian II. (1564 - 1576), Göttingen 1993 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 45).
Lanzinner, Maximilian, Einleitung, in: Lanzinner, Maximilian/ Strohmeyer, Arno (Hrsg.), Der Reichstag 1486-1613. Kommunikation - Wahrnehmung - Öffentlichkeit, Göttingen 2006 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 73), S. 9–25.
Lanzinner, Maximilian, Facetten des periodischen Reichstags in Regensburg, in: Unger, Klemens/ Styra, Peter/ Neiser, Wolfgang (Hrsg.), Regensburg zur Zeit des Immerwährenden Reichstags. Kultur-historische Aspekte einer Epoche der Stadtgeschichte, Regensburg 2013, S. 47–61.
Leeb, Josef, Der Magdeburger Sessionsstreit von 1582. Voraussetzungen, Problematik und Konsequenzen für Reichstag und Reichskammergericht, Wetzlar 2000 (Schriftenreihe der Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung 24).
Mörke, Olaf, Holstein und Schwedisch-Pommern im Alten Reich. Integrationsmuster und politische Identitäten in Grenzregionen, in: Jörn, Nils/ North, Michael (Hrsg.), Die Integration des südlichen Ostseeraumes in das Alte Reich, Köln/ Weimar/ Wien 2000 (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 35), S. 425–472.
Mout, Nicolette, Die Niederlande und das Reich im 16. Jahrhundert (1512-1609), in: Press, Volker (Hrsg.), Alternativen zur Reichsverfassung in der Frühen Neuzeit?, München 1995 (Schriften des Historischen Kollegs: Kolloquien 23), S. 143–168.
Rauscher, Peter, Kaisertum und hegemoniales Königtum. Die kaiserliche Reaktion auf die niederländische Politik Philipps II. von Spanien, in: Edelmayer, Friedrich (Hrsg.), Hispania - Austria II. Die Epoche Philipps II. (1556-1598), Wien/ München 1999 (Studien zur Geschichte und Kultur der iberischen und iberoamerikanischen Länder 5), S. 57–88.
Roberg, Burkhard, Türkenkrieg und Kirchenpolitik. Die Sendung Kardinal Madruzzos an den Kaiserhof 1593 und zum Reichstag von 1594, Teil 1, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken (1985), S. 192–305.
Roberg, Burkhard, Türkenkrieg und Kirchenpolitik. Die Sendung Kardinal Madruzzos an den Kaiserhof 1593 und zum Reichstag von 1594, Teil 2, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken (1986), S. 192–268.
Schäfer, Dietrich, Geschichte von Dänemark. Bd. 5: Vom Regierungsantritt Friedrichs II. (1559) bis zum Tode Christians IV. (1648), Gotha 1902 (Allgemeine Staatengeschichte Abt. I: Geschichte der europäischen Staaten 13).
Scharff, Alexander, Schleswig-Holstein in der europäischen und nordischen Geschichte, in: Jessen-Klingenberg, Manfred (Hrsg.), Schleswig-Holstein in der deutschen und nordeuropäischen Geschichte. Gesammelte Aufsätze, Stuttgart 1969 (Kieler Historische Studien 6), S. 9–42.
Scharff, Alexander, Schleswig-Holstein und Dänemark im Zeitalter des Ständestaates, in: Jessen-Klingenberg, Manfred (Hrsg.), Schleswig-Holstein in der deutschen und nordeuropäischen Geschichte. Gesammelte Aufsätze, Stuttgart 1969 (Kieler Historische Studien 6), S. 43–74.
Schnettger, Matthias, "Principe sovrano" oder "Civitas imperialis"? Die Republik Genua und das Alte Reich in der Frühen Neuzeit; (1556 - 1797), Mainz 2006 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz Abt. für Universalgeschichte 209).
Schnettger, Matthias, Die Bühne des Reichs. Zeremonialgeschichtliche Perspektiven auf den Wormser Reichstag von 1521, in: Arnold, Claus/ Belz, Martin/ Schnettger, Matthias (Hrsg.), Reichstag - Reichsstadt - Konfession. Worms 1521, Münster 2023 (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte Band 148), S. 87–111.
Schulze, Winfried, Reich und Türkengefahr im späten 16. Jahrhundert. Studien zu den politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer äußeren Bedrohung, München 1978.
Spieß, Karl-Heinz, Rangdenken und Rangstreit im Mittelalter, in: Paravicini, Werner (Hrsg.), Zeremoniell und Raum, Sigmaringen 1997 (Residenzforschungen 6), S. 39–61.
Stieve, Felix, Die Politik Baierns 1591-1607. Bd. 1, München 1878 (Briefe und Akten zur Geschichte des Dreissigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher 4).
Taddei, Elena, Die Este und das Heilige Römische Reich im langen 16. Jahrhundert. Kontakte - Konflikte - Kulturtransfer, Wien/ Köln/ Weimar 2021.
[...]
1 Aulinger, Rosemarie, Das Bild des Reichstages im 16. Jahrhundert. Beiträge zu einer typologischen Analyse schriftlicher und bildlicher Quellen, Göttingen 1980 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 18), S. 143, 147.
2 Lanzinner, Maximilian, Friedenssicherung und politische Einheit des Reiches unter Kaiser Maximilian II. (1564 - 1576), Göttingen 1993 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 45), S. 407.
3 Dotzauer, Winfried, Die deutschen Reichskreise (1383 - 1806). Geschichte und Aktenedition, Stuttgart 1998, S. 334f.
4 Gross, Lothar/ Lacroix, Robert von, Urkunden und Aktenstücke des Reichsarchivs Wien zur reichsrechtlichen Stellung des burgundischen Kreises. Bd. 1, Wien 1944 (Veröffentlichungen des Reichsarchivs Wien); Dies., Urkunden und Aktenstücke des Reichsarchivs Wien zur reichsrechtlichen Stellung des burgundischen Kreises. Bd. 2, Wien 1945 (Veröffentlichungen des Reichsarchivs Wien).
5 Fleischmann, Peter, Kurtze und aigentliche Beschreibung, des zu Regenspurg in disem 94. Jar gehaltenen Reichstag. Sambt einverleibten Kay. Hofstadts und Corrigirten Tittulars […], Regensburg 1594.
6 Lanzinner, Maximilian, Einleitung, in: Ders./ Strohmeyer, Arno (Hrsg.), Der Reichstag 1486-1613. Kommunikation - Wahrnehmung - Öffentlichkeit, Göttingen 2006 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 73), S. 9–25.
7 Goetze, Dorothée/ Oetzel, Lena, A Diplomat Is a Diplomat Is a Diplomat? On How to Approach Early Modern European Diplomacy in Its Diversity: An Introduction, in: Dies. (Hrsg.), Early modern European diplomacy. A handbook, Berlin/ Boston 2024, S. 1–24.
8 Schulze, Winfried, Reich und Türkengefahr im späten 16. Jahrhundert. Studien zu den politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer äußeren Bedrohung, München 1978.
9 Kohler, Alfred, Bemerkungen zur Wahrnehmung von Reich und Reichstag in den spanischen Königreichen, in: Lanzinner, Maximilian/ Strohmeyer, Arno (Hrsg.), Der Reichstag 1486-1613. Kommunikation - Wahrnehmung - Öffentlichkeit, Göttingen 2006 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 73), S. 453–460, S. 454.
10 Bergerhausen, Hans-Wolfgang, „EXCLUSIS WESTPHALEN ET BURGUNDT“. Zum Kampf um die Durchsetzung der Reichsmünzordnung von 1559, in: Zeitschrift für Historische Forschung 2 (1993), S. 189–203.
11 Mout, Nicolette, Die Niederlande und das Reich im 16. Jahrhundert (1512-1609), in: Press, Volker (Hrsg.), Alternativen zur Reichsverfassung in der Frühen Neuzeit?, München 1995 (Schriften des Historischen Kollegs: Kolloquien 23), S. 143–168.
12 Rauscher, Peter, Kaisertum und hegemoniales Königtum. Die kaiserliche Reaktion auf die niederländische Politik Philipps II. von Spanien, in: Edelmayer, Friedrich (Hrsg.), Hispania - Austria II. Die Epoche Philipps II. (1556-1598), Wien/ München 1999 (Studien zur Geschichte und Kultur der iberischen und iberoamerikanischen Länder 5), S. 57–88.
13 Krieger, Martin, Der südliche Ostseeraum und der Deutsche Reichstag (16. - 18. Jh.), in: Jörn, Nils/ North, Michael (Hrsg.), Die Integration des südlichen Ostseeraumes in das Alte Reich, Köln/ Weimar/ Wien 2000 (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 35), S. 275–309.
14 Dotzauer, Die deutschen Reichskreise.
15 Lanzinner, Einleitung, S. 11–13.
16 Ders., Der Aufstand der Niederlande und der Reichstag zu Speyer 1570, in: Angermeier, Heinz/ Meuthen, Erich (Hrsg.), Fortschritte in der Geschichtswissenschaft durch Reichstagsaktenforschung. Vier Beiträge aus der Arbeit an den Reichstagsakten des 15. und 16. Jahrhunderts, Göttingen 1988 (Bayerische Akademie der Wissenschaften München 35), S. 102–117, S. 107.
17 Ders., Friedenssicherung und politische Einheit, S. 513.
18 Spieß, Karl-Heinz, Rangdenken und Rangstreit im Mittelalter, in: Paravicini, Werner (Hrsg.), Zeremoniell und Raum, Sigmaringen 1997 (Residenzforschungen 6), S. 39–61, S. 59.
19 Auge, Oliver, "Klein" trifft auf "Groß". Anhaltiner und andere "kleine" Fürsten auf Reichsversammlungen und Reichstagen, in: Ders./ Hecht, Michael (Hrsg.), Kleine Fürsten im Alten Reich. Strukturelle Zwänge und soziale Praktiken im Wandel (1300–1800), Berlin 2022 (Zeitschrift für Historische Forschung. Beiheft 59), S. 73–94, S. 75f.
20 Ebd., S. 81.
21 Ebd., S. 79f.
22 Ebd., S. 83.
23 Goetze, Dorothée, No Country for New Diplomatic History. Diplomacy within the Holy Roman Empire, in: Dies./ Oetzel, Lena (Hrsg.), Early modern European diplomacy. A handbook, Berlin/ Boston 2024, S. 307–332, S. 314f.
24 Ebd., S. 315.
25 Kohlndorfer-Fries, Ruth, Diplomatie und Gelehrtenrepublik. Die Kontakte des französischen Gesandten Jaques Bongars (1554-1612), Tübingen 2009 (Frühe Neuzeit 137, S. 35f.
26 Aulinger, Das Bild, S. 144.
27 Bechtold, Jonas/ Braun, Guido, Diets as a Sphere of Diplomatic Interaction, in: Goetze, Dorothée/ Oetzel, Lena (Hrsg.), Early modern European diplomacy. A handbook, Berlin/ Boston 2024, S. 483–505, S. 493.
28 Ebd., S. 484f.
29 Lanzinner, Maximilian, Facetten des periodischen Reichstags in Regensburg, in: Unger, Klemens/ Styra, Peter/ Neiser, Wolfgang (Hrsg.), Regensburg zur Zeit des Immerwährenden Reichstags. Kultur-historische Aspekte einer Epoche der Stadtgeschichte, Regensburg 2013, S. 47–61, S. 59.
30 Ebd., S. 55–59.
31 Bechtold/ Braun, Diets, S. 492.
32 Taddei, Elena, Die Este und das Heilige Römische Reich im langen 16. Jahrhundert. Kontakte - Konflikte - Kulturtransfer, Wien/ Köln/ Weimar 2021, S. 392.
33 Aulinger, Das Bild, S. 144f.
34 Bechtold/ Braun, Diets, S. 492.
35 Aulinger, Das Bild, S. 146.
36 Bechtold/ Braun, Diets, S. 492.
37 Aulinger, Das Bild, S. 148f.
38 Ebd., S. 148f.
39 Lanzinner, Facetten des periodischen Reichstags, S. 55–59.
40 Bechtold/ Braun, Diets, S. 493.
41 Pazderová, Alena, Epistulae et acta Caesaris Speciani 1592-1598, 3 Bde., Prag 2016 (Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592-1628 Tomus 1, S. 484, 491, 511, 528, 531, 546, 592, 629, 617, 654, 665, 713f., 748, 770.
42 Ebd., S. 9–13.
43 Ehses, Stephan, Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Die Kölner Nuntiatur., Unveränd. Nachdr., Paderborn 1899, S. 308, 443.
44 Schulze, Reich und Türkengefahr, S. 90.
45 Ebd., S. 90.
46 Roberg, Burkhard, Türkenkrieg und Kirchenpolitik. Die Sendung Kardinal Madruzzos an den Kaiserhof 1593 und zum Reichstag von 1594, Teil 1, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken (1985), S. 192–305, S. 242–244.
47 Pazderová, Epistulae et acta Caesaris Speciani, S. 47f., 54–56, 152, 162, 310, 357.
48 Ebd., S. 908, 916, 945, 1087f., 1066, 1082, 1087, 1109, 1114f., 1123.
49 Schulze, Reich und Türkengefahr, S. 93–95.
50 Leeb, Josef, Der Reichstag zu Regensburg 1594, 3 Bde., Berlin/ Boston 2024 (Deutsche Reichstagsakten. Reichsversammlungen 1556-1662), S. 409.
51 Schulze, Reich und Türkengefahr, S. 93–95.
52 Stieve, Felix, Die Politik Baierns 1591-1607. Bd. 1, München 1878 (Briefe und Akten zur Geschichte des Dreissigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher 4), S. 200.
53 Lanzinner, Facetten des periodischen Reichstags, S. 50.
54 Pazderová, Epistulae et acta Caesaris Speciani, S. 47f., 54–56, 152, 162, 310, 357.
55 Schulze, Reich und Türkengefahr, S. 95f.
56 Leeb, Reichstagsakten, S. 397–421.
57 Braun, Guido, Reichstage und Friedenskongresse als Erfahrungsräume päpstlicher Diplomatie. Kulturelle Differenzerfahrungen und Wissensgenerierung, in: Ders. (Hrsg.), Diplomatische Wissenskulturen der Frühen Neuzeit. Erfahrungsräume und Orte der Wissensproduktion, Berlin/ Boston 2018 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom Band 136), S. 89–112, S. 101–109.
58 Roberg, Burkhard, Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Die Kölner Nuntiatur, Bd. II,4: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani (1594 Januar - 1596 August), Paderborn 1983, S. 31f.
59 Ders., Türkenkrieg 1, S. 249–251.
60 Ders., NB II, 4, S. 22–25; Ders., Türkenkrieg 1, S. 251f.
61 Roberg, Burkhard, Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Die Kölner Nuntiatur, Bd. II,3: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani (1592 Juli - 1593 Dez.), München/ Schöningh 1971, S. 392.
62 Pazderová, Epistulae et acta Caesaris Speciani, S. 957f., 972, 994, 1017, 1025, 1042, 1094f.
63 Koller, Alexander, Representing Spiritual and Secular Interests. The Development of Papal Diplomacy, in: Goetze, Dorothée/ Oetzel, Lena (Hrsg.), Early modern European diplomacy. A handbook, Berlin/ Boston 2024, S. 143–166, S. 144f.
64 Leeb, Reichstagsakten, S. 1709–1711.
65 Roberg, Türkenkrieg 1, S. 216–220.
66 Leeb, Reichstagsakten, S. 1774f.
67 Roberg, Türkenkrieg 1, S. 256–292.
68 Leeb, Reichstagsakten, S. 1708f.
69 Ebd., S. 1709–1711.
70 Gotthard, Axel, Der Augsburger Religionsfrieden, Münster 2004 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 148), S. 449.
71 Schulze, Reich und Türkengefahr, S. 98.
72 Stieve, Die Politik Baierns, S. 182.
73 Gotthard, Augsburger Religionsfrieden, S. 449.
74 Leeb, Josef, Der Magdeburger Sessionsstreit von 1582. Voraussetzungen, Problematik und Konsequenzen für Reichstag und Reichskammergericht, Wetzlar 2000 (Schriftenreihe der Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung 24), S. 33–37.
75 Jörgensen, Bent, Konfessionelle Selbst- und Fremdbezeichnungen. Zur Terminologie der Religionsparteien im 16. Jahrhundert, Berlin 2014 (Colloquia Augustana 32), S. 450–452.
76 Aulinger, Das Bild, S. 350f.
77 Roberg, Türkenkrieg 1, S. 242–244.
78 Pazderová, Epistulae et acta Caesaris Speciani, S. 1178f.
79 Ebd., S. 1322, 1419.
80 Stieve, Die Politik Baierns, S. 165.
81 Schnettger, Matthias, "Principe sovrano" oder "Civitas imperialis"? Die Republik Genua und das Alte Reich in der Frühen Neuzeit; (1556 - 1797), Mainz 2006 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz Abt. für Universalgeschichte 209), S. 567–569.
82 Schulze, Reich und Türkengefahr, S. 90–92.
83 Leeb, Reichstagsakten, S. 475.
84 Stieve, Die Politik Baierns, S. 169.
85 Aulinger, Das Bild, S. 146f., 151.
86 Ebd., S. 145f.
87 Ebd., S. 146f., 151.
88 Leeb, Reichstagsakten, S. 177.
89 Gross/ Lacroix, Urkunden und Aktenstücke 2, S. 378.
90 Stieve, Die Politik Baierns, S. 470.
91 Beiderbeck, Friedrich, Die Wahrnehmung des Reichstages in der Reichspolitik König Heinrichs IV. von Frankreich, in: Lanzinner, Maximilian/ Strohmeyer, Arno (Hrsg.), Der Reichstag 1486-1613. Kommunikation - Wahrnehmung - Öffentlichkeit, Göttingen 2006 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 73), S. 497–521, S. 506f.
92 Ebd., S. 513.
93 Bohn, Robert, Geschichte Schleswig-Holsteins, 2., durchgesehene Auflage, München 2015 (Beck'sche Reihe 2615), S. 51f.
94 Auge, Oliver, Dynastiegeschichte als Perspektive vergleichender Landesgeschichte. Das Beispiel der Herzöge und Grafen von Schleswig und Holstein (Anfang 13. - Ende 17. Jahrhundert), in: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte (2010), S. 23–46, S. 29.
95 Dotzauer, Die deutschen Reichskreise, S. 337.
96 Krieger, Der südliche Ostseeraum, S. 278–281.
97 Leeb, Reichstagsakten, S. 2163.
98 Krieger, Der südliche Ostseeraum, S. 308.
99 Lange, Ulrich, Stände, Landesherr und große Politik - vom Konsens des 16. zu den Konflikten des 17. Jahrhunderts, in: Ders./ Göttsch-Elten, Silke (Hrsg.), Geschichte Schleswig-Holsteins. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 2. Aufl., Neumünster 2003, S. 153–265, S. 225f.
100 Scharff, Alexander, Schleswig-Holstein und Dänemark im Zeitalter des Ständestaates, in: Jessen-Klingenberg, Manfred (Hrsg.), Schleswig-Holstein in der deutschen und nordeuropäischen Geschichte. Gesammelte Aufsätze, Stuttgart 1969 (Kieler Historische Studien 6), S. 43–74, S. 49.
101 Auge, Oliver, 'Vom Gegeneinander zum Miteinander'? Zur Deutung der Grenzregion zwischen Dänemark und Deutschland als Raum nationaler Konfrontation, in: Schröder, Lina/ Wegewitz, Markus/ Gundermann, Christine (Hrsg.), Raum- und Grenzkonzeptionen in der Erforschung europäischer Regionen, Dresden 2023, S. 111–127, S. 114.
102 Mörke, Olaf, Holstein und Schwedisch-Pommern im Alten Reich. Integrationsmuster und politische Identitäten in Grenzregionen, in: Jörn, Nils/ North, Michael (Hrsg.), Die Integration des südlichen Ostseeraumes in das Alte Reich, Köln/ Weimar/ Wien 2000 (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 35), S. 425–472, S. 456f.
103 Auge, Dänemark und Deutschland, S. 115.
104 Ebd., S. 120.
105 Ebd., S. 120f.
106 Scharff, Schleswig-Holstein und Dänemark, S. 60.
107 Mörke, Holstein und Schwedisch-Pommern, S. 458f.
108 Bohn, Geschichte Schleswig-Holsteins, S. 46.
109 Auge, Oliver, The "Unions" between Sleswick, Holstia and Denmark in the Fifteenth and Sixteenth Centuries and Their Nordic Precursors, in: Srodecki, Paul/ Kersken, Norbert/ Petrauskas, Rimvydas (Hrsg.), Unions and divisions. New Forms of Rule in Medieval and Renaissance Europe, London/ New York 2023 (Themes in medieval and early modern history), S. 248–264, S. 257–259.
110 Scharff, Schleswig-Holstein und Dänemark, S. 57.
111 Ebd., S. 64.
112 Scharff, Alexander, Schleswig-Holstein in der europäischen und nordischen Geschichte, in: Jessen-Klingenberg, Manfred (Hrsg.), Schleswig-Holstein in der deutschen und nordeuropäischen Geschichte. Gesammelte Aufsätze, Stuttgart 1969 (Kieler Historische Studien 6), S. 9–42, S. 23–29.
113 Greinert, Melanie, Heiratspolitik als bestimmender Faktor dynastischer Größe. Das Konnubium der Gottorfer Dynastie, in: Auge, Oliver/ Hecht, Michael (Hrsg.), Kleine Fürsten im Alten Reich. Strukturelle Zwänge und soziale Praktiken im Wandel (1300–1800), Berlin 2022 (Zeitschrift für Historische Forschung. Beiheft 59), S. 361–402, S. 363.
114 Ebd., S. 363f.
115 Ebd., S. 366–369.
116 Ebd., S. 387f.
117 Auge, Dynastiegeschichte, S. 32.
118 Dotzauer, Die deutschen Reichskreise, S. 340–342.
119 Ebd., S. 338.
120 Ebd., S. 344–355.
121 Krieger, Der südliche Ostseeraum, S. 290f.
122 Dotzauer, Die deutschen Reichskreise, S. 340–342.
123 Krieger, Der südliche Ostseeraum, S. 290f.
124 Gross/ Lacroix, Urkunden und Aktenstücke 1, S. 66.
125 Kohler, Alfred, Quellen zur Geschichte Karls V, Darmstadt 1990 (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte der Neuzeit 15), S. 468–479.
126 Ders., Bemerkungen, S. 453.
127 Leeb, Reichstagsakten, S. 372.
128 Pazderová, Epistulae et acta Caesaris Speciani, S. CV–CVII.
129 Rauscher, Kaisertum und hegemoniales Königtum, S. 62–64.
130 Kohler, Quellen Karls V., S. 466–468.
131 Gross/ Lacroix, Urkunden und Aktenstücke 2, S. 72–76.
132 Kohler, Quellen Karls V., S. 392–399; Gross/ Lacroix, Urkunden und Aktenstücke 1, S. 441; Dotzauer, Die deutschen Reichskreise, S. 465–469.
133 Mout, Niederlande und das Reich, S. 149f.
134 Dotzauer, Die deutschen Reichskreise, S. 404–406.
135 Mout, Niederlande und das Reich, S. 154f.
136 Ebd., S. 156.
137 Bergerhausen, EXCLUSIS, S. 191f.
138 Ebd., S. 192–195.
139 Gross/ Lacroix, Urkunden und Aktenstücke 2, S. 141.
140 Lanzinner, Friedenssicherung und politische Einheit, S. 367.
141 Dotzauer, Die deutschen Reichskreise, S. 343.
142 Lanzinner, Aufstand der Niederlande, S. 112f.
143 Bergerhausen, EXCLUSIS, S. 192.
144 Lanzinner, Friedenssicherung und politische Einheit, S. 389.
145 Rauscher, Kaisertum und hegemoniales Königtum, S. 70–72.
146 Ebd., S. 65f.
147 Mout, Niederlande und das Reich, S. 157.
148 Gross/ Lacroix, Urkunden und Aktenstücke 2, S. 272.
149 Mout, Niederlande und das Reich, S. 144.
150 Ebd., S. 145.
151 Ebd., S. 158.
152 Lanzinner, Aufstand der Niederlande, S. 109.
153 Mout, Niederlande und das Reich, S. 160.
154 Ebd., S. 166.
155 Lanzinner, Aufstand der Niederlande, S. 104.
156 Ders., Friedenssicherung und politische Einheit, S. 518; Rauscher, Kaisertum und hegemoniales Königtum, S. 72–85.
157 Mout, Niederlande und das Reich, S. 165.
158 Aitzing, Michael, Annalis rerum gestarum histora. Das ist ein historische Relation gedenckwierdiger sachen, so jetzt ablauffendes Jahr 1594 unnd ein wenig zuvor sich […] zugetragen, Köln 1594, S. 97.
159 Findeisen, Jörg-Peter, Christian IV. Zwischen Mythos und Wahrheit, Kiel 2014, S. 48.
160 Ebd., S. 52f.
161 Aitzing, Annalis, S. 21f.
162 Findeisen, Christian IV., S. 53–56.
163 Pazderová, Epistulae et acta Caesaris Speciani, S. 1465f.
164 Findeisen, Christian IV., S. 48f.
165 Schäfer, Dietrich, Geschichte von Dänemark. Bd. 5: Vom Regierungsantritt Friedrichs II. (1559) bis zum Tode Christians IV. (1648), Gotha 1902 (Allgemeine Staatengeschichte Abt. I: Geschichte der europäischen Staaten 13), S. 253–266.
166 Lange, Stände, Landesherr und große Politik, S. 225f.
167 Leeb, Reichstagsakten, S. 178.
168 Ebd., S. 2388f.
169 Fleischmann, Kurtze und aigentliche Beschreibung, S. Ddd2.
170 Leeb, Reichstagsakten, S. 2389.
171 Gross/ Lacroix, Urkunden und Aktenstücke 2, S. 380.
172 Lefèvre, Joseph, Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas. Partie 2: Recueil destiné a faire suite aux travaux de L.-P. Gachard 4 (1592 - 1598), Brüssel 1960, S. 233, 241.
173 Stieve, Die Politik Baierns, S. 250f.
174 Khevenhüller, Hans, Geheimes Tagebuch 1548-1605, Graz 1971, S. 218f.
175 Stieve, Die Politik Baierns, S. 450–452.
176 Leeb, Reichstagsakten, S. 933.
177 Stieve, Die Politik Baierns, S. 263f.
178 Leeb, Reichstagsakten, S. 2375.
179 Gross/ Lacroix, Urkunden und Aktenstücke 2, S. 380.
180 Leeb, Reichstagsakten, S. 340.
181 Stieve, Die Politik Baierns, S. 472.
182 Edelmayer, Friedrich, Söldner und Pensionäre. Das Netzwerk Philipps II. im Heiligen Römischen Reich, Wien/ München 2002 (Studien zur Geschichte und Kultur der iberischen und iberoamerikanischen Länder 7), S. 43.
183 Pazderová, Epistulae et acta Caesaris Speciani, S. LXXXf.
184 Leeb, Reichstagsakten, S. 859.
185 Ebd., S. 885f.
186 Ebd., S. 1703.
187 Aulinger, Das Bild, S. 235f.
188 Leeb, Reichstagsakten, S. 801.
189 Ebd., S. 777, 891.
190 Ebd., S. 913.
191 Ebd., S. 849.
192 Ebd., S. 839f.
193 Dotzauer, Die deutschen Reichskreise, S. 419.
194 Leeb, Reichstagsakten, S. 1598.
195 Ebd., S. 1499f.
196 Stieve, Die Politik Baierns, S. 471f.
197 Leeb, Reichstagsakten, S. 126.
198 Ebd., S. 286.
199 Ebd., S. 206.
200 Ebd., S. 1209.
201 Ebd., S. 1115, 1134, 1144, 1161, 1168, 1173, 1181, 1223, 1233, 1237.
202 Aulinger, Das Bild, S. 196.
203 Roberg, Burkhard, Türkenkrieg und Kirchenpolitik. Die Sendung Kardinal Madruzzos an den Kaiserhof 1593 und zum Reichstag von 1594, Teil 2, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken (1986), S. 192–268, S. 199–202.
204 Leeb, Reichstagsakten, S. 1115.
205 Ebd., S. 222f.
206 Stieve, Die Politik Baierns, S. 208.
207 Leeb, Reichstagsakten, S. 346.
208 Ebd., S. 1140.
209 Ebd., S. 1775–1781.
210 Ebd., S. 1156.
211 Ebd., S. 763, 1935.
212 Ebd., S. 351.
213 Ebd., S. 427f.
214 Ebd., S. 1130.
215 Ebd., S. 1935.
216 Ebd., S. 116.
217 Ebd., S. 430–432.
218 Ebd., S. 900.
219 Ebd., S. 415–417.
220 Stieve, Die Politik Baierns, S. 471f.
221 Leeb, Reichstagsakten, S. 920.
222 Ebd., S. 2162–2167.
223 Ebd., S. 1936f.
224 Häberlin, Franz Dominicus, Neueste Teutsche Reichs-Geschichte. Vom Anfange des Schmalkaldischen Krieges bis auf unsere Zeiten 19, Halle 1786, S. VII–XV.
225 Leeb, Reichstagsakten, S. 2140–2143.
226 Ebd., S. 1850–1853.
227 Ebd., S. 2041f.
228 Ebd., S. 1438.
229 Bergerhausen, Hans-Wolfgang, Die Stadt Köln und die Reichsversammlungen im konfessionellen Zeitalter. Ein Beitrag zur korporativen reichsständischen Politik 1555 - 1616, Köln 1990 (Veröffentlichungen des Kölnischen Geschichtsvereins e.V 37), S. 260–264.
230 Leeb, Reichstagsakten, S. 1594–1630.
231 Ebd., S. 2221–2231.
232 Ebd., S. 1605.
233 Schnettger, Matthias, Die Bühne des Reichs. Zeremonialgeschichtliche Perspektiven auf den Wormser Reichstag von 1521, in: Arnold, Claus/ Belz, Martin/ Ders. (Hrsg.), Reichstag - Reichsstadt - Konfession. Worms 1521, Münster 2023 (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte Band 148), S. 87–111, S. 87.
234 Pazderová, Epistulae et acta Caesaris Speciani, S. 1445f.
235 Leeb, Reichstagsakten, S. 205.
236 Ebd., S. 1395.
237 Stieve, Die Politik Baierns, S. 252f.
238 Fleischmann, Kurtze und aigentliche Beschreibung, S. Zz2.
239 Leeb, Reichstagsakten, S. 475.
240 Ebd., S. 1410, 1747.
241 Aulinger, Das Bild, S. 282–287.
242 Fleischmann, Kurtze und aigentliche Beschreibung, S. Ggg.
243 Stieve, Die Politik Baierns, S. 223.
244 Ebd., S. 469.
245 Fleischmann, Kurtze und aigentliche Beschreibung, S. Mm2; Aitzing, Annalis, S. 110.
246 Stieve, Die Politik Baierns, S. 239.
247 Fleischmann, Kurtze und aigentliche Beschreibung, S. Mm, Ss, Uu2, Yy2.
248 Ebd., S. Fff3, Ggg2.
249 Ebd., S. Kk2, Oo, Qq, Ss, Xx2.
250 Ebd., S. Pp3.
Details
- Titel
- Die europäische Dimension des Regensburger Reichstags 1594
- Untertitel
- Burgund und Holstein zwischen Kaiser und Königen
- Hochschule
- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Institut für Geschichtswissenschaft. Abteilung für Frühe Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte)
- Note
- 1,0
- Autor
- Tom-Pascal Weigelt (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2024
- Seiten
- 41
- Katalognummer
- V1544098
- ISBN (Buch)
- 9783389098356
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Reichstag Dänemark Spanien Habsburger Gesandte Gesandtschaften Diplomatie Konfessionen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 30,99
- Arbeit zitieren
- Tom-Pascal Weigelt (Autor:in), 2024, Die europäische Dimension des Regensburger Reichstags 1594, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1544098
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-