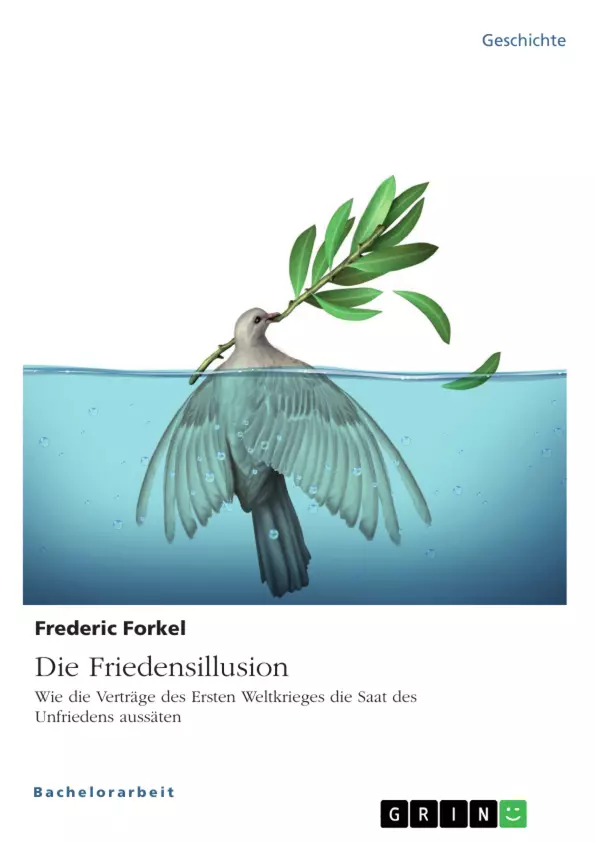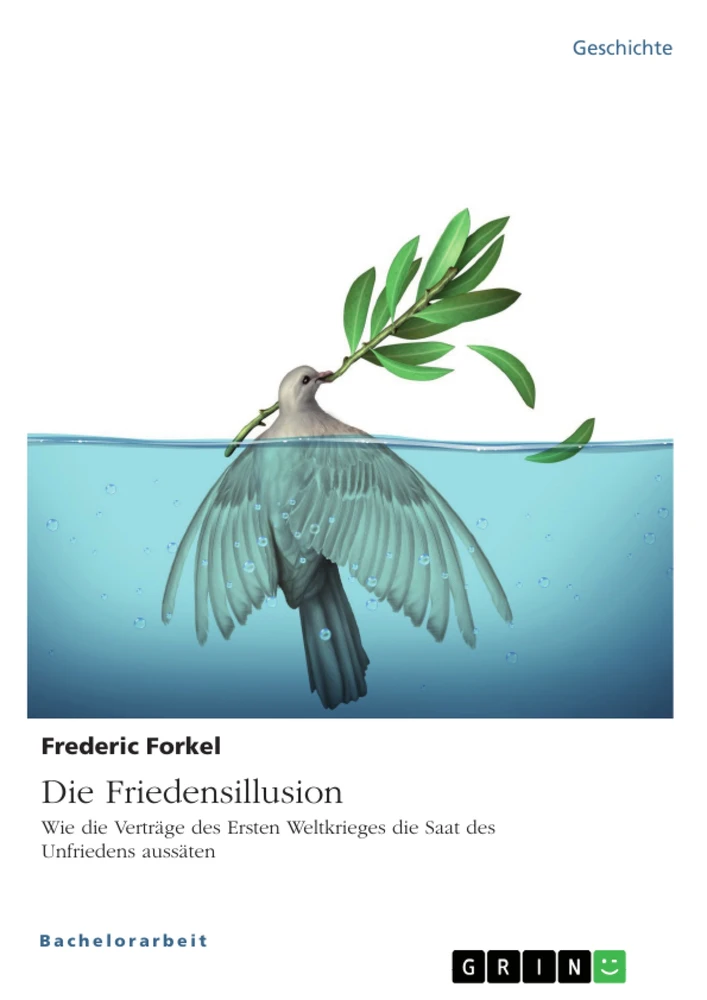
Die Friedensillusion
Bachelorarbeit, 2024
59 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Ausgangslage
2.1 Pariser Friedenskonferenz
2.2 Interessen der Hauptsiegermächte
2.3 Aufbau einer internationalen Ordnung – der Völkerbund
3. Pariser Vorortverträge
3.1 Versailler Vertrag
3.2 Vertrag von Saint-Germain
3.3 Vertrag von Trianon
3.4 Vertrag von Neuilly-sur-Seine
3.5 Verträge von Sévres und Lausanne
4. Pulverfass Osteuropa
4.1 Vertrag von Brest-Litowsk
4.2 Konflikte Osteuropas
5. Seitenwechsel
5.1 Italien
5.2 Japan
6. Fazit
7. Quellen- und Literaturverzeichnis
8. Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
“[D]er uns aufgezwungene Kampf, den wir jetzt um das künftige Schicksal Deutschlands durchfechten, macht es zur gebieterischen Notwendigkeit, uns in jedem Augenblick bewußt zu bleiben, wie es zu diesem Kampf gekommen ist und wo seine letzten Ursachen zu suchen sind.”1
Mit diesen Worten versuchte Joachim von Ribbentrop, Reichsminister des Auswärtigen Amtes zur Zeit des Nationalsozialismus, die Verantwortung für den Krieg und die damit verbundenen Konflikte auf die Alliierten abzuwälzen. Diese Aussage stellt jedoch nichts anderes als Propaganda dar, die das zu jener Zeit vorherrschende Gedankengut widerspiegelt. Die Frage nach Schuld und Unschuld ist nicht nur Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen, sondern wird auch immer wieder von Historikern, Politikwissenschaftlern und Nationalisten gestellt. Ebenso stellt sich die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, heutzutage noch eine Schuld festzustellen, oder ob es nicht besser wäre, lediglich die Ursachen zu analysieren, um ähnliche Fehler in der Zukunft zu vermeiden. Wie der Historiker Christopher Clark betont, wird jede Analyse durch die Schuldfrage eingeengt, und für den Verlauf der Geschichte ist diese letztlich bedeutungslos.2
Die Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg war geprägt von Instabilität und politischen Turbulenzen. Reiche zerfielen, neue Staaten und Bündnisse entstanden, Demokratien wurden gegründet und verschwanden wieder. Der Erste Weltkrieg, noch tief im kollektiven Gedächtnis verankert, schreckte die Welt nicht vor weiteren Konflikten ab.
Diese Arbeit wird sich weder mit der Schuldfrage noch mit dem genauen Ablauf einzelner Ereignisse der Zwischenkriegszeit befassen. Stattdessen wird das internationale System jener Zeit bewertet, die Auswirkungen der Pariser Vorortverträge analysiert und untersucht, wie es zu den Uneinigkeiten zwischen den Siegermächten sowie dem Bündniswechsel Japans und Italiens zum Zweiten Weltkrieg kam.
Dieses Forschungsfeld existiert so lange, wie der Erste Weltkrieg vorüber ist, und dennoch ist es bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Im 20. Jahrhundert wurden überwiegend Einzelfälle analysiert, wobei der internationale Fokus deutlich auf Deutschland lag. Forschung zu anderen Regionen der Welt in der Zwischenkriegszeit fand fast ausschließlich in den betroffenen Regionen selbst statt. Erst in jüngster Zeit beginnen wir, die Forschung der letzten hundert Jahre zusammenzutragen und ein umfassendes Bild der damaligen Welt zu rekonstruieren. Nur aus diesem Gesamtbild wird es möglich sein, die komplexen Zusammenhänge zu verstehen und mögliche Handlungsempfehlungen für die Zukunft abzuleiten – insbesondere mit Blick auf aktuelle Konfliktregionen wie die Ukraine, den Nahen Osten oder die Sahelzone.
In der gegenwärtigen wissenschaftlichen Literatur fällt insbesondere auf, dass sich zwei große Sprachräume intensiv mit der Thematik auseinandersetzen. Zum einen handelt es sich um den deutschsprachigen, zum anderen um den angloamerikanischen Raum. Diese Aufteilung birgt jedoch ein signifikantes Problem. Es ist deutlich erkennbar, dass viele angloamerikanische Forscher die deutschsprachige Literatur weitgehend ignorieren, was dazu führt, dass sie in bestimmten Bereichen des Forschungsstandes oft hinterherhinken. Im Gegensatz dazu integrieren die aktuellen deutschsprachigen Werke die internationale Literatur fast durchgängig und bieten dadurch eine breitere und tiefere Diskussionsbasis. Bemerkenswert ist, dass die deutschsprachige Forschung trotz ihrer internationalen Ausrichtung gelegentlich die Thesen anderer Forscher ebenfalls nicht hinreichend berücksichtigt, was zu einem fragmentierten Diskurs führen kann.
Gleichwohl zeigt sich in der Forschung eine klare Tendenz zu einem immer differenzierteren Verständnis der historischen Ereignisse. Die früher üblichen simplen Schuldzuweisungen sind heute weitgehend obsolet, und auch der früher gelegentlich propagierte Automatismus, der nahezu zwangsläufig zur Eskalation in den Zweiten Weltkrieg führte, wird zunehmend hinterfragt.3 Aus politikwissenschaftlicher Perspektive lässt sich sogar argumentieren, dass das Ende des Ersten Weltkrieges den Weg für eine erfolgreiche Implementierung der Theorie des Demokratischen Friedens4 ebnete.5 Dennoch muss konstatiert werden, dass sich diese Entwicklung nicht bewährte, da zahlreiche junge Demokratien in den Folgejahren scheiterten. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Literatur heute ein vielschichtiges und nuanciertes Bild der Zwischenkriegszeit zeichnet, das frühere vereinfachende Darstellungen zunehmend ablöst. Dieses differenzierte Verständnis trägt maßgeblich dazu bei, die Komplexität der damaligen geopolitischen und gesellschaftlichen Dynamiken besser zu erfassen und ein tieferes Verständnis für die Ursachen und Folgen der Ereignisse zu entwickeln.
Horst Möller gelangte zu dem Schluss, dass die Pariser Vorortverträge nicht allein die Verantwortung für die späteren Konflikte und den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs tragen. Vielmehr begünstigte eine Vielzahl von Zufällen und unvorhergesehenen Ereignissen die Eskalation der Spannungen. Dennoch legten diese Verträge unbestreitbar einen Grundstein für die darauf folgenden Entwicklungen.6 In einer ähnlichen Weise zieht der US-amerikanische Historiker Erik Goldstein sein Resümee. Er erkennt zwar Fehler in der Ausgestaltung der internationalen Politik, betont jedoch, dass die damalige Situation als ein weitgehend experimenteller Zustand zu verstehen sei. Die Auswirkungen neuer Systeme, wie etwa des Völkerbundes oder der Minderheitenschutzverträge, waren zu diesem Zeitpunkt kaum absehbar.7 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Goldstein seine Überlegungen auch in den Kontext der Kriegsschuldfrage des Zweiten Weltkriegs stellt, eine Thematik, die ich, wie bereits zuvor erläutert, bewusst ausklammern möchte. Jörn Leonhard hingegen argumentiert, dass nicht primär die Verträge nach dem Ersten Weltkrieg das Problem darstellten, sondern dass die Weichen für das Scheitern eines dauerhaften Friedens bereits während des Krieges selbst gestellt wurden. Es wurden Vereinbarungen und Abkommen getroffen, die letztlich weder miteinander noch mit der Realität in Einklang zu bringen waren.8 Eine weitere überzeugende These wird von Ulrich Schlie vorgebracht. Er identifiziert drei gravierende Fehler in der Nachkriegsordnung:
1. Die Friedensverträge waren in ihrem Inhalt zu radikal und standen im Widerspruch zu den idealistischen Werten, die sie eigentlich verkörpern sollten, was unweigerlich zu inneren Widersprüchen führte.
2. Es wurde die Dynamik der Massenbewegungen und die Macht der Propaganda in den besiegten Staaten unterschätzt.
3. Die Instrumente der Schiedsgerichtsbarkeit und der Konfliktverhütung im internationalen System waren unzureichend entwickelt.9
Besonders kritisch äußert sich der Militärhistoriker Michael S. Neiberg. Obwohl er sich in seinem Werk hauptsächlich auf den Versailler Vertrag konzentriert, lassen sich seine Argumente auch auf die anderen Verträge der Pariser Vorortkonferenzen übertragen. Neiberg kommt zu dem Ergebnis, dass die Nachkriegsordnung von 1919 die wirtschaftlichen Grundlagen für eine nachhaltige Stabilisierung untergrub. Dies geschah durch die Auferlegung hoher Reparationslasten auf Deutschland, die, obwohl sie nicht ganz das Niveau der Bestimmungen des Vertrags von Brest-Litowsk erreichten, das neue demokratische System sowohl materiell als auch ideologisch diskreditierten. Darüber hinaus wurden wichtige, jedoch unzufriedene Mächte wie Japan, China und Italien marginalisiert. Die neue Institution des Völkerbundes blieb aufgrund der Uneinigkeit zwischen Großbritannien und Frankreich sowie dem entscheidenden Fernbleiben der USA von Anfang an weitgehend machtlos:
„Even on its own terms [...] the treaty looked bad to contemporaries and looks little better with the passage of time. Built on far too many narrow compromises and a flawed vision of a world still governed by a small number of great powers, it failed to reflect or take into account the massive changes that the war had unleashed“10
In der vorliegenden Arbeit werde ich untersuchen, in welchem Ausmaß die Abkommen und Friedensverträge des Ersten Weltkriegs nicht nur weitere Konflikte bis 1939 förderten, sondern möglicherweise auch bedingten. Dabei werde ich eine ausführliche qualitative Literaturrecherche durchführen, die sich nicht nur auf Sekundärliteratur stützt, die sich explizit mit der Forschungsfrage auseinandersetzt, sondern auch spezialisierte Studien zu einzelnen Konflikten oder Regionen einbezieht. Dies ermöglicht eine bessere Analyse der Beziehungen zwischen den verschiedenen Konflikten. Zudem werden relevante Abkommen und Verträge, wo notwendig, als Primärquellen eingehend untersucht.
2. Ausgangslage
Im Jahr 1917 trat Russland mit dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk aus dem Ersten Weltkrieg aus, was das Kräfteverhältnis in Europa nachhaltig veränderte. Im darauffolgenden Jahr kapitulierten nach und nach die Mittelmächte, was den Weg für eine umfassende Neuordnung Europas ebnete. In zahlreichen Regionen des Kontinents kam es in dieser Zeit zu Aufständen unterdrückter Minderheiten, die nach Selbstbestimmung und Freiheit strebten. Nachdem die Waffenstillstandsverträge von Mudros11, Compiègne12, Thessaloniki13 und Villa Giusti14 unterzeichnet worden waren, stand die internationale Gemeinschaft vor der Herausforderung, die territoriale und politische Neuordnung Europas zu verhandeln. Dabei galt es, eine Vielzahl von unterschiedlichen und oftmals widersprüchlichen Interessen und Ansprüchen in Einklang zu bringen. Insbesondere die Verliererstaaten setzten große Hoffnungen in Wilsons 14-Punkte-Plan, der einen milden und gerechten Frieden versprach und die Grundlage für eine stabile Nachkriegsordnung legen sollte.
2.1 Pariser Friedenskonferenz
Ein zentraler Aspekt, der die Pariser Friedenskonferenz maßgeblich prägte, war das Fehlen Russlands. Das mittlerweile bolschewistische Russland wurde erst im Jahr 1921, also nach dem Ende der Konferenz, von den USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland anerkannt.15 Dieses Fehlen verdeutlicht die instabile diplomatische Lage, in deren Kontext die Konferenz stattfand. Zudem erschwerte es die Schaffung eines dauerhaften Friedens in Europa erheblich, dass eine der europäischen Großmächte und Hauptakteure des Ersten Weltkriegs bei der wohl bedeutendsten Nachkriegskonferenz der Weltgeschichte abwesend war.
Präsident Wilson betrachtete die USA als überlegen und versuchte, diese Überlegenheit auf Europa und den Friedensprozess zu übertragen.16 Aus heutiger Sicht erscheint dieses Vorgehen als realitätsfern, da es ohne ausreichendes Verständnis für die Situation in vielen europäischen Ländern, Regionen und Kulturen erfolgte. Diese Unkenntnis führte zwangsläufig zu Vorschlägen, die in der Praxis kaum umsetzbar waren und nicht zu den Gegebenheiten passten. Dementsprechend war auch die Struktur der Pariser Konferenz nicht geeignet, Wilsons Ideale umzusetzen. Hölzle führt dies darauf zurück, dass Wilson den 14-Punkte-Plan während des Krieges vorgeschlagen hatte, um Deutschland zu einer schnellen Kapitulation zu bewegen. Als Deutschland jedoch kapitulierte und sich auf die 14 Punkte bezog, war seine Verhandlungsposition erheblich geschwächt, da es bereits besiegt war.17
Die Verliererstaaten hatten bei der Konferenz keinerlei Mitspracherecht, keinen Zugang zu den Sitzungen und durften lediglich schriftliche Mitteilungen einreichen. Dieser Ausschluss erwies sich als verheerend für die Ergebnisse der Konferenz, da den Verliererstaaten Bedingungen auferlegt wurden, gegen die sie sich nicht wehren konnten.18 Ein ähnlich ungerechter Umgang wurde auch innerhalb der Siegerstaaten und ihrer assoziierten Länder gepflegt. In den Plenarsitzungen hatten nur die fünf Hauptsiegermächte – Großbritannien, Frankreich, die USA, Italien und Japan – ein Stimmrecht. Andere Länder durften nur abstimmen, wenn eine Entscheidung sie unmittelbar betraf, und neu entstandene Staaten durften lediglich Stellungnahmen abgeben.19 Diese Ungleichbehandlung bei einer Konferenz von weltweiter Bedeutung schuf zwangsläufig Nährboden für Unzufriedenheit und Ablehnung der Konferenzergebnisse.
Die wesentlichen Entscheidungen wurden jedoch vom Rat der Vier getroffen, der die Hauptsiegermächte ohne Japan umfasste. Dieser Rat stieß auf erheblichen Widerstand, insbesondere von Japan sowie von Berufsdiplomaten anderer Länder und sogar von Vertretern der eigenen Siegermächte. Der Rat der Vier verfügte über nahezu uneingeschränkte Macht und fertigte keine Protokolle seiner Sitzungen an, was die Transparenz der Entscheidungen massiv beeinträchtigte.20 Die Pariser Friedenskonferenz brach mit vielen etablierten Normen des internationalen Diplomatentums, weshalb sie häufig als diplomatisch gescheitert angesehen wird. Die idealistischen Vorsätze und der Wunsch der Diplomaten nach Transparenz in der Vertragsausarbeitung konnten nicht eingehalten werden. Dies führte zu wachsendem Unmut unter den Diplomaten und verhinderte die Bildung von Vertrauen zwischen den ehemals verfeindeten Mächten.21 Zudem stellte der Verlauf der Konferenz einen Bruch mit dem ersten Punkt von Wilsons 14-Punkte-Plan dar, der das Ende der Geheimdiplomatie forderte.22
2.2 Interessen der Hauptsiegermächte
Um die komplexen Vertragsgestaltungen der Pariser Friedenskonferenz vollständig zu verstehen, ist es unerlässlich, die unterschiedlichen Interessen der Siegermächte näher zu betrachten. Dabei ist von zentraler Bedeutung, dass jedes Land eigene, teils widersprüchliche Vorstellungen und Ziele verfolgte, was die Verhandlungen erheblich erschwerte. Für die Vereinigten Staaten bestand das primäre Ziel darin, die von Präsident Wilson formulierten 14 Punkte durchzusetzen, die in der Gründung des Völkerbundes münden sollten, um eine dauerhafte internationale Friedensordnung zu etablieren.23
Frankreich hingegen verfolgte konkrete Sicherheitsinteressen, die maßgeblich von der Sorge vor einer möglichen Revanche Deutschlands geprägt waren. Marschall Foch24 setzte sich daher vehement für die Besetzung des Rheinlandes, sowie der strategisch wichtigen Gebiete Helgoland und Cuxhaven ein, um zukünftige Bedrohungen durch Deutschland effektiv zu verhindern.25 Großbritannien wiederum war insbesondere über ein mögliches Machtungleichgewicht auf dem europäischen Kontinent besorgt.26 Ein (neo)realistisches Verständnis der internationalen Beziehungen, das in Großbritannien vorherrschte, führte zu dem Bestreben, ein multipolares Europa zu schaffen. In einem solchen System sollten mehrere mittelstarke Staaten existieren, die aufgrund ihres relativen Gleichgewichts nicht in der Lage wären, ohne erhebliche Risiken gegeneinander Krieg zu führen. Dieses geopolitische Kalkül Großbritanniens war jedoch nicht nur auf Europa beschränkt. Um seine eigene Stellung als Weltmacht zu verteidigen, insbesondere angesichts der aufstrebenden Vereinigten Staaten, verlangte Premierminister Lloyd George27 die vollständige Übernahme der deutschen Marineflotte. Diese Forderung führte zu Spannungen zwischen Großbritannien und Frankreich, wobei sich beide Mächte gegenseitig die Schuld an einem möglichen Scheitern der Konferenz zuschrieben.28
Die Verhandlungen mit Italien stellten eine besonders schwierige Herausforderung dar. Italien war ursprünglich Teil eines Verteidigungsbündnisses mit dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn29, wurde jedoch durch den Londoner Vertrag zum Kriegseintritt auf Seiten der Alliierten bewegt. Bereits im Vorfeld der Konferenz war klar, welche Gebietsansprüche und Interessen von Italien als legitim betrachtet wurden. Diese umfassten unter anderem Südtirol, Triest, Trentino, Görz, Gradisca, die gesamte istrianische Halbinsel bis zum Golf von Quarnaro, einschließlich der Inseln Cres und Losinj, sowie die dalmatinischen Inseln und die Städte Zadar, Sibenik, Trogir, Vlora und die Insel Sazan. Darüber hinaus beanspruchte Italien die Hoheitsgewalt über den Dodekanes, Einflussgebiete in Vorderasien und die Korrektur einiger Grenzen in italienisch-afrikanischen Kolonien. Zudem sollte Italien Anteile an den deutschen Kolonien erhalten, und Äthiopien wurde in einem separaten Abkommen mit Großbritannien explizit zugesprochen.30
Japan hingegen konzentrierte sich weitgehend auf seine eigenen nationalen und sicherheitspolitischen Interessen und hielt sich aus den europäischen Angelegenheiten zurück. Es forderte die ihm versprochenen deutschen Überseegebiete im Pazifik. Neben diesen territorialen Ansprüchen verfolgte Japan jedoch auch ein weltpolitisches Ziel, das über rein nationale Interessen hinausging: Es setzte sich dafür ein, eine Gleichstellungsklausel aller menschlichen Rassen in die Satzung des Völkerbundes aufzunehmen, um damit eine Grundlage für internationale Anerkennung und Gleichberechtigung zu schaffen.31
Durch diese unterschiedlichen und teilweise konträren Interessen der Siegermächte wurde die Verhandlungsdynamik der Pariser Friedenskonferenz erheblich kompliziert und trug maßgeblich dazu bei, dass die endgültigen Vereinbarungen oft mehr von Kompromissen als von klaren, kohärenten Lösungen geprägt waren.
2.3 Aufbau einer internationalen Ordnung – der Völkerbund
Als 14. Punkt in Wilsons Friedensplan war die Gründung des Völkerbundes vorgesehen, um zukünftige Konflikte zu verhindern und die territoriale Unversehrtheit der Mitgliedsstaaten zu gewährleisten. Die Idee eines Völkerbundes fand schnell weltweit Anklang, und bereits kurz nach dem Waffenstillstand von Compiègne, am 24. Dezember 1918, bei seinem Amtsantritt als neuer Staatssekretär des deutschen Auswärtigen Amtes, sprach Brockdorff-Rantzau von der Unterstützung Deutschlands für diese Idee. Er sagte:
“Die erste und vornehmste Aufgabe, die meiner harrt, ist die Herbeiführung eines Rechtsfriedens. [...] Wenn es gelingt, einen Rechtsfrieden zu schließen, aber auch nur in diesem Falle, ist die Basis für einen Völkerbund gegeben, dessen Errichtung ich aus innerster Überzeugung anstrebe, und ich weiß, daß die Mehrheit des deutschen Volkes, daß jetzt sein Schicksal selbst in die Hand genommen hat, hinter mir steht.”32
Es ist bemerkenswert, dass Deutschland bereits im Dezember 1918, so kurz nach dem Ende der Feindseligkeiten, bereit war, seinen Platz in einer neuen internationalen Ordnung zu suchen, vorausgesetzt, der Frieden würde als gerecht empfunden. Dies bot eine bedeutende Chance, einen langfristigen Frieden zu sichern, wenn selbst noch im Kriegszustand befindliche und verfeindete Nationen gemeinsam an einer Lösung arbeiteten.
Noch bevor der Friedensvertrag von Versailles unterzeichnet oder gar sein Inhalt Deutschland bekannt war, legten deutsche Diplomaten im April 1919 einen Entwurf für den Völkerbund vor.33 Trotz dieses deutschen Willens, über die Schatten des Krieges und jahrhundertelange Feindschaften hinauszugehen, wurde Deutschland nicht in den Völkerbund aufgenommen. Diese Entscheidung führte zwangsläufig zu Fragen hinsichtlich der Wahrnehmung dieser Ablehnung durch Deutschland. Durch diese Ausgrenzung wurde das Land außenpolitisch isoliert und hatte keine Möglichkeit, sich an neue Bündnisse zu binden oder Teil eines geregelten internationalen Systems zu werden. Es dauerte fünf weitere Jahre, bis Deutschland mit den Verträgen von Locarno einen Schritt in Richtung internationaler Gleichberechtigung machte und 1926 schließlich dem Völkerbund beitreten durfte.34 Bemerkenswert ist, dass diese Ausgrenzung offenbar nicht auf die Feindschaft des Ersten Weltkriegs zurückzuführen war, denn Bulgarien und Österreich durften bereits 1920 dem Völkerbund beitreten, Ungarn folgte 1922. Vielmehr war die Entscheidung durch die tief verwurzelte Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland motiviert. Frankreich wollte im Falle eines erneuten deutschen Angriffs einen international isolierten Gegner haben, doch dabei wurden die hehren Ideale der Konfliktbeilegung untergraben.
Auch das Scheitern des japanischen Bestrebens, eine Gleichstellungsklausel in die Satzung des Völkerbundes aufzunehmen, führte zu erheblichem Unmut.35 Zwar stieß die Idee des Völkerbundes weltweit auf breite Zustimmung, doch waren insbesondere in den westlichen Staaten Gesellschaften und Gesetzgebungen noch nicht bereit für eine solche Gleichstellung. Besonders in den USA sowie in den britischen Dominions gab es antijapanische Gesetzgebungen, die einer solchen Klausel widersprochen hätten.36 Die rassistischen Darstellungen von Asiaten in den westlichen Staaten, etwa als „gelbe Affen“37, befeuerten dieses Denken und machten es unmöglich, ernsthaft über Gleichberechtigung nachzudenken.
Die USA bestanden darauf, den vertraglichen Schutz von Minderheiten zu verankern, da durch die Entstehung vieler Nationalstaaten das Ende mehrerer Vielvölkerreiche, wie dem Habsburgerreich, dem Deutschen Reich und dem russischen Zarenreich, eingeleitet wurde. Durch die Gebietsveränderungen entstanden in ansonsten relativ homogenen Ländern oft sehr kleine Minderheiten, die jedoch in bestimmten Regionen eines Staates dominant waren. In den letzten Phasen der Konferenz setzte sich Wilson nachdrücklich dafür ein, dass eine Kommission für Minderheitenfragen eingerichtet und der Minderheitenschutz in der Satzung des Völkerbundes verankert wird, was jedoch letztlich nicht durchgesetzt werden konnte.38
Es ist zwar verständlich, dass der Völkerbund in einer schwierigen internationalen Zeit gegründet wurde, dennoch überrascht es, dass der Rat der Vier eine Vielzahl besonders heikler und ungelöster Fragen, wie etwa Gebietszusprechungen, dem Völkerbund überließ.39 Einerseits könnte dies darauf hindeuten, dass der Rat der Vier sich nicht über alle Staaten hinwegsetzen wollte und hoffte, durch die Einbindung des Völkerbundes eine höhere Legitimität zu erlangen. Andererseits stellt sich die Frage, warum ein Rat der Vier überhaupt notwendig war, wenn nicht gerade für die Lösung solcher schwierigen Fragen. Am Ende wurden einer noch jungen und instabilen Organisation Aufgaben übertragen, deren Ergebnisse direkte Auswirkungen auf die internationale Meinung zum Völkerbund hatten und deren Misslingen das gesamte Konzept hätte scheitern lassen können.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Völkerbund auf nahezu allen Ebenen gescheitert ist. Weder konnte er Konflikte in Europa oder anderswo verhindern, noch trug er zur dauerhaften Demokratisierung bei.40 Durch den Nichtbeitritt der USA41 als eigentlichen Initiator und die überwiegende Beteiligung europäischer Länder oder von europäischen Staaten kontrollierter Gebiete entwickelte sich der Völkerbund zu einer weitgehend europäisierten Institution. Dies zeigte sich auch darin, dass etwa 65 % der Mittel des Völkerbundes aus europäischen Staaten stammten und dieser sich hauptsächlich mit dem Wiederaufbau Mittel- und Osteuropas befasste, während andere Regionen der Welt weitgehend vernachlässigt wurden.42 Diese europäische Fokussierung führte wiederum zur Ablehnung des Völkerbundes durch außereuropäische Staaten.43 Zudem fehlte eine effektive Strategie zur Verhinderung von Konflikten, sodass der Völkerbund während seiner gesamten Existenz dem aufstrebenden Nationalismus und den Revanchegelüsten nichts entgegenzusetzen hatte.44 Der Völkerbund mutierte zu einem System, das sich hauptsächlich um europäische Belange kümmerte und sich damit weit von seinem ursprünglichen Ziel, der weltweiten Friedenssicherung, entfernte. In Bezug auf die weiteren Konflikte in Europa nach dem Ersten Weltkrieg kam Weidenfeld zu dem Schluss, dass ein gemeinsames europäisches Narrativ und eine verbindende Kultur fehlten.45 Dies lässt sich auch auf den Völkerbund übertragen, der lediglich ein loser Zusammenschluss von Staaten war, die durch wenig miteinander verbunden waren, stattdessen durch Revanchegelüste und gegenseitigen Hass geprägt wurden, während zugleich die Schiedsgerichtsbarkeit des internationalen Systems noch nicht ausreichend entwickelt war.
3. Pariser Vorortverträge
Die fünf Pariser Vorortverträge wurden ursprünglich mit dem Ziel entworfen, den Kriegszustand zu beenden und gemeinsam mit dem neu geschaffenen Völkerbund den Weg für eine friedliche Weltordnung zu ebnen. In der Praxis gestaltete sich die Situation jedoch anders. Bis heute sind die einzelnen Friedensverträge von Versailles, Saint-Germain, Neuilly-sur-Seine, Trianon und Sèvres tief in der Erinnerungskultur der unterlegenen Nationen verankert und werden insbesondere von rechten und nationalistischen Kräften immer wieder instrumentalisiert und aufgegriffen.46
Der erste Schritt in Richtung Frieden wurde durch die Unterzeichnung der fünf Waffenstillstandsverträge gemacht, die zunächst ähnliche Bedingungen für die unterlegenen Mächte festlegten. Diese beinhalteten unter anderem die sofortige Demobilisierung der jeweiligen Armeen sowie das Durchmarsch- und Besatzungsrecht für die alliierten Streitkräfte.47 Diese Maßnahmen sollten den Alliierten die Möglichkeit geben, im Falle eines Scheiterns der Friedensverhandlungen schnell und ohne großen Widerstand erneut gegen die Mittelmächte vorgehen zu können.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der häufig übersehen wird, ist, dass den endgültigen Friedensverträgen sogenannte Präliminarfrieden48 vorausgingen. Bereits in diesen Vorverhandlungen zeigten sich erhebliche Uneinigkeiten unter den Siegermächten, nicht nur hinsichtlich ihrer Ziele und Interessen, sondern auch in der Frage, inwieweit sie bereit waren, in den endgültigen Friedensverträgen von den zuvor vereinbarten Präliminarfrieden abzuweichen.49 Diese Uneinigkeit spiegelte sich in den unterschiedlichen Bedingungen der einzelnen Friedensverträge wider und führte letztlich dazu, dass weder die besiegten noch die siegreichen Staaten mit den endgültigen Vereinbarungen vollständig zufrieden waren.
In der wissenschaftlichen Forschung wird oft direkt oder indirekt der Begriff des „karthagischen Friedens“50 diskutiert.51 Einige Historiker und Rechtswissenschaftler verwenden diesen Begriff, um ein abschließendes Urteil über einen der Friedensverträge zu fällen, andere greifen lediglich die damit verbundene Rhetorik auf, während wiederum andere versuchen, sich vollständig von dieser Bezeichnung zu distanzieren. Auch in dieser Arbeit wird bewusst darauf verzichtet, die These eines „karthagischen Friedens“ zu übernehmen und die fünf Friedensverträge anhand dieser Argumentation zu bewerten. Der Grund dafür liegt in der Gefahr des Objektivitätsverlustes, der entstehen kann, wenn ein Forscher eine solch kontroverse These annimmt. In solchen Fällen besteht die Gefahr, dass die ausgewählten Argumente zu einseitig werden und eine umfassende, ausgewogene Analyse erschwert wird.
3.1 Versailler Vertrag
Obwohl Russland selbst nicht an der Pariser Friedenskonferenz teilnahm, war den Alliierten der harte Frieden von Brest-Litowsk, den das Deutsche Kaiserreich Russland auferlegt hatte, noch stark in Erinnerung.52 Dieser Diktatfrieden ermöglichte es Deutschland, seinen Einfluss über weite Teile Osteuropas auszudehnen. In Anbetracht dessen stellten sich viele sicherlich die Frage, warum man nun mit Deutschland nachsichtig umgehen sollte, wenn Deutschland selbst Russland solch drakonische Bedingungen auferlegt hatte und im Falle eines Sieges über die Westalliierten wohl kaum zurückhaltender gewesen wäre. Daraus ergibt sich die Überlegung, ob der Vertrag von Brest-Litowsk möglicherweise als Vorbild für die Pariser Vorortverträge diente.
Ein Zitat, das häufig verwendet wird, um die deutsche Reaktion auf den Versailler Vertrag zu verdeutlichen, stammt von Philip Scheidemann:
„ich frage Sie: wer kann als ehrlicher Mann, ich will gar nicht sagen als Deutscher, nur als ehrlicher vertragstreuer Mann solche Bedingungen eingehen? Welche Hand müßte nicht verdorren, die sich und uns in diese Fesseln legt? […] Wir haben Gegenvorschläge gemacht, wir werden noch weitere machen. Wir sehen, mit Ihrem Einverständnis, unsere heilige Aufgabe darin, zu Verhandlungen zu kommen. Dieser Vertrag ist nach Auffassung der Reichsregierung unannehmbar! […] Würde dieser Vertrag wirklich unterschrieben, so wäre es nicht Deutschlands Leiche allein, die auf dem Schlachtfelde von Versailles liegen bleibe. Daneben würden als ebenso edle Leichen liegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die Unabhängigkeit freier Nationen, der Glaube an all die schönen Ideale, unter deren Banner die Entente zu fechten vorgab, und vor allem der Glaube an die Vertragstreue.“53
Rößler beschreibt den Versailler Vertrag als einen Übergang zwischen traditionellen Friedensschlüssen, die von den imperialistischen Ambitionen der Sieger geprägt waren sowie von ideologischen Zielen wie Selbstbestimmung und Demokratie. Dieser duale Charakter führte dazu, dass der Vertrag ein uneinheitliches Konstrukt darstellte, das ideologische Prinzipien enthielt, welche die imperialistischen Forderungen eigentlich hätten ablehnen sollen.54 Auch wenn ich in einigen Punkten der Ausführungen in Blessings Dissertation nicht folge, da sie wesentliche Aspekte außer Acht lässt, ist seine Analyse zutreffend, dass der Versailler Vertrag in seiner Detailtiefe unübertroffen war, indem er fast jeden Aspekt der deutschen Nachkriegszeit regelte und damit eine „Totalität des Friedens“ aus der „Totalität des Krieges“ machte.55 Diese „Totalität des Friedens“ manifestierte sich darin, dass Frankreich trotz starker revisionistischer Bestrebungen an keiner Stelle nachgeben wollte. Die Angst war zu groß, dass ein Entgegenkommen in einem Punkt den Anfang für weitere deutsche Revisionsbestrebungen bedeuten könnte.56
Die Ablehnung des Versailler Vertrags begann bereits mit dessen Ausgestaltung. Es war über Jahrhunderte hinweg Tradition, dass der Besiegte in die Friedensverhandlungen einbezogen wurde. Im Falle des Versailler Vertrags jedoch wurde dieser Deutschland ohne Verhandlungen oktroyiert. Deutschland wurde kein einziges Mal konsultiert, und der fertige Vertrag wurde dem Land plötzlich und ohne Vorwarnung überreicht.57
Die Deutschen fühlten sich zunehmend wie ein Vasallenstaat ohne jede Autonomie, ein Eindruck, der durch mehrere Vorfälle verstärkt wurde. So wurde im Versailler Vertrag keine genaue Summe für die Reparationszahlungen festgelegt.58 Als 1921 schließlich die Reparationen auf 221 Milliarden Goldmark festgesetzt wurden – was dem gesamten deutschen Volksvermögen entsprach – und Deutschland nach Ablauf eines Ultimatums nicht mit den Zahlungen begann, besetzten britische und französische Truppen erneut deutsche Städte.59 Obwohl der Krieg erst drei Jahre zurücklag, wurde Deutschland weiterhin nicht als gleichberechtigter Partner anerkannt, und es gab keine Kompromissbereitschaft seitens der Alliierten. Dies führte zu wachsendem Unmut in der deutschen Bevölkerung, die sich ausgenutzt und ausgepresst fühlte. Der Verdacht, dass die Alliierten tatsächlich einen „karthagischen Frieden“ anstrebten, wurde durch die Ruhrbesetzung 1923 nochmals verstärkt.
Besonders kritisch war auch die Entscheidung des Völkerbundes, Oberschlesien Polen zuzusprechen, obwohl sich die deutsche Bevölkerung erfolgreich gegen einen polnischen Angriff zur Wehr gesetzt hatte. Fragwürdig war diese Entscheidung auch deshalb, weil eine Volksabstimmung durchgeführt wurde, bei der 61 % der Bevölkerung für den Verbleib in Deutschland gestimmt hatten.60 Es stellt sich die Frage, warum eine Abstimmung im Sinne des Selbstbestimmungsrechts durchgeführt wurde, wenn das Ergebnis letztlich ignoriert wurde. Diese Entscheidung vermittelte den Verliererstaaten den Eindruck, dass die Siegermächte willkürlich nach ihren eigenen Interessen handelten und sich nicht an ihre eigenen Werte hielten.
Eine interessante Perspektive auf die Auswirkungen der Beschränkung des deutschen Heeres auf 100.000 Mann bietet Deist. Er argumentiert, dass dieses stehende Berufsheer, so klein es auch war, eine entscheidende Voraussetzung für die rasche Militarisierung während der NS-Zeit bildete. Nur durch dieses Heer gab es eine hohe Ausbildungsqualität und professionelle Strukturen, die das schnelle Anwachsen des deutschen Militärs ermöglichten.61 Folgt man dieser Argumentation, so könnte man schlussfolgern, dass der Versailler Vertrag genau das Gegenteil von dem bewirkte, was Frankreich, insbesondere Marschall Foch, erreichen wollte. Zwar war Deutschland auf dem Papier militärisch geschwächt und besaß keine schweren Waffen, doch gewährleistete dieses System keineswegs die Sicherheit Frankreichs. Stattdessen blieb die tief verwurzelte Erbfeindschaft bestehen, die durch den Ausschluss Deutschlands aus dem Völkerbund nicht überwunden werden konnte. Diese Feindschaft bestand gegenüber einem Land mit einer deutlich höheren Bevölkerungszahl als Frankreich und einem Militär, das trotz der Einschränkungen gute Bedingungen für eine Aufrüstung besaß. Daraus lässt sich ableiten, dass nur durch diplomatische Interaktionen in Form von Zusammenarbeit, Gleichberechtigung und möglichen Assoziierungsabkommen Frankreich eine langfristige Sicherheit gegenüber Deutschland hätte erlangen können.
1926 wurde Deutschland schließlich der Beitritt zum Völkerbund gewährt. Es hatte jedoch mehr als ein halbes Jahrzehnt gedauert, bis mit den Verträgen von Locarno versucht wurde, das internationale System zu stabilisieren und außenpolitische Verhältnisse zu schaffen, mit denen alle beteiligten Staaten einverstanden waren.62 Es lässt sich darüber streiten, ob diese Reaktion in einem angemessenen Zeitraum stattfand. Hätte man Deutschland, wie den anderen Verliererstaaten, kurz nach der Gründung des Völkerbundes eine Mitgliedschaft ermöglicht, hätte sich der deutsche Revisionismus möglicherweise anders entwickelt. Doch eine solche Spekulation würde in das Postfaktische abgleiten. Daher kann lediglich festgestellt werden, dass Locarno ein Erfolg für die Staatengemeinschaft und den europäischen Frieden darstellte, auch wenn dieser Erfolg möglicherweise zu spät kam.
Es stellt sich die Frage, ob der Versailler Vertrag konkret eine Mitschuld an der Entwicklung Deutschlands in den 1920er und 1930er Jahren trug. Der Historiker Conze argumentiert, dass nicht der Versailler Vertrag selbst für das Erstarken des Nationalsozialismus verantwortlich war, sondern seine Instrumentalisierung und die extreme deutsche Revisionspolitik, die die Weimarer Republik schwächten.63 Dem ist entgegenzuhalten, dass der Versailler Vertrag selbstverständlich nicht direkt zum Nationalsozialismus führte, er jedoch den Nährboden für die erwähnte Instrumentalisierung und Revisionspolitik bot, die einen breiten gesellschaftlichen Konsens fanden.64 Es war ein Vertrag, der nicht nur bei Anhängern rechter Ideologien, sondern in nahezu allen politischen Lagern Deutschlands auf Ablehnung stieß.65 Auch wenn man das Märchen der Dolchstoßlegende beiseite lassen möchte, muss man dennoch fragen, ob neben den rein vertraglichen Bedingungen weitere Aspekte zur Nichtakzeptanz führten. Ein starkes Argument, das oft international wenig Beachtung findet, ist, dass sich die Deutschen möglicherweise nie wirklich als besiegt empfanden, zumindest nicht in einem Ausmaß, das die strengen Vertragsbedingungen gerechtfertigt hätte. In weiten Teilen des Landes gab es keine Besatzungstruppen, und keine alliierten Streitkräfte marschierten in Berlin ein, wie es die Deutschen 1871 in Paris getan hatten.66 Deutsche Städte und Landstriche, insbesondere im Westen, blieben weitgehend unversehrt, da die Fronten größtenteils außerhalb des Deutschen Reiches lagen. Abgesehen von toten und verwundeten Angehörigen sowie Lebensmittelengpässen erlebten die Deutschen den Krieg selten direkt zu Hause.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Uneinigkeit der Alliierten in der sogenannten „deutschen Frage“ wesentlich dazu beigetragen hat, dass jeder von ihnen einen Großteil seiner Forderungen im Versailler Vertrag durchsetzen konnte. Anstatt als geeinte Verbündete aufzutreten, agierten die Siegermächte in den Verhandlungen eher als Rivalen, die primär ihre eigenen nationalen Interessen verfolgten. Diese Herangehensweise führte letztlich zu einem verhältnismäßig harten Vertragswerk, zu dessen Deutschland zur Unterzeichnung gezwungen war.
Besonders Frankreichs Sicherheitsbedenken, die maßgeblich von der Furcht vor einer deutschen Revanche geprägt waren, erwiesen sich zunächst als übertrieben. Doch gerade die umfassenden Bestimmungen des Versailler Vertrags schufen genau das Konfliktpotenzial, das diese Ängste letztlich rechtfertigte. Es gelang den Siegermächten nicht, Deutschland in ein gemeinsames Bündnissystem zu integrieren oder die Revanchegelüste nachhaltig zu unterbinden. Stattdessen legten die Alliierten den Vertrag nicht nur äußerst rigide aus und zeigten keinerlei Bereitschaft zu Kompromissen, sondern provozierten auch direkt den Unmut der deutschen Bevölkerung, indem sie Gebiete besetzten und unrechtmäßige Gebietszuweisungen vornahmen.
In diesem Kontext diente der Versailler Vertrag zunehmend als Sündenbock, der die Radikalisierung innerhalb Deutschlands förderte. Dass der Vertrag den hohen ideologischen Ansprüchen von Präsident Wilson nicht gerecht wurde und dies letztlich zur Nicht-Unterzeichnung durch die USA führte67, schwächte seine Akzeptanz zusätzlich. Dies verstärkte bei den Deutschen das Gefühl, dass selbst die USA als eine der führenden Siegermächte den Vertrag als zu hart empfanden. So trug der Versailler Vertrag maßgeblich zur Entstehung eines politischen Klimas bei, das die Radikalisierung und den Aufstieg extremistischer Kräfte in Deutschland begünstigte.
3.2 Vertrag von Saint-Germain
Österreich wurde durch den Friedensvertrag von Saint-Germain schwer getroffen. Als einstige Großmacht war das Land nur noch ein Schatten seiner selbst. Im Gegensatz zu Deutschland wurde Österreich schnell der Beitritt zum Völkerbund gewährt. Dies konnte jedoch weder das Sterben der Demokratie noch die Geburt des Austrofaschismus verhindern. Es stellt sich daher die Frage, inwiefern der Vertrag von Saint-Germain zu dieser Entwicklung beigetragen hat.
Ein ähnliches Phänomen wie in Deutschland war die Doppelmoral bei der Anwendung des Selbstbestimmungsprinzips. Im Frühjahr 1919 führte die österreichische Bevölkerung eine Volksabstimmung durch, bei der sich eine deutliche Mehrheit für einen Anschluss an Deutschland aussprach. Dieser Anschluss wurde jedoch durch die Verträge von Versailles und Saint-Germain untersagt.68 Im Jahr 1921 wiederholte man diese Abstimmung in Salzburg und Tirol, allerdings nur in diesen beiden Bundesländern, da die Bundesregierung keine Zustimmung erteilte. Die Ergebnisse, mit 98 % Zuspruch in Tirol und 99 % in Salzburg, waren dennoch eindeutig.69 Das Ziel der Alliierten war es, die Entstehung einer neuen mitteleuropäischen Großmacht zu verhindern, deren militärische Stärke weitere Konflikte begünstigen könnte. Doch dieser Widerspruch zum angestrebten Selbstbestimmungsrecht ist offensichtlich und erklärt zugleich den später gefeierten Anschluss Österreichs an Deutschland im Jahr 1938.
Der gescheiterte friedliche Anschluss Österreichs an Deutschland war jedoch nicht der einzige Fall, in dem das Selbstbestimmungsrecht nicht umgesetzt wurde. Im Fall Südtirols beharrte Italien auf dem Londoner Vertrag, der Südtirol als Gegenleistung für Italiens Kriegseintritt auf Seiten der Alliierten Italien zusprach. Ein amerikanischer Kompromissvorschlag, der Italien lediglich einen Großteil Südtirols zugestand, wurde ebenfalls abgelehnt.70
Neben dem Unmut über die internationale Politik hat die aktuelle Forschung einen weiteren wesentlichen Faktor identifiziert, der zur Radikalisierung in Österreich beitrug: die massive Arbeitslosigkeit. Nach dem Schwarzen Freitag war Österreich von Massenarbeitslosigkeit betroffen, stärker als viele andere europäische Länder. Besonders gravierend war die Situation unter den Jugendlichen, deren Arbeitslosenquote bis 1934 auf 25 % anstieg.71
Obwohl der Vertrag von Saint-Germain für Österreich hart ausfiel und das Land kein Anrecht auf das Selbstbestimmungsrecht hatte, ist es dennoch bemerkenswert, dass die jahrhundertealte Erbfeindschaft zwischen Österreich und Italien nach dem Ersten Weltkrieg endete. Konflikte, wie jene um die Brennergrenze, erschienen im Vergleich zu anderen europäischen Auseinandersetzungen nahezu trivial.72 Letztlich scheiterte Österreichs erste Demokratie jedoch aufgrund der zunehmenden Radikalisierung. Der Vertrag von Saint-Germain spielte dabei nur eine indirekte Rolle. Zwar wurde Österreich durch den Völkerbund schnell in die internationale Staatengemeinschaft integriert, doch der Verlust der Selbstidentität als Großmacht, verbunden mit der Enttäuschung über die Nichtanwendung des Selbstbestimmungsprinzips, trug wesentlich zum Verfall der Demokratie in Österreich bei.
3.3 Vertrag von Trianon
Ungarn erlitt nach dem Ersten Weltkrieg ein Schicksal, das dem von Deutschland und Österreich in vielerlei Hinsicht ähnelte. Die ungarische Delegation wurde vor vollendete Tatsachen gestellt, und ihre Einwände fanden bei den Alliierten kaum Beachtung.73 Es gab also keine bevorzugte oder benachteiligte Behandlung unter den Verliererstaaten, was jedoch die Empörung in Ungarn nicht milderte. Ähnlich wie Österreich sah sich Ungarn plötzlich als ein auf sich allein gestelltes, relativ kleines Land, dessen Bevölkerung jedoch weiterhin die Identität eines Großreichs bewahrte. Diese Diskrepanz zwischen der alten imperialen Identität und der neuen Realität führte zu einer tiefen Verbitterung und erschwerte die Modernisierung der nationalen Identität erheblich.74 In Zahlen ausgedrückt bedeutete dies, dass Ungarn von einer Fläche von 325.411 km² auf nur noch 92.963 km² schrumpfte und die Bevölkerung von 20,9 Millionen auf 7,62 Millionen Bürger zurückging.75 Zudem sah sich Ungarn aufgrund der Grenzverschiebungen mit erheblichen Flüchtlingsströmen konfrontiert. Allein zwischen 1919 und 1924 kamen rund 400.000 Flüchtlinge ins Land, was die Verwaltung stark belastete und zur weiteren Instabilität beitrug.76 Die im Vertrag von Trianon nicht konkret festgelegten Reparationszahlungen führten, ähnlich wie in Deutschland, bei ihrer späteren Festsetzung zu großem Entsetzen in Ungarn.77
Zwar wurde Ungarn, wie auch Österreich, in den Völkerbund aufgenommen, doch blieb es zunächst außenpolitisch isoliert. Diese Isolation wurde durch die sogenannte Kleine Entente, ein Militärbündnis zwischen Rumänien, der Tschechoslowakei und dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, noch verstärkt, das Ungarn regelrecht umzingelte.78 Die Folge war ein Aufstieg des Nationalismus, während zugleich jegliche ungarischen Revisionsbestrebungen unterbunden wurden. Diese Entwicklungen führten zu einer Spirale des Hasses, die im Laufe der Jahre weiter angefacht wurde.
Kastner analysiert treffend, dass eine Vielzahl von Faktoren zu dieser Situation beitrugen, die Ungarn schließlich in die Arme des faschistischen Italiens trieben. Dazu gehörten die übertriebenen Gebietsansprüche der Tschechoslowakei, die militärische Intervention Rumäniens im Jahr 1919, wodurch Rumänien ohnehin als einer der großen Gewinner des Ersten Weltkriegs galt79, sowie die ständigen diplomatischen Interventionen Frankreichs und Großbritanniens, die immer dann eingriffen, wenn Ungarn Handlungen unternahm, die der Tschechoslowakei nicht passten.80
Dieser Hass wurde weiter dadurch verstärkt, dass auch im Falle Ungarns das Selbstbestimmungsprinzip keine Anwendung fand. Stattdessen wurden ungarische Gebiete mit ethnischen Minderheiten an die Nachbarstaaten vergeben.81 Zugleich war Ungarn jedoch vertraglich verpflichtet, die Rechte dieser Minderheiten zu schützen.82 Für viele Nationalisten in Ungarn mag dies wie Hohn gewirkt haben, doch aus einer objektiven Perspektive betrachtet, sind die Minderheitenschutzverträge insbesondere in einem ehemaligen Vielvölkerstaat positiv zu bewerten. Denn ein Nationalstaat hat in der Regel wenig Interesse daran, sich um Minderheiten zu kümmern, besonders wenn für diese Volksgruppen neu gegründete Staaten existierten.
Die tiefe Ablehnung des Vertrags von Trianon innerhalb Ungarns wird deutlich in einer Textpassage des ungarischen Juristentages, die als Appell an die Rechtsgelehrten der Welt gerichtet war:
„Es ist kein Ziel der Wissenschaft, die Kriege zu klassifizieren und gute und böse Kriege zu unterscheiden. Doch ist es über alle Zweifel erhaben, daß vom Standpunkte des dem Kriege folgenden Friedens, jener Krieg besser ist, aus dem die Partei, die oben blieb, nicht nur als dessen Gewinner, sondern auch als dessen Sieger hervorkam, und nach dem Krieg ein der durch den wohlverdienten Sieg erweckten zufriedenen Stimmung an den grünen Tisch der Friedensverhandlungen tritt und im Bewußtsein seiner Superiorität auch seinen gewesenen Gegner achtet, denn er würde durch die Herabsetzung seines Gegners nur den Glanz seines eigenen Triumphes dämpfen. Nach solchen Siegen pflegt man die wahren Friedensverträge zu schließen, denen der gemeinsame Entschluß der beiden vertragschließenden Parteien den Inhalt verleiht, — nicht der schrankenlose Wille des Siegers, den der zum Widerstande unfähige Besiegte nur unter dem Eindrücke des Waffengeklirrs, d. h. einer kriegerischen Drohung solange anerkennt, als er diese Drohungen fürchten muß.“83
Für die ungarischen Gelehrten war der Vertrag von Trianon also keineswegs ein edler Frieden, der die Feindschaften beiseitelegte, sondern ein Diktatfrieden, den man nur deshalb unterzeichnete, weil keine andere Wahl bestand. Diese Haltung war sinnbildlich für Ungarn und die anderen Verliererstaaten. Bis heute bleibt der Vertrag von Trianon ein fortdauerndes Trauma für Ungarn, das immer wieder instrumentalisiert und in politischen Reden thematisiert wird.84 Die außenpolitische Isolation, der erneute Verstoß gegen das Selbstbestimmungsprinzip, gekoppelt mit nationalistischen Ideologien und einer Großmacht-Identität, schufen keine günstigen Voraussetzungen für ein friedliches Ungarn. Vielmehr boten sie ideale Bedingungen für weitere Konflikte, die Revisionspolitik Ungarns in Zusammenarbeit mit dem nationalsozialistischen Deutschland und letztlich den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Achsenmächte.
3.4 Vertrag von Neuilly-sur-Seine
Der Traum vom großbulgarischen Reich, genährt durch das Geheimabkommen zwischen Deutschland und Bulgarien, das Bulgarien im Falle eines Sieges Mazedonien sowie das Morava-Gebiet zusprach, und im Falle eines Kriegseintritts Rumäniens und Griechenlands auf Seiten der Entente die verlorenen Gebiete des Zweiten Balkankrieges85, endete am 27. November 1919 mit der Unterzeichnung des Friedensvertrags von Neuilly-sur-Seine. Im Vergleich zu den Gebietsverlusten der anderen Mittelmächte traf es Bulgarien territorial gesehen weniger hart, insbesondere da ein Großteil der bulgarischen Bevölkerung in den Gebieten verblieb, die auch nach dem Vertrag noch Teil des bulgarischen Staates waren.86 Diese relative Milde betraf jedoch ausschließlich die territorialen Veränderungen.
In einem anderen Kontext, nämlich in Bezug auf die menschlichen Verluste, war Bulgarien schwer betroffen. Mit 160.000 Toten und 400.000 Verwundeten bei einer Gesamtbevölkerung von nur fünf Millionen Menschen verzeichnete Bulgarien im Verhältnis die höchsten relativen Verluste aller Länder im Ersten Weltkrieg.87 Auch wenn Bulgarien ähnlich wie die anderen Mittelmächte nach dem Krieg Einschränkungen auferlegt bekam, so schienen diese zunächst nicht die Art von nationalistischem Aufruhr ausgelöst zu haben wie in anderen Verliererstaaten. Stattdessen wurde die Polarisierung der bulgarischen Gesellschaft durch die außervertraglichen Folgen des Krieges befeuert. Dazu zählten etwa die Zerstörung des Handels durch das Fehlen von Transportmitteln, der Zusammenbruch der Industrie aufgrund des Mangels an Rohstoffen sowie der Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion durch das Fehlen von Saatgut, was in eine Hungersnot mündete. Auch die Flüchtlingsströme aus den abgetretenen Gebieten sowie die Anwesenheit der Besatzungstruppen der Alliierten trugen zur gesellschaftlichen Polarisierung bei.88
Diese Polarisierung zeigte sich besonders deutlich im Konflikt zwischen Kommunisten und Konservativen, der in der Ermordung des Ministerpräsidenten Aleksandar Stamboliski durch konservative Kräfte im Jahr 1923 gipfelte. Diese Tat führte zur Machtübernahme durch die Konservativen, während ein anschließender, aber gescheiterter Septemberaufstand der Kommunisten und das Verbot der kommunistischen Partei die politische Landschaft weiter destabilisierten.89
Zar Boris III errichtete daraufhin eine autoritäre Diktatur in Bulgarien, doch wird in der historischen Forschung die andauernde politische Instabilität des Landes auf den sogenannten „Vorfall von Petrich“ und das allgemeine Migrationsproblem zwischen Griechen und Bulgaren zurückgeführt.90 Der im Vertrag von Neuilly-sur-Seine vereinbarte Minderheitenschutz erwies sich in diesem Konflikt als ineffektiv.91 Insgesamt waren es mehr als 190.000 Menschen, die zwischen Bulgarien, Griechenland und dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen hin- und herwanderten, um in das Land ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu gelangen.92
Im Gegensatz zu den anderen ehemaligen Mittelmächten verfolgte Bulgarien in Bezug auf territoriale Revisionen eine andere Strategie. Angesichts der Schwächung des Landes durch die vielen Kriege in kurzer Zeit – wobei die hohen Verluste des Ersten Weltkriegs den Höhepunkt bildeten – sowie der schwierigen wirtschaftlichen und industriellen Transformationsprozesse93, entschied sich Bulgarien, keine aggressiven, kriegsauslösenden Revisionshandlungen zu unternehmen. Stattdessen setzte das Land auf eine Politik der friedlichen Revision.94 Diese Strategie führte zwar nicht zur Revision der Grenzen, aber mit der Haager Schlussakte im Januar 1930 gelang es Bulgarien, die Reparationszahlungen um etwa 87 % von 2,25 Milliarden auf 171,6 Millionen Goldmark zu reduzieren.95
Trotz der typischen harten Bedingungen der Pariser Vorortverträge lässt sich keine direkte Kausalität zwischen dem Vertrag von Neuilly-sur-Seine und der Entwicklung hin zu einer Diktatur oder dem späteren Beitritt Bulgariens zu den Achsenmächten herstellen. Vielmehr könnte der Kriegseintritt Bulgariens auf Seiten der Achsenmächte auf den politischen und wirtschaftlichen Druck sowie die Hoffnung auf eine Revision der Grenzen in Thrakien und Makedonien zurückgeführt werden – Gebiete, die im Zweiten Balkankrieg verloren gingen und deren Verlust im Vertrag von Neuilly-sur-Seine lediglich bestätigt wurde.96 Wenn man die Argumentation weiter ausdehnt, könnte man die misslungene Annäherung Bulgariens an Griechenland und das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (insbesondere noch unter Stamboliski) sowie die generelle außenpolitische Isolation des Landes – mit Ausnahme des Völkerbundes – als Grundstein dafür betrachten, dass das Dritte Reich überhaupt erst in der Lage war, entsprechenden Druck auf Bulgarien auszuüben.97 Daher wäre es unangemessen, im Falle Bulgariens von einem vereinfachten Automatismus vom Friedensvertrag hin zum Zweiten Weltkrieg zu sprechen.
3.5 Verträge von Sévres und Lausanne
Um die Diskussion über den Vertrag von Sèvres vollständig zu verstehen, ist es notwendig, bereits frühere Entwicklungen und Abmachungen zu betrachten. Wie bereits eingangs erwähnt, argumentiert Leonhard, dass nicht die Friedensverträge selbst das eigentliche Problem darstellten, sondern vielmehr die zahlreichen Vereinbarungen über die Nachkriegsordnung, die bereits während des Krieges getroffen wurden und die sich letztlich als unvereinbar mit der Realität erwiesen.98 Diese These lässt sich im Falle des Osmanischen Reiches besonders gut überprüfen.
Im Jahr 1915 befand sich der Erste Weltkrieg für die Alliierten in einer schwierigen Phase. Die Briten suchten weltweit nach Verbündeten und fanden einen in den unterdrückten Arabern, die sich gegen die Herrschaft des Osmanischen Reiches auflehnten. Im sogenannten Protokoll von Damaskus forderten die Araber ein unabhängiges Königreich, das alle osmanischen Gebiete Vorderasiens südlich des 37. Breitengrades umfassen sollte.99 Sir Henry McMahon, der britische Hochkommissar in Ägypten, bestätigte im Oktober 1915 diese Forderungen, mit Ausnahme der Regionen Mersina und Alexandretta, in denen keine arabische Mehrheit lebte. Die Briten waren besorgt, dass die Araber sich ansonsten den Mittelmächten anschließen könnten, die bereits auf dem Vormarsch in Richtung Suez-Kanal waren.100
Diese Zugeständnisse der Briten sollten eingehalten werden, doch stattdessen führten sie parallel zu den Verhandlungen mit den Arabern, Gespräche mit Frankreich und Russland, die zum Sykes-Picot-Abkommen führten. Dieses Abkommen sah die Aufteilung der muslimischen Welt in kleinere Staaten vor, die unter britische und französische Kontrolle gestellt werden sollten. Als die Bolschewiki das Abkommen 1917 öffentlich machten und es in die britische Presse gelangte, beschädigte dies das Vertrauen der Araber in die Briten erheblich.101 Doch das Sykes-Picot-Abkommen war nicht der einzige Vorfall, der zu Spannungen führte. Auch die Balfour-Deklaration von 1917, in der Großbritannien den Zionisten in Palästina eine nationale Heimstätte versprach, stand im Widerspruch zu den Zusagen, die den Arabern gemacht worden waren.102
Die Folgen dieser widersprüchlichen Abmachungen sind bis heute spürbar. Die Enttäuschung der Araber über die westlichen Mächte sowie der daraus resultierende Hass, der sich nicht nur gegen die Briten und Franzosen, sondern aufgrund der Balfour-Deklaration auch gegen die jüdische Bevölkerung richtete, haben tiefe und anhaltende Auswirkungen auf die geopolitische Lage in der Region. Diese unvereinbaren Versprechen, die während des Krieges gemacht wurden, legten den Grundstein für viele der Konflikte, die das 20. Jahrhundert und darüber hinaus geprägt haben.103
Wie bei den anderen Verliererstaaten konnte auch das Osmanische Reich vergeblich auf die Anwendung des Selbstbestimmungsprinzips hoffen. Zahlreiche Völker und Staaten, allen voran Griechenland und Italien, erhoben umfangreiche Gebietsansprüche. Statistiken, die belegten, dass in vielen der geforderten Gebiete überwiegend Muslime lebten, wurden von George Lloyd mit der Begründung abgetan, dass in diesen Regionen einst eine christliche Mehrheit vorgeherrscht habe.104 Selbst wenn diese Behauptung zutraf, bleibt fraglich, ob dies tatsächlich als Grundlage für das Selbstbestimmungsprinzip herangezogen werden konnte. Schließlich würde sich die demografische Struktur eines Gebiets nicht kurzfristig ändern, auch wenn es einem christlich-europäischen Staat zugesprochen würde, der dort keine Bevölkerungsmehrheit stellt. Wenn man das Argument, dass eine Region irgendwann einmal zu einer bestimmten Volksgruppe oder Religion gehörte, als Grundlage für Gebietsansprüche verwendet, stellt sich unweigerlich die Frage, wie weit man diese Argumentation treiben kann, ohne in Absurditäten zu verfallen. Jede Region der Welt war im Laufe der Geschichte einmal unter einer anderen Herrschaft, eine andere Religion dominierte oder eine andere Volksgruppe lebte dort zumindest zeitweise. Eine Entscheidung, die auf einer solch fragwürdigen Argumentationsbasis getroffen wird, nur um ideologische Ansprüche zu rechtfertigen, kann nur als fatal bezeichnet werden.
Neben den ohnehin harten Friedensbedingungen empfand das Osmanische Reich die Anwesenheit nicht-osmanischer Truppen in Istanbul, erstmals seit 1453, als besonders demütigend. Zwar handelte es sich offiziell nicht um eine Besatzung, doch trug die Situation alle Merkmale einer solchen. Die Stadt wurde von den Alliierten in Distrikte aufgeteilt und eine eigene Militärverwaltung eingerichtet.105 Auf der einen Seite führte dies zu einem verletzten Selbstbestimmungsgefühl und einem wachsenden Ärger über die ständige Präsenz feindlicher Truppen. Auf der anderen Seite wurde jedoch der Aspekt erfüllt, den Macmillan ansprach: Ohne eine solche militärische Präsenz hätte die osmanische Bevölkerung sich möglicherweise nicht wirklich besiegt gefühlt, was zu einer noch geringeren Akzeptanz des Friedensvertrages von Sèvres geführt hätte.106
Die Kontrolle, die die Türken nach dem Ersten Weltkrieg wiedererlangen wollten, beschränkte sich nicht nur auf die territoriale Souveränität. Anders als bei den anderen Verliererstaaten des Krieges behielten sich die Alliierten auch das Recht vor, die Finanzen des Osmanischen Reiches zu überwachen.107 Dies wirft die grundlegende Frage auf, inwieweit überhaupt von einem souveränen Osmanischen Reich gesprochen werden kann. Ein weiterer Aspekt, der die Souveränität des Reiches in Frage stellt, ist die im Vertrag von Sèvres (als einziger der Pariser Friedensverträge) enthaltene Bestimmung, dass das Osmanische Reich keinerlei Militär108 unterhalten durfte.109 Damit wurde dem Osmanischen Reich de facto jede Möglichkeit zur Selbstverteidigung und zur Ausübung seiner Souveränität genommen.
Es stellt sich die berechtigte Frage, warum das Osmanische Reich im Vergleich zu den anderen Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs besonders hart getroffen wurde. Auch innerhalb der Siegermächte gab es Auseinandersetzungen über die genaue Ausgestaltung des Vertrags. So protestierte der italienische Premierminister Francesco Nitti, da er bereits aufgrund des Vertrags von Sèvres einen bevorstehenden Konflikt zwischen Türken und Griechen kommen sah. Die weitreichenden griechischen Ansprüche auf die Dardanellen, Gallipoli, verschiedene Mittelmeerinseln, Ionien, Thrakien und Smyrna (heute Izmir) erschienen ihm überzogen.110
Warum also sind die Alliierten beim Osmanischen Reich derart von den anderen Friedensverträgen abgewichen und gingen besonders streng gegen die Osmanen vor? Bereits beim Waffenstillstand von Mudros gab es, im Gegensatz zu den Waffenstillstandsverträgen der anderen Mittelmächte, keinerlei Bezug zu Wilsons 14 Punkten.111 Dies lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass das Osmanische Reich von den westlichen Mächten nicht als ebenbürtig angesehen wurde. Nicht nur die unterschiedliche Staatsreligion spielte eine Rolle, sondern das Reich galt generell als unterentwickelt und wurde nicht als gleichwertiger Rivale betrachtet.112 Diese Haltung der westlichen Mächte trug einen stark imperialistischen Beigeschmack, da sie es den Alliierten ermöglichte, das Osmanische Reich und seine Nachfolgestaaten wie Kolonien zu behandeln und ihre eigenen wirtschaftlichen und strategischen Interessen durchzusetzen.
Diese imperialistische Herangehensweise verstärkte das Feindbild der muslimischen Völker gegenüber den westlichen Mächten und schuf den Nährboden für den aufkommenden Nationalismus, der sich schließlich im Türkischen Befreiungskrieg manifestierte. Der Sieg von Mustafa Kemal Atatürk und die Geburt der modernen Türkei führten letztlich zu genau dem Gegenteil dessen, was die Alliierten beabsichtigt hatten. Sie verloren die direkte Kontrolle über das Land, und die blutigen Auseinandersetzungen, insbesondere zwischen Armeniern und Türken sowie Griechen und Türken, zeigten deutlich, dass das Ziel der Friedenskonferenz – einen stabilen Frieden zu schaffen – verfehlt wurde.
Mit dem Vertrag von Lausanne im Jahr 1923 wurde die Unabhängigkeit der Türkei vertraglich festgelegt, und dieser Vertrag kann als ein bedeutender Meilenstein der Nachkriegsdiplomatie betrachtet werden. Im Gegensatz zu den Pariser Vorortverträgen durften bei den Verhandlungen in Lausanne türkische Vertreter nach den Prinzipien der traditionellen Diplomatie am Verhandlungstisch Platz nehmen und an der Ausarbeitung eines Vertrages mitwirken, der für alle Beteiligten akzeptabel war.113 Diese Entwicklung zeigt, dass es einen weiteren blutigen Konflikt bedurfte, um die Alliierten erkennen zu lassen, dass Frieden nicht durch Diktat erzwungen werden kann, ohne dabei neue Konflikte zu provozieren, sondern dass er gemeinsam ausgearbeitet werden muss. Auf diese Weise konnten die Türken zumindest Teile des Vertrages von Sèvres revidieren.
Obwohl diese Arbeit den Vertrag von Lausanne als positiv bewertet, teilten nicht alle Zeitgenossen diese Einschätzung. Insbesondere in Großbritannien löste der Vertrag breite Enttäuschung aus, wie Tusan treffend herausgearbeitet hat. Die britische Öffentlichkeit war überwiegend der Meinung, dass der Vertrag von Lausanne die Opfer des Krieges nicht in dem Maße rechtfertigte, wie es hätte sein sollen, und dass er dadurch die ideologische Legitimation des Befreiungskrieges untergrub.114 Es stellt sich die Frage, ob diese Enttäuschung nicht sogar als Ausdruck von Bitterkeit gewertet werden kann. Denn das Osmanische Reich war gefallen, die Türkei als Nachfolgestaat war deutlich geschwächt, und die Alliierten hatten ihre Einflusszonen im Nahen Osten weiter ausgebaut. Was also hätte geschehen müssen, damit sich die Kriegsopfer aus Sicht der Briten „gelohnt“ hätten?
Im Zusammenspiel mit dem Sykes-Picot-Abkommen und der McMahon-Korrespondenz wird deutlich, dass die Briten nicht nur ihre Verbündeten hintergingen, sondern auch ihre imperialistischen Interessen über alles stellten, ohne Rücksicht auf langfristige Stabilität oder die Bedürfnisse der betroffenen Völker zu nehmen. Es lässt sich außerdem feststellen, und dies entspricht auch dem wissenschaftlichen Konsens, dass der Vertrag von Sèvres im Vergleich zu den anderen Friedensverträgen der mit Abstand härteste war und den stärksten Charakter der Unterwerfung aufwies.115 Noch heute werden die Abkommen von Sykes-Picot und Sèvres genutzt, um gegen die westlichen Staaten zu propagieren.116 Die Alliierten trugen ungewollt zur Entstehung eines umfassenden religiösen und anti-westlichen Narrativs bei, das mit nationalistischem Gedankengut gepaart ist und von der Heroisierung vergangener Kriege, wie dem Türkischen Befreiungskrieg, genährt wird. Die Doppelmoral der Alliierten, die sich in ihren Geheimabkommen, dem Hintergehen ihrer Verbündeten, der Missachtung des Selbstbestimmungsprinzips sowie der generell respektlosen Behandlung des Osmanischen Reiches und seiner Nachfolgestaaten zeigte, offenbart, dass es nie das Ziel des Krieges war, ein friedliches Konzept für diese Region zu entwickeln. Stattdessen standen die eigenen imperialistischen Interessen im Vordergrund, was letztlich zu einer tiefen und anhaltenden Instabilität in der Region führte.
4. Pulverfass Osteuropa
Das Ende des Ersten Weltkrieges hinterließ in Osteuropa eine Region voller Konflikte und Instabilität. Die einst dominierenden Mächte, das Deutsche Kaiserreich, das Habsburgerreich sowie das Russische Zarenreich, waren nur noch ein Schatten ihrer früheren Größe und Macht. In diesem Machtvakuum kämpften zahlreiche Völker um ihre Unabhängigkeit und versuchten, jahrhundertealte Ansprüche durchzusetzen. Länder wie Estland, Belarus, Litauen, Lettland, Polen, die Tschechoslowakei und die Ukraine traten erstmals auf der politischen Landkarte Europas in Erscheinung (siehe Abbildungen 1 und 2).
Die Entstehung dieser neuen Nationalstaaten ist jedoch nicht ausschließlich auf die Pariser Vorortverträge zurückzuführen, sondern auch auf eine Vielzahl weiterer, damit verbundener Faktoren. Um ein umfassendes Verständnis der Entwicklungen in Osteuropa nach dem Ersten Weltkrieg zu gewinnen, ist es daher unerlässlich, auch den Vertrag von Brest-Litowsk sowie dessen weitreichende Auswirkungen in die Analyse einzubeziehen.
Europa 1914
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Europa 1914, Quelle: Westermann, 2009, S. 92.
Europa 1920/21
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Europa 1920/21, Quelle: Westermann, 2017, S. 106.
4.1 Vertrag von Brest-Litowsk
Die Entstehung der Nationen Finnland, Estland, Litauen, Lettland, Belarus und der Ukraine ist in erster Linie nicht auf die Pariser Vorortverträge zurückzuführen, sondern geht wesentlich auf den Friedensvertrag von Brest-Litowsk zurück, den Deutschland 1918 mit den Bolschewiki schloss. Dieser Vertrag führte zu erheblichen territorialen und wirtschaftlichen Verlusten für Russland: Das Land verlor ein Drittel seiner Bevölkerung, 89 % seiner Kohlebergwerke und 73 % seiner Eisenindustrie.117 Durch diesen übermäßig harten Frieden, der stark von den Hegemoniebestrebungen Deutschlands getrieben war, erhielten die Mittelmächte die Möglichkeit, Truppen von der Ostfront abzuziehen, Kriegsgefangene zu befreien und diese erneut einzusetzen sowie gleichzeitig Zugriff auf große Teile der kriegswichtigen Industrie zu erlangen.
Dieser Frieden, der in jeder Hinsicht überzogen war, verdeutlicht eine erhebliche Doppelmoral seitens Deutschlands, das später den Versailler Vertrag als Unrechtsvertrag brandmarkte. Im Kontext des Vertrages von Brest-Litowsk erscheint diese Haltung als ein offensichtliches Beispiel für zweierlei Maß. Wie bereits erwähnt, war dieser Frieden den Alliierten sehr wohl bewusst, und es war unvermeidlich, dass sich einige Mitglieder der Alliierten die Frage stellten, warum man Deutschland milder behandeln sollte, als Deutschland selbst Russland behandelt hatte.118
Auf der anderen Seite hätten die Alliierten durchaus die Möglichkeit gehabt, Einfluss auf die Verhandlungen zu nehmen, indem sie Diplomaten zur Konferenz entsandten. Doch aus Protest gegen den Rückzug Russlands aus dem Ersten Weltkrieg und die Machtübernahme der Bolschewiki verzichteten sie auf diese Chance, wodurch sie Deutschland nichts entgegenzusetzen hatten.119 Dies führte nicht nur dazu, dass sie keinen Einfluss auf den Vertrag von Brest-Litowsk nehmen konnten, sondern auch zunächst keine Kontrolle über die neu entstandenen Staaten hatten, obwohl die Alliierten später Partisanen und Widerstandskämpfer unterstützten.
Der Frieden von Brest-Litowsk führte keineswegs zu einer Stabilisierung der Region. Vielmehr war die Region in den folgenden Jahren von anhaltenden Konflikten und Grenzstreitigkeiten geprägt, während nationalistische Ansichten innerhalb der verschiedenen Bevölkerungsgruppen neue Feindbilder schürten. Millionen von nicht abgegebenen Waffen zirkulierten weiterhin in der Region, während es den neu gebildeten Nationen zunächst an Polizei und Militär fehlte, um diese Situation zu kontrollieren.120
Darüber hinaus veränderte dieser Frieden die Bedeutung des noch andauernden Ersten Weltkrieges für die übrigen Staaten erheblich. Während Russland ursprünglich als Verbündeter Frankreichs und Englands galt, wandelte sich dies mit dem Aufstieg der Bolschewiki. Der Verteidigungskrieg der Alliierten wurde zunehmend zu einem Befreiungskrieg, der viele ethnische Gruppen einbezog, wobei der ursprüngliche Kriegsgrund in den Hintergrund trat.121
Ein weiterer bedeutender Aspekt war die Veröffentlichung der Geheimverträge durch die Bolschewiki, wie etwa des Sykes-Picot-Abkommens, was die Interessen der Alliierten stark beeinträchtigte.122 Diese Veröffentlichungen untergruben den Status der Alliierten als Befreier und machten deutlich, dass es im Krieg in erster Linie um ihre eigenen imperialistischen Interessen ging. Diese Offenlegung stand im Widerspruch zur von Präsident Wilson geforderten Ideologie, die den Eintritt der USA in den Krieg legitimierte. Es ist wahrscheinlich, dass gerade diese Geheimverträge der Grund dafür waren, dass die Abschaffung der Geheimdiplomatie den ersten Punkt in Wilsons 14-Punkte-Plan bildete.123
Es zeigt sich, wie weitreichend und komplex die Auswirkungen eines Friedensvertrags sein können und wie eng diese mit den späteren Entwicklungen in Europa verknüpft waren. Die daraus resultierenden territorialen Veränderungen und politischen Instabilitäten legten den Grundstein für viele der Konflikte, die Osteuropa in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg prägten.
4.2 Konflikte Osteuropas
Trotz des Friedens von Brest-Litowsk kehrte in Osteuropa keine Ruhe ein. Es dauerte bis 1922, bis Russland die vollständige Kontrolle über alle seine Gebiete wiedererlangte. Um ihre taktischen Vorteile nicht zu verlieren und in der Hoffnung, die Bolschewiki zu schwächen, besetzten 1918 japanische Truppen Wladiwostok, während britische Truppen die Häfen von Archangelsk und Murmansk unter Kontrolle brachten und Frankreich das ukrainische Odessa besetzte.124
Polen verfolgte ursprünglich das Ziel, Gebiete zurückzugewinnen, in denen überwiegend Polen lebten, und einen Zugang zum Meer zu erhalten. Dies wurde ihnen mehrheitlich auch zugestanden. Doch die polnischen Ambitionen gingen darüber hinaus: Sie strebten die Wiederherstellung der Grenzen von 1771 an. Dies führte zu einem großen Konflikt in Osteuropa, als Polen in Kampfhandlungen mit seinen Nachbarstaaten verwickelt wurde.125 Man könnte sagen, dass Polen, beflügelt von der eigenen Unabhängigkeit, von einem Machthunger ergriffen wurde. Frankreich, das als Verbündeter Polens agierte und gleichzeitig ein Interesse daran hatte, Deutschland möglichst geschwächt zu sehen, unterstützte diese Ambitionen. Für Frankreich bot sich in einem starken Polen eine Gelegenheit, die Bolschewiki weiter zu schwächen. Deshalb zeigte Frankreich wenig Interesse daran, den polnischen Expansionsbestrebungen Einhalt zu gebieten.
Durch diese Politik gelang es den Alliierten, in Mittel- und Osteuropa mehrere mittelstarke Mächte zu etablieren, die sich gegenseitig in Schach halten sollten. Die Idee war, dass diese Staaten aufgrund ihrer begrenzten Macht keine Hegemonie anstreben könnten, was eigentlich zur Vermeidung weiterer Konflikte beitragen sollte. Doch diese Strategie brachte nicht die erhoffte Stabilität, sondern führte zu weiteren Spannungen und Auseinandersetzungen in der Region.
Um die extreme Instabilität und das Chaos in Osteuropa nach dem Ersten Weltkrieg zu verdeutlichen, kann das Beispiel Kiew herangezogen werden, das zwischen 1917 und 1920 insgesamt 15 Mal den Herrschaftswechsel erlebte. Diese häufigen Machtwechsel unterstreichen die volatile politische Lage in der Region während dieser Zeit.126 Nach dem Zerfall des Habsburgerreiches im November 1918 entbrannte der erste große Konflikt in Osteuropa unmittelbar nach der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung. Ostgalizien, eine Region, die vom letzten österreichischen Statthalter zunächst der Ukraine zugesprochen wurde, geriet schnell in den Fokus militärischer Auseinandersetzungen. Ukrainische Milizen marschierten umgehend in das Gebiet ein, doch das Problem war die demografische Struktur: Während die ländlichen Gebiete überwiegend von Ukrainern bewohnt waren, waren die Städte, insbesondere Lemberg, von einer polnischen Bevölkerungsmehrheit geprägt. Nach mehreren blutigen Schlachten, insbesondere um Lemberg und Wolhynien, und zahlreichen Offensiven beider Seiten entschied der Hohe Rat der Pariser Friedenskonferenz im November 1919 zugunsten Polens. Ostgalizien sollte für 25 Jahre unter polnischer Kontrolle bleiben, bevor ein Referendum über die Zugehörigkeit der Region durchgeführt werden sollte.127
Diese Entscheidung wirft mehrere Fragen auf, insbesondere, warum das Referendum erst nach 25 Jahren abgehalten werden sollte. Ostgalizien war eine überwiegend von Ukrainern bewohnte Region. Ein alternatives Vorgehen, wie etwa die vorübergehende Verwaltung der Region durch den Völkerbund, wie es beispielsweise im Saarland der Fall war, hätte möglicherweise eine bessere Lösung dargestellt. Es ist fraglich, ob die Alliierten hofften, dass Polen in diesen 25 Jahren die demografische Mehrheit in der Region zugunsten der Polen verändern könnte. Diese Entscheidung steht jedenfalls in starkem Widerspruch zu dem Ideal der Selbstbestimmung, das eigentlich eines der Grundprinzipien der Pariser Vorortverträge war.
Parallel dazu führte die Ukrainische Volksrepublik gemeinsam mit den Truppen der Westukraine (das Polen zugesprochene Ostgalizien) einen Befreiungskrieg gegen Sowjetrussland. Angesichts der militärischen Überlegenheit der russischen Truppen sah sich die Ukrainische Volksrepublik gezwungen, den polnischen Anspruch auf die Westukraine anzuerkennen, um so die Unterstützung Polens im Kampf gegen Russland zu sichern. Infolgedessen besetzten polnische Truppen ukrainische Städte, um sie vor dem russischen Vormarsch zu schützen. Diese Vereinbarung führte jedoch zu internen Konflikten, da die westukrainischen Soldaten diesen Pakt nicht akzeptierten und sich stattdessen der Freiwilligenarmee Russlands anschlossen. Dies führte zu einer verstrickten Lage, in der Ukrainer gegen Ukrainer kämpften, alle mit dem Ziel, einen unabhängigen ukrainischen Staat zu errichten. Der Polnisch-Sowjetische Krieg nahm in diesem Kontext seinen Lauf. Nachdem Polen zunächst von Russland zurückgedrängt und teilweise besetzt wurde, gelang es den polnischen Truppen in der Schlacht von Warschau im August 1920, das Blatt zu wenden. Sie trieben die russischen Truppen bis zu 250 Kilometer hinter die Curzon-Linie128 zurück. Doch der Konflikt weitete sich weiter aus: Im Oktober 1920, nach dem Bruch des Vertrags von Suwalki, marschierte Polen in Litauen ein und okkupierte das Gebiet um Vilnius.129
Mit dem Frieden von Riga im Jahr 1921 fand der Polnisch-Sowjetische Krieg schließlich ein offizielles Ende, und die neuen Grenzen wurden entlang der damaligen Frontlinien zugunsten Polens gezogen.130 Diese Grenzziehung verstieß jedoch in vielen Fällen deutlich gegen das Prinzip der Selbstbestimmung, da in den betroffenen Gebieten häufig eine ukrainische Bevölkerungsmehrheit vorherrschte.131 Das Nichteinschreiten der Alliierten und des Völkerbunds, abgesehen von dem Vorschlag der Curzon-Linie durch den Hohen Rat der Pariser Friedenskonferenz, lässt sich darauf zurückführen, dass der Völkerbund, der maßgeblich von Frankreich und Großbritannien dominiert wurde, ein Interesse daran hatte, ein starkes Polen als Pufferstaat zu etablieren. Diese Entscheidung war strategisch motiviert, um im Falle zukünftiger Konflikte einen Schutzwall gegen Deutschland oder Russland zu haben haben. Zudem untermauert diese Entwicklung Ulrich Schlies These, dass die Schiedsgerichtsbarkeit und Konfliktverhütung im internationalen System der damaligen Zeit unzureichend ausgebildet waren. Die Tatsache, dass andere Mitgliedsstaaten des Völkerbundes nicht in der Lage oder willens waren, in den Grenzkonflikt einzugreifen, zeigt die Schwächen der internationalen Institutionen auf und verdeutlicht, dass die Mechanismen zur Konfliktbewältigung und Friedenssicherung nicht ausreichend entwickelt waren.
Insgesamt verhielten sich die Alliierten in den osteuropäischen Fragen nach dem Ersten Weltkrieg sehr zurückhaltend. Diese Zurückhaltung ermöglichte zunächst den Gedanken an ein Bündnis der Randstaaten, das Finnland, Polen und die baltischen Staaten umfassen sollte.132 Als dieses Projekt jedoch scheiterte, richtete Polen seinen Blick auf die historische Polnisch-Litauische Union, was zur Idee des Intermariums führte. Ziel war es, eine Konföderation aus Polen, der Ukraine, Belarus und Litauen zu schaffen, die sich sowohl gegen die Sowjetunion als auch gegen Deutschland verteidigen könnte.133 Trotz dieser ambitionierten Pläne scheiterte das Intermarium an gegenseitigem Misstrauen, das unter anderem durch die polnischen Expansionsbestrebungen und die zahlreichen Grenzstreitigkeiten verstärkt wurde. Infolgedessen blieb Osteuropa weiterhin eine Region kleiner und mittelgroßer Staaten, die dem heraufziehenden Zweiten Weltkrieg nicht standhalten konnten. Die Zeit reichte nicht aus, um das notwendige Vertrauen zwischen den osteuropäischen Staaten aufzubauen, und die Unterstützung der Alliierten kam zu spät, um die revisionistischen Bestrebungen Deutschlands noch rechtzeitig einzudämmen.
Ein weiterer Faktor, der das Scheitern des Intermariums begünstigte, war die Angst der neu entstandenen Staaten, nach gerade erst gewonnener Unabhängigkeit wieder in einen neuen Vielvölkerstaat integriert zu werden, in dem ihre spezifischen Interessen möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt würden. Die Friedensverträge des Ersten Weltkrieges hinterließen viele instabile und sich selbst findende Staaten, die sich gegenseitig so sehr schwächten, dass Deutschland während dieser Zeit wieder erstarken konnte, was die Invasion im Zweiten Weltkrieg erleichterte. Im Gegensatz dazu konnte die 1922 gegründete Sowjetunion, bestehend aus Russland als dominierender Macht sowie Belarus, der Ukraine, Armenien, Georgien und Aserbaidschan, eine neue regionale Hegemonie aufbauen.134
Die Kämpfe um Städte wie Lemberg oder Vilnius135 verdeutlichen darüber hinaus, dass in der Realität das Prinzip der reinen Selbstbestimmung nicht immer umsetzbar ist, insbesondere in multiethnischen Gebieten, in denen keine Volksgruppe die absolute Mehrheit stellt. Die vielen neu entstandenen Nationalstaaten erhoben diverse Ansprüche, die sie historisch, kulturell oder ethnisch begründeten. Die Alliierten hatten zwar die dominierenden Großreiche in der Region zerschlagen und vielen Volksgruppen Autonomie zugesprochen, doch letztlich ließen sie diese mit den daraus resultierenden Problemen in Osteuropa weitgehend allein. Der Polnisch-Sowjetische Krieg ist ein prägnantes Beispiel dafür, wie Idealismus und Realpolitik oft in Konflikt geraten und wie der Völkerbund nicht in der Lage war, wirksam zu intervenieren. Letztlich verrieten die Alliierten durch ihr passives Verhalten und die nicht ausreichende Unterstützung der betroffenen Staaten ihre eigenen Ideale und schufen so eine fragile Ordnung, die dem Druck der kommenden Jahre nicht standhalten konnte.
5. Seitenwechsel
Im Ersten Weltkrieg schlossen sich Italien und Japan den Alliierten an, motiviert durch ihre eigenen expansionistischen Ziele. Diese beiden Länder, die ursprünglich auf der Seite der Siegermächte standen, wechselten im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs die Seiten und bildeten gemeinsam mit Deutschland den Dreimächtepakt, der das Bündnis der Achsenmächte begründete. Dieser dramatische Seitenwechsel wirft die Frage auf, welche Faktoren und Unzufriedenheiten in den Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg dazu führten, dass Italien und Japan sich von den Alliierten abwandten und eine Allianz mit Deutschland eingingen.
Im Folgenden soll eine Analyse dieser Entwicklung erfolgen, wobei besonderes Augenmerk auf die Diskrepanzen in den Friedensverhandlungen gelegt wird, die zur Entfremdung dieser beiden Staaten von den westlichen Mächten beitrugen und letztlich zur Bildung des Achsenbündnisses führten.
5.1 Italien
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs war es keineswegs selbstverständlich, dass Italien auf Seiten der Alliierten kämpfen würde. Italien war ursprünglich durch ein Verteidigungsbündnis mit dem Habsburger Reich und dem Deutschen Reich verbunden. Das Land sah sich jedoch von seiner Bündnispflicht befreit, da Österreich-Ungarn durch seinen Einmarsch in Serbien als Aggressor galt. Darüber hinaus sah das Dreibund-Bündnis vor, dass im Falle einer Gebietsvergrößerung eines Vertragspartners den anderen Partnern eine entsprechende Kompensation zustehe. Italien hatte jedoch für die Habsburger Annexionen auf der Balkanhalbinsel keine solche Kompensation erhalten, was die Beziehungen zwischen Italien und den anderen Bündnispartnern bereits vor Kriegsausbruch erheblich belastete.136
Die Situation änderte sich entscheidend mit dem Londoner Vertrag vom 26. April 1915. In diesem Abkommen verpflichtete sich Italien, innerhalb eines Monats die Mobilmachung seiner Streitkräfte durchzuführen und auf Seiten der Entente in den Krieg einzutreten. Im Gegenzug wurden Italien weitreichende territoriale Zugeständnisse zugesichert: Südtirol, Triest, Trentino, Görz, Gradisca, die gesamte istrianische Halbinsel bis zum Golf von Quarnaro einschließlich der Inseln Cres und Losinj, die dalmatinischen Inseln sowie die Städte Zadar, Sibenik, Trogir, Vlora und die Insel Sazan. Zudem wurde Italien die Hoheitsgewalt über den Dodekanes, Einflussgebiete in Vorderasien, Grenzkorrekturen in seinen afrikanischen Kolonien, Anteile an deutschen Kolonien (insbesondere Äthiopien in einem gesonderten Vertrag) sowie bestimmte Rohstofflieferungen zugesagt. Diese weitreichenden Zusagen brachten die Entente in eine schwierige Lage.137 Der Vertrag wurde in einer Zeit extremer Unsicherheit abgeschlossen, als der Ausgang des Krieges keineswegs klar war. Im Gegenteil, die moderne Forschung tendiert eher dazu, dass die Niederlage der Mittelmächte zu Beginn des Krieges unwahrscheinlich schien und ein Patt als mögliches Szenario galt.138 In dieser verzweifelten Situation nutzte Italien seine Verhandlungsposition geschickt aus, um hohe Forderungen zu stellen und umfangreiche Zugeständnisse zu erzielen.
Der Londoner Vertrag von 1915 führte zu unüberwindbaren Problemen bei der Neugestaltung Europas nach dem Ersten Weltkrieg. Viele der Gebiete, die Italien im Rahmen dieses Abkommens zugesprochen wurden, waren überwiegend von slawischen Bevölkerungsgruppen bewohnt.139 Eine einfache Übertragung dieser Gebiete an Italien hätte gegen das Selbstbestimmungsprinzip verstoßen. Dies stellte die Alliierten vor ein grundlegendes Dilemma: Sollte das Prinzip der nationalen Selbstbestimmung, das eng mit der Ideologie der Befreiung verknüpft war, höher gewichtet werden, oder sollte man sich an die vertraglichen Vereinbarungen halten, um die eigene Glaubwürdigkeit zu wahren?
Dieses Dilemma war von enormer Tragweite, da jede Entscheidung potenziell schwerwiegende Probleme nach sich ziehen konnte. Für die anderen Siegermächte war es jedoch von entscheidender Bedeutung, ein starkes Jugoslawien zu schaffen, das als Puffer zwischen Italien und Russland dienen sollte.140 Diese Strategie ähnelt der, die auch gegenüber Polen verfolgt wurde: Ziel war es, ein multipolares Europa zu schaffen, in dem kein Staat es sich leisten könnte, einen Krieg gegen einen seiner Nachbarn zu führen, ohne erhebliche Verluste zu riskieren. Diese geopolitische Absicht wurde unter dem Deckmantel des Selbstbestimmungsprinzips verborgen. Letztlich erwies sich diese Strategie jedoch als wenig erfolgreich. Der Vertrag von Rapallo, der ursprünglich zwischen Italien und Jugoslawien geschlossen wurde, wurde 1924 durch den Vertrag von Rom revidiert, was kurze Zeit später zur Besetzung des Freistaats Fiume durch italienische Truppen führte.141
Der erste deutliche Ausdruck des italienischen Unmuts trat bereits 1919 zutage. Italien fühlte sich von seinen Verbündeten Frankreich und Großbritannien hintergangen, da seine territorialen Ansprüche im Mittelmeerraum zugunsten Griechenlands verzögert wurden. Diese Situation führte zu erheblichen Spannungen, da italienische Nationalisten die Frage aufwarfen, warum Griechenland, das ohne territoriale Forderungen in den Krieg eingetreten war, sein Territorium verdoppeln durfte, während Italien auf einige der ihm zugesagten Gebiete verzichten sollte.142 Diese Krise eskalierte im März 1919, als Italien Marmaris und Antalya besetzte, offiziell unter dem Vorwand, dort für Ordnung zu sorgen. Im Streit um Fiume und Smyrna entsandte Italien Kriegsschiffe, woraufhin Griechenland – unterstützt von Großbritannien und Frankreich – ebenfalls Truppen nach Smyrna verlegte, um seine Ansprüche deutlich zu machen und Italien von der Besetzung abzuhalten. In diesem Zuge besetzte Griechenland jedoch auch weitere Gebiete, was den Unmut der dort lebenden Bevölkerung verstärkte.143
Immerhin konnten in den Streitfragen über Zypern und Rhodos Kompromisse gefunden werden.144 Doch diese Konflikte offenbaren, wie die divergierenden Ansprüche und territorialen Zusagen innerhalb der Alliierten zu Spannungen führten, die die Ausarbeitung akzeptabler Nachkriegsbedingungen erschwerten und weitere Konflikte begünstigten. Diese Ereignisse können auch als Verstärkung der griechisch-italienischen Rivalität verstanden werden, die letztlich in der italienischen Invasion Griechenlands im Jahr 1940 gipfelte.
Trotz dieser Spannungen konnte Italien sein Territorium erheblich ausweiten, indem es Gebiete wie Südtirol, Trentino, Triest, Julisch Venetien, Istrien und Teile Dalmatiens erwarb.145 Dies wirft die Frage auf, ob die italienischen Nationalisten übermäßig gierig waren, ob die Entente einen Fehler beging, indem sie Italien zu viel zusprach, oder ob nicht eine Mischung aus beidem vorlag. Hirschfelder kommt zu dem Schluss, dass diese erheblichen Gebietsgewinne, auch wenn sie nicht alle italienischen Ansprüche erfüllten, nationalistische und großmachtpolitische Vorstellungen weiter anheizten. Gleichzeitig wuchs der Unmut darüber, dass Italien keinen Anteil an den deutschen Kolonien erhielt.146 Dieser Prozess ähnelt einem Teufelskreis: Je mehr Gebiete Italien zugesprochen wurden, desto mehr Hoffnungen hegten die Nationalisten auf weitere Eroberungen und eine regionale Hegemonie Italiens. Je weniger Gebiete Italien jedoch erhielt, desto größer war das Gefühl des Verrats gegenüber Frankreich und Großbritannien, insbesondere in Bezug auf die Vereinbarungen des Londoner Vertrages.
Aus italienischer Perspektive musste die Übergabe der im Londoner Vertrag von 1915 versprochenen Gebiete an Italien zwingend erfolgen, denn die Entscheidung, sich auf die Seite der Alliierten zu stellen, bedeutete einen Verrat an den ursprünglichen Verbündeten, den Mittelmächten. In Italien gab es auch Stimmen, die für einen Kriegseintritt an der Seite der Mittelmächte plädierten, wie etwa Außenminister Sidney Sonnino, der zu Kriegsbeginn Sympathien für die Mittelmächte hegte.147 Für Sonnino war die Nichterfüllung des Londoner Vertrags daher ein besonders schwerer Schlag.
Italien kann heute als Beispiel dafür angesehen werden, wie ein liberales politisches System ins Wanken geraten kann.148 Dies ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass das Land trotz der großen wirtschaftlichen Not und der Verluste von 600.000 Soldaten bedeutende Erfolge verzeichnen konnte: Es hatte Trient und Triest befreit, war bis an den Brenner und nach Dalmatien vorgedrungen, und das Habsburgerreich, das als Erbfeind galt, existierte nicht mehr. Zudem wurde Italien auf der Friedenskonferenz als eine der vier großen Siegermächte anerkannt.
Diese Umstände führen zu der Schlussfolgerung, dass nicht nur die Verliererstaaten, die durch die Pariser Vorortverträge geschwächt wurden, anfällig für den Zusammenbruch der Demokratie waren. Auch in einem Land, das als Siegermacht aus dem Krieg hervorging, konnten Unzufriedenheit und enttäuschte Erwartungen zu politischer Instabilität und dem Niedergang des demokratischen Systems führen. Daher ist es zu einfach, eine direkte Kausalität zwischen den Friedensverträgen und dem Fall der Demokratie herzustellen; vielmehr müssen auch andere Faktoren berücksichtigt werden, die selbst Siegermächte betreffen können.
Im Falle Italiens trug der Londoner Vertrag und insbesondere seine Nichterfüllung maßgeblich zum Zusammenbruch der Demokratie bei. Die italienische Regierung bestand auf der vollständigen Umsetzung des Vertrags, was in der Bevölkerung große Hoffnungen weckte. Als diese Erwartungen jedoch enttäuscht wurden, führte dies zu einer erheblichen Destabilisierung des Landes.149 Italien verfolgte einen „Alles-oder-Nichts“-Kurs, der selbst dann zu Konflikten geführt hätte, wenn alle beanspruchten Gebiete an das Land übergeben worden wären. Dennoch kann dies nicht als der einzige Faktor betrachtet werden.
Nach dem Ersten Weltkrieg befand sich Italien in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Die finanziellen Mittel für dringend benötigte Sozialpolitiken fehlten, und die Lage wurde durch Massenentlassungen in der Industrie verschärft, die aufgrund des Rückgangs von Rüstungsaufträgen erfolgten. Allein zwischen Dezember 1920 und Januar 1922 stieg die Zahl der Arbeitslosen von etwa 100.000 auf über 500.000.150 Die enttäuschten Hoffnungen, der Unmut über den scheinbaren Verrat durch die eigenen Verbündeten und die schwierige wirtschaftliche Situation schufen ein Umfeld, das die Radikalisierung des italienischen politischen Systems und den Aufstieg Mussolinis begünstigte. Besonders bemerkenswert war dabei seine Unterstützung durch nationalistische Militärs. Wenn Woller den aktuellen Forschungsstand zusammenfasst und folgende Faktoren für den Aufstieg Mussolinis nennt:
1. Jugend- und Erneuerungsbewegung,
2. Aufstiegs- und Emanzipationsbewegung des Mittelstandes im Zuge der Industrialisierung,
3. Nationale Befreiungsbewegung, die Abhängigkeiten von anderen Ländern verringern wollte, und
4. Faschismus als Ausdruck des letzten Aufbäumens des christlichen Abendlandes und der „weißen Rasse“,151
So bleibt leider unbeachtet, warum diese Aspekte überhaupt eine solche Bedeutung erlangen konnten. Dadurch erscheint die Kausalkette unvollständig. Diese vorliegende Analyse zeigt jedoch, dass die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen nach dem Ersten Weltkrieg eine entscheidende Rolle spielten und Leonhards These bestätigen, dass die Konflikte bereits durch die Abkommen, die während des Krieges geschlossen wurden, begünstigt wurden.
5.2 Japan
Im Vergleich zu den vier anderen Hauptsiegermächten war Japans Beitrag zum Ersten Weltkrieg verhältnismäßig gering. Japans Kriegseintritt auf Seiten der Entente war vor allem durch das Streben nach der Sicherung der deutschen Kolonien in Asien motiviert. Doch trotz seiner Zugehörigkeit zu den Siegermächten musste Japan eine Reihe systematischer Diskriminierungen durch seine eigenen Verbündeten ertragen.
Obwohl Japan zu den fünf Hauptsiegermächten zählte und in den Plenarsitzungen der Friedenskonferenz volles Stimmrecht hatte, wurde es aus dem Rat der Vier ausgeschlossen, der die wichtigsten Entscheidungen traf. Diese Ausgrenzung Japans als einzige Hauptsiegermacht trotz seiner Proteste152 lässt sich im gesellschaftlichen Kontext der westlichen Staaten nur als Ausdruck von Rassismus verstehen. In den westlichen Gesellschaften war das Bild des Asiaten oft durch abwertende Stereotype wie den "gelben Affen" geprägt.153 Darüber hinaus wurde grundsätzlich infrage gestellt, ob Japan den westlichen Mächten gleichgestellt sein sollte. Präsident Woodrow Wilson weigerte sich, Japans Kolonialansprüche anzuerkennen, und stellte die Frage, ob Japan überhaupt als Mandatsmacht zugelassen werden könne.154 Diese Herabsetzung und Benachteiligung Japans führte zu einem tiefen Gefühl der Enttäuschung und des Verrats, ähnlich wie es auch Italien empfand. Für Japan, das sich als stolze und aufstrebende Nation sah, bedeutete diese Diskriminierung eine schwerwiegende Verletzung des nationalen Ehrgefühls. Japans Rolle und Beitrag im Ersten Weltkrieg wurden nicht angemessen gewürdigt, was die Grundlage für seinen Bruch mit den westlichen Mächten legte.
Als Japans zweiter großer Wunsch, die Gleichberechtigung aller Rassen, nicht in die Satzung des Völkerbundes aufgenommen wurde, löste dies in der gesamten japanischen Bevölkerung großes Entsetzen aus.155 Pantzer argumentiert, dass den westlichen Mächten mehr an wirtschaftlichen Absatzmärkten lag als an kultureller Anerkennung oder Gleichberechtigung.156 Diese Einschätzung greift jedoch zu kurz, da es nicht nur um eine Bevorzugung ökonomischer Interessen ging, sondern vielmehr um eine grundlegende Ignoranz der westlichen Mächte gegenüber den Anliegen eines ihrer Verbündeten sowie um die Missachtung ihrer eigenen Ideale. Um den japanischen Unmut zu besänftigen, versuchten die Alliierten, Japan mit der Washingtoner Konferenz wieder auf eine Stufe mit den anderen Hauptsiegermächten zu stellen. Im Rahmen des Washingtoner Flottenabkommens157 wurde eine gemeinsame Rüstungsbegrenzung beschlossen, wodurch Japan als militärisch bedeutende Macht anerkannt wurde.158 Erfolgreich war diese Strategie jedoch nicht, denn es signalisiert lediglich, dass Japan als militärisch so stark wahrgenommen wird, dass es eine Bedrohung für die anderen Siegermächte darstellt, was den japanischen Nationalismus stärkt, während es zugleich die Frage wieder aufbringt, warum man als Rasse nicht gleichberechtigt sei.
Der nachfolgende japanische Kolonialismus und Imperialismus war Ausdruck eines tief verwurzelten Unsicherheitsgefühls, das aus dem westlichen Rassismus und der Fremdherrschaft in weiten Teilen Asiens resultierte.159 Diese Expansion Japans war eine Gegenbewegung gegen die westlichen Mächte, die dem Land zeigen sollte, dass es nicht zu unterschätzen sei. Dennoch müssen die 21 Forderungen, die Japan während des Ersten Weltkriegs an China übermittelte, kritisch betrachtet werden. Diese Forderungen hätten Japan umfangreiche Gebiete in China zugesprochen und die Möglichkeit eröffnet, China in ein Protektorat zu verwandeln.160 Das Ultimatum und die damit erzwungene Annahme der Forderungen durch China verschafften Japan territoriale Ansprüche. Als China in den frühen 1930er Jahren begann, westliche Hilfe beim Wiederaufbau des Landes anzunehmen, sah Japan darin eine Verschwörung gegen seine Interessen. Diese Annahme, zusammen mit den Gebietsansprüchen aus den 21 Forderungen, diente Japan als Rechtfertigung für die Besetzung der Mandschurei im Jahr 1931 und den Beginn des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges.161
Während die Ungleichbehandlung Japans durch die westlichen Mächte scharf kritisiert werden muss, ist auch das imperialistische Vorgehen Japans selbst stark zu verurteilen. Trotz dieser Kritikpunkte konnte Japan mit den ihm zugesprochenen Gebieten zufrieden sein. Besonders hervorzuheben ist die Übertragung der ursprünglich von Deutschland besetzten chinesischen Provinz Shandong an Japan, was in China erheblichen Unmut auslöste.162
Angesichts dieser Ereignisse erscheint eine Annäherung Japans an Deutschland als eine logische Konsequenz. Japan fühlte sich nicht nur von seinen Verbündeten im Westen verraten und abgewertet, sondern es teilte mit Deutschland auch das Gefühl der Demütigung und das Feindbild, das sich nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt hatte. Darüber hinaus sah Japan in Deutschland, insbesondere im preußischen Staat, ein historisches und politisches Vorbild.163 Preußen, ursprünglich ein agrarisch geprägtes Land, das sich immer wieder gegen größere Mächte zur Wehr setzte, sich industrialisierte und schließlich zu einer Großmacht aufstieg, verkörperte genau das, was Japan anstrebte.
6. Fazit
Aus heutiger historischer Perspektive mag es verlockend erscheinen, über die Entscheidungen und Handlungen der damaligen Akteure zu urteilen. Wir verfügen über den Vorteil von 100 Jahren retrospektiver Analyse und können die Ereignisse mit der Distanz und dem Wissen unserer Zeit betrachten. Doch sollte dabei berücksichtigt werden, dass die Entscheidungsträger von damals unter völlig anderen Bedingungen agierten. Sie hatten nicht den Luxus der Zeit für langjährige Studien, waren selbst emotional stark involviert und agierten in einem Zeitgeist, der sich deutlich von unserem heutigen unterscheidet. Zudem könnten den Akteuren damals Informationen und Daten zur Verfügung gestanden haben, die uns heute entweder nicht mehr zugänglich sind oder die wir nicht in gleichem Maße berücksichtigen. Dies könnte ihre Entscheidungen in einem anderen Licht erscheinen lassen. Es wäre daher anmaßend, aus unserer heutigen Perspektive einen ultimativen Anspruch auf die normative Wahrheit zu erheben und rückblickend zu verurteilen, was damals hätte anders laufen sollen. Unsere Aufgabe als Historiker besteht vielmehr darin, die erkannten Fehler zu analysieren, daraus Lehren zu ziehen und diese Erkenntnisse auf die heutige Zeit anzuwenden, um ähnliche Fehler in der Zukunft zu vermeiden.
Die vorliegende Arbeit zeigt deutlich, dass die Hauptsiegermächte nach dem Ersten Weltkrieg oft versuchten, die neuen Staaten und Verlierermächte gegeneinander auszuspielen.164 Gleichzeitig waren sie selbst in zentralen Interessen, Vorstellungen und Forderungen uneinig. Diese Uneinigkeit lässt sich zwar als Versuch der Kompromissfindung interpretieren, führte jedoch dazu, dass letztlich kaum ein Land mit seiner Position wirklich zufrieden war. Länder ratifizierten die Verträge nicht oder traten wichtigen Institutionen nicht bei, wie etwa China und die USA den Versailler Vertrag nicht ratifizierten oder die USA dem Völkerbund fernblieben.
Die extreme Doppelmoral, insbesondere Großbritanniens, und der ständige Widerspruch zwischen imperialistischen Interessen und Wilsons Ideologie der demokratischen Befreiung führten zu einer zerstrittenen internationalen Staatengemeinschaft. Diese Gemeinschaft trug zwar revolutionäre Ideen wie die Minderheitenschutzgesetze und den Völkerbund in sich, konnte jedoch weder deren Potenzial vollständig ausschöpfen noch auf dringende Probleme in angemessener Zeit reagieren. Besonders das inkonsequent angewendete Selbstbestimmungsprinzip sorgte in weiten Teilen der Welt für erheblichen Unmut. Die Minderheitenschutzverträge können als ein Versuch der Versöhnung betrachtet werden, um jene Völker, die nicht von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch machen konnten, zu beruhigen, ihre Rechte zu sichern und damit präventiv Konflikten entgegenzuwirken.165 Dennoch blieb stets die Frage offen, nach welchen Kriterien die Selbstbestimmung gewährt wurde, und die Verträge konnten die betroffenen Staaten letztlich nicht ausreichend zufriedenstellen. Dieses zweierlei Maß könnte als der entscheidende Faktor betrachtet werden, der die Ideen der Pariser Friedenskonferenz scheitern ließ.
Es wäre jedoch zu kurz gegriffen zu behaupten, dass die Pariser Vorortverträge direkt zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs führten. Sie schufen jedoch den Nährboden für Radikalisierung und boten nationalistischen Kräften eine Grundlage zur Instrumentalisierung. Leonhards These, dass bereits die während des Ersten Weltkriegs geschlossenen Geheimabkommen ein friedliches Europa verhinderten, wurde in dieser Arbeit bestätigt, insbesondere durch die Analyse des Londoner Vertrags und des Sykes-Picot-Abkommens. Auch Ulrich Schlies These, dass die Friedensverträge nicht mit den idealistischen Werten der Zeit übereinstimmten und somit Konflikte begünstigten, sowie der Aspekt, dass das internationale System zur Konfliktverhütung unzureichend war, konnte bestätigt werden. Neibergs Argument, dass die Destabilisierung der Länder und die Marginalisierung eigener Verbündeter wie Japan und Italien zu weiteren Spannungen führten, wurde ebenfalls durch die vorliegende Analyse untermauert. Möllers Argument, dass eine Vielzahl unvorhersehbarer Zufälle den Verlauf der Geschichte beeinflusste, möchte ich jedoch nach dieser eingehenden Untersuchung zurückweisen. Zwar mögen solche Zufälle geschehen sein, doch viele Konflikte wurden durch die Verträge, Geheimabkommen und die Diskrepanz zwischen ideologischen Ansprüchen und imperialistischen Zielen zusätzlich begünstigt. Auch Goldsteins These, dass ein experimenteller Zustand des internationalen Systems herrschte, sollte hinterfragt werden, da dieser Zustand nicht einfach entstand, sondern gezielt geschaffen wurde – und dabei wurden die oben genannten Fehler begangen.
Um abschließend den Historiker Hellmuth Rößler zu zitieren: "Kein Staat kann ohne schwerste Gefährdung sein Handeln in Widerspruch setzen zu dem Prinzip, nach dem er angetreten ist."166 Diese Aussage führt zwangsläufig zu der Frage, wie ein dauerhafter Frieden ohne Rachegelüste überhaupt möglich sein kann, denn die Pariser Vorortverträge haben dies nicht erreicht. Man könnte versucht sein, dies ausschließlich darauf zurückzuführen, dass die Verträge in sich nicht schlüssig waren und im Widerspruch zur Ideologie der Sieger standen. Doch diese Erklärung greift zu kurz. Das grundlegende Problem liegt darin, dass nach fast jedem Krieg entsprechende Revanchegedanken aufkommen – eine Reaktion, die zutiefst menschlich ist. Niemand möchte eine Niederlage einfach akzeptieren, und wenn die Friedensbedingungen als ungerecht empfunden werden, wachsen die revisionistischen Bestrebungen. Wenn die Möglichkeit zur Revision besteht, warum sollte man dann nicht auch versuchen, sich selbst zu entschädigen und dem Gegner eine Kostprobe seiner eigenen Medizin zu verabreichen? So wird als Wiedergutmachung noch eine Schippe draufgelegt, und eine lange Spirale von Gewalt und Hass beginnt. Menschen machen Fehler, und Staaten, die von Menschen geführt werden, sind davon nicht ausgenommen. Nur weil ein Staat grauenhafte Dinge vollbringt, bedeutet das nicht, dass alle seine Bürger dies unterstützen. Es erfordert Mut, über den eigenen Schatten zu springen und manchmal etwas zu tun, das zunächst emotional nicht richtig erscheint.
Ein passendes Beispiel dafür liefert Erich Eyck, der die Geschichte von Herennius nutzt, um die Diskrepanz zwischen einer emotionalen und einer rationalen Friedensschließung aufzuzeigen.167 Als die Samniten im Jahr 321 v. Chr. ein römisches Heer besiegten, fragte der Anführer seinen Vater Herennius, was er mit den Gefangenen tun solle. Herennius riet ihm, alle freizulassen. Diese Antwort erschien dem Anführer unlogisch, woraufhin Herennius vorschlug, alle Gefangenen zu töten. Auch dies schien dem Anführer zu extrem, und er fragte, ob es keinen Mittelweg gebe. Doch Herennius entgegnete, dass der Mittelweg weder die Römer zu Freunden machen würde noch die Samniten von ihren Feinden befreite.
Diese Geschichte soll uns daran erinnern, dass Friedensmacher manchmal bereit sein müssen, von ihren eigenen Ansprüchen abzurücken, um zukünftige Konflikte nicht zu provozieren. In einer globalisierten Welt sollten wir uns von der Maxime "Auge um Auge, Zahn um Zahn" verabschieden. Auch wenn dies unserer Natur zu widersprechen scheint, ist es doch eine Anstrengung wert, dafür einzutreten.
7. Quellen- und Literaturverzeichnis
Primärquellen
Graf Brockdorf-Rantzau, Ulrich, Presseerklärung zum Amtsantritt als Staatssekretär des Auswärtigen Amtes vom 24 Dezember 1918, in: Schwabe, Klaus, Quellen zum Friedensschluss von Versailles, Darmstadt 1997.
Scheidemann, Philip, Rede zum Vertrag von Versailles, in: Die Weimarer Republik – Deutschlands erste Demokratie, zuletzt abgerufen unter https://www.weimarer-republik.net/jubilaeum/revolution-und-gruendung-der-republik-tag-fuer-tag/mai-1919/scheidemann-welche-hand-muesste-nicht-verdorren-die-sich-und-uns-in-diese-fesseln-legt/ am 19. August 2024.
Ungarischer Juristenverein, Der Friedensvertrag von Trianon: Vom Standpunkte des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit, Budapest 1931.
Vertrag von Neuilly-sur-Seine, zuletzt abgerufen unter https://www.versailler-vertrag.de/neuilly/ am 12. August 2024.
Vertrag von Saint-Germain, in: Staatsarchiv Österreich, Signatur AT-OeStA/HHStA GKA GesA Kopenhagen 210-2.
Vertrag von Sévres, zuletzt abgerufen unter https://www.versailler-vertrag.de/sevres/index.htm am 13. August 2024.
Vertrag von Trianon, zuletzt abgerufen unter https://www.versailler-vertrag.de/trianon/index.htm am 12. August 2024.
Vertrag von Versailles, in: Politisches Archiv des Auswärtiges Amtes, Signatur PA AA, MULT R, 282-258.
Von Ribbentrop, Joachim, in: Deutsche Informationsstelle (Hg.), 100 Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges: Auswahl aus dem amtlichen deutschen Weissbuch, Berlin 1939.
Literatur
Barraclough, Geoffrey, Das Britische Reich und der Frieden, in: Rössler, Hellmuth (Hg.), Ideologie und Machtpolitik 1919: Plan und Werk der Pariser Friedenskonferenzen 1919, Göttingen 1966.
Birke, Ernst, Rußland, seine Westgebiete, der Kommunismus und Versailles, in: Rössler, Hellmuth (Hg.), Ideologie und Machtpolitik 1919: Plan und Werk der Pariser Friedenskonferenzen 1919, Göttingen 1966.
Braun, Brigitte, “Brennende Grenzen”: Revisionspropaganda im deutschen Kino der 1920er Jahre am Beispiel Oberschlesiens, in: Störtkuhl, Beate (Hg.), Aufbruch und Krise: das östliche Europa und die Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg, München 2010.
Clark, Christopher, Die Schlafwandler, München 2013.
Conze, Eckart, Die große Illusion: Versailles 1919 und die Neuordnung der Welt, München 2018.
Crampton, Richard J., A Concise History of Bulgaria, Cambridge 2005.
Crampton, Richard J., The Historical Legacy: The Problem of Political Stability in Bulgaria before 1944, in: Höpken, Wolfgang (Hg.), Revolution auf Raten: Bulgariens Weg zur Demokratie, München 1996.
Daily News Hungary, Budapest Mayor: Trianon ‘indelible’ part of Hungarians’ life, zuletzt abgerufen unter https://dailynewshungary.com/budapest-mayor-trianon-indelible-part-of-hungarians-life/ am 12. August 2024.
Deist, Wilhelm, Die militärischen Bestimmungen der Pariser Vorortverträge, in: Rössler, Hellmuth (Hg.), Ideologie und Machtpolitik 1919: Plan und Werk der Pariser Friedenskonferenzen 1919, Göttingen 1966.
Dragostinova, Theodora, Between Two Motherlands: Nationality and Emigration among the Greeks of Bulgaria, 1900–1949, New York 2011.
Epstein, Fritz T., Studien zur Geschichte der „Russischen Frage” auf der Pariser Friedenskonferenz von 1919, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 7 (4), 1959.
Eyck, Erich, Geschichte der Weimarer Republik: Vom Zusammenbruch des Kaisertums bis zur Wahl Hindenburgs, Erlenbach-Zürich 1962.
Frey, Dóra, Geheimdiplomatie und Völkerrecht: die Verträge von London und Bukarest aus rechtshistorischer Perspektive, in: Dácz, Eniko/Griessler, Christina/Kovács, Henriett (Hgg.), Der Traum vom Frieden - Utopie oder Realität?: Kriegs- und Friedensdiskurse aus historischer, politologischer und juristischer Perspektive (1914-2014), Baden-Baden 2016.
Gassner, Miriam, Der Vertrag von Sèvres: Vertragstext und Analyse des Friedensschlusses mit der Türkei vom 10. August 1920 im Kontext der Pariser Vorortverträge, Baden-Baden 2023.
Gergely Szüts, István, The Refugee Problem and Citizenship in Hungary from the End of the First World War until 1924, in: Journal of East Central European Studies 70 (1), 2021.
Gerhards, Thomas, Staat, Nation und Moderne: Europa 1870-1920, Stuttgart 2022.
Goldstein, Erik, The First World War peace settlements, 1919-1925, London 2013.
Hager, Kurt, Aspekte der politischen Ordnung Europas 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, in: Schlie, Ulrich/Lojkó, Miklós/Weber, Thomas (Hgg.), Vom Nachkrieg zum Vorkrieg: die Pariser Friedensverträge und die internationale Ordnung der Zwischenkriegszeit, Baden-Baden 2020.
Haggenmüller, Martina, Bulgarien und die Mittelmächte, in: Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns (Hg.), Verbündet: Bayern und Bulgarien im Ersten Weltkrieg, München 2017.
Hammed, Yousry, Der Nahe Osten und Europa im Spannungsfeld von Migration und Terrorismus, Wiesbaden 2022.
Härtel, Hans-Joachim/Schönfeld, Roland, Bulgarien: Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Regensburg 1998.
Heyde, Jürgen, Geschichte Polens, München 2023.
Hölzle, Erwin, Wilsons Friedensplan und seine Durchführung, in: Rössler, Hellmuth (Hg.), Ideologie und Machtpolitik 1919: Plan und Werk der Pariser Friedenskonferenzen 1919, Göttingen 1966.
Hou, Zhongjun, Die chinesischen auswärtigen Beziehungen und der Erste Weltkrieg, Stuttgart 2024.
Hovi, Kalervo, Polnisch-finnische Interessensphären im Baltikum: Zur Neubewertung der Randstaatenpolitik in den Jahren 1919–1920, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 29 (1), Breslau 1981.
Jansen, Christian/Janz, Oliver, Von Napoleon bis Berlusconi: Eine Geschichte Italiens vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart, Stuttgart 2023.
Kastner, Georg, Revisionismus und die Grenzen der Diplomatie: Ungarn unter Horthys Ägide zwischen den Weltkriegen, in: Schlie, Ulrich/Lojkó, Miklós/Weber, Thomas (Hgg.), Vom Nachkrieg zum Vorkrieg: die Pariser Friedensverträge und die internationale Ordnung der Zwischenkriegszeit, Baden-Baden 2020.
Kieser, Hans-Lukas, Nahostfriede ohne Demokratie: der Vertrag von Lausanne und die Geburt der Türkei 1923, Zürich 2023.
Knaus, Gerald, Bulgarien, München 1997.
Knipp, Kersten, Im Taumel: 1918 - Europas Sturz und Neubeginn, Darmstadt 2018.
Köse, İsmail, The Lloyd George Government of the UK: Balfour Declaration the Promise for a National Home to Jews (1916-1920), in: Belleten 82 (294).
Kraus, Hans-Christof, Versailles und die Folgen: Außenpolitik zwischen Revisionismus und Verständigung 1919 – 1933, Berlin 2013.
Krüger, Peter, Locarno und die Frage eines europäischen Sicherheitssystems unter besonderer Berücksichtigung Ostmitteleuropas, in: Schattkowsky, Ralph (Hg.), Locarno und Osteuropa: Fragen eines europäischen Sicherheitssystems in den 20er Jahren, Marburg 1994.
Lehnstaedt, Stephan, Der vergessene Sieg: der Polnisch-Sowjetische Krieg 1919/20 und die Entstehung des modernen Osteuropa, München 2019.
Lemberg, Eugen, Die Nationalitätenfrage im Donauraum auf Grund der Pariser Vorortverträge, in: Rössler, Hellmuth (Hg.), Ideologie und Machtpolitik 1919: Plan und Werk der Pariser Friedenskonferenzen 1919, Göttingen 1966.
Leonhard, Jörn, Der überforderte Frieden: Versailles und die Welt 1918-1923, München 2018.
Linhart, Sepp, The “Yellow Monkey”: Japan´s Image during the First World War as Seen on German Picture Postcards, in: Schmidt, Jan/Schmidtpott, Katja (Hgg.), The East Asian Dimension of the First World War: Global Entanglements and Japan, China, and Korea, 1914-1919, New York 2020.
Löhr, Isabella, Völkerbund, in: Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (Hg.), Europäische Geschichte Online, zuletzt abgerufen unter https://www.ieg-ego.eu/de/threads/transnationale-bewegungen-und-organisationen/internationalismus/isabella-loehr-voelkerbund#citation am 11. August 2024.
Lojkó, Miklós, Uncertain Beginnings in Danubian Central Europe: Embedding the new states system in Czechoslovakia, Hungary and Poland, 1919-1927, in: Schlie, Ulrich/Lojkó, Miklós/Weber, Thomas (Hgg.), Vom Nachkrieg zum Vorkrieg: die Pariser Friedensverträge und die internationale Ordnung der Zwischenkriegszeit, Baden-Baden 2020.
Lorenz, Thomas, "Die Weltgeschichte ist das Weltgericht!": der Versailler Vertrag in Diskurs und Zeitgeist der Weimarer Republik, Frankfurt am Main 2008.
Lukas, Stefan, Die Neuordnung des Nahen Ostens: vom radikalen Wandel einer Region zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Berlin 2018.
Macmillan, Margaret, Peacemakers: The Paris Peace Conference of 1919 and Its Attempt to End War, London 2001.
Malfèr, Stefan, Wien und Rom nach dem Ersten Weltkrieg: österreichisch-italienische Beziehungen 1919 – 1923, Köln 1978.
Martin, Bernd, Das deutsch-japanische Bündnis im Zweiten Weltkrieg, in: Kreiner, Josef (Hg.), Deutschland - Japan in der Zwischenkriegszeit, 1990 Bonn.
Milow, Caroline, Die ukrainische Frage 1917-1923 im Spannungsfeld der europäischen Diplomatie, Wiesbaden 2002.
Möller, Horst, Die Neuordnung Europas 1918–1920, in: Möller, Horst (Hg.), Der Erste Weltkrieg: Deutschland und Russland im europäischen Kontext, Berlin 2023.
Mommsen, Wolfgang J., Der Vertrag von Versailles: Eine Bilanz, in: Krumeich, Gerd (Hg.), Versailles 1919: Ziele - Wirkung – Wahrnehmung, Essen 2001.
Neiberg, Michael S, The Treaty of Versailles: A Concise History, Oxford 2017.
Nestl, Heiko, Die japanische Chinapolitik im Zweiten Weltkrieg: 1940 - 1945; Problemstrukturen und Strategien zur Lösung des China-Dilemmas, München 1997.
Oehlrich, Conrad, Die Friedensregelungen für die türkischen und arabischen Gebiete nach dem Ersten Weltkrieg, in: Rössler, Hellmuth (Hg.), Ideologie und Machtpolitik 1919: Plan und Werk der Pariser Friedenskonferenzen 1919, Göttingen 1966.
Pantzer, Peter, Japan und Österreich zwischen beiden Kriegen, in: Kreiner, Josef (Hg.), Japan und die Mittelmächte im Ersten Weltkrieg und in den zwanziger Jahren, 1986 Bonn.
Paruseva, Dobrinka, Gesellschaft, Technologie und Kultur, oder wie Bulgarien auf die Moderne traf, in: Brunnbauer, Ulf/Höpken, Wolfgang (Hgg.), Transformationsprobleme Bulgariens im 19. Und 20. Jahrhundert: Historische und ethnologische Perspektiven, München 2007.
Payk, Marcus M., Frieden durch Recht? Der Aufstieg des modernen Völkerrechts und der Friedensschluss nach dem Ersten Weltkrieg, Boston 2018.
Pećinar, Aleksandra, The Paris Peace Conference: Contemporary Balkans’ perspective, in: International Relations 12 (3), 2019.
Portnov, Andrii, Polen und Ukraine: Verflochtene Geschichte, geteilte Erinnerung in Europa, Berlin 2022.
Rathkolb, Oliver, Erste Republik, Austrofaschismus, Nationalsozialismus (1918-1945), in: Lackner, Christian/Winkelbauer, Thomas (Hgg.), Geschichte Österreichs, Stuttgart 2015.
Rößler, Hellmuth, Deutschland und Versailles, in: Hellmuth Rössler (Hg.), Ideologie und Machtpolitik 1919: Plan und Werk der Pariser Friedenskonferenzen 1919, Göttingen 1966.
Rotte, Ralph, Ending the War Without Peace: New Literature on the End of the First World War and on Peace Efforts After 1918/19, in: Neue politische Literatur 65 (2), Wiesbaden 2020.
Scharr, Kurt/Gräf, Rudolf, Rumänien: Geschichte und Geographie, Böhlau 2008.
Schlie, Ulrich, Europäische Ordnung: 100 Jahre nach den Friedensverträgen von Paris 1919/20, in: Schlie, Ulrich/Lojkó, Miklós/Weber, Thomas (Hgg.), Vom Nachkrieg zum Vorkrieg: die Pariser Friedensverträge und die internationale Ordnung der Zwischenkriegszeit, Baden-Baden 2020.
Schulze Wessel, Martin, Der Fluch des Imperiums: die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte, München 2023.
Schwentker, Wolfgang, Geschichte Japans, München 2022.
Sierpowski, Stanislaw/Czubisnksi, Antoni, Der Völkerbund und das Locarno-System, in: Schattkowsky, Ralph (Hg.), Locarno und Osteuropa: Fragen eines europäischen Sicherheitssystems in den 20er Jahren, Marburg 1994.
Smith, Leonard, V., Sovereignty at the Paris Peace Conference of 1919, Oxford 2018.
Steller, Verena, Zwischen Geheimnis und Öffentlichkeit. Die Pariser Friedensverhandlungen 1919 und die Krise der universalen Diplomatie, in: Zeithistorische Forschungen 8 (3), 2011.
Tusan, Michelle Elizabeth, The last Treaty: Lausanne and the End of the First World War in the Middle East, Cambridge 2023.
Überegger, Oswald, Im Schatten des Krieges: Geschichte Tirols 1918-1920, Paderborn 2019.
Viefhaus, Erwin, Die Minderheitenfrage und die Entstehung der Minderheitenschutzverträge auf der Pariser Friedenskonferenz 1919: eine Studie zur Geschichte des Nationalitätenproblems im 19. und 20. Jahrhundert, Würzburg 1960.
Wedrac, Stefan, Die Illusion der Selbstbestimmung in Tirol 1918-1920, in: Fräss-Ehrfeld, Claudia (Hg.), Volksabstimmungen und andere Grenzlösungen nach dem Ersten Weltkrieg, Klagenfurt am Wörthersee 2020.
Weidenfeld, Werner, Europa – zur Zukunftssuche eines Kontinents, in: Schlie, Ulrich/Lojkó, Miklós/Weber, Thomas (Hgg.), Vom Nachkrieg zum Vorkrieg: die Pariser Friedensverträge und die internationale Ordnung der Zwischenkriegszeit, Baden-Baden 2020.
Westermann (Hg.), Diercke Drei: Universalatlas, Braunschweig 2009.
Westermann (Hg.), Diercke Drei: Universalatlas, Braunschweig 2017.
Zägel, Jörg, Vergangenheitsdiskurse in der Ostseeregion: Die Sicht auf Krieg, Diktatur, Völkermord und Vertreibung in Russland, Polen und den baltischen Staaten, Berlin 2007.
Zöllner, Reinhard, Geschichte Japans: von 1800 bis zur Gegenwart, Paderborn 2013.
Zürrer, Werner, Die 'Griechische Frage' auf den Friedenskonferenzen von 1919/20, in: Südost-Forschungen 35 (1), München 1976.
8. Abbildungsverzeichnis
Abbildung 2: Europa 1920/21, Quelle: Westermann, 2017, S. 106
Abbildung 1: Europa 1914, Quelle: Westermann, 2009, S. 92
[...]
1 Joachim von Ribbentrop, in: Deutsche Informationsstelle (Hg.), 100 Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges: Auswahl aus dem amtlichen deutschen Weissbuch, Berlin 1939, S. 11.
2 Vgl. Christopher Clark, Die Schlafwandler, München 2013, S. 715f.
3 Vgl. Ralph Rotte, Ending the War Without Peace: New Literature on the End of the First World War and on Peace Efforts After 1918/19, in: Neue politische Literatur 65 (2), Wiesbaden 2020, S. 241.
4 Der Demokratische Friede ist eine Theorie der Internationalen Beziehungen, welche (empirisch bestätigt) davon ausgeht, dass statistisch gesehen, Kriege zwischen zwei Demokratien unwahrscheinlich sind.
5 Vgl. Kurt Hager, Aspekte der politischen Ordnung Europas 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, in: Ulrich Schlie / Miklós Lojkó / Thomas Weber (Hgg.), Vom Nachkrieg zum Vorkrieg: die Pariser Friedensverträge und die internationale Ordnung der Zwischenkriegszeit, Baden-Baden 2020, S. 51.
6 Vgl. Horst Möller, Die Neuordnung Europas 1918–1920, in: Horst Möller (Hg.), Der Erste Weltkrieg: Deutschland und Russland im europäischen Kontext, Berlin 2023, S. 148.
7 Vgl. Erik Goldstein, The First World War peace settlements, 1919-1925, London 2013, S. 33.
8 Vgl. Jörn Leonhard, Der überforderte Frieden: Versailles und die Welt 1918-1923, München 2018, S. 1255ff.
9 Vgl. Ulrich Schlie, Europäische Ordnung: 100 Jahre nach den Friedensverträgen von Paris 1919/20, in: Ulrich Schlie / Miklós Lojkó / Thomas Weber (Hgg.), Vom Nachkrieg zum Vorkrieg: die Pariser Friedensverträge und die internationale Ordnung der Zwischenkriegszeit, Baden-Baden 2020, S. 27f.
10 Michael S. Neiberg, The Treaty of Versailles: A Concise History, Oxford 2017, S. 98.
11 Waffenstillstand vom 30. Oktober 1918 zwischen dem Osmanischen Reich und Großbritannien als Vertreter der Alliierten.
12 Waffenstillstand vom 11. November 1918 zwischen dem Deutschen Reich sowie Frankreich und Großbritannien als Vertreter der Alliierten.
13 Waffenstillstand vom 29. September 1918 zwischen dem Zarentum Bulgarien und Frankreich als Vertreter der Alliierten.
14 Waffenstillstand vom 3. November 1918 zwischen Österreich-Ungarn und Italien als Vertreter der Alliierten.
15 Vgl. Helmut Altrichter, Sowjetrussland und Europa: Die Anfänge der sowjetischen Außenpolitik, in: Horst Möller (Hg.), Der Erste Weltkrieg: Deutschland und Russland im europäischen Kontext, Berlin 2023, S. 141.
16 Vgl. Leonhard, Der überforderte Frieden, S. 82.
17 Vgl. Erwin Hölzle, Wilsons Friedensplan und seine Durchführung, in: Hellmuth Rössler (Hg.), Ideologie und Machtpolitik 1919: Plan und Werk der Pariser Friedenskonferenzen 1919, Göttingen 1966, S. 15.
18 Vgl. Miklós Lojkó, Uncertain Beginnings in Danubian Central Europe: Embedding the new states system in Czechoslovakia, Hungary and Poland, 1919-1927, in: Ulrich Schlie / Miklós Lojkó / Thomas Weber (Hgg.), Vom Nachkrieg zum Vorkrieg: die Pariser Friedensverträge und die internationale Ordnung der Zwischenkriegszeit, Baden-Baden 2020, S. 75.
19 Vgl. Leonhard, Der überforderte Frieden, S. 667f.
20 Vgl. Margaret Macmillan, Peacemakers: The Paris Peace Conference of 1919 and Its Attempt to End War, London 2001, S. 282.
21 Vgl. Verena Steller, Zwischen Geheimnis und Öffentlichkeit. Die Pariser Friedensverhandlungen 1919 und die Krise der universalen Diplomatie, in: Zeithistorische Forschungen 8 (3), 2011, S. 362.
22 Vgl. Kersten Knipp, Im Taumel: 1918 - Europas Sturz und Neubeginn, Darmstadt 2018, S. 175.
23 Vgl. Steller, Zwischen Geheimnis und Öffentlichkeit, S. 362.
24 Marshall Ferdinand Foch war in den Friedensverhandlungen involviert und französischer Unterzeichner des Waffenstillstandsvertrages von Compiègne.
25 Vgl. Wilhelm Deist, Die militärischen Bestimmungen der Pariser Vorortverträge, in: Hellmuth Rössler (Hg.), Ideologie und Machtpolitik 1919: Plan und Werk der Pariser Friedenskonferenzen 1919, Göttingen 1966, S. 190.
26 Vgl. Geoffrey Barraclough, Das Britische Reich und der Frieden, in: Hellmuth Rössler (Hg.), Ideologie und Machtpolitik 1919: Plan und Werk der Pariser Friedenskonferenzen 1919, Göttingen 1966, S. 65.
27 David Lloyd George war von 1916 bis 1922 Premierminister Großbritanniens und Vertreter im Rat der Vier.
28 Vgl. Deist, Die militärischen Bestimmungen der Pariser Vorortverträge, S. 190.
29 Vgl. Hans Woller, Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert, München 2010, S. 65
30 Vgl. Dóra Frey, Geheimdiplomatie und Völkerrecht: die Verträge von London und Bukarest aus rechtshistorischer Perspektive, in: Eniko Dácz / Christina Griessler / Henriett Kovács (Hgg.), Der Traum vom Frieden - Utopie oder Realität?: Kriegs- und Friedensdiskurse aus historischer, politologischer und juristischer Perspektive (1914-2014), Baden-Baden 2016, S. 145
31 Vgl. Wolfgang Schwentker, Geschichte Japans, München 2022, S. 690.
32 Ulrich Graf Brockdorf-Rantzau, Presseerklärung zum Amtsantritt als Staatssekretär des Auswärtigen Amtes vom 24 Dezember 1918, in: Klaus Schwabe, Quellen zum Friedensschluss von Versailles, Darmstadt 1997, S. 84f.
33 Vgl. Leonhard, Der überforderte Frieden, S. 674.
34 Vgl. Hans-Christof Kraus, Versailles und die Folgen: Außenpolitik zwischen Revisionismus und Verständigung 1919 – 1933, Berlin 2013, S. 104. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Kraus in der Vergangenheit immer wieder Skandale wegen politisch rechtem Gedankengut hatte sowie der Publikation innerhalb von Magazinen der Neuen Rechten. Da er jedoch als Historiker einen guten Ruf hat und ich selbst die Vorwürfe nicht sicher bewerten kann, gehe ich zunächst davon aus, dass seine historischen Werke, zumindest die Fakten, davon unbeeinflusst sind.
35 Vgl. Schwentker, Geschichte Japans, S. 690.
36 Vgl. Reinhard Zöllner, Geschichte Japans: von 1800 bis zur Gegenwart, Paderborn 2013, S. 342.
37 Vgl. Sepp Linhart, The “Yellow Monkey”: Japan´s Image during the First World War as Seen on German Picture Postcards, in: Jan Schmidt / Katja Schmidtpott (Hgg.), The East Asian Dimension of the First World War: Global Entanglements and Japan, China, and Korea, 1914-1919, New York 2020, S. 125.
38 Vgl. Erwin Viefhaus, Die Minderheitenfrage und die Entstehung der Minderheitenschutzverträge auf der Pariser Friedenskonferenz 1919: eine Studie zur Geschichte des Nationalitätenproblems im 19. und 20. Jahrhundert, Würzburg 1960, S. 100f.
39 Vgl. Fritz T. Epstein, Studien zur Geschichte der „Russischen Frage” auf der Pariser Friedenskonferenz von 1919, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 7 (4), 1959, S. 477.
40 Vgl. Wolfgang J. Mommsen, Der Vertrag von Versailles: Eine Bilanz, in: Gerd Krumeich (Hg.), Versailles 1919: Ziele - Wirkung – Wahrnehmung, Essen 2001, S. 359.
41 Dies tat sie aufgrund von Unzufriedenheit mit dem nicht erfolgreich in die Satzung aufgenommenen Minderheitenschutz und den Pariser Vorortverträgen allgemein.
42 Vgl. Isabella Löhr, Völkerbund, in: Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (Hg.), Europäische Geschichte Online, zuletzt abgerufen unter https://www.ieg-ego.eu/de/threads/transnationale-bewegungen-und-organisationen/internationalismus/isabella-loehr-voelkerbund#citation am 11. August 2024.
43 Vgl. Stanislaw Sierpowski / Antoni Czubisnksi, Der Völkerbund und das Locarno-System, in: Ralph Schattkowsky (Hg.), Locarno und Osteuropa: Fragen eines europäischen Sicherheitssystems in den 20er Jahren, Marburg 1994, S. 38.
44 Vgl. Thomas Gerhards, Staat, Nation und Moderne: Europa 1870-1920, Stuttgart 2022, S. 194.
45 Vgl. Werner Weidenfeld, Europa – zur Zukunftssuche eines Kontinents, in: Ulrich Schlie / Miklós Lojkó / Thomas Weber (Hgg.), Vom Nachkrieg zum Vorkrieg: die Pariser Friedensverträge und die internationale Ordnung der Zwischenkriegszeit, Baden-Baden 2020, S. 174f.
46 Vgl. Schlie, Europäische Ordnung, S. 12.
47 Vgl. Deist, Die militärischen Bestimmungen der Pariser Vorortverträge, S. 189.
48 Dies ist ein vorläufiger Friedensschluss, der die wichtigsten zukünftigen Hauptpunkte des endgültigen Friedens beinhaltet und wird geschlossen, um zügig zu einem Friedenszustand überzugehen und zugleich den beteiligten Parteien eine Vorstellung davon zu geben, mit was für Auswirkungen sie rechnen können.
49 Vgl. Marcus M. Payk, Frieden durch Recht? Der Aufstieg des modernen Völkerrechts und der Friedensschluss nach dem Ersten Weltkrieg, Boston 2018, S. 359.
50 Der Begriff geht auf die punischen Kriege zwischen Rom und Karthago zurück und steht für einen Friedensvertrag, der einen solch hohen Preis vom Besiegten verlangt, dass er zwar überlebt, aber sich nicht mehr wieder entwickeln kann.
51 Vgl. Goldstein, The First World War peace settlements, S. 20.
52 Vgl. Eckart Conze, Die große Illusion: Versailles 1919 und die Neuordnung der Welt, München 2018, S. 116.
53 Philip Scheidemann, Rede zum Vertrag von Versailles, in: Die Weimarer Republik – Deutschlands erste Demokratie, zuletzt abgerufen unter https://www.weimarer-republik.net/jubilaeum/revolution-und-gruendung-der-republik-tag-fuer-tag/mai-1919/scheidemann-welche-hand-muesste-nicht-verdorren-die-sich-und-uns-in-diese-fesseln-legt/ am 19. August 2024.
54 Vgl. Hellmuth Rößler, Deutschland und Versailles, in: Hellmuth Rössler (Hg.), Ideologie und Machtpolitik 1919: Plan und Werk der Pariser Friedenskonferenzen 1919, Göttingen 1966, S. 211.
55 Vgl. Ralph Blessing, Der mögliche Frieden: die Modernisierung der Außenpolitik und die deutsch-französischen Beziehungen 1923 – 1929, München 2008, S. 48.
56 Vgl. Kraus, Versailles und die Folgen, S. 110.
57 a. a. O., S. 22ff.
58 Ein Widergutmachungsausschuss sollte stattdessen später über die genaue Summe urteilen. Vgl. Art. 254, Vertrag von Versailles, in: Politisches Archiv des Auswärtiges Amtes, Signatur PA AA, MULT R, 282-258.
59 Vgl. Kraus, Versailles und die Folgen, S. 41f.
60 Vgl. Heinrich Hirschfelder, Reich, Republik, Diktatur, Bamberg 1993, S. 226.
61 Vgl. Deist, Die militärischen Bestimmungen der Pariser Vorortverträge, S. 204.
62 Vgl. Peter Krüger, Locarno und die Frage eines europäischen Sicherheitssystems unter besonderer Berücksichtigung Ostmitteleuropas, in: Ralph Schattkowsky (Hg.), Locarno und Osteuropa: Fragen eines europäischen Sicherheitssystems in den 20er Jahren, Marburg 1994, S. 27f.
63 Vgl. Conze, Die große Illusion, S. 471f.
64 Vgl. Brigitte Braun, “Brennende Grenzen”: Revisionspropaganda im deutschen Kino der 1920er Jahre am Beispiel Oberschlesiens, in: Beate Störtkuhl (Hg.), Aufbruch und Krise: das östliche Europa und die Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg, München 2010, S. 112.
65 Vgl. Thomas Lorenz, "Die Weltgeschichte ist das Weltgericht!": der Versailler Vertrag in Diskurs und Zeitgeist der Weimarer Republik, Frankfurt am Main 2008, S. 98-104.
66 Vgl. Macmillan, Peacemakers, S. 168
67 Vgl. Möller, Die Neuordnung Europas, S. 146.
68 Vgl. Leonhard, Der überforderte Frieden, S. 1068f. Vgl. Art. 88, Vertrag von Saint-Germain, in: Staatsarchiv Österreich, Signatur AT-OeStA/HHStA GKA GesA Kopenhagen 210-2.
69 Vgl. Stefan Wedrac, Die Illusion der Selbstbestimmung in Tirol 1918-1920, in: Claudia Fräss-Ehrfeld (Hg.), Volksabstimmungen und andere Grenzlösungen nach dem Ersten Weltkrieg, Klagenfurt am Wörthersee 2020, S. 53f.
70 Vgl. Oswald Überegger, Im Schatten des Krieges: Geschichte Tirols 1918-1920, Paderborn 2019, S. 105.
71 Vgl. Oliver Rathkolb, Erste Republik, Austrofaschismus, Nationalsozialismus (1918-1945), in: Christian Lackner / Thomas Winkelbauer (Hgg.), Geschichte Österreichs, Stuttgart 2015, S. 494.
72 Vgl. Stefan Malfèr, Wien und Rom nach dem Ersten Weltkrieg: österreichisch-italienische Beziehungen 1919 – 1923, Köln 1978, S. 163.
73 Vgl. Jörg K. Hoensch, Geschichte Ungarns: 1867 – 1983, Stuttgart 1984, S. 103.
74 a. a. O. S. 104f.
75 a. a. O. S. 103.
76 Vgl. István Gergely Szüts, The Refugee Problem and Citizenship in Hungary from the End of the First World War until 1924, in: Journal of East Central European Studies 70 (1), 2021, S. 52.
77 Es war mir leider nicht möglich das Original oder eine Kopie zu sichten, weshalb auf diese private online-Version zurückgegriffen wurde. Da auch die Verträge von Saint-Germain und Versailles in dieser online-Version mit den Archivtexten übereinstimmen, gehe ich davon aus, dass auch beim Vertrag von Trianon alles stimmt. Art. 180, Vertrag von Trianon, zuletzt abgerufen unter https://www.versailler-vertrag.de/trianon/index.htm am 12. August 2024.
78 Vgl. Miklós Molnár, Geschichte Ungarns: von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hamburg 1999, S. 365.
79 Vgl. Kurt Scharr / Rudolf Gräf, Rumänien: Geschichte und Geographie, Böhlau 2008, S. 59.
80 Vgl. Georg Kastner, Revisionismus und die Grenzen der Diplomatie: Ungarn unter Horthys Ägide zwischen den Weltkriegen, in: Ulrich Schlie / Miklós Lojkó / Thomas Weber (Hgg.), Vom Nachkrieg zum Vorkrieg: die Pariser Friedensverträge und die internationale Ordnung der Zwischenkriegszeit, Baden-Baden 2020, S. 91.
81 Vgl. Molnár, Geschichte Ungarns, S. 365.
82 Vgl. Eugen Lemberg, Die Nationalitätenfrage im Donauraum auf Grund der Pariser Vorortverträge, in: Hellmuth Rössler (Hg.), Ideologie und Machtpolitik 1919: Plan und Werk der Pariser Friedenskonferenzen 1919, Göttingen 1966, S. 128.
83 Vgl. Ungarischer Juristenverein, Der Friedensvertrag von Trianon: Vom Standpunkte des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit, Budapest 1931, S. 4f.
84 Vgl. Daily News Hungary, Budapest Mayor: Trianon ‘indelible’ part of Hungarians’ life, zuletzt abgerufen unter https://dailynewshungary.com/budapest-mayor-trianon-indelible-part-of-hungarians-life/ am 12. August 2024.
85 Vgl. Martina Haggenmüller, Bulgarien und die Mittelmächte, in: Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns (Hg.), Verbündet: Bayern und Bulgarien im Ersten Weltkrieg, München 2017, S. 83.
86 Vgl. Richard. J. Crampton, A Concise History of Bulgaria, Cambridge 2005, S. 144f.
87 Vgl. Gerald Knaus, Bulgarien, München 1997, S. 70.
88 Vgl. Hans-Joachim Härtel / Roland Schönfeld, Bulgarien: Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Regensburg 1998, S. 179.
89 Vgl. Vgl. Knaus, Bulgarien, S. 72f.
90 Vgl. Theodora Dragostinova, Between Two Motherlands: Nationality and Emigration among the Greeks of Bulgaria, 1900–1949, New York 2011, S. 158.
91 Vgl. Art. 50, Vertrag von Neuilly-sur-Seine, zuletzt abgerufen unter https://www.versailler-vertrag.de/neuilly/ am 12. August 2024.
92 Vgl. Leonhard, Der überforderte Frieden, S. 1071f.
93 Vgl. Dobrinka Paruseva, Gesellschaft, Technologie und Kultur, oder wie Bulgarien auf die Moderne traf, in: Ulf Brunnbauer / Wolfgang Höpken (Hgg.), Transformationsprobleme Bulgariens im 19. Und 20. Jahrhundert: Historische und ethnologische Perspektiven, München 2007, S. 30ff.
94 Vgl. Richard J. Crampton, The Historical Legacy: The Problem of Political Stability in Bulgaria before 1944, in: Wolfgang Höpken (Hg.), Revolution auf Raten: Bulgariens Weg zur Demokratie, München 1996, S. 12.
95 Vgl. Härtel/Schönfeld, Bulgarien, S. 184.
96 Vgl. Knaus. Bulgarien, S. 73.
97 Vgl. Härtel/Schönfeld, Bulgarien, S. 180ff.
98 Vgl. Leonhard, Der überforderte Frieden, S. 1255ff.
99 Vgl. Stefan Lukas, Die Neuordnung des Nahen Ostens: vom radikalen Wandel einer Region zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Berlin 2018, S. 50.
100 Vgl. Lukas, Die Neuordnung des Nahen Ostens, S. 51ff.
101 a. a. O., S. 56f.
102 Vgl. İsmail Köse, The Lloyd George Government of the UK: Balfour Declaration the Promise for a National Home to Jews (1916-1920), in: Belleten 82 (294), S. 735.
103 Vgl. Yousry Hammed, Der Nahe Osten und Europa im Spannungsfeld von Migration und Terrorismus, Wiesbaden 2022, S. 50.
104 Vgl. Werner Zürrer, Die 'Griechische Frage' auf den Friedenskonferenzen von 1919/20, in: Südost-Forschungen 35 (1), München 1976, S. 221.
105 Vgl. Leonhard, Der überforderte Frieden, S. 172f.
106 Vgl. Macmillan, Peacemaker, S. 168.
107 Vgl. Hans-Lukas Kieser, Nahostfriede ohne Demokratie: der Vertrag von Lausanne und die Geburt der Türkei 1923, Zürich 2023, S. 113.
108 Mit Ausnahme einer Leibwache und Gendarmerie
109 Vgl. Art. 152, Vertrag von Sévres, zuletzt abgerufen unter https://www.versailler-vertrag.de/sevres/index.htm am 13. August 2024.
110 Vgl. Vgl. Zürrer, Die 'Griechische Frage' auf den Friedenskonferenzen von 1919/20, S. 220.
111 Vgl. Miriam Gassner, Der Vertrag von Sèvres: Vertragstext und Analyse des Friedensschlusses mit der Türkei vom 10. August 1920 im Kontext der Pariser Vorortverträge, Baden-Baden 2023, S. 18.
112 Vgl. Conrad Oehlrich, Die Friedensregelungen für die türkischen und arabischen Gebiete nach dem Ersten Weltkrieg, in: Hellmuth Rössler (Hg.), Ideologie und Machtpolitik 1919: Plan und Werk der Pariser Friedenskonferenzen 1919, Göttingen 1966, S. 167f.
113 Vgl. Gassner, Der Vertrag von Sèvres, S. 69.
114 Vgl. Michelle Elizabeth Tusan, The last Treaty: Lausanne and the End of the First World War in the Middle East, Cambridge 2023, S. 221.
115 Vgl. Payk, Frieden durch Recht?, S. 660.
116 Vgl. Kieser, Nahostfriede ohne Demokratie, S. 281
117 Vgl. Leonhard, Der überforderte Frieden, S. 122f.
118 Vgl. Conze, Die große Illusion, S. 116.
119 Vgl. Caroline Milow, Die ukrainische Frage 1917-1923 im Spannungsfeld der europäischen Diplomatie, Wiesbaden 2002, S. 92.
120 Vgl. Leonhard, Der überforderte Frieden, S. 477f.
121 Vgl. Ernst Birke, Rußland, seine Westgebiete, der Kommunismus und Versailles, in: Hellmuth Rössler (Hg.), Ideologie und Machtpolitik 1919: Plan und Werk der Pariser Friedenskonferenzen 1919, Göttingen 1966, S. 93.
122 Vgl. Kastner, Rußland, seine Westgebiete, der Kommunismus und Versailles, S. 106
123 Vgl. Knipp, Im Taumel, S. 175.
124 Vgl. Goldstein, The First World War peace settlements S. 49.
125 Vgl. Jürgen Heyde, Geschichte Polens, München 2023, S. 92.
126 Vgl. Martin Schulze Wessel, Der Fluch des Imperiums: die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte, München 2023, S. 173.
127 Vgl. Andrii Portnov, Polen und Ukraine: Verflochtene Geschichte, geteilte Erinnerung in Europa, Berlin 2022, S. 40f.
128 Die Curzon-Linie war eine der Pariser Friedenskonferenz im Dezember 1919 vorgeschlagene Demarkationslinie auf Grundlage der Mehrheitsbevölkerung.
129 Vgl. Jörg Zägel, Vergangenheitsdiskurse in der Ostseeregion: Die Sicht auf Krieg, Diktatur, Völkermord und Vertreibung in Russland, Polen und den baltischen Staaten, Berlin 2007, S. 90.
130 Vgl. Heyde, Geschichte Polens, S. 93.
131 a. a. O. S. 94.
132 Vgl. Kalervo Hovi, Polnisch-finnische Interessensphären im Baltikum: Zur Neubewertung der Randstaatenpolitik in den Jahren 1919–1920, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 29 (1), Breslau 1981, S. 46.
133 Vgl. Heyde, Geschichte Polens, S. 102.
134 Vgl. Altrichter, Sowjetrussland und Europa, S. 142
135 Vgl. Stephan Lehnstaedt, Der vergessene Sieg: der Polnisch-Sowjetische Krieg 1919/20 und die Entstehung des modernen Osteuropa, München 2019, S. 17ff.
136 Vgl. Frey, Geheimdiplomatie und Völkerrecht, S. 142.
137 Vgl. Woller, Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert, S. 65.
138 Vgl. Rotte, Ending the War Without Peace, S. 232.
139 Vgl. Macmillan, Peacemaker, S. 289.
140 Vgl. Christian Jansen / Oliver Janz, Von Napoleon bis Berlusconi: Eine Geschichte Italiens vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart, Stuttgart 2023, S. 134.
141 Vgl. Aleksandra Pećinar, The Paris Peace Conference: Contemporary Balkans’ perspective, in: International Relations 12 (3), 2019, S. 330.
142 Vgl. Zürrer, Die 'Griechische Frage' auf den Friedenskonferenzen von 1919/20, S. 221.
143 Vgl Gassner, Der Vertrag von Sèvres, S. 34f.
144 Vgl. Zürer, Die 'Griechische Frage' auf den Friedenskonferenzen von 1919/20, S. 223.
145 Vgl. Woller, Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert, S. 80.
146 Vgl. Hirschfelder, Reich, Republik, Diktatur, S. 341.
147 Vgl. Macmillan, Peacemaker, S. 291.
148 Vgl. Jansen/Janz, Von Napoleon bis Berlusconi, S. 132.
149 a. a. O. S. 133.
150 Vgl. Woller, Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert, S. 78f.
151 a. a. O. S. 88.
152 Vgl. Macmillan, Peacemaker, S. 282.
153 Vgl. Linhart, The “Yellow Monkey“, S. 125.
154 Vgl. Leonhard, Der überforderte Frieden, S. 709.
155 Vgl. Schwentker, Geschichte Japans, S. 690.
156 Vgl. Peter Pantzer, Japan und Österreich zwischen beiden Kriegen, in: Josef Kreiner (Hg.), Japan und die Mittelmächte im Ersten Weltkrieg und in den zwanziger Jahren, 1986 Bonn, S. 189.
157 Manchmal auch Fünf-Mächte-Abkommen genannt.
158 Vgl. Schwentker, Geschichte Japans, S. 692.
159 a. a. O., S. 693f.
160 Vgl. Zhongjun Hou, Die chinesischen auswärtigen Beziehungen und der Erste Weltkrieg, Stuttgart 2024, 103ff.
161 Vgl. Heiko Nestl, Die japanische Chinapolitik im Zweiten Weltkrieg: 1940 - 1945; Problemstrukturen und Strategien zur Lösung des China-Dilemmas, München 1997, S. 39f.
162 Vgl. Zöllner, Geschichte Japans, S. 343.
163 Vgl. Bernd Martin, Das deutsch-japanische Bündnis im Zweiten Weltkrieg, in: Josef Kreiner (Hg.), Deutschland - Japan in der Zwischenkriegszeit, 1990 Bonn, S. 200.
164 Vgl. V. Smith, Sovereignty at the Paris Peace Conference of 1919, Oxford 2018, S. 59.
165 Vgl. Viefhaus, Die Minderheitenfrage und die Entstehung der Minderheitenschutzverträge auf der Pariser Friedenskonferenz 1919, S. 225.
166 Rößler, Deutschland und Versailles, S. 242.
167 Vgl. Erich Eyck, Geschichte der Weimarer Republik: Vom Zusammenbruch des Kaisertums bis zur Wahl Hindenburgs, Erlenbach-Zürich 1962, S. 112.
Details
- Titel
- Die Friedensillusion
- Untertitel
- Wie die Verträge des Ersten Weltkrieges die Saat des Unfriedens aussäten
- Note
- 1,7
- Autor
- Frederic Forkel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2024
- Seiten
- 59
- Katalognummer
- V1550321
- ISBN (Buch)
- 9783389104644
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Erster Weltkrieg Diplomatie Friedensvertrag Pariser Vorortverträge Ursachen des Zweiten Weltkrieges Völkerbund Pariser Friedenskonferenz Versailler Vertrag Vertrag von Saint-Germain Vertrag von Trianon Vertrag von Neuilly-sur-Seine Vertrag von Sévres Vertrag von Lausanne Vertrag von Brest-Litowsk Seitenwechsel Italiens Seitenwechsel Japans Ukrainischer Unabhängigkeitskrieg Polnisch-Sowjetischer Krieg Frieden Friedensschaffung Revisionismus Instabilität Konflikte Selbstbestimmungsrecht Ukraine-Krieg Friedensordnung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 26,99
- Arbeit zitieren
- Frederic Forkel (Autor:in), 2024, Die Friedensillusion, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1550321
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-