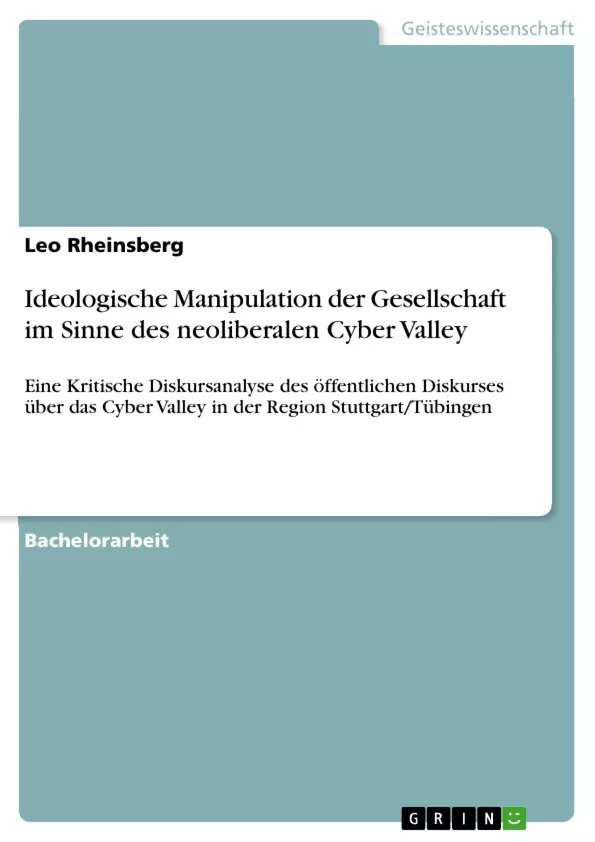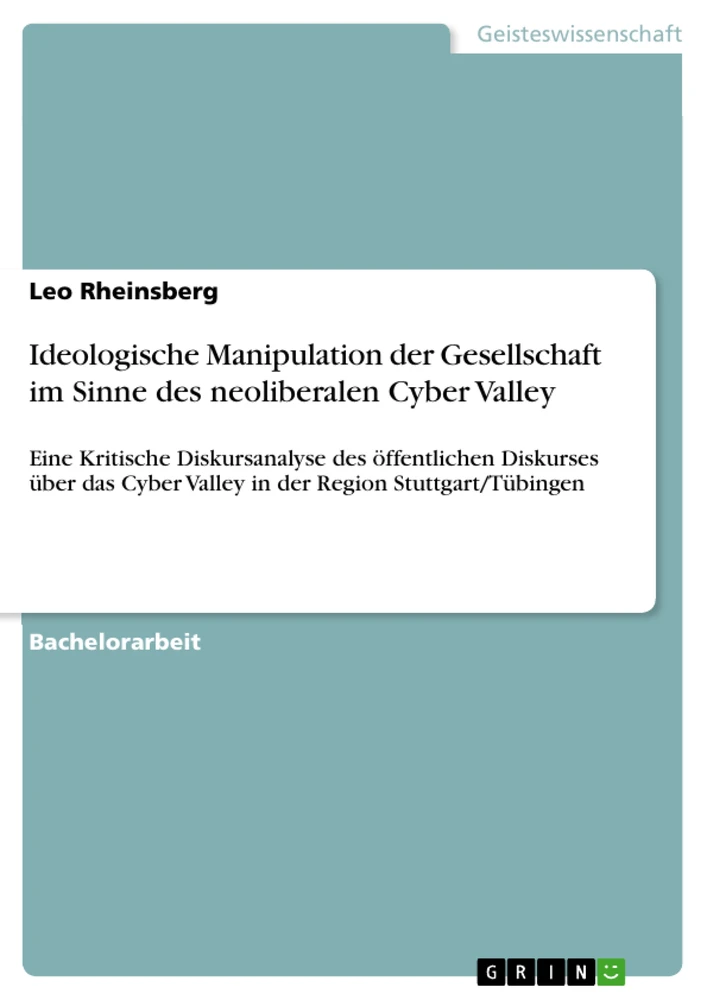
Ideologische Manipulation der Gesellschaft im Sinne des neoliberalen Cyber Valley
Bachelorarbeit, 2023
60 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Hinweise für das Lesen dieser Arbeit I
Abkürzungsverzeichnis II
I. Einleitung .
II. Cyber Valley - Thematischer Hintergrund
III. Theoretischer Rahmen der KDA
III. I. Macht und Wissen
III. II. Diskursbegriff
III. III. Wirklichkeit
III. IV. Normalismus und Kollektivsymbolik
IV. Methodisches Verfahren der KDA
IV. I. Strukturanalyse
IV. II. Feinanalyse
IV. III. Analyse des gesamten Diskursstranges
V. Empirische Untersuchung
V. I. Vorannahmen zum Cyber Valley Diskursstrang
V. II. Materialgrundlage
V. II. I. Material-Korpus
V. II. II. Material-Dossier
V. III. Strukturanalyse
V. III. I. Tabellarische Erfassung
V. III. II. Materialaufbereitung
V. III. III. Ergänzung: Aspektorientierte Analyse des Material-Korpus
V. IV. Feinanalyse
V. IV. I. Sprachlich-rhetorischeMittel
V. IV. II. Inhaltlich-ideologische Aussagen
V. IV. III. Abschließende Gesamtanalyse typischer Diskursfragmente
VI. Analyse des gesamten Diskursstranges
VII. Kritik
VIII. Vorschläge zur Veränderung des kritisierten Diskurses
XI. Fazit
X. Literaturverzeichnis
X.I. Literaturquellen
X. II. Internetquellen
X. III. Verzeichnis der in der Analyse verwendeten Quellen aus dem Material-Korpus
XI. Anhang
Download-Seiten
Hinweise für das Lesen dieser Arbeit
1. Schreibweise: Bei den Begriffen, die in dieser Arbeit kursiv gesetzt sind, um sie hervorzuheben, handelt es sich in einigen Fällen um Begriffe der Kritischen Diskursanalyse (KDA), die in Kapitel III. Theoretischer Rahmen der KDA oder in Kapitel IV. Methodisches Verfahren der KDA beschrieben werden. Dort sind diese Begriffe zur besseren Auffindbarkeit in der Beschreibung fett gedruckt und/oder direkt im Titel des Unterkapitels genannt. In anderen Fällen sind es sind Buchtitel, Kapitelbezeichnungen oder Namen von nicht-menschlichen Akteur*innen wie zum Beispiel: Institutionen, Kollektive oder Verbände.
2. Zitierweise: Die Zitierweise der verfassten Feinanalysen (welche sich im Anhang befinden) unterscheidet sich von der sonstigen Zitierweise, sofern der Bezug zum eigentlichen Text hergestellt wird. In diesem Fall wird zuerst der Dateiname genannt, gefolgt von folgender Zitierweise: (Z. [Anfangszeile] - [Endzeile]). Wenn auf andere selbst erstellte Anhänge verwiesen wird, werden die Dateinamen als Äquivalent zum Namen der Autor*in sowie der Jahreszahl oder des genauen Datums verwendet.
3. Anhang: Wenn in dieser Arbeit auf den Anhang verwiesen wird, ist damit der beigefügte USBStick gemeint, auf dem alle Dateien im PDF-Format gespeichert sind. Ordner und Dateien, die vom Verfasser erstellt wurden, sind mit seinen Initialen „LR“, gefolgt von der Jahreszahl oder dem genauen Datum der Erstellung, gekennzeichnet.
Der USB-Stick enthält Ordner mit allen Analysen, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit erstellt wurden und auf die Bezug genommen wird (Ordner „LR 2023_ANALYSE MATERIAL 72
Seiten“ und „LR 2023_STRUKTURANALYSE-TABELLEN_88 Seiten“). Für die Analyse verwendete Quellen befinden sich in einem separaten Ordner (Ordner „LR 2023_IN DER ANALYSE VERWENDETE QUELLEN AUS DEM MATERIAL-KORPUS“).
Darüber hinaus sind sämtliche Internetquellen (Ordner „LR 2023_INTERNETQUELLEN“), das Material-Dossier (Ordner „LR 2023_MATERIAL-DOSSIER 1569 Seiten Chronologisch sortiert“), das Material-Korpus (Ordner „LR 2023_MATERIAL-KORPUS 2340 Seiten“) sowie eine Hausarbeit, zwei Essays und zwei Listen des Verfassers (Ordner „LR 2023_HAUSARBEIT, ESSAYS UND LISTEN“), auf die im Text verwiesen wird, vorhanden.
Abkürzungsverzeichnis
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
I. Einleitung
Ziel dieser Arbeit
Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die nicht offensichtliche ideologische Beeinflussung von Sprache durch die untersuchten Akteur*innen im öffentlichen Diskurs und deren Machtwirkungen mit Hilfe der Kritischen Diskursanalyse aufzudecken.
Der öffentliche Diskurs, der untersucht wird, bezieht sich auf das Cyber Valley. Das Cyber Valley ist ein international führender Forschungsverbund im Bereich der Künstlichen Intelligenz in der Region Stuttgart-Tübingen in Baden-Württemberg.
Forschungsfrage
Die Analyse des Materials wird von der folgenden Forschungsfrage ausgehend durchgeführt: „Wie wird das Cyber Valley und seine Initiative zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Forschung und Industrie in der öffentlichen Debatte diskursiv konstruiert?“
Persönlicher Standpunkt
Die vorliegende Arbeit ist Teil meiner macht-kritischen Auseinandersetzung mit den vorherrschenden politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen, die ich grundlegend ablehne. Meine Haltung hat sich während dieser persönlichen Auseinandersetzung entwickelt und ist kontinuierlich im Wandel. Sie bewegt sich in einem dynamischen Bereich zwischen dieser Auseinandersetzung bis zur Gewissheit, dass alles anders sein könnte und das noch heute.
In Übereinstimmung mit der Kritischen Diskursanalyse (KDA) erhebt meine Haltung keinen Anspruch auf eine „objektive Wahrheit“ oder eine „allgemeine Moral“ und bezieht sich auch nicht darauf (Jäger/Zimmermann 2019: 98; Jäger 2015: 155).
Ich wende mich gegenjede Form einer imaginierten und propagierten Alternativlosigkeit zum Status Quo1 des Plattformkapitalismus2 und aller anderen Kapitalismen und erhebe meine Stimme für den Mut zur direkten Utopie, für die Realisierung des Traums von einer Welt, in der alle Menschen weltweit die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten und u.a. mit Hilfe von Technologien die Lebensgrundlagen aller Menschen zu bewahren und langfristig im Einklang mit der Natur zu leben.
Ich denke, dass Technologien gezielt dazu eingesetzt werden können, ein gutes Leben für alle Menschen auf der Erde zu ermöglichen, anstatt wie bisher unnötigen Reichtum anzuhäufen (aus quantitativer Perspektive betrachtet meist nur als Einser und Nullen auf digitalen Konten) und die Lebensgrundlagen aller zu zerstören. Für eine Umsetzung müssten die Technologien jedoch neu überdacht und gestaltet werden. Das heißt, sie müssen u.a. von Hierarchien, dem Patriarchat und dem Kapital emanzipiert sein.3
Wie die politische Aktivistin Naomi Klein (2023: 53-62), distanziere ich mich davon, bestehende Technologien und seine Anhängerinnen als Feindbild heraufzubeschwören, noch zu glorifizieren und als eine Art von Rettung für die Menschheit zu sehen wie es Anhängerinnen der Ideologie4 des „Technologischen Determinismus“, des „Transhumanismus“ und des „Akzelerationismus“ machen (vgl. ebd.: 53-62). Denn meiner Meinung nach sind es die Menschen selbst, die für ihr Leben und das Wohl der Allgemeinheit Verantwortung übernehmen müssen. Dies kann kein anderes Wesen, keine Nation, keine individualistische Optimierungsideologie, oder keine Technologie.
Folglich bin ich persönlich voreingenommen gegenüber jeglicher Wahrheit und Normalität im Kapitalismus. Das Cyber Valley ist aus meiner Sicht ein Produkt der herrschenden Verhältnisse oder, wie es Siegfried Jäger (2015: 49) formuliert, des „zurzeit in der Bundesrepublik Deutschland vorherrschenden politischen Diskursfes]“, der von der „heute herrschenden Elite bzw. mediopolitischen Klasse“ geprägt wird. Dieser Diskurs wird von ihm „insgesamt als neokonservativ bzw. neoliberal geprägt und durchdrungen“ bezeichnet. Daran anlehnend handelt es sich beim Cyber Valley nach Ansicht des Verfassers dieser Arbeit um eine Initiative, die von neokonservativer Beeinflussung geprägt und von neoliberalen Grundsätzen durchdrungen ist, die die Erforschung, Entwicklung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) intensiviert, um daraus privaten Profit zu generieren und damit einhergehend Soziale Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung, Überwachung und Krieg fördert. Auch wenn die Initiatorinnen das Gegenteil behaupten (vgl. Marischka 2020: vgl. 66f; vgl. Thiemeyer et al. 2023: 56f., 59f.), zeigt schon allein der Name „Cyber Valley“ in Anlehnung an das Silicon Valley (vgl. Marischka 2020: 144; vgl. Thiemeyer et al. 2023: 54, 58) und die Selbstbezeichnung als „Forschungskonsortium“ (Cyber Valley 2023a) den unternehmerischen Fokus und den Anschluss an neoliberale Werte des Silicon Valley5. Mehr zum Cyber Valley im Kapitel II. Cyber Valley - Thematischer Hintergrund.
Neben meinem hier beschriebenen persönlichen Standpunkt und der damit einhergehenden Voreingenommenheit gegenüber dem Thema ist es nicht zu verleugnen, dass meine Auswahl des Themas, des Materials und der Methoden, sowie meine persönliche Interpretation der Theorie in den gesamten empirischen Arbeitsprozess eingeflossen sind. Jedoch versuche ich nun, den empirischen Arbeitsprozess nach bestem Wissen und Gewissen zu gestalten, um die damit einhergehenden potenziellen Verzerrungen in Bezug auf die Forschungsergebnisse möglichst gering zu halten. Diese Transparenz soll u.a. dazu beitragen, dass die Leserinnen dieser Arbeit eine bessere Basis haben, das Geschriebene kritisch zu beurteilen.
Motivation
Die Wahl meines Forschungsthemas in dieser Arbeit ist, neben meinem persönlichen Standpunkt, im Wesentlichen durch die folgenden drei Elemente motiviert.
Erstens, und u.a. übereinstimmend mit den netzforma* Aktivistinnen, dem AutorinnenKollektiv Qapulcu6 , dem AI Now Institute und Naomi Klein, bin ich der Auffassung, dass die von (größtenteils) kapitalistischen Großunternehmen im Internet eingesetzte KI bereits heute einen unberechenbaren und rasant wachsenden Einfluss auf die Prägung des Individuums und die Produktion der Gesellschaft und damit, um mit Jäger (2015: 88) zu sprechen, auf den Gesamtdiskurs hat (vgl. AI Now Institute 2023; vgl. Klein 2023: 53-62; vgl. Mühlhoff et al. 2019; vgl. netzforma e.V. 2021; vgl. Schwarz 2021). Ebenso hat der mediale Diskursstrang zu KI, wie noch zu zeigen sein wird, einen entscheidenden Einfluss auf das Bewusstsein der Menschen und prägt, wie andere Diskursstränge auch, das gesellschaftliche Gefüge maßgeblich mit (vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 13, 37). Er formt damit wiederum die Gestaltung von KI, welche wiederum Einfluss auf das Bewusstsein der Menschen nimmt, zum Beispiel in Form von ChatBots (wie Bart von Alphabet oder Chat GPT von Open AI) „im Sinne des Mainstreams“ (Simanowski 2023: 69) mit US-amerikanischer Akzentuierung (vgl. ebd.: 68ff.). Es entstehen sich verstärkende Wechselspiele7 (vgl. Jäger 2015: 26, 128; vgl. Simanowski 2023: 69; vgl. Morozov 2023). Daher hält der Verfasser eine wissenschaftliche Auseinandersetzung in Form einer KDA mit diesem Thema für unerlässlich, um gesellschaftliche Entwicklungen heute und in Zukunft (zumindest im Ansatz) verstehen zu können und dem „Technologischen Angriff“ und der damit einhergehenden „Digitalen Entmündigung“ perspektivisch etwas entgegen setzen zu können (vgl. Capuicu 2023; Mühlhoff et al. 2019: 103ff.).
Dies führt mich zum zweiten Punkt. Es ist mir ein Anliegen, die Gestaltung der KI-Technolo- gien nicht den von kapitalistischen Interessen geleiteten Kräften zu überlassen, da ich, wie eingangs erwähnt, genügend Phantasie habe, dass die Gestaltung der KI und die mit ihr verfolgten Ziele (im Sinne privatwirtschaftlichen Profits) grundlegend anders sein könnten.
Diese Motivation brachte mich bereits am 18.12.2018, noch vor Beginn meines Soziologiestudiums, dazu, eine Besetzung des Hörsaalgebäudes Kupferbau an der Universität Tübingen zu unterstützen. Das Motto der Aktion lautete „Wissenschaft für die Menschen - nicht für die Industrie, Überwachung und Krieg“. Darüber hinaus habe ich Audiobeiträge8 zu diesem Thema im Freien Radio mit meinen Kolleginnen der Sendung Resonanz Con(tra)sens seit 2017 veröffentlicht, um das Thema und die Kritik daran einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen (vgl. Marischka 2020: 30, 55; vgl. Resonanz Con(tra)sens 29.10.2017 & 07.12.2018).
Drittens sehe ich im Cyber Valley eine Vernachlässigung der Tatsache, dass Technik nicht einfach aufgrund ihrer funktionalen Eigenschaften vorhanden ist, sondern in sozialen Prozessen entsteht und entwickelt wird. Damit einhergehend wird im Cyber Valley die Frage „Wer oder was steuert die Technikentwicklung?“ (Rammert/Schulz-Schaeffer 2020: 674) und wer dabei wie viel Macht hat, völlig außer Acht gelassen.
Die techniksoziologische Perspektive, wie sie im Zuge der Techniksoziologie und den Science and Technology Studies entwickelt wurde stellt genau jene Frage ins Zentrum (vgl. ebd.: 674f.).
Nach Werner Rammert und Ingo Schulz-Schaeffer (2020: 672) wird deutlich, dass Technologien und technische Prozesse von Menschen entworfen und gestaltet werden und sich ihre Bedeutung und Sinnhaftigkeit aus den „menschlichen Handlungszielen“ und den „sozialen Praktiken“, in die sie eingebettet sind, ergibt (vgl. ebd.).
Im Cyber Valley scheint eine verbreitete Sichtweise vorzuherrschen, die auch Rammert und Schulz-Schaeffer (vgl. ebd.) beschreiben, welche „die Welt des Sozialen und die Welt des Technischen [als] zwei voneinander getrennte Wirklichkeitsbereiche“ begreift (ebd.). Demnach kommt „Die Gesellschaft, so diese Vorstellung, [...] erst ins Spiel, wenn es um die Frage geht, ob, wie und wofür diese Funktionalitäten genutzt werden können und sollen“ (ebd.). Diese Auffassung zeigt sich in deutlicher Weise im Cyber Valley, obwohl dessen Beirat Public Advisory Board und die Public Engagement Managerinnen des Cyber Valley auf den ersten Blick eine andere Sichtweise vertreten (vgl. Cyber Valley 2023d & 2023e). Dabei können die Public Engagement Managerinnen ihre Sichtweisejedoch nicht glaubwürdig vertreten, da sie einseitig Partei für das Cyber Valley in seiner aktuellen Verfasstheit ergreifen.
Dies wird zum Beispiel im Interview vom 08.04.2021 mit Patrick Klügel, einem der Public Engagement Managerinnen, deutlich, der sich als Moderator sieht, der den Dialog organisiert, das Cyber Valley in seiner gegenwärtigen Form aber absolut unkritisch darstellt (vgl. Cyber Valley 08.04.2021).
Rammert und Schulz-Schaeffer (2020: 674) stellen fest, dass „die jeweilige geschichtliche und gesellschaftliche Situation, in der Techniken entwickelt werden, eine entscheidende Rolle“ spielt und dass „ökonomische Logik [...] letzten Endes die technische Entwicklung [bestimme] - darin waren sich Karl Marx und Max Weber einig“. So gesehen ist es nicht verwunderlich, dass das Cyber Valley nach der vorherrschenden „ökonomischen Logik“ funktioniert.
Diese drei Punkte und ihre Verschränkungen sowie die im folgenden erörterte DiskursForschungslücke, machen das Thema für mich persönlich und damit aus meiner subjektiven Perspektive, die nicht unabhängig vom vorherrschenden Diskurs verstanden werden kann, zu einem lohnenden und konfliktgeladen Thema für die KDA.
Diskurs-Forschungslücke
Es besteht eine erhebliche Forschungslücke hinsichtlich der (kritischen) Erforschung des Diskursstrangs des Cyber Valley und damit der Art und Wirkung des Diskurses in diesem Kontext.
Die einzige dem Verfasser bekannte Publikation in dieser Richtung, wenn auch ohne die Anwendung der KDA, ist das Buch Cyber Valley - Unfall des Wissens. Künstliche Intelligenz und ihre Produktionsbedingungen - Am Beispiel Tübingen von Christoph Marischka aus dem Jahr 2020. Der in Tübingen lebende Antimilitarist und Sozialwissenschaftler Marischka legt in diesem Buch den Schwerpunkt auf die kritische Auseinandersetzung mit den Auswirkungen und Bedingungen der Entwicklung von KI in diesem spezifischen Kontext. Marischka untersucht, wie KI-Systeme in einer zunehmend vernetzten und datengetriebenen Welt entstehen und welche sozialen und politischen Machtstrukturen damit einhergehen. Er setzt sich kritisch mit der Rolle von Akteurinnen wie Universitäten, Unternehmen und politischen Entscheidungsträgerinnen auseinander und fragt nach den Folgen der KI-Entwicklung für die Gesellschaft (vgl. Marischka 2020).
Unabhängig von Cyber Valley und der Methode der KDA sind die Produktionsbedingungen von KI ein Thema, das in den letzten Jahren vermehrt Gegenstand verschiedener Publikationen und Diskussionen war. Im Fokus stehen dabei zunehmend die ethischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen der Entwicklung, Implementierung und Nutzung von KI-Systemen im Kontext einer enormen Machtkonzentration und Intransparenz in diesem Bereich (vgl. Christian 2020; vgl. Crawford 2021; vgl. Lovink 2022; vgl. netzforma e.V. 2021; vgl. O’Neil 2016; vgl. Schadt 2022).
Die Autorin Kate Crawford (2021) argumentiert in ihrem Buch Atlas of AI - Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence für ihre These „KI ist weder intelligent noch künstlich“ (Crawford 2021: 8, aus dem Englischen übersetzt vom Verfasser) und dass KI entwickelt wurde, um zu diskriminieren, wie sie in Kapitel IV. Classification erläutert (vgl. ebd.: 123-150).
In der Diskussion über die Produktionsbedingungen von KI wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Entwicklung und Produktion von KI-Systemen in den Zuständigkeitsbereich öffentlicher und nicht kommerzieller Akteurinnen fallen sollte. Dabei werden (genau wie bei der Protestbewegung gegen das Cyber Valley) eine Gemeinwohl-Orientierung, demokratische Kontrolle und eine Zivilklausel9, welche eine Kooperation mit militärischen Instanzen und eine militärische Nutzung verhindern soll, gefordert (vgl. Marischka 2023: 55-60).
Eine entsprechende Publikation des Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung (DISS) oder andere Forschungsarbeiten, die die KDA auf dieses spezifische Thema anwenden, konnte der Verfasser bisher nicht finden.
Die vorhandene Forschungslücke bezüglich des Diskursstrangs zum Cyber Valley und dessen Auswirkungen besteht darin, dass bisher nur eine begrenzte kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema vorliegt und Kritische Diskursanalysen des Diskursstrangs vollständig fehlen.
Theorie und Methodenwahl
Der Verfasser hat sich bewusst für die KDA entschieden, da es sich um eine explizit macht- und gesellschaftskritische Theorie und Methode handelt (vgl. Jäger 2015: 91; vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 6).
Die KDA, wie sie in dem Werk Kritische Diskursanalyse von Jäger aus dem Jahr 2015 in der siebten Auflage vorliegt, sowie das begleitende Buch Lexikon Kritische Diskursanalyse: Eine Werkzeugkiste von Jäger und Zimmermann aus dem Jahr 2019 in der zweiten Auflage sind in Bezug aufTheorie, Methode und Aufbau die für die vorliegende Arbeit maßgeblichen Werke. Die Theorie wird in Kapitel III. Theoretischer Rahmen der KDA und die Methode im Kapitel IV. Methodisches Verfahren der KDA erläutert.
Die KDA verfolgt einen interventionistischen Wissenschaftsansatz, der sich für interventionistisches wissenschaftliches Arbeiten ausspricht (vgl. Jäger 2015: 11). Er entspricht am ehesten der gegenwärtigen persönlichen Haltung des Verfassers, seiner Herangehensweise und seiner Forschungsfrage, da dadurch Diskurse kritisch hinterfragt und problematisiert werden können. Darüber hinaus können auf Basis der Analyse Empfehlungen für Medienvertreterinnen formuliert werden (vgl. Angermuller et al. 2014: 89f.; vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 22f.).
Vor diesem Hintergrund sieht der Verfasser in der KDA eine erfolgversprechende Methode, um seine Wünsche und Träume zu verfolgen, die eng mit den Träumen Michel Foucaults „Träume von einer besseren und gerechteren Welt“ (Jäger 2015: 78) verbunden sind, wie sie Jäger zusammenfassend beschreibt und die er selbst verfolgt (vgl. ebd.: 152).
Ich bin mir bewusst und bedauere, dass diese Art der Darstellung von meiner Haltung in dieser Form und Struktur nicht den vorherrschenden Erwartungen an eine Bachelorarbeit entspricht. Dies liegt vermutlich daran, dass in den Wissenschaften im Allgemeinen und damit auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften immer noch häufig die Auffassung vertreten wird, wissenschaftliche Methoden könnten neutral sein (vgl. ebd.: 25, 110; vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 6f.). Dieser Auffassung widerspricht Jäger grundlegend mit der Äußerung „Wissenschaft ist immer schon politisch“ (Jäger 2015: 11; vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 7, 98). In Übereinstimmung mit Foucault gibt es für die forschende Person, mit den Worten Jägers, „keinen neutralen Ort, an den man sich zurückziehen kann“ (Jäger 2015: 127). In der vermeintlichen Neutralität der Wissenschaft und ihrer Methoden manifestieren sich bestehende Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die stets den eigenen Zwecken und denen des hegemonialen Diskurses dienen und nicht denen aller Menschen fernab kapitalistischer Verwertung (vgl. ebd.: 10, 25, 150f.; vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 7, 24).
Ausgehend von dieser Behauptung, welcher ich zustimme, ist es in der KDA unabdingbar, den eigenen Standpunkt möglichst selbstreflexiv und transparent darzulegen (vgl. Jäger 2015: 10f.; vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 114). Die Darlegung meines Standpunktes ist somit notwendiger Teil des Prozesses der KDA als solcher (vgl. Jäger 2015: 91).
Methode der Kritischen Diskursanalyse
Die Methode der KDA ermöglicht eine politische Analyse sprachlicher Performanzen. Jäger (2015) schlägt in Kapitel VI. Die Methode der Diskurs- und Dispositivanalyse: eine »Gebrauchsanweisung« zehn Schritte zur Durchführung einer KDA vor, die jedoch in ihrer Art, Reihenfolge sowie Anzahl (entsprechend des Forschungsgegenstands bzw. der Fragestellung) spezifisch modifiziert werden können (vgl. Jäger 2015: 90 bis 111). Zunächst wird das Ziel der Untersuchung benannt, der theoretische Hintergrund skizziert und die gewählte Methode erläutert (Schritt 1). Der Untersuchungsgegenstand ist genau zu benennen und zu begründen (Schritt 2), ebenso die Materialgrundlage (Schritt 3). Es folgt eine Strukturanalyse mit Zusammenfassung und Voranalyse zur Auswahl eines typischen Artikels (Schritt 4). Daran schließt sich die Feinanalyse und ihre Zusammenschau (Schritt 5) und die Ermittlung des unmittelbaren diskursiven Kontextes (Schritt 6) an. Danach wird eine zusammenfassende Diskursanalyse mit Bezug auf Struktur- und Feinanalyse durchgeführt (Schritt 7). Kritik (Schritt 8), Vorschläge zur Bekämpfung und/oder Vermeidung der kritisierten Diskurse (Schritt 9) und Reflexionen zur Gültigkeit (Schritt 10) schließen die KDA ab (vgl. ebd.).
Auftau der Arbeit
Die Gliederung der Arbeit orientiert sich an den zehn Schritten der Kritischen Diskursanalyse (KDA) nach Jäger (vgl. ebd.). In der vorliegenden Einleitung (Kapitel I) werden bereits wichtige Aspekte der Schritte 1 und 2 nach Jäger (vgl. ebd.) berücksichtigt. Kapitel II befasst sich mit dem thematischen Hintergrund des Cyber Valley. In Kapitel III wird der theoretische Rahmen der KDA einschließlich der zentralen Begriffe vorgestellt. Kapitel IV befasst sich mit dem methodischen Verfahren und den angewandten Analysemethoden der KDA (Strukturanalyse, Feinanalyse und Analyse des gesamten Diskursstranges). Diese Methoden werden ausführlich erläutert und begründet.
Im Kapitel V erfolgt die empirische Untersuchung des öffentlichen Diskurses über das Cyber Valley und seine Initiative. Zunächst nennt der Verfasser drei Vorannahmen zum Diskursstrang des Cyber Valley. Die Materialgrundlage der Untersuchung wird vorgestellt und die Strukturanalyse wird durchgeführt. Zunächst erfolgt eine tabellarische Erfassung von 14 Diskursfragmenten, die im Anhang zu finden sind. Auf dieser Grundlage erfolgt die Materialaufbereitung, die sich auf die Zusammenschau von Aussagen, Themen und Normalismen konzentriert. Im Anschluss daran wird auf das Sagbarkeitsfeld innerhalb des Diskursstrangs und den Raum für Kritik im Diskursstrang eingegangen.
Basierend auf den Ergebnissen der Strukturanalyse wird die Auswahl der Diskursfragmente für die Feinanalyse begründet. Diese Begründung wird anschließend mit Hilfe der aspektorientierten Analyse nach Friede et al. (2022) am Material- Korpus überprüft. In der anschließenden Feinanalyse werden die Darstellung des Wissens und die Mittel, mit denen bestimmte Wirkungen erzielt werden, anhand der im Methodenteil beschriebenen Schritte näher untersucht.
Im Kapitel VI. Analyse des gesamten Diskursstranges werden die Ergebnisse der Struktur- und Feinanalyse zusammengefasst. Kapitel VII. Kritik enthält Kritikpunkte, die auf diesen Erkenntnissen aufbauen. In Kapitel VIII. Vorschläge zur Veränderung des kritisierten Diskurses werden Handlungsempfehlungen für Medienvertreterinnen ausgesprochen. Abschließend werden im Fazit u.a. die Grenzen der Untersuchung aufgezeigt und Möglichkeiten für zukünftige Forschungen sowie alternative Forschungsansätze zum Thema erörtert.
II. Cyber Valley - Thematischer Hintergrund
Das Cyber Valley befindet sich in der Region Stuttgart-Tübingen in Südwestdeutschland und ist einer von mehreren KI-Standorten, die in den letzten zehn Jahren im süddeutschen Raum10 realisiert wurden oder geplant sind (vgl. Digitalisierungsstrategie 2017: 24, 31, 98f.).
Es werden Gründung, Ziele und Struktur des „Ökosystems“11 einschließlich der beteiligten Akteurinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik vorgestellt.
Zudem werden das Kooperationsmodell zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, die interdisziplinäre Zusammenarbeit, der Technologietransfer sowie die Bildungsförderung im Kontext der KI-Forschung und -Entwicklung behandelt. Abschließend wird die Struktur des Cyber Valley, die Rolle von Amazon sowie die Gründung des Public Advisory Board erläutert.
Vorabjedoch zwei Anmerkungen, die sich zum einen auf die Quellen beziehen, die zur Erläuterung des Cyber Valley herangezogen wurden, und zum anderen auf das, was im Cyber Valley und in dieser Arbeit unter dem Begriff,,Künstliche Intelligenz“ verstanden wird.
Dieses Kapitel basiert hauptsächlich auf Informationen aus offiziellen Quellen wie der Internetseite des Cyber Valley und der Unterseite „Häufig gestellte Fragen“ (www.cyber-valley. de/de/faqs) sowie der Publikation „Digitalisierungsstrategie 2017“ des Landes Baden-Württemberg. Mit aktuellen Informationen aus der Publikation Cyber and the City. Künstliche Intelligenz bewegt Tübingen zur gleichnamigen Ausstellung im Tübinger Stadtmuseum im Jahr 2023 wird die Darstellung des Cyber Valley ergänzt. Zunächst wird der Begriff„Künstli- che Intelligenz“ beschrieben, da er für den Kontext des Cyber Valley und des Diskursstrangs von zentraler Bedeutung ist.
Auf der Internetseite von Cyber Valley werden als Künstliche Intelligenz (KI) intelligente digitale Systeme beschrieben, die auf maschinellem Lernen basieren. Sie sind in der Lage, Regelmäßigkeiten in Datensätzen zu erkennen, Vorhersagen zu treffen und Aufgaben selbstständig zu erledigen (vgl. Cyber Valley 2023b). Als Anwendungsbereiche dieser Technologie werden das autonome Fahren, die automatische Bildverbesserung, die maschinelle InternetSuche und Roboterassistenten im Haushalt genannt (vgl. ebd.).
Wie Jean-Marcel Krausen (2023: 10ff.), wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Recht der Digitalisierung und Innovation an der Universität Bielefeld, ausführt, gibt es bislang weder für den Begriff „Intelligenz“ noch für „Künstliche Intelligenz“ (englisch Artificial Intelligence, kurz AI) eine allgemein anerkannte Definition. Was seiner Meinung nach u.a. „[...] deutlich macht, dass es nicht die eine KI gibt“ (ebd.: 19). Aus diesem Grund und auch, weil KI in dieser Arbeit hauptsächlich im Kontext des Cyber Valley eine Rolle spielt, wird auf das Verständnis von KI des Cyber Valley zurückgegriffen. Bei dieser Beschreibung von KI handelt es sich um „schwache“ KI, also die Art von KI, wie sie bisher vorliegt, das heißt eine KI, die ausschließlich von Menschen festgelegte Aufgaben bearbeitet, indem sie menschliche Intelligenz simuliert (vgl. ebd.: 24). Im Gegensatz dazu steht die „starke“ KI, also eine KI, die sich unabhängig vom Menschen selbst steuert und in ihrem Denken und Fühlen dem Menschen gleicht, also eine KI, die bisher nur in der Vorstellung des Menschen vorhanden ist (vgl. Krausen 2023: 24).
Das Cyber Valley wurde am 15. Dezember 2016 auf Initiative von Bernhard Schölkopf, Direktor am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (MPI IS), einer Einrichtung der renommierten Max-Planck-Gesellschaft (MPG), als strategische Geschäftsbeziehung zwischen der MPG, den Universitäten Stuttgart und Tübingen, Industriepartnerinnen und der Landesregierung Baden-Württemberg gegründet (vgl. Digitalisierungsstrategie 2017: lOf.). Ausgangspunkt für die Gründung war u.a. die Annahme, dass KI zunehmend Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft gewinnt und eine Bündelung von Kompetenzen und Ressourcen für den Erhalt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit unerlässlich schien (vgl. Cyber Valley 2023b) sowie, damit einhergehend, „[d]ie Angst um den Industriestandort (und damit den Wohlstand in) Baden-Württemberg“ (Thiemeyer et al. 2023: 58). Erklärtes Ziel von Cyber Valley ist und war es, die Forschung und Entwicklung im Bereich KI und Robotik zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik in diesem spezifischen Bereich zu stärken (vgl. Cyber Valley 2023b). Dies sollte durch ein „KI-Ökosys- tem“ nach dem Vorbild des Silicon Valley in den USA erreicht werden (vgl. Thiemeyer et al. 2023: 58).
Das Cyber Valley kann auch als Teil der „Initiative 4.0“ der Bundesregierung betrachtet werden, nach welcher „wo immer sinnvoll“ auf das Modell der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Forschung und Privatwirtschaft gesetzt wird (Digitalisierungsstrategie 2017: 15; vgl. Thiemeyer et al. 2023: 62f.).
Seit seiner Gründung hat sich das Cyber Valley, das sich auch als interdisziplinäres Forschungsnetzwerk präsentiert, nach eigenen Angaben zu einem dynamischen Forschungsund Innovationszentrum entwickelt, das talentierte Forscherinnen aus aller Welt anzieht, wodurch es zu einem bedeutenden Akteur in der globalen KI-Gemeinschaft geworden ist (vgl. Cyber Valley 2023b).
Zu den Industriepartnerinnen zählen große Unternehmen wie Amazon, BMW AG, IAV GmbH, Mercedes-Benz Group AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Robert Bosch GmbH und ZF Friedrichshafen AG (vgl. Cyber Valley 2023b). Finanziell unterstützt wird das Projekt u.a. von der Christian Bürkert Stiftung, der Gips-Schule Stiftung, der Vector Stiftung und der Carl Zeiss Stiftung (vgl. ebd.) sowie der Hector Stiftung (vgl. Thiemeyer et al. 2023: 60f.). Diese Industriepartnerinnen und Stiftungen beteiligen sich an der Finanzierung von Professuren und Forschungsgruppen an den Universitäten Tübingen und Stuttgart sowie am MPI IS (vgl. Cyber Valley 2023b).
Das Cyber Valley fungiert als Plattform für den Austausch von Wissen und Ressourcen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlichen Einrichtungen und konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklung von KI in Bereichen wie maschinellem Lernen, Computer Vision und Robotik (vgl. Cyber Valley 2023b; vgl. Thiemeyer et al. 2023: 55f.).
Laut Cyber Valley ist eine besondere Stärke das Kooperationsmodell zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, das einen engen Austausch zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen ermöglichen soll (vgl. Cyber Valley 2023b). Internationale Kooperationen werden gefördert, um den globalen Austausch von Wissen, Talenten und Ressourcen zu fördern und den Zugang zu internationalen Netzwerken und Märkten zu ermöglichen (vgl. ebd.). Auch die Unterstützung von Unternehmensgründungen gehört zu den zentralen Aufgaben des Cyber Valley. Dabei soll durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen und die Schaffung eines günstigen Umfelds für Start-ups der Transfer von KI-Technologien in den Markt beschleunigt werden (vgl. ebd.; vgl. Thiemeyer et al. 2023: 57). Dies wiederum soll die wirtschaftliche Entwicklung, den Technologietransfer und die Umsetzung von Forschungsergebnissen vorantreiben (vgl. Cyber Valley 2023b).
Im Cyber Valley findet ein vielfältiger Austausch zwischen Wirtschaft und Hochschulen bzw. öffentlichen Einrichtungen statt (vgl. Thiemeyer et al. 2023: 56f.). Eine wichtige Form dieses Austausches sind gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte, bei denen auch ein Austausch von Mitarbeiterinnen zwischen Industrie und Hochschule stattfindet (vgl. ebd.: 59). Wissenschaftlerinnen arbeiten zeitweise in Unternehmen dies soll den Wissenstransfer fördern und die Verbindung zwischen Forschung und Praxis stärken (vgl. Cyber Valley 2023b). Das Cyber Valley fungiert auch als Plattform für den Transfer von geistigem Eigentum und ermöglicht Unternehmen den Zugang zu neusten Forschungsergebnissen, um deren rasche Umsetzung in kommerziellen Anwendungen sicherzustellen (vgl. ebd.).
Eine weitere selbst erklärte Aufgabe von Cyber Valley ist die Förderung der Aus- und Weiterbildung im Bereich der KI. Das Projekt unterstützt Bildungsprogramme, die Studierenden praktische Erfahrungen in der Industrie ermöglichen (vgl. ebd.). Umgekehrt bieten die Partnerinnenunternehmen von Cyber Valley Praktika, Mentoring-Programme und Gastvorlesungen an, um den Wissenstransfer fördern (vgl. ebd.).
Die Struktur des Cyber Valley beruht laut dessen Selbstdarstellung auf einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, in der die verschiedenen Akteurinnen ihr Wissen, ihre Ressourcen und ihre Expertise teilen, um gemeinsame Ziele im Bereich der KI und Robotik zu erreichen. Ein zentraler Lenkungsausschuss sorgt für die strategische Ausrichtung und Umsetzung der Projekte im Cyber Valley (vgl. Cyber Valley 2023b).
Amazon im Cyber Valley
Im Rahmen von Cyber Valley spielt der Konzern Amazon eine wichtige Rolle als Industriepartner und unterstützt aktiv die Förderung von KI und deren Anwendungen (vgl. Thiemeyer et al. 2023: 59). Die Zusammenarbeit zwischen Amazon und dem Cyber Valley umfasst verschiedene Aspekte wie gemeinsame Forschungsprojekte, den Austausch von Wissen und Ressourcen sowie finanzielle Unterstützung (vgl. ebd.: 57ff.). Als Beispiel sei hier der Gründungsdirektor des MPI IS selbst genannt, so heißt es in Cyber and the City. Künstliche Intelligenz bewegt Tübingen: „Schölkopf ist - wie weitere Mitarbeiterinnen des MPI und der Universität - in Nebentätigkeit bei Amazon beschäftigt“ (ebd.: 59).
Reaktion auf Proteste
Im August 2019 wurde als Reaktion auf Proteste im Rahmen des Cyber Valley ein Public Advisory Board (PAB), ein öffentlicher Beirat, eingerichtet (vgl. ebd.). Dieser Beirat repräsentiert eine gemeinsame Kommission aus Vertreterinnen der Politik, Wissenschaft und Wirtschaft (vgl. Cyber Valley 2023d). Die Hauptaufgabe des PAB besteht darin, wissenschaftliche Projekte zu bewerten, die aus dem Forschungsfonds des Cyber Valley finanziert werden sollen (vgl. ebd.). Es geht um Projekte, die vom Forschungsfonds finanziert werden, der wiederum von Industriepartnerinnen gefüllt wird (vgl. Thiemeyer et al. 2023: 59).
III. Theoretischer Rahmen der KDA
Dieses Kapitel widmet sich den theoretischen Grundlagen der KDA gemäß Jäger, einer spezifischen Methode der Diskursanalyse (vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 35). Eine erfolgreiche Anwendung der KDA erfordert eine fundierte theoretische Basis, wie Jäger betont (Jäger 2015: 19). Die KDA nach Jäger ist eine qualitative sozialwissenschaftliche Methode, die maßgeblich von Jäger und dem DISS entwickelt wurde.12
Das DISS analysiert hauptsächlich Diskurse in Medien und im Alltag unter Verwendung klassischer grammatischer und rhetorischer Mittel (vgl. Angermuller et al. 2014: 89f.). Ein spezielles Interesse gilt der Rolle der Presse (medialer Diskursstrang) bei der Produktion und Verfestigung von Diskriminierung (vgl. ebd.). Ziel des Ansatzes ist es u.a., Journalistinnen ein Bewusstsein dafür zu vermitteln, dass sie als Medienvertreterinnen Macht haben und durch ihr eigenes Sprachverhalten zum Abbau diskriminierender Vorurteile gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten beitragen können (vgl. ebd.).
Nach Jäger (2015) ist die KDA ein Teil der „ Cultural Studies [...] die sich als prinzipiell kontextuell, theoriegeleitet, interventionistisch, inter- und transdisziplinär sowie selbstreflexiv verstehen“ (Jäger 2015: 11, kursiv im Original). Dabei wird ihre Eigenständigkeit jedoch gewahrt (vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 35).
Jäger führt die Arbeit von Jürgen Link und seinem Team13 fort. Diese haben versucht, die Methoden von Foucault sichtbar zu machen und weiterzuentwickeln (vgl. Jäger 2015: 17 ff., 25f.; vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 8 ff.). Die Fortführung dieses Strangs mündete bei Jäger mit Unterstützung aller Mitarbeiterinnen des DISS in der KDA, wie sie in dem Werk Kritische Diskursanalyse von 2015 (in der siebten Auflage) vorliegt. In dieser Auflage präzisiert Jäger die Begriffe Diskurs und Dispositiv und erläutert den politischen Nutzen der KDA(vgl. Jäger 2015: 7).
Die KDA betrachtet sich als eine methodische „Werkzeugkiste“ im Sinne Foucaults (vgl. Jäger 2015: 77). Mit ihr können die wechselseitig aufeinander bezogenen Strukturen von Macht und Wissen analysiert werden (vgl. ebd.: 18f.).
Im Folgenden werden die zentralen Überlegungen und Begriffe von Foucault erläutert, die der Kritischen Diskursanalyse zugrunde liegen und für diese Arbeit von Bedeutung sind.
III. I. Macht und Wissen
Foucaults Macht-Wissen-Theorie beschreibt das relationale Verhältnis von Wissen und Macht in der Gesellschaft (vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 10f.). Macht und Wissen sind nach dieser Theorie untrennbar miteinander verbunden und durch mündliche oder schriftliche Äußerungen wird Wissen transportiert, das Verhalten und weitere Diskurse beeinflussen kann. Diese Diskurse tragen dazu bei, Macht- und Herrschaftsverhältnisse in der Gesellschaft zu strukturieren (vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 10). Ein Diskurs ist demnach ein komplexes System der Bedeutungserzeugung, das eng mit Macht und Wissen verbunden ist.
In seinen Arbeiten definiert Foucault „Wissen“ als die Summe der Erkenntnisprozesse und Wissenseffekte, die zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einem bestimmten Bereich akzeptabel sind. „Macht“ hingegen umfasst eine Vielzahl einzelner Mechanismen, die in der Lage sind, Verhalten oder Diskurse zu beeinflussen und sie kann als eine Art „Netz“ gedacht werden, in welches alles, wenn auch nicht mit gleichmäßiger (Diskurs-)Macht, eingeflochten ist (vgl. Jäger 2015: 137f.; vgl. Jager/Zimmermann 2019: 44). Foucault untersuchte die komplexen Beziehungen zwischen Wissen und Macht in verschiedenen Gesellschaften und zeigte, dass Wissen nur dann als Element funktionieren kann, wenn es einem System spezifischer Regeln und Zwänge entspricht. Gleichzeitig kann Macht nur als Mechanismus funktionieren, wenn sie sich in Verfahren und Mittel-Zweck-Beziehungen entfaltet, die in Wissenssystemen verankert sind. Diese Theorie ist von zentraler Bedeutung für das Verständnis der gegenseitigen Abhängigkeit von Wissen und Macht in der Gesellschaft und ihrer wechselseitigen Beeinflussung.
III. II. Diskursbegriff
Jäger folgt dem DiskursbegriffFoucaults und bezieht sich dabei auch auf die Foucault-Rezeption von Jürgen Link (vgl. Jäger 2015: 10, 36f., 135). In Anlehnung an Foucault versteht Link Diskurse als strukturierte und institutionalisierte Aussagen, die durch ihre Verknüpfung mit Handlungen Macht-Wirkungen entfalten können (vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 37).
So sind Diskurse als „eine Menge von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem zugehören“ (Foucault 1988: 156) zu verstehen. Dabei wird von Link hervorgehoben, dass Diskurse keine rein sprachlichen Phänomene sind, sondern ein Zusammenspiel von Sprache, Macht und Wissen darstellen, das bestimmte Wissensbestände und Werte legitimiert und gleichzeitig Machtverhältnisse „der bürgerlich-kapitalistischen neo-liberalen Gesellschaft“ reproduziert und stabilisiert (Jäger 2015: 25; vgl. Jäger 2015: 25f.). Diskurse sind dabei nicht statisch, sondern durch historische, politische und gesellschaftliche Entwicklungen ständigen Veränderungen und Umdeutungen unterworfen (vgl. ebd.: 86). Diskurse haben somit nicht nur eine beschreibende Funktion, sondern auch normative und praktische Auswirkungen auf unser Denken und Handeln (vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 8 ff., 11; vgl. Jäger 2015: 17ff., 125).
Diskurse als „ "Träger« von (jeweils gültigem) »Wissen« “ (Jäger/Zimmermann 2019: 11, kursiv im Original) und gesellschaftliche Deutungsmuster prägen als wirklichkeitsgenerierende Praktiken das Bewusstsein der Subjekte, da „[...] Wirklichkeit nach Maßgabe der Diskurse von den über Wissen verfügenden Menschen gedeutet wird“ (Jäger 2015: 36) und strukturieren damit das gesellschaftliche Leben, indem sie die Art und Anzahl der Aussagen, sowie ihre Beziehungen untereinander regulieren (vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 13f, 37f.). Die Diskurse stellen die Gesamtheit der Aussagen dar, die kollektiv organisiert sind und regeln, was zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt werden kann und was nicht (vgl. ebd.: 29ff.). Sie sind somit die konstituierenden Kräfte, die den Rahmen für die Bildung und Verbreitung von Aussagen setzen. Jäger unterstreicht, dass Diskurs(e) als „vollgültige Materialitäten“ (ebd.: 13) zu betrachten und als „materiell und praktisch wie das Bauen eines Hauses“ zu begreifen sind (Jäger 2015: 36).
Eine prägnante Definition des Diskurses liefert Jäger, indem er ihn als „Fluss des Wissens durch Zeit und Raum“ beschreibt (ebd.: 29). Ein Diskurs setzt sich aus unterschiedlichen Einheiten zusammen. Die kleinste Einheit des Diskurses ist die Aussage (vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 30f.) und der Diskurs eine Form von Aussagepraktiken, „die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen“ (Foucault 1973: 74). Eine Aussage ist eine abstrakte Proposition, die als inhaltliche Grundaussage fungiert, während die konkrete schriftliche oder wörtliche Äußerung mit ihren rhetorischen und stilistischen Mitteln ihre spezifische Darstellungsform ist (vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 29ff.).
Das nächst größere Element des Diskurses bildet das Diskursfragment , welches als sprachliche Äußerungen oder Performanzen betrachtet werden kann (vgl. ebd.: 37, 39f), die eine oder mehrere Aussagen transportieren und einen „thematisch einheitlichen Text oder Textteil“14 bilden (ebd.: 39). Ein Text kann sich demnach aus mehreren Diskursfragmenten zusammensetzen (vgl. ebd.). Diese Diskursfragmente fügen sich in einer begrenzten Ansammlung wiederum zu thematisch zusammenhängenden Diskurssträngen zusammen (vgl. Jäger 2015: 160; vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 39). Jäger (2015: 139) definiert Diskursstränge als „Bündelungen von inhaltlichen Verfestigungen [...] die historisch erarbeitet wurden und den Charakter von Regeln haben, denen die Menschen weitgehend routinehaft folgen“. Wie die Diskursfragmente können ebenso die Diskursstränge mit anderen Themen verknüpft sein und auf Verbindungen zu anderen Diskursfragmenten bzw. Diskurssträngen hinweisen. Solche Fälle in denen in einem Diskursfragment verschiedene Themen angesprochen werden werden Diskursverschränkung genannt, auch wenn nur ein Hauptthema angesprochen wird, in dem aber Bezüge zu anderen Themen hergestellt werden (vgl. Jäger 2015: 87). Diese Diskursverschränkungen fungieren als zentrales Bindeglied von Diskursen (vgl. ebd.: 89).
Der gesamte gesellschaftliche Diskurs setzt sich aus einer Vielzahl solcher Diskursstränge und Diskursverschränkungen „In einer gegebenen Gesellschaft in einer gegebenen Zeit an einem gegebenen Ort [...]“ (ebd.: 86) zusammen und stellt ein so genanntes diskursives Gewimmel dar, das wiederum Teil eines übergeordneten Weltdiskurses ist (vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 15f., 35, 86).
Jäger betont in diesem Zusammenhang, dass die Diskurspositionen innerhalb eines vorherrschenden Diskurses sehr homogen sind, was als Ergebnis des jeweils vorherrschenden Diskurses gesehen werden kann (vgl. Jäger 2015: 85). Mit Diskursposition ist „ein spezifischer politisch-ideologischer Standort einer Person, einer Gruppe oder eines Mediums gemeint“ (ebd.). Diskurspositionen, die sich vom vorherrschenden Diskurs abgrenzen, werden von Jäger als Gegendiskurse bezeichnet (vgl. ebd.).
Diskursebenen sind soziale Orte, von denen aus verschiedene Diskurse in Bereichen wie Wissenschaft, Politik, Medien, Bildung, Alltag und Wirtschaft stattfinden oder von denen aus sie aus einer bestimmten Perspektive adressiert werden (vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 17). Diese Ebenen wirken zusammen und beeinflussen sich gegenseitig (vgl. Jäger 2015: 83f.; vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 17). Medien nehmen Fragmente aus anderen Diskursen auf und bilden den Mediendiskurs, der weitgehend einheitlich ist, aber unterschiedliche Diskurspositionen enthält (vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 17f.). Es gibt intermediale Abhängigkeiten, bei denen die Medien voneinander abschreiben, oder bei denen sie von der gleichen ideologischen Position aus sprechen (vgl. Jäger 2015: 84). Diskursebenen basieren auf politischen, wissenschaftlichen und Alltagsdiskursen, die von den Medien aufgegriffen und in den Alltag zurückgetragen werden. Gesellschaftliche Eliten spielen bei der Entwicklung und Verfestigung von Diskursen eine wichtige Rolle, sie sind aber nicht die einzigen Akteure (vgl. ebd.: 83f.).
Des Weiteren kann festgehalten werden, dass es sich bei Diskursen um spezifische Formen der Bedeutungsproduktion innerhalb eines Dispositivs15 handelt, während es sich bei einem Dispositiv um ein umfassenderes Konzept handelt, das die Art und Weise beschreibt, wie Macht und Wissen in einer bestimmten Gesellschaft organisiert sind (vgl. Jäger 2015: 112ff.).
III. III. Wirklichkeit
Foucault weist daraufhin, wie Jäger (2015: 10f.) erläutert, dass die historische Position, an der sich die sprechende Person befindet, jeden wissenschaftlichen Standpunkt beeinflusst und es daher wichtig ist, dies bei der Interpretation von Wirklichkeiten zu berücksichtigen. Foucault sieht die wissenschaftlich forschende Person als Teil einer allgemeinen „Ordnung der Wahrheit“ (ebd.: 10), die für die Struktur und das Funktionieren der Gesellschaft grundlegend ist (vgl. ebd.: 10f). Jäger macht deutlich, dass Wahrheit nicht einfach eine Ansammlung von wahren Dingen ist, sondern vielmehr eine Ansammlung von Regeln, die bestimmen, was als wahr oder falsch zu gelten hat und die mit spezifischen Machteffekten einhergehen (vgl. ebd.: 11). Jäger weist auch daraufhin, dass Wissenschaft immer politisch ist und immer um Deutungen ringt und das „auch wenn sie beanspruchen, rein deskriptiv vorzugehen“ (Jäger 2015: 10).16 Er stellt ferner heraus, dass es keine absolute Werturteilsfreiheit gibt und dass Wissenschaftlerinnen aufklareBegriffe angewiesen sind (vgl. ebd.: 11).
III. IV. Normalismus und Kollektivsymbolik
Die Diskurstheorie, die der Kritischen Diskursanalyse zugrunde liegt, konzentriert sich auf das durch Diskurse vermittelte Wissen und den dadurch hervorgerufenen Macht-Wirkungen (vgl. Jäger 2015: 39). Um diese diskursiven Wirkungen von Macht analysieren zu können, akzentuiert Jäger (vgl. ebd.: 55) die Bedeutung diskursiver Kategorien des Normalismus und der Kollektivsymbolik.
In Anlehnung an Link (2006: 60) beschreiben Jäger und Zimmermann (2019: 87f) Normalismus als den Prozess, in dem in modernen Gesellschaften „Normalitäten“ durch diskursive Verfahren mit Hilfe von Kollektivsymbolik hergestellt und aufrechterhalten werden (vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 87ff). Jäger und Zimmermann merken an: „Normalismus [kann] als vorherrschender Kulturtyp westlicher Industriegesellschaften angesehen werden“ (ebd.: 88). Des Weiteren ist Normalismus von Normativität zu unterscheiden (vgl. ebd.). Normativität bezieht sich aufRegeln, die Menschen oder bestimmten Gruppen von Menschen vorschreiben, wie sie handeln sollen (vgl. ebd.). Diese Normen sind dem Handeln der Individuen „vorgeschaltet und prä-existent“ (ebd.).
Im Gegensatz dazu bezieht sich Normalität auf statistische Durchschnittswerte und kann daher erst im Nachhinein festgestellt werden (vgl. ebd.). Die Entwicklung einer normierten Gesellschaft erfordert daher als Grundlage die statistische Erfassung und Analyse wesentli- chergesellschaftlicherBereiche (vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 87ff.).
Es gibt zwei unterschiedliche Strategien, die (potenziell verschiebbaren) Grenzen der Normalität zu bestimmen: „protonormalistische“ und „flexibel-normalistische“ Strategien (Jäger 2015: 54), die beide die „latente[n] »Denormalisierungsangst«“ (ebd.) der Subjekte zum Ausgangspunkt haben (vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 88f.). Ziel des Normalismus ist es, dynamische Wachstumsprozesse zu steuern und zu regulieren. Er findet weltweit Anwendung in unterschiedlichen Kategorien von Normalität (vgl. ebd.: 89). In der KDA wird Normalismus als „diskurstragende Kategorie“ verstanden (vgl. ebd.).
Die Kollektivsymbolik umfasst nach Jäger und Zimmermann in Anlehnung an Link alle gemeinsamen Symbole, Gleichnisse und metaphorischen Modelle einer bestimmten Kultur (vgl. ebd.: 70). Kollektivsymbolik - auch Topoi genannt - sind sämtliche fest etablierte „kulturelle Stereotype[n]“ (ebd.: 20), die von allen ohne bewusste Reflexion verwendet werden (vgl. ebd.: 70). Sie ermöglicht es, Veränderungen in der Gesellschaft zu integrieren und zwischen dem, was als normal gilt, und dem, was davon abweicht, zu unterscheiden (vgl. ebd.). Sie ist auch als „wichtiges Bindemittel der Diskurse“ zu verstehen (vgl. ebd.: 20). Dabei werden durch die Verwendung von „Symbolserien“ sowohl die Innen- als auch die Außenwelt durch Zeichen und Symbole repräsentiert, wobei dem eigenen System „Subjektstatus im Sinne einer autonomen, zurechnungsfähigen, quasi juristischen Person“ zugesprochen wird (Jäger/Zimmermann 2019: 72). Die Kollektivsymbolik schafft ein imaginäres soziales und individuelles Ganzes, in dem sich die Menschen zu Hause fühlen (vgl. ebd.). Des Weiteren dient die Kollektivsymbolik dazu, Diskurse zu strukturieren und „aufgrund ihrer bildlichen Logik Handlungsanweisungen“ zu erteilen oder zu suggerieren (ebd.).
IV. Methodisches Verfahren der KDA
Die KDA baut, wie in der Einleitung und dem Kapitel zu Theorie bereits erwähnt, auf der Foucaultsche Diskurstheorie auf und versteht sich als unvollendet (vgl. Jäger 2015: 7f., 77f., 173). Jäger weist darauf hin, dass Foucault selbst keine in sich geschlossene Methode der Diskursanalyse formuliert hat, sein (sich zeitlebens in Bewegung befindendes) Vorgehen sich jedoch aus seinen Schriften rekonstruieren lässt (vgl. ebd.: 8). Des Weiteren merkt Jäger in Bezug auf die KDA an, dass „die methodische »Werkzeugkiste« immer »offen« ist für neue Instrumente und eigene Kreativität“ (ebd.: 112), wie es auch bei Foucault der Fall war (vgl. ebd.: 19, 77, 90). Voraussetzung für ein sinnvolles Funktionieren der Methode ist allerdings die Rückbindung an die Theorie (vgl. ebd.: 12).
In der nachfolgenden Beschreibung der Methode, die als Grundgerüst für den empirischen Teil dient, bezieht sich der Verfasser aufKapitel VI. DieMethode derDiskurs- undDispositi- vanalyse: eine «Gebrauchsanweisung«, des Buches Kritische Diskursanalyse: eine Einführung, geschrieben von Jäger (2015: 90 bis 111), bezogen.
Die Methode der KDA besteht demnach aus zehn Schritten, die im Folgenden kurz erläutert werden, um dann die Schritte „Strukturanalyse“ (4.), „Feinanalyse“ (5.), „Diskursiver Kontext“ (6.) und „Zusammenfassende Diskursanalyse“ (7.) näher zu erläutern, da sie für diese Arbeit am umfangreichsten sind.
Am Anfang stehen die Präzisierung der Untersuchungsziele, die Darstellung des theoretischen Rahmens, die Erläuterung der angewandten Methodik sowie die sorgfältige Definition und Begründung des Untersuchungsgegenstandes und der Materialgrundlage (vgl. ebd.: 90), wie sie bereits in den vorangegangenen Kapiteln behandelt wurden.
Danach erfolgt die sogenannte „Strukturanalyse“ mit einer Zusammenfassung und ersten Analyse der Texte, die als Grundlage für die Auswahl eines typischen Textes dient (vgl. Jäger 2015: 90). Anschließend werden Feinanalysen an den zuvor ausgewählten Texten durchgeführt und der (unmittelbare) diskursive Kontext ermittelt (vgl. ebd.: 91, 128).
Darauf folgt eine zusammenfassende Diskursanalyse, die auf der Struktur- und Feinanalyse aufbaut (vgl. ebd.: 91). Es folgen Kritik sowie Vorschläge zur Bekämpfung bzw. Vermeidung der kritisierten Diskurse (vgl. ebd.). Abschließend werden Schlussbetrachtungen zur Gültigkeit der Analyse und ethische Grundsatzüberlegungen angestellt (vgl. ebd.). Diese Betrachtungen und Überlegungen werden ebenso wie die Kritik nicht absolut gesetzt, sondern bewusst zur Diskussion gestellt.
IV. I. Strukturanalyse
Bei der Strukturanalyse wird zunächst jedes Diskursfragment17 in einer einzelnen Tabelle mit wichtigen Informationen wie u.a.: Datum, Autorin, Textsorte, Rubrik, Themen, Kollektivsymbole, Normalismen und Aussagen notiert (vgl. Jäger 2015: 83f., 96).
Die in den Strukturanalyse-Tabellen enthaltenen Informationen sind von grundlegender Bedeutung für die ordnungsgemäße Materialaufbereitung (vgl. ebd.: 110).
Die geordneten Strukturanalyse-Tabellen stellen das Ergebnis der Strukturanalyse dar. Sie geben zunächst einen ersten qualitativen und quantitativen Überblick, z.B. über die Art, Verteilung und Häufigkeit von Tabellenaspekten wie Aussagen und Kollektivsymbole (vgl. ebd.: 95).
Aufbauend auf diesen Erkenntnissen kann anschließend eine vertiefende analytische Interpretation erfolgen, die in einer Materialaufbereitung mündet. Hierbei liegt der Fokus primär auf der Erkundung des Sagbarkeitsfeldes - dem, was im Diskursstrang ausgedrückt wird, sowie dem, was nicht ausgedrückt und/oder bewusst ausgespart wird (vgl. Jäger 2015: 12). In diesem Zusammenhang wird auch geklärt, welche Gedanken im Diskursstrang präsent sind und welche nicht, und damit, welches Wissen jeweils als wahr akzeptiert wird und welches nicht, und was bereits als etablierte Geschichte gilt (Jäger/Zimmermann 2019: 106). Die Analyse des Sagbarkeitsfeldes zielt also darauf ab, die Grenzen und Strategien von Diskursen zu verstehen, die in ihrer Wirkung bestimmen, was gesagt werden kann und wie Aussagen im Kontext von Diskursen platziert werden (vgl. ebd.: 107.).
Abschließend wird der Artikel für die Feinanalyse bestimmt, in der u.a. die Tiefenstruktur der Aussagen ermittelt wird und die genauere Identifizierung weiterer Punkte der vorherigen Strukturanalyse-Tabellen erfolgt (vgl. Jäger2015: 95ff., 107).
Bei der Klassifizierung der Artikel in der Strukturanalyse ist die Kategorie „Themen und Unterthemen“ auch als direkter Hinweis auf den Diskursstrang zu verstehen und die Inhalte finden sich in der Kategorie „ Diskursebene “ (vgl. ebd.: 83f). Die jeweiligen Diskursstränge wirken auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen (vgl. ebd.). Beispielsweise erscheint das Thema Cyber Valley als spezifischer Diskursstrang auf der medialen Diskursebene und gleichzeitig als interdisziplinärer Diskursstrang auf den Ebenen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Bildung etc. Dabei werden die Texte nach inhaltlichen Schwerpunkten geordnet, ggf. Diskursverschränkungen identifiziert und die wichtigsten Themen erfasst (vgl. Jäger 2015: 87; vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 18).
Für die vorliegende Arbeit sind die aus den Diskursfragmenten identifizierten inhaltlich homogenen Aussagen, Kollektivsymbole und Normalismen, die in den Strukturanalyse-Tabellen festgehalten werden, von besonderer Bedeutung für erste Einschätzungen des Diskursstrangs und die daraus resultierende Auswahl typischer Diskursfragmente für die Feinanalyse.
IV. II. Feinanalyse
Die Feinanalyse dient der Ermittlung der Tiefenstruktur der Aussagen und erfordert u.a. die genaue Untersuchung der Aussagen im Zusammenhang mit anderen Faktoren der Materialaufbereitung sowie die Einschätzung ihrer Wirkung im unmittelbaren Kontext des Diskursstrangs (vgl. Jäger 2015: 99). Die Feinanalyse nach Jäger (2015: 98-111) soll die folgenden fünfPunkte ermitteln:
1. Institutioneller Rahmen: Der institutionelle Kontext des Diskursfragments wird anhand der Kategorien in der Strukturanalyse-Tabelle bestimmt (vgl. ebd.).
2. Textoberfläche: Hier werden die grafische Gestaltung, die Sinneinheiten und die angesprochenen Themen aufgedeckt (vgl. ebd.: 101f).
3. Sprachlich-rhetorischeMittel: Dieser ausführliche Schritt umfasst die linguistische Mikroanalyse des Diskursfragments, die sich u.a. mit der Kollektivsymbolik, ihrer Funktion und den Argumentationsstrategien befasst (vgl. Jäger 2015: 98).
4. Inhaltlich-ideologische (nicht sprachliche) Aussagen: Es wird erfasst, was zwischen den Zeilen zu lesen ist und welche unterschiedlichen Verständnisse und Vorstellungen diesen Aussagen zugrunde liegen (vgl. ebd.: 108).
5. Abschließende Gesamtanalyse des Diskursfragments (vgl. ebd.: 108-111).
In Schritt 5, dem letzten Schritt der Feinanalyse, erfolgt die abschließende Gesamtanalyse des jeweiligen Diskursfragments mit Hilfe der vorangegangenen vier Analyseschritte und der darin festgehaltenen ersten Eindrücke und spontanen Überlegungen (vgl. Jäger 2015: 108, 110).
Dabei wird ein vertieftes Verständnis des Gesamtdiskurses angestrebt, um dessen Wirkung auf die Gesellschaft und die einzelnen Akteurinnen besser begreifen zu können (vgl. ebd.: 108). Jäger (ebd.) betont die Bedeutung einer umfassenden Betrachtung, bei der eine bestimmte Anzahl von Texten mit der Feinanalyse untersucht werden muss, um den gesamten Verlauf des Diskursstranges zu erfassen und seine Entwicklung sowie seine Gesamtwirkung zu verstehen. Die Wirkungsanalyse des einzelnen Diskursfragments sollte immer einhergehen mit einem Blick auf dessen Verhältnis im Kontext des gesamten Diskursstrangs und auf mögliche Konsequenzen des diskursiv vermittelten Wissens für die vermutete Gesamtwirkung im Diskursstrang (vgl. ebd.; vgl. Jäger/Zimmermann 2019: 19).
Die Durchführung dieses Analyseschrittes sollte, wie die der vorangegangenen Schritte, möglichst neutral und objektiv erfolgen (vgl. Jäger 2015: 108), wobei Jäger anmerkt: „Nicht dem Fetisch Objektivität im Sinne naturwissenschaftlicher Scheinobjektivität aufsitzen!“ (ebd.: 110).
IV. III. Analyse des gesamten Diskursstranges
Im Anschluss an die Struktur- und Feinanalyse erfolgt eine Analyse des gesamten Diskursstranges, in der die wesentlichen inhaltlichen und formalen Merkmale sachlich und präzise dargestellt werden (vgl. Jäger 2015: 111). Dieser Schritt ist unentbehrlich, um aus den vorangegangenen Analysen einen Gesamteindruck zu gewinnen und darauf aufbauend Kritik zu formulieren.
V. Empirische Untersuchung
Die der empirischen Untersuchung vorangestellten Vorannahmen wurden bereits in der Einleitung dargelegt. Zur weiteren Transparenz und anschließenden kritischen Betrachtung (siehe Kapitel VII. Kritik) werden im Unterkapitel V. I. Vorannahmen zum Cyber Valley Diskursstrang drei Vorannahmen des Verfasser zusammengefasst.
Die hier vorliegende empirische Untersuchung nach der Methode der KDA befasst sich anschließend mit der Materialauswahl, welche zum Material- Korpus (des gesamten gesammelten und oberflächlich gesichteten Materials, Kapitel V. II. I.) führt und aus der die Auswahl für das Material- Dossier (die gezieltere Einordnung des Untersuchungsgegenstandes als Grundlage für die Struktur- und Feinanalyse, Kapitel V. II. II.) getroffen wird. Auf der Grundlage des Material- Dossiers wurde eine umfassende Strukturanalyse von 14 Diskursfragmenten aus diversen Publikationsorganen mit insgesamt 88 Seiten Länge durchgeführt (siehe Kapitel V. III. Strukturanalyse). Dabei wird mit einzelnen Diskursfragmenten auf der Diskursebenen der Medien und Wissenschaft operiert, vereinzelt auch mit den Diskursverschränkungen auf den Ebenen der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Online- und Printformat von Zeitungen und Institutionen bzw. wichtigen Akteurinnen wie der MPG bzw. des MPI IS, die zum thematischen gemeinsamen Nenner (Diskursstrang) des Cyber Valley seit seiner öffentlichen Bekanntgabe18 am 15.12.2016 Artikel oder Pressemeldungen veröffentlicht haben.
Teil der Strukturanalyse sind die Unterkapitel V. III. I. Tabellarische Erfassung und V. III. II., Materialaufbereitung die im Ergebnis drei Diskursfragmente für die Feinanalyse bestimmen. Zur Überprüfung der Auswahl für die Feinanalyse wird ergänzend zur Strukturanalyse eine aspektorientierte Analyse durchgeführt (siehe Unterkapitel V. III. III.).
Anmerkung:
Die empirischen Analysen, welche u.a. Struktur- und Feinanalysen enthalten und insgesamt 160 Seiten umfassen, sind aus Platzgründen größtenteils nicht in die vorliegende Arbeit integriert, sondern als Anhang beigefügt. Der Verfasser hat lediglich ausgewählte Passagen und quantitative Daten entnommen, um eine umfassendere und tiefgreifendere Analyse des Diskursstrangs zu ermöglichen.
V. I. Vorannahmen zum Cyber Valley Diskursstrang
Der Verfasser hat u.a. folgende drei Vorannahmen zum Cyber Valley Diskursstrang im Vorfeld der empirischen Analyse:
1. Die Betrachtung von Alternativen zum Cyber Valley ist möglicherweise unzureichend.
2. Das Cyber Valley könnte die Demokratie schwächen und die Macht großer Unternehmen und kapitalstarker Interessengruppen stärken.
3. Das Cyber Valley könnte die Ideologie des Silicon Valley verfolgen.
V. II. Materialgrundlage
Die Materialgrundlage dieser Arbeit besteht aus dem weiter unten beschriebenen Material Korpus, welches als Grundlage für den Material- Dossier der Strukturanalyse dient.
Das Material- Korpus besteht hauptsächlich aus Diskursfragmenten, die aus Zeitungsartikeln sowohl in gedruckter als auch in Online-Form stammen. Des Weiteren umfasst es Diskursfragmente von Akteurinnen des Cyber Valley im Kontext des untersuchten Diskursstrangs. Bei der Vorauswahl des Material- Korpus als Materialgrundlage sind, abgesehen von den Industriepartnerinnen, alle Gründungsmitglieder des Cyber Valley vertreten.
Die Recherche fand in den Hauptbibliotheken der Universitäten Freiburg und Tübingen statt. Zusätzlich wurden am 30.05.2023 im Stadtarchiv Tübingen alle verfügbaren Artikel der Tübinger Zeitung Schwäbisches Tagblatt - Tübinger Chronik zum Thema Cyber Valley gesichtet, fotografiert und digital gespeichert.
Ein Problem, mit dem sich der Verfasser bei der Beschaffung der Materialgrundlage konfrontiert sah, war die Auswahl der diskursiven Ereignisse, die den Untersuchungszeitraum des Diskursstrangs bestimmen.
Für diese Festlegung boten sich mehrere diskursive Ereignisse an. Zu nennen sind hier die erste Pressemitteilung des Cyber Valley am 15.12.2016, der Beginn bzw. das Ende der Besetzung des Hörsaalzentrums Kupferbau, das fünfjährige Bestehen des Cyber Valley, die Gemeinderatssitzung, in der die Entscheidung über die Grundstücksvergabe an Amazon getroffen wurde, sowie die Eröffnung des Amazon-Standorts im Cyber Valley am 28.02.2023. Schließlich wurde der Untersuchungszeitraum durch das erstgenannte und das letztgenannte Ereignis definiert, wobei eine andere Wahl des Untersuchungszeitraums ebenso wie eine andere Fokussierung innerhalb des gewählten Zeitraums zu anderen Ergebnissen führen würde.
Das Material- Korpus und das Material- Dossier sind als Ordner mit PDF-Dateien im Anhang zu dieser Arbeit zur Verfügung gestellt.
V. II. I. Material-Korpus
Basierend auf der Forschungsfrage „Wie wird das Cyber Valley und seine Initiative zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Forschung und Industrie in der öffentlichen Debatte diskursiv konstruiert?“ wurden zunächst 216 Artikel (mit einem Gesamtumfang von 489 Seiten) der auflagenstärksten Tageszeitungen in Baden-Württemberg, der Stuttgarter Zeitung (StZ) und Stuttgarter Nachrichten (STN) mit dem Stichwort „Cyber Valley“ gesich- tetund als PDF-Datei gespeichert19 (vgl. VSZV 31.12.2017).
Zusätzlich wurden 15 Artikel des Schwäbischen Tagblatts - Tübinger Chronik (TB) über das Cyber Valley und seine Initiative ausgewählt. Das TB ist die einzige Tageszeitung in Tübingen und somit auch die mit der höchsten Auflage (vgl. ebd.). Die 15 Artikel des TB umfassen 52 Seiten.
Als ergänzende überregionale Quellen wurden die zwei auflagenstarken überregionalen Zeitungen, die Süddeutsche Zeitung aus München mit 8 Artikeln (77 Seiten) und die Südwest Presse aus Ulm mit 17 Artikeln (41 Seiten) zum Kontext des Cyber Valley ausgewählt.
Bei allen genannten Zeitungen geht der Verfasser dieser Arbeit davon aus, dass sie aufgrund ihrer hohen Printauflagen, ihres Internet-Angebots und ihres langjährigen Bestehens einen maßgeblichen Einfluss auf den lokalen Diskurs und die Meinungsbildung in Baden-Württemberg bzw. Süddeutschland ausüben.
Von der offiziellen Internetseite des Cyber Valley, welche von der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. betreut wird (vgl. Cyber Valley 2023c), wurden im Juli 2023 alle 265 online verfügbaren Meldungen der Rubrik „News“ als PDF-Datei (mit insgesamt 712 Seiten), sowie 27 weitere Diskursfragmente (379 Seiten), gespeichert.
Zusätzlich wurden 40 Meldungen (106 Seiten) des Newsletters der Universität Tübingen mit dem Stichwort „Cyber Valley“ sowie von der Universität Stuttgart zwei Diskursfragmente (24 Seiten) digital gespeichert. Des Weiteren wurden neun Berichte und Pressemeldungen (178 Seiten) von der offiziellen Internetseite des Landes Baden-Württemberg zum Thema Cyber Valley und Digitalisierungsstrategie aufgenommen.
Mit dieser Materialauswahl verschafft sich der Verfasser dieser Arbeit einen ersten Überblick über den öffentlichen Diskurs zu Cyber Valley und seiner Initiative zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Forschung und Industrie.
Die Publikationen der Industriepartnerinnen von Cyber Valley wurden bewusst nicht einbezogen, da aufgrund ihrer privatwirtschaftlichen Perspektive eine einseitige Parteinahme bezüglich der Forschungsfrage zu erwarten ist und ihre Einbeziehung einen erheblichen zusätzlichen Zeitaufwand erfordert hätte.
V. II. II. Material-Dossier
Um ein vorläufiges Material- Dossier als Grundlage für die Strukturanalyse zu erstellen, wurde das Material- Korpus nach den beiden Schlüsselwörtern „Zusammenarbeit“ und „Kooperation“ durchsucht, wobei alle 62 Diskursfragmente (insgesamt 1569 Seiten), die eines oder beide dieser Wörter enthielten, in das Material- Dossier aufgenommen wurden.
Diese Vorgehensweise bei der Erstellung des Material- Dossiers wurde gewählt, um Textmaterialien mit enger thematischer Verbindung zur Forschungsfrage zu finden und somit die Analyse effizient durchführen zu können.
Mögliche Probleme bei dieser Vorgehensweise könnten auftreten, wenn relevante Texte übersehen werden, die zum Beispiel Umschreibungen von „Zusammenarbeit“ und „Kooperation“ enthalten, aber inhaltlich zum Thema gehören. Da es jedoch nicht möglich ist, die gesamten 2340 Seiten des Material- Korpus gründlich zu lesen, bleibt dies unvermeidlich.
Wie sich im Verlauf der Strukturanalyse gezeigt hat, war die Vorauswahl des Materials für die Strukturanalyse ausreichend. Von insgesamt 62 Diskursfragmenten im Material- Dossier wurden lediglich 14 ausgewählt.
V. III. Strukturanalyse
Wie im Kapitel IV. I. Strukturanalyse genauer beschrieben, werden im Rahmen der Strukturanalyse Texte mit thematischen Bezügen systematisch erfasst, chronologisch geordnet und in einer Tabelle zusammengefasst. Die Auswahl des Diskursstrangs in dieser Arbeit orientiert sich an der Forschungsfrage und berücksichtigt Publikationen ab dem Zeitpunkt der öffentlichen Ankündigung des Cyber Valley am 15.12.2016 bis zum Tag der Eröffnung des Amazon- Standorts in Tübingen am 28.02.2023 (vgl. MPG 15.12.2016; vgl. Rekittke 28.02.2023).
Aus dem Diskursstrang wurden erste Aussagen extrahiert und die den Aussagen zugrunde liegenden Normalismen, Kollektivsymbole und Argumentationsstrategien identifiziert, um einen Überblick über deren Art, Häufigkeit und jeweilige Sättigung zu erhalten. Auf dieser Grundlage wurden anschließend mit Hilfe der Materialaufbereitung drei repräsentative Artikel für die Feinanalyse ausgewählt (siehe Kapitel V. III. II. Materialaufbereitung).
Das vorläufige Material- Dossier wurde für die Strukturanalyse nur teilweise verwendet, da nach der tabellarischen Erfassung von 7 Diskursfragmenten bereits eine Sättigung in den Aussagen, Kollektivsymbolen und Normalismen erkennbar war. Zur Sicherheit wurden jedoch insgesamt 14 Diskursfragmente tabellarisch erfasst, ohne dass eine weitere Sättigung in den genannten Punkten erreicht wurde.
Hinweise:
1. Die Dateinamen der Strukturanalyse-Tabellen beginnen mit „LR 2023_“ gefolgt von „Strukturanalyse-Tabelle“ und der entsprechenden Nummer sowie dem Titel des Diskursfragments, dem Namen der Autorin, dem Erscheinungsdatum des Diskursfragments, gefolgt vom Namen des Publikationsorgans. Wenn vorhanden, wird zuletzt der Archivname in Großbuchstaben angegeben.
2. Materialgrundlage sind die Ordner „Material- Dossier “ und „LR 2023_Strukturanalyse- Tabellen“ (beide im Anhang). Der Ordner „LR 2023_Strukturanalyse-Tabellen“ enthält 14 Strukturanalyse-Tabellen, die jeweils ein Diskursfragment aus dem Material- Dossier behandeln. Im Folgenden wird jede der Strukturanalyse-Tabellen mit „Tabelle“ abgekürzt, gefolgt von der jeweiligen Nummer, und wenn auf ein den Tabellen entsprechendes Diskursfragment Bezug genommen wird, wird dieses mit „Text“ bzw. im Plural mit „Texten“, gefolgt von der jeweiligenNummer, abgekürzt.
V. III. I. Tabellarische Erfassung
Im Folgenden werden die zentralen Analysekategorien erläutert und teilweise begründet, die in Anlehnung an Jäger (2015) für die Strukturanalyse-Tabellen ausgewählt wurden.
Zur Veranschaulichung kann eine der Strukturanalyse-Tabellen im Anhang dienen (Ordner „LR 2023_Strukturanalyse-Tabellen“).
Die Kategorien im oberen Teil der Tabelle (wie zum Beispiel „Datum“, „Textsorte“, „Erscheinungsform/Ort“, „Überschrift des Artikels“, „Publikationsorgan/Medium“, „Charakterisierung der Redaktion“ usw.) dienen u.a. der genauen Einordnung des institutionellen Rahmens des Diskursfragments.
Die Bestimmung der Kategorie „Textsorte“ ist von zentraler Bedeutung. Sie gibt Aufschluss über die inhaltliche Funktion des Textes und zeigt Abweichungen von den üblichen Funktionen auf. Ebenso relevant ist die Kategorie „Quellen des Wissens“, die danach fragt, ob der Artikel historische Ereignisse oder Wissensquellen behandelt und wie das Thema in früheren Ausgaben der Publikation behandelt wurde.
Ein grundlegender Aspekt ist die Erkenntnis, dass sprachliche Texte von Personen verfasst werden, die in bestimmte Diskurse eingebunden sind und dementsprechend eine bestimmte Diskursposition einnehmen. Aus diesem Grund ist es von Bedeutung, Informationen über die Verfasserinnen zu sammeln, die in der Zeile „Autorin“ festgehalten wurden.
Grundlegend ist auch das Festhalten der „Erste[n] Eindrücke beim ersten Lesen [...]“, wobei subjektive Gedanken, Assoziationen und Vermutungen erfasst werden.
Soweit möglich, wurde die Position des Artikels innerhalb der Ausgabe analysiert und das Verhältnis zu anderen Artikeln erfasst. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden in der Kategorie „Graphische Form“ festgehalten. Es ist anzumerken, dass diese Angaben für die meisten Artikel des Stadtarchivs Tübingens nicht möglich war, da es sich hierbei meist um einzelne Ausschnitte handelt.
Die Inhaltsanalyse im Rahmen der Strukturanalyse stellt eher eine Form der Textzusammenfassung dar. Ziel ist die grobe Erfassung der inhaltlichen Intention des Textes und der Autorin. Dabei werden Vermutungen über die beabsichtigte Wirkung der Autorin angestellt und inhaltliche Bezüge sowie sprachliche Ausdrucksformen identifiziert. Daran schließen sich weitere Auseinandersetzung mit der Textanalyse an. Zum Beispiel mit den folgenden Kategorien „Themen“, „(tatsächliche) Diskursposition“, „Kollektivsymbole“, „Normalismen“ und „Aussagen“. Zur Vervollständigung wurde am Ende der Tabelle eine Zeile „Sonstige Auffälligkeiten“ eingefügt, um Platz für spontane Notizen nach gründlicher Durchsicht des Diskursfragments und Ausfüllen der Tabelle zu bieten. Besonderes Augenmerk wird auf die identifizierten Aussagen, Kollektivsymbole und Normalismen gelegt, die maßgeblich zur Analyse beitragen.
V. III. II. Materialaufoereitung
Im Folgenden werden anhand der Häufigkeit und Art des Auftretens von zentralen Aussagen, Themen und Normalismen diskursive Wirkungsschwerpunkte identifiziert und die Diskurspositionen sowie das Sagbarkeitsfeld der untersuchten Publikationsorgane aufgezeigt. Darauf aufbauend werden typische Diskursfragmente für die Feinanalyse bestimmt.
Da die Aussagen eine zentrale Bedeutung für die vorliegende Analyse haben, wird deren Zusammenschau im folgenden ausführlicher dargestellt als die Zusammenschau der Themen und der Normalismen.
Zusammenschau der Aussagen
Auf Grund der Strukturanalyse ergeben sich folgende Häufigkeiten der Aussagen: positive Bewertung des Cyber Valley (9 Mal); positive Bewertung der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft (7 Mal); Betonung der Bedeutung von KI und maschinellem Lernen für die Zukunft (7 Mal); Bedeutung von KI für die Wettbewerbsfähigkeit (6 Mal); Betonung der Bedeutung von Wissenschaft und Forschung (6 Mal).
Grundsätzlich vermitteln der Newsletter der Universität Tübingen (Universität Tübingen 01.2018), die Pressemeldung der MPG (MPG 15.12.2016), ein Artikel in der Zeitung Die Zeit (Martin-Jung 24.10.2017) und alle in der Strukturanalyse untersuchten Texte aus den Zeitungen TB, StZ und STN eine sehr ähnliche, wirtschaftsnahe Diskursposition und befürwortende Haltung zum Cyber Valley. Die Aussagen und ihre Häufigkeit unterscheiden sich je nach Publikationsorgan nur geringfügig.
Bezüglich der ermittelten Diskursposition und der Häufigkeit der Aussagen, die sich dieser Zuordnen lassen, ergibt sich über die Diskursfragmente folgendes Bild: Direkt einer wirtschaftsnahen Diskursposition lassen sich mehr als die Hälfte der 59 Aussagen (32 Stück) zuordnen. Die verbleibenden 27 Aussagen können indirekt einer wirtschaftsnahen Diskursposition zugeordnet werden (vgl. LR2023_Strukturanalyse-Tabelle 1 bis 14).
Im Folgenden werden die am häufigsten vorkommenden Aussagen zum Cyber Valley hinsichtlich ihrer Anzahl und zugehörigen Publikationsorgane aufgeführt:
- Positive Bewertung des Cyber Valley (insgesamt 9 Mal), in Text 1 (MPG); 2, 5, 14 (TB); 4 (Universität Tübingen); 6, 9, 10, 11 (StZ/STN)
- Positive Bewertung der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft (insgesamt 7 Mal), in Text: 1 (MPG); 2 (TB); 3 (Die Zeit); 9,10,12,13 (StZ/STN)
- Betonung der Bedeutung von KI und maschinellem Lernen für die Zukunft (insgesamt 7 Mal), in Text: 2, 5, 7, 14 (TB); 6, 10, 11 (StZ/STN)
- Bedeutung von KI für die Wettbewerbsfähigkeit (insgesamt 6 Mal), in Text: 1 (MPG); 2, 14 (TB); 6,10,11 (StZ/STN)
- Betonung der Bedeutung von Wissenschaft und Forschung (insgesamt 6 Mal), in Text: 1 (MPG); 7, 14 (TB); 8,9,10 (StZ/STN)
- Betonung der wirtschaftlichen Vorteile für die Stadt (Tübingen und/oder Stuttgart) (insgesamt 5 Mal), in Text: 2, 5, 7, 14 (TB); 9 (StZ/STN)
- Betonung der Ausrichtung der Forschung auf die Bedürfnisse der Wirtschaft (insgesamt 4 Mal), in Text: 2, 14 (TB); 12,13 (StZ/STN)
- Positive Bewertung der Zusammenarbeit mit Industriepartner*innen (insgesamt 4 Mal), in Text: 1 (MPG); 2,7,14 (TB)
- Positive Bewertung der Investitionen und Bemühungen zur Positionierung von Stuttgart als Wissensmetropole (insgesamt 4 Mal), in Text: 6, 8, 9 (StZ/STN); 14 (TB)
- Betonung der finanziellen und technologischen Vorteile großer Unternehmen (insgesamt 3 Mal), in Text: 3, 7 (TB); 13 (StZ/STN)
- Positive Bewertung der Ansiedlung von Amazon in Tübingen (insgesamt 3 Mal), in Text: 3 (Die Zeit); 6 (StZ/STN); 7 (TB)
Anmerkung: Die oben aufgeführten und weitere Aussagen sind in der Zeile „Aussagen“ der Strukturanalyse-Tabellen der einzelnen Diskursfragmente im Anhang enthalten.
Zusammenschau der Themen
Alle untersuchten Diskursfragmente behandeln ähnliche Themen im Kontext des Cyber Valley und seiner Initiative, unterscheiden sich jedoch in der Häufigkeit der Themen und in den Unterthemen, Schwerpunkten und Akzenten, die wohl vor allem auf die regionale Ausrichtung zurückzuführen sind. Die Wahl der Themen und Unterthemen lässt auf eine neoliberal-kapitalistische Diskursposition schließen.
Das auf Tübingen fokussierte TB legt einen besonderen Schwerpunkt auf die spezifischen Diskussionen rund um das Engagement von Amazon in Tübingen und die Auswirkungen von Spitzenforschung auf die Stadtgesellschaft. Dies wird auf die Ansiedlung von Amazon und die Proteste gegen Amazon und das Cyber Valley in Tübingen zurückzuführen sein. Darüber hinaus behandelt das TB insgesamt ein breiteres Themenspektrum, es liegen also mehr Diskursverschränkungen vor.
Auch die STN/StZ greifen ähnliche Themen auf, allerdings in geringerer Anzahl und mit ausführlicheren Berichten. Die Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen, Wirtschaft und Politik wird stärker betont, was (im Vergleich zum TB) auf eine etwas stärker ausgeprägte neoliberal-kapitalistische Diskursposition hindeuten könnte.
In beiden Zeitungen werden folgende Themen behandelt: Bedeutung von Wissenschaft und Forschung; Forschung und Alltag; Forschungsinstitutionen und Kooperationen; Wettbewerb und globale Bedeutung; Verknüpfung von Wissenschaft, Wirtschaft und Innovation; Förderung durch Stiftungen und staatliche Investitionen; Spitzenforschung und technische Innovation; Bedeutung internationaler Fachkräfte; Entwicklung des Cyber Valley im Bereich KI; KI-Forschung und das Thema Kooperation von Forschungseinrichtungen mit Wirtschaft und Politik im Cyber Valley.
Eine Aufschlüsselung der Themen und ihrer Häufigkeit nach Zeitungen und Tabellen bzw. Texten findet sich in der beigefügten PDF-Datei mit dem Namen „LR 2023_Themen Aufschlüsselung“.
Zusammenschau der Normalismen
Eine Zusammenschau der Normalismen der 14 Diskursfragmente zeigt u.a., dass KI und technologischer Fortschritt sowie Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie als normal, wünschenswert und unverzichtbar angesehen werden. Dies zeigen auch die fünf am häufigsten genannten Normalismen (siehe unten), die die Bedeutung des Cyber Valley für die Entwicklung und Umsetzung von Kl-Anwendungen in diesem Kontext unterstreichen (vgl. LR 2023_Normalismen Zusammenschau).
Neben den fünf am häufigsten genannten Normalismen wurden in den verschiedenen Texten weitere Normalismen identifiziert, darunter diskursive Verfahren, Zukunftsnarrative, technologischer Determinismus, Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, politische Instanzen, Universitäten, wissenschaftliche Einrichtungen, Technologie- und Automobilunternehmen, private Stiftungen, Hierarchie von Wissen und Intelligenz, Standards für Verantwortung, Ethik und Transparenz sowie die Notwendigkeit eines europäischen Leitbildes für den Umgang mit KI (vgl. ebd.). Diese Normalismen geben einen Einblick in die unterschiedlichen Perspektiven und Akzentuierungen, die im Kontext des Cyber Valley in den analysierten Texten existieren und wie sie in ihnen repräsentiert werden. Die aufgeführten Normalismen können sich überschneiden und es gibt weitere (vgl. ebd.).
Die fünf häufigsten Normalismen sind:
1. Bekräftigung der Kooperationen von Forschungseinrichtungen/Forschungsprojekten und Industrie als wichtige und wünschenswerte Praxis. ^ Dieser Normalismus kommt in den Texten 1 bis 6, 8,9, 11 und Text 13 vor.
2. Betonung der Bedeutung von KI als Schlüsseltechnologie für die Zukunft und ihrer normalen und wünschenswerten Rolle in der Gesellschaft. ^ Dieser Normalismus kommt in den Texten 1 bis 6, 8, 9 und 10 vor.
3. Darstellung bestimmter Regionen, wie z.B. das Cyber Valley in Stuttgart-Tübingen oder das Silicon Valley, als führende Standorte für Spitzenforschung und technologischen Fortschritt.
4. Betonung der wirtschaftlichen Bedeutung von KI und technologischem Fortschritt für Unternehmen, Industrie und Wettbewerbsfähigkeit.
5. Reproduktion von Standards für Exzellenz, Innovationsführerschaft und Verantwortung in der KI-Forschung und -Anwendung.
Diese fünf Normalismen spiegeln die Vorstellung wider, dass KI und technologischer Fortschritt sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus wissenschaftlicher Sicht als normal, wünschenswert und unverzichtbar angesehen werden. Sie betonen die Bedeutung von Forschungseinrichtungen, Kooperationen und regionalen Schwerpunkten für die Entwicklung und Umsetzung von KI-Anwendungen.
Sagbarkeitsfeld innerhalb des Diskursstrangs
Das Sagbarkeitsfeld der untersuchten Publikationsorgane in der Strukturanalyse und damit die Grenzen und Bandbreiten möglicher Aussagen und der zugrundeliegenden Normalismen innerhalb des untersuchten Diskursstrangs lassen sich aufgrund der obigen Ergebnisse wie folgt beschreiben:
Es wird fast ausschließlich positiv über die Entwicklungen im Cyber Valley und dessen Initiative berichtet. Die Diskursfragmente vermitteln den Eindruck, dass KI eine Schlüsseltechnologie ist und ihre Bedeutung für die industrielle Entwicklung, die das Cyber Valley vorantreibt, fundamental ist. Das Cyber Valley wird als großer Erfolg und wichtiger Faktor für technologischen Fortschritt und wirtschaftlichen Erfolg dargestellt.
In den Diskursfragmenten wird die Initiative zur Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft positiv hervorgehoben und argumentiert, dass diese Zusammenarbeit notwendig ist, um im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben. Es wird deutlich, dass eine gewisse Bandbreite an Aussagen innerhalb des Sagbarkeitsfeldes akzeptabel ist, insbesondere solche, die die Bedeutung der KI-Forschung für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit hervorheben und auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen hinweisen.
Diskurspositionen
Die StZ und die STN (die im Kern von einer gemeinsamen Redaktion gestaltet werden) sowie die Autorinnen der untersuchten Diskursfragmente (Erik Raidt und Renate Allgöwer) werden aufgrund der in den Strukturanalyse-Tabellen festgehaltenen Informationen vom Verfasser in der Diskursposition als bürgerlich-liberal bis bürgerlich-konservativ eingeordnet (vgl. LR 2023_Strukturanalyse-Tabelle_6: lf.; vgl. LR 2023_Strukturanalyse-Tabelle_8: lf.; vgl. LR2023_Strukturanalyse-Tabelle_l2: lf.).
Auch das Schwäbische Tagblatt - Tübinger Chronik und die dazugehörigen Autorinnen der untersuchten Diskursfragmente werden in ihren Diskurspositionen als bürgerlich-liberal bis bürgerlich-konservativ eingeschätzt. Allerdings erscheinen sie im Vergleich zu den Diskurspositionen der StZ und STN als etwas gemäßigter (vgl. LR 2023_Strukturanalyse-Tabelle_2: lf.; vgl. LR 2023_Strukturanalyse-Tabelle_5: lf.; vgl. LR 2023_Strukturanalyse-Tabelle_7: lf.; vgl. LR2023_Strukturanalyse-Tabelle_l4: lf.).
Raum für Kritik
Ethische und soziale Implikationen des Cyber Valley sowie seiner Initiative werden in den Diskurspositionen des in der Strukturanalyse untersuchten Diskursstrangs nur dann erwähnt, wenn sie von Institutionen innerhalb des Cyber Valley stammen und in diesem Zusammenhang positiv hervorgehoben werden.20
Eine direkte Kritik am Cyber Valley findet sich, aus den vertretenen Diskursposition der analysierten Publikationsorganen heraus, nicht. Sie dient lediglich als Berichterstattung über den Gegendiskurs - wie beispielsweise im TB -Artikel „Wenn nicht hier, dann woanders“ - oder als beiläufige Bemerkung21, wie in dem Kommentar „Wer forscht, gewinnt. Stuttgart feiert erstmals ein Wissenschaftsfestival“ in den STN, beide aus dem Jahr 2019 (vgl. Zimmer, 07.03.2019; vgl. Raidt, 24.06.2019). Dieses Jahr war geprägt von Ereignissen wie der Besetzung des Hörsaalgebäudes Kupferbau und der Gründung des Bündnisses gegen das Cyber Valley.
Das Sagbarkeitsfeld der untersuchten Publikationsorgane lässt also insgesamt in zwei Fällen Raum für Kritik: Entweder werden kritische Fragen innerhalb des Cyber Valley von Instanzen aus dem Cyber Valley selbst bearbeitet, was dann positiv hervorgehoben wird, oder die direkte Kritik am Cyber Valley wird aufgrund aktueller Protestereignisse in der Stadt Tübingen unübersehbar, was dann aber hauptsächlich in der Regionalpresse (TB) aufgegriffen wird.
Auswahl für die Feinanalyse
Die meisten der in der Strukturanalyse untersuchten Diskursfragmente eignen sich für die folgende Feinanalyse, da sie als vertretend für den Querschnitt der Diskursfragmente im Material- Dossier angesehen werden können.
Es wurden die folgenden drei Diskursfragmente für die Feinanalyse bestimmt:
1. Pressemeldung der MPG „Startschuss für das Cyber Valley“ veröffentlicht am 15.12.2016 auf der offiziellen Internetseite der MPG (im Folgenden mit „Text 1 - Pressemeldung“ abgekürzt und im Literaturverzeichnis unter „MPG 15.12.2016“ zu finden).
2. Interview mit Bernhard Schölkopf und Winfried Kretschmann „Das ist ein Forschungsparadies“ veröffentlicht am 28.01.2022 in der StZ (im Folgenden mit „Text 2 - Interview“ abgekürzt und im Literaturverzeichnis unter „Allgöwer 28.01.2022“ zu finden).
3. Nachricht „Amazon-Standort Tübingen: Kretschmann eröffnet Neubau. Ministerpräsident Winfried Kretschmann kam zur Eröffnung des vierten deutschen Forschungsstandortes des Online-Händlers“ veröffentlicht am 28.02.2023 auf Schwäbisches Tagblatt Online (im Folgenden mit „Text 3 - Nachricht“ abgekürzt und im Literaturverzeichnis unter „Rekittke 28.02.2023“ zu finden).
Die ausgewählten Diskursfragmente wurden neben ihrer Repräsentativität in Bezug auf das ermittelte Sagbarkeitsfeld und für den Diskursstrang vor allem aufgrund ihrer unterschiedlichen publizistischen Herkunft (MPG, StZ/STN, TB), ihres vergleichsweise großen Textumfangs und ihrer zeitlichen Position im Untersuchungszeitraum (ganz am Anfang (2016) und gegen Ende (2022 und 2023)) ausgewählt und erwiesen sich aufgrund der Strukturanalyse und ihrer Materialaufbereitung in ihrer Wirkung auf den Diskursstrang als relativ ausgeprägt, u.a. da in ihnen relativ viele (6 Stück der oben dargestellten) Aussagen identifiziert werden konnten und auch weil sie bestimmte Diskursereignisse markieren (Öffentliche Bekanntgabe des Beginns des Cyber Valley (1.), Interview mit Bernhard Schölkopf und Winfried Kretschmann zum Ellis-Institut, das einen der größten Ausbauschritte des Cyber Valley markiert (2.) und eine Nachricht zur Eröffnung des Amazon-Standorts Tübingen am 28.02.2023 (3.)).
V. III. III. Ergänzung: Aspektorientierte Analyse des Material-Korpus
Aufgrund der ausbaufähigen Ergebnisse der Strukturanalysen in Bezug auf die Forschungsfrage hat der Verfasser die aspektorientierte Analyse nach Friede et al. (2022)22 auf das Material Korpus mit über 400 Diskursfragmenten und insgesamt 2340 Seiten angewendet, um die Argumentation innerhalb der Textabschnitte mit den Stichworten „Zusammenarbeit“ und/oder „Kooperation“ zu untersuchen (vgl. LR 2023_Aspektorientierte Analyse).
Die Ergebnisse der aspektorientierten Analyse zeigen, dass die Aussagen und Argumentationen der zwölf Textabschnitte23 während des gesamten Untersuchungszeitraums (2016 bis 2023) und in verschiedenen Publikationsorganen durchweg ein positiv konstruiertes Bild des Cyber Valley und seiner Initiative zeichnen (vgl. ebd.).
Die Ergebnisse der aspektorientierten Analyse stimmen somit mit den Ergebnissen der Strukturanalyse überein und bestätigen die Auswahl der drei Diskursfragmente für die Feinanalyse, da diese auch als stellvertretend für den Querschnitt der Diskursfragmente im Material Korpus angesehen werden können (vgl. LR 2023_Aspektorientierte Analyse).
V. IV. Feinanalyse
Bei der Feinanalyse der drei ausgewählten Diskursfragmente (Text 1 - Pressemeldung, Text 2 - Interview und Text 3 - Nachricht) geht es zum einen darum, herauszufinden, wie gültiges Wissen zustande kommt und wie dieses Wissen weitergegeben wird, und zum anderen darum, die Wirkung von Aussagen im unmittelbaren Kontext des Diskursstrangs besser einschätzen zu können (vgl. Jäger 2015: 99). Zu diesem Zweck erfolgt die Erfassung der Tiefenstruktur der Aussagen anhand der in Kapitel IV. II. Feinanalyse beschriebenen Schritte drei und vier der Feinanalyse nach Jäger (2015).
Die empfohlenen (Fein-)Analyseschritte 1 zum institutionellen Rahmen und 2 zur Textoberfläche (vgl. Jäger 2015: 99ff., 101f.) wurden in den drei Feinanalysen im Anhang dieser Arbeit durchgeführt (vgl. LR 2023_Feinanalyse 2016; vgl. LR 2023_Feinanalyse 2022; vgl. LR 2023_Feinanalyse 2023). Darüber hinaus wurden diese Aspekte bereits in den Strukturanalyse-Tabellen berücksichtigt (vgl. V. III. I. Tabellarische Erfassung; vgl. Ordner „LR 2023_Strukturanalyse-Tabellen“).
V. IV. I. Sprachlich-rhetorische Mittel
Im Folgenden werden Argumentationen und Legitimationsstrategien sowie Kollektivsymbole in den drei Diskursfragmenten (Text 1 - Pressemeldung, Text 2 - Interview und Text 3 - Nachricht) genauer analysiert und verglichen. Eine detailliertere Analyse dieser und weiterer sprachliche-rhetorischer Mittel, wie z.B. die Hierarchie der vorhandenen Substantive, der Sprachstil oder die Verwendung direkter oder indirekter Rede für bestimmte Zwecke, findet sich in den entsprechenden Feinanalysen im Anhang (vgl. LR 2023_Feinanalyse 2016; vgl. LR 2023_Feinanalyse 2022; vgl. LR 2023_Feinanalyse 2023).
Gemeinsamkeiten in den Argumentationen und Legitimationsstrategien für das Cyber Valley:
1. Kooperation und Stärke im Wettbewerb: Alle drei Diskursfragmente betonen die Wichtigkeit der Kooperation und des Zusammenschlusses von (öffentlicher) Wissenschaft und (privater) Wirtschaft, um im internationalen Wettbewerb in der Forschung und Entwicklung von KI konkurrenzfähig zu bleiben. In diesem Zusammenhang wird jeweils darauf hingewiesen, dass eine Bündelung der Kräfte notwendig ist, um gegenüber Ländern wie China und den USA erfolgreich zu sein.
2. Technologischer Fortschritt: In allen drei Diskursfragmenten wird betont, dass das Cyber Valley eine Vorreiterrolle im Bereich des technologischen Fortschritts und der KI-Forschung einnimmt, um die Entwicklung und Anwendung von KI voranzutreiben.
3. Attraktivität für Talente: Alle drei Diskursfragmente weisen darauf hin, dass das Cyber Valley aufgrund seiner Forschungseinrichtungen, der Zusammenarbeit mit renommierten Unternehmen und der Möglichkeit, Forschung auf höchstem Niveau zu betreiben, Talente aus der ganzen Welt angezogen hat und weitere Talente anziehen soll.
Alle drei Diskursfragmente zeigen eine Argumentation, die die Bedeutung des Cyber Valley als wichtigen Spitzenstandort für KI-Forschung und -Entwicklung in Europa hervorhebt. Strategische Argumente wie Kooperation, technologischer Fortschritt und Attraktivität für Talente ziehen sich durch alle drei Diskursfragmente. Unterschiede bestehen vor allem in den spezifischen Kontexten, wie dem Beginn des Cyber Valley (Text 1 - Pressemeldung), der Gründung des Ellis-Instituts (Text 2 - Interview) oder der Eröffnung eines Amazon- Forschungszentrums (Text 3 - Nachricht).
Wie in allen drei Feinanalysen mehrfach beobachtet werden konnte, dienen in allen drei Diskursfragmenten die Kollektivsymbole dazu, bestimmte Aussagen hervorzuheben und damit ihre Botschaften in den Köpfen der Leser*innen zu verankern, während der Stil aller drei Diskursfragmente im Wesentlichen informativ und sachlich bleibt (vgl. LR 2023_Feinanalyse 2016: 11; vgl. LR 2023_Feinanalyse 2022: 6f.; vgl. LR 2023_Feinanalyse 2023: 11). Jäger (2015: 105f.) bezeichnet die geschilderte Funktion der Kollektivsymbole als „Fährenfunktion“.
V. IV. II. Inhaltlich-ideologische Aussagen
In diesem Schritt der Feinanalyse wurden gemäß den Empfehlungen von Jäger (2015: 108) Leitlinien für eine ideologische Bewertung erarbeitet. Dabei wurden auf Basis bzw. in der Feinanalyse des jeweiligen Diskursfragments (Text 1 - Pressemitteilung, Text 2 - Interview und Text 3 - Nachricht) sowie mit Hilfe der in den Strukturanalyse-Tabellen erfassten Aussagen und Normalismen Vermutungen darüber angestellt, welche ideologischen Vorstellungen in den Diskurspositionen der jeweiligen Diskursfragmente präsent sind (vgl. LR 2023_Fein- analyse 2016: 11f.; vgl. LR 2023_Feinanalyse 2022: 7ff., 11; vgl. LR 2023_Feinanalyse 2023: 13ff.).
Text 1 - Pressemeldung:
In der Pressemeldung werden Aussagen getroffen und Normalismen transportiert, die einem technologischen Determinismus nahe kommen, nämlich dass „Intelligente Systeme“ und die „digitale Zukunft“ für den Menschen bzw. die Gesellschaft unausweichlich und notwendig sind (vgl. LR2023_Feinanalyse 2016: Z. 4-9, 14-17).
So heißt es beispielsweise: „Intelligente Systeme werden unsere Zukunft prägen [...] Um die Entwicklung dorthin voranzutreiben, schaffen Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft [...] im Raum Stuttgart-Tübingen das Cyber Valley“ (LR 2023_Feinanalyse 2016: Z. 4-9) und „Das Cyber Valley soll ein Ort sein, an dem die technologischen Grundlagen für unsere digitale Zukunft gelegt werden. [...] Denn die digitale Zukunft betrifft uns alle“ (LR 2023_Fein- analyse 2016: Z. 14-17). Das Cyber Valley wird dabei als die Instanz (in der dafür am besten geeigneten Region) dargestellt, die sich am besten um die Elemente dieser unausweichlichen Zukunft sorgt - und zwar im Interesse aller (vgl. ebd.: Z. 14-17, 28-29, 36-37, 58-63).
Darüber hinaus scheint die neoliberal-kapitalistische Ideologie der Diskursposition durch, indem u.a. die Kooperation mit der Industrie, die Unterstützung privatwirtschaftlicher Unternehmensgründungen und die Absicht, möglichst schnell von der Grundlagenforschung zu marktfähigen Anwendungen zu kommen, als selbstverständlich dargestellt und sogar positiv hervorgehoben werden (vgl. ebd.:Z. 18-21,38-41).
Text 2 - Interview:
Mit einer Ausnahme24, spiegeln die Aussagen und die transportierten Normalismen in diesem Interview eine positive und aufgeschlossene Haltung gegenüber dem Cyber Valley und seiner Initiative wieder. Des Weiteren scheint eine neoliberal-kapitalistische Denkweise der Interviewten durch, in der wirtschaftlicher Wettbewerb, private Finanzierung und kommerzielle Anwendungen im Mittelpunkt stehen (vgl. LR 2023_Feinanalyse 2022). Die (wirtschaftlichen) Vorteile und Potenziale, die sich daraus ergeben, werden unterstrichen, während mögliche Bedenken oder Kritikpunkte der Vergangenheit angehören sollen (vgl. LR 2023_Feinana- lyse 2022: Z. 4-6, 33-35, 46-50).
Diese Diskursposition entspricht (bis auf die oben genannte Ausnahme) der oben dargestellten Diskursposition derPressemeldung der MPG vom 15.12.2016 (vgl. MPG 15.12.2016).
Text 3 - Nachricht:
Dieser Artikel ist das letzte Diskursfragment im untersuchten Diskursstrang. Er beschreibt die Entwicklung der KI und die Ansiedlung von Amazon in Tübingen positiv. Es werden vor allem die wirtschaftlichen Chancen und Potenziale betont, während mögliche Bedenken oder Kritikpunkte kaum erwähnt werden (vgl. LR 2023_Feinanalyse 2023: 13).
Die Verknüpfung im Text zwischen der Gründung des Amazon-Forschungsstandorts und den positiven Auswirkungen dieser Etablierung kann als Mechanismus des Normalismus betrachtet werden. Sie trägt dazu bei, eine bestimmte Vorstellung von Normalität zu fördern, welche mit der positiven Einstellung gegenüber KI und der Integration großer Unternehmen wie Amazon verbunden ist (vgl. LR 2023_Strukturanalyse-Tabelle_14: 4f.). Die Äußerung des Ministerpräsidenten Kretschmann, „Wer nicht mitkocht, steht zuletzt auf der Speisekarte“ (LR 2023_Feinanalyse 2023: Z. 32-33), betont die Wichtigkeit der Beteiligung an der Entwicklung und Forschung von KI und verdeutlicht den dringenden Handlungsbedarf im Kontext des Wettbewerbs.
Alles in allem zeigt der Text eine Diskursposition, die die Entwicklung von KI und die Beteiligung großer Unternehmen wie Amazon positiv bewertet. Dabei stehen wirtschaftliche und wettbewerbsorientierte Aspekte im Mittelpunkt und mögliche kritische Betrachtungen werden in den Hintergrund gedrängt. Wie in den beiden zuvor behandelten Texten scheint auch hier eine neoliberal-kapitalistische Denkweise der Diskursposition zugrunde zu liegen.
V. IV. III. Abschließende Gesamtanalyse typischer Diskursfragmente
Das Wissen, das die Leser*innen aus dem öffentlichen Diskurs über das Cyber Valley in den hier untersuchten Diskursfragmenten 25 präsentiert bekommen, ist in seiner Wirkung darauf ausgerichtet, die nationalstaatliche Standortlogik der Wohlstandserhaltung und die neoliberalkapitalistische Ausrichtung des Cyber Valley und seiner Initiative als zu befürwortend einzustufen.
Die Pressebeiträge unterscheiden sich in ihren zustimmenden Aussagen über das Cyber Valley kaum von den Pressemeldungen des Cyber Valley bzw. seiner Akteur*innen.
Letztendlich verfolgen alle drei in der Feinanalyse untersuchten Diskursfragmenten das Ziel, das Cyber Valley als bedeutendes Forschungszentrum für KI darzustellen und dessen Legitimität und Zukunftsrelevanz zu untermauern. Die spezifischen Argumentations- und Legitimationsstrategien unterscheiden sich leicht, aber das übergeordnete Narrativ der Bedeutung der KI-Forschung, der Kooperation (zwischen Wissenschaft und Wirtschaft) und der Attraktivität für Talente zieht sich durch alle Texte (vgl. LR 2023_Feinanalyse Zusammenschau: lf.).
VI. Analyse des gesamten Diskursstranges
Im betrachteten Zeitraum (2016 bis 2023) konnte für diesen Diskursstrang durch Struktur- und Feinanalysen unter anderem festgestellt werden, dass einfache Wiederholungen der oben aufgeführten Aussagen, Themen und Normalismen mittels der Fährenfunktion der Kolle- tivsymbole und ihrer Implikate wie etwa dem der Alternativlosigkeit26, höchstwahrscheinlich zu einer das Cyber Valley bejahenden Haltung bei den Leserinnen führen.
Die Diskursmacht liegt vor allem bei den Akteurinnen des Cyber Valley selbst, insbesondere bei der MPG und der Landesregierung von Baden-Württemberg, da diese in der Regel von der Presse als Referenzpunkte herangezogen werden. Die Berichterstattung der untersuchten Pressepublikationsorgane stimmt dementsprechend hinsichtlich der identifizierten Aussagen, Themen und Normalismen mit denen der Akteurinnen des Cyber Valley überein (vgl. LR 2023_Feinanalyse Zusammenschau; vgl. LR 2023_Themen Aufschlüsselung; vgl. LR 2023_Normalismen Zusammenschau).
In den Diskursfragmenten werden Kollektivsymbole einheitlich verwendet und verstärken dadurch ideologisch vermittelte Aussagen. Gleichzeitig wird in den Diskursfragmenten ein sachlicher Stil beibehalten und es werden viele Fakten präsentiert, was insgesamt einen seriösen Eindruck hinterlässt (vgl. LR 2023_Feinanalyse 2016: 11; vgl. LR 2023_Feinanalyse 2022: 6f; vgl. LR 2023_Feinanalyse 2023: 11).
Die Analyse des Sagbarkeitsfeldes 27 zeigt eine fast einseitig positive Berichterstattung. Kritische Aspekte werden vor allem dann behandelt, wenn interne Instanzen des Cyber Valley diese ansprechen. In diesen Fällen werden sie von den untersuchten Pressepublikationsorganen durchweg positiv bewertet.
Direkte Kritik am Cyber Valley wird in keinem Diskursfragment geäußert und ist somit kein Teil einer Diskursposition im untersuchten Diskursstrang. Die untersuchten Pressepublikationsorgane behandelt direkte Kritik am Cyber Valley lediglich als Objekt der Berichterstattung, insbesondere in der regionalen Berichterstattung des TB im Jahr 2019, als die Proteste gegen das Cyber Valley ihren Höhepunkt erreicht hatten.
Weiterhin ist deutlich geworden, dass es im betrachteten Diskursstrang keine Debatte zwischen den Akteurinnen des Cyber Valley und den untersuchten Pressepublikationsorganen gibt. Somit gibt es im Sagbarkeitsfeld keinen Raum für eine öffentliche Debatte. Dies steht im Gegensatz zur ursprünglichen Annahme des Verfassers dieser Arbeit bei der Formulierung der Forschungsfrage: „Wie wird das Cyber Valley und seine Initiative zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Forschung und Industrie in der öffentlichen Debatte diskursiv konstruiert?“.
Die vermutete einseitige Parteinahme in den Veröffentlichungen der Industriepartner*innen des Cyber Valley findet sich, wie die vorangegangenen Analysen gezeigt haben, auch in den untersuchten Veröffentlichungen der Akteur*innen des Cyber Valley und den untersuchten Diskursfragmenten der Presse wieder. Hier scheint sich zu bestätigen, was Jäger (2015: 85) anmerkt, nämlich dass die Diskurspositionen innerhalb eines dominanten Diskurses sehr homogen sind und, für den untersuchten Diskursstrang noch mehr, dass die Diskurspositionen der untersuchten Pressepublikationsorgane mit denen eines Forschungskonsortiums wie dem Cyber Valley weitgehend übereinstimmen können.
Das übergeordnete Ziel des Diskursstrangs scheint zu sein, das Cyber Valley als führenden Standort im Bereich der KI-Forschung zu legitimieren und seine Initiative zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Forschung und Industrie als die einzig richtige darzustellen.
Alternativen zum Cyber Valley und seiner Initiative liegen außerhalb der Grenzen des identifizierten Sagbarkeitsfeldes und werden somit durch die Wirkung des Diskursstrangs unsichtbar und unwissbar gemacht.
VII. Kritik
Basierend auf dem persönlichen Standpunkt des Verfassers (zum Zeitpunkt des Verfassens der vorliegenden Arbeit) und den damit verbundenen ethischen Grundüberlegungen, wie sie in der Einleitung zu dieser Arbeit erörtert wurden, wurde bereits mehrfach beiläufig Kritik geübt. Nachfolgend werden diese Kritikpunkte detailliert erläutert und weitere hinzugefügt. Darüber hinaus wird eine kritische Betrachtung der drei vom Verfasser aufgestellten Vorannahmen vorgenommen (vgl. Kapitel V. I. Vorannahmen zum Cyber ValleyDiskursstrang).
Basierend auf den Erkenntnissen zum Sagbarkeitsfeld, der Einseitigkeit der Diskurspositionen im Diskursstrang und den damit einhergehenden immer wiederkehrenden positiven Beschreibungen des Cyber Valley können folgende Wirkungseffekte vermutet werden: Eine umfassende und kritische Diskussion über die tatsächlichen Auswirkungen des Cyber Valley und seiner Initiative auf die Gesellschaft wird erheblich erschwert und mögliche Alternativen unterdrückt (vgl. V. III. II. Materialaufbereitung; vgl. V. IV. III. Abschließende Gesamtanalyse typischer Diskursfragmente).
Diese Wirkungseffekte werden vermutlich u.a. dadurch verstärkt, dass sowohl das Cyber Valley als auch die untersuchten Presseorgane ihre Publikationen als vermeintlich differenziert und neutral/objektiv konstruieren und möglicherweise auch so verstehen, da sie auf Fakten basieren.
Die Grundlagen dieser Wirkungseffekte werden möglicherweise auch dadurch verstärkt, dass das Cyber Valley bzw. seine Akteur*innen externe Kritik (des Gegendiskurses) dazu nutzt, sich vermeintlich28 zu optimieren, indem es zum Beispiel Public Engagement Managerinnen aufstellt und das PAB einrichtet (vgl. Cyber Valley 2023d & 2023e).
Bewertung der Diskurspositionen
Basierend auf den Erkenntnissen aus Kapitel VI. Analyse des gesamten Diskursstranges zeigt sich, dass die Diskurspositionen der Pressepublikationsorgane weitgehend mit denen des Cyber Valley übereinstimmen und dass im untersuchten Diskursstrang seitens der untersuchten Pressepublikationsorgane keine kritische Auseinandersetzung mit dem Cyber Valley stattfindet. Die in den Strukturanalyse-Tabellen beschriebenen Diskurspositionen haben sich somit in der weiteren Analyse bestätigt.
Es entsteht der Eindruck, dass die untersuchten Zeitungen eine Art erweiterte Öffentlichkeitsarbeitsabteilung des Cyber Valley und seiner Akteurinnen darstellen (sei es bewusst oder unbewusst). Dieser Eindruck widerspricht der offiziellen Rolle der Presse, wie sie von der Bundesrepublik Deutschland auf ihrer offiziellen Internetseite (www.deutschland.de) beschrieben wird. Dort wird die Rolle der Presse als unabhängige Berichterstattung und Kontrolle des politischen Geschehens beschrieben (vgl. Berg 05.06.2020).
Vorannahmen Bewertung
Im Kapitel V. I. Vorannahmen zum Cyber ValleyDiskursstrang formulierte der Verfasser drei Vorannahmen zum Cyber Valley und dem damit verbundenen Diskursstrang. Durch die Analyse haben diese an Bedeutung gewonnen, auch wenn sie aufgrund der als unabgeschlossen zu verstehenden Analyse nicht abschließend bestätigt werden konnten. Im Folgenden werden abschließende Einschätzungen zu den drei Vorannahmen formuliert.
Zu Vorannahme 1 „Die Betrachtung von Alternativen zum Cyber Valley ist möglicherweise unzureichend“:
In dieser Vorannahme sieht sich der Verfasser nach der Untersuchung des Diskursstrangs bestärkt. Die untersuchten Publikationen der Presseorgane und des Cyber Valley kommunizieren keine Alternativen und die fehlende kritische Auseinandersetzung mit der sozialen Konstruktion von KI-Technologien und den Auswirkungen der KI-Nutzung und -Forschung lässt die Betrachtung von Alternativen auch nicht notwendig erscheinen.
Zu Vorannahme 2 „Das Cyber Valley könnte die Demokratie schwächen und die Macht großer Unternehmen und kapitalstarker Interessengruppen stärken“:
Diese Annahme gewinnt an Relevanz. Es ist davon auszugehen, dass das Cyber Valley und der von ihm geprägte Diskurs die Demokratie weiter schwächen und gleichzeitig die Macht von Großunternehmen und kapitalstarken Interessengruppen stärken wird.
Zu Vorannahme 3 „Das Cyber Valley könnte die Ideologie des Silicon Valley verfolgen“:
Die Vorannahme, dass die Ideologie des Silicon Valley auf das Cyber Valley übertragen wurde bzw. von dessen Akteur*innen auch unbewusst von innen heraus verfolgt wird, hat sich durch den untersuchten Diskursstrang bekräftigt (vgl. Kapitel VI. Analyse des gesamten Diskursstranges). Möglicherweise lässt sich dies u.a. auf die Wirkung des „in der Bundesrepublik Deutschland vorherrschenden politischen Diskurses“, wie ihn Jäger (2015: 49) beschreibt, zurückzuführen.
Die Ideologie, die in der Analyse des Diskursstrangs sichtbar wurde, sieht in der Technologie (die sie als neutral betrachtet) eine universelle Lösung und eine unaufhaltsame Kraft, die in Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft weiterentwickelt werden muss.29 Das wurde sowohl in Kapitel VI. Analyse des gesamten Diskursstranges, als auch bei der Zusammenschau der Normalismen deutlich (vgl. LR 2023_Normalismen Zusammenschau: 5f.). Dies etabliert die Denkweise, dass öffentliche Forschung im Bereich der KI in Kooperation mit privaten Akteur*innen geschehen muss.
Die Chance, mit dem Cyber Valley ein neues Konzept für die Erforschung und Anwendung von KI in Gegenwart und Zukunft zu entwickeln, wurde meines Erachtens nicht genutzt, wie die Analyse des Diskursstrangs zeigt. Dies liegt vermutlich u.a. daran, dass es keine umfassende Auseinandersetzung mit bestehenden Alternativen und Ansätzen im digitalen Bereich30 gibt und diese möglicherweise der nationalstaatlichen Standortlogik der Wohlstanderhaltung und der neoliberal-kapitalistischen Haltung der Initiatorinnen und aktuellen Akteurinnen des Cyber Valley widersprechen.
VIII. Vorschläge zur Veränderung des kritisierten Diskurses
Zunächst könnten Journalistinnen ihre Ideologie (welche als Normalität verstanden wird) grundlegend kritisch reflektieren31, sich ihrer Machtposition als „handlungsstrategischer Akteur“ bewusst werden und die damit verbundenen Konsequenzen für die Art der Wirkung des von ihnen Mitproduzierten im Diskursstrang reflektieren (Vogel/Deus 2020: 186). Dabei könnten sie sich, wie Friedemann Vogel und Fabian Deus (2020: 189) anmerken, folgende Fragen aufrichtig beantworten: „Warum halte ich das für relevant und nicht das andere? Was ist wichtig? Wem gebe ich Recht und Raum? Und wem nicht?“ (ebd.).
Außerdem wäre es wünschenswert, die Akteurinnen des Gegendiskurses 32 in den Diskursstrang einzubinden, ohne sie für gewinnorientierte oder andere Interessen in Anspruch zu nehmen.
IX. Fazit
Ziel und Inhalt
Das Ziel dieser Arbeit war es, den Diskursstrang um das Cyber Valley mittels einer KDA zu untersuchen. Dabei wurden die implizite ideologische Beeinflussung durch Sprache und die damit verbundenen Machtstrukturen herausgearbeitet, um darauf aufbauend eine kritische Reflexion durchzuführen.
Inhaltlich konzentrierte sich die Arbeit auf die Analyse der Selbstdarstellung und der Darstellungen des Cyber Valley in verschiedenen Publikationsorganen, insbesondere im Hinblick auf seine Initiative zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Forschung und Industrie.
Im Rahmen der KDA nach Jäger (2015) wurden ausgewählte Schritte der Methoden angewendet und im Fall der Strukturanalyse mit der aspektorientierten Analyse nach Friede et. al. (2022) ergänzt.
Ausmaß der Untersuchung
Die Untersuchung umfasste eine Strukturanalyse mit vierzehn Strukturanalyse-Tabellen, die durch eine aspektorientierte Analyse mit zwölf ausgewählten Textabschnitten erweitert wurde. Darüber hinaus wurden drei Feinanalysen durchgeführt, um die Tiefenstruktur der Aussagen und ihre Auswirkungen im Kontext des Diskursstrangs zu ergründen. Dabei wurden vor allem sprachliche und rhetorische Mittel sowie ideologische Aussagen untersucht.
Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit konnten jedoch viele der insgesamt 160 Seiten Material mit Struktur- und Feinanalysen des Verfassers nicht berücksichtigt werden und wurden nur teilweise durch Verweise und wenige Zitate einbezogen.
Ergebnisse der Analyse
Die Analyse des Diskursstrangs zeigt eine einheitliche und positiv besetzte Darstellung des Cyber Valleys als führender Standort für KI-Forschung und -Entwicklung in den analysierten Diskursfragmenten. Die behandelten Aspekte, einschließlich der Aussagen und Normalismen, unterstreichen gemeinsam die Relevanz der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, des technologischen Fortschritts und der Anziehungskraft für Talente im Kontext des heraufbeschworenen Wettbewerb.
Die Wirkung des Diskursstrangs, die durch die Analysearbeit ermittelt werden konnte, besteht darin, dass Alternativen zum Cyber Valley und seiner Initiative nicht akzeptiert werden oder als undenkbar erscheinen. Dies bietet den Akteur*innen des Cyber Valley Gelegenheit, sich zu etablieren und Diskurse zugunsten ihrer Interessen weiter zu beeinflussen.
Es ist anzunehmen, dass dies zu einer Verstärkung des Machtungleichgewichts im Diskurs führt, da kritisches Verhalten gegenüber dem Cyber Valley und seiner Initiative unterdrückt wird, ohne dass dies als Unterdrückung im öffentlichen Diskurs wahrgenommen wird.
Grenzen der Untersuchung
Die Gültigkeit der Ergebnisse dieser als unabgeschlossen zu betrachtenden Arbeit33, könnte durch weitere Forschungen zum Thema, eventuell auch mit anderen Methoden, weiterbearbeitet und/oder überprüft werden.
Alternative Forschungsansätze
Sicherlich könnte eine wissenssoziologische Diskursanalyse in Anlehnung an Sasa Bosancic und Reiner Keller gewinnbringend sein (vgl. BosanciC/Keller 2022). Gleiches gilt für eine Diskursethnographie wie von Florian Elliker (2022: 507-518) im Handbuch Soziologische Ethnographie beschrieben.
Möglichkeiten für zukünftige Forschungen
Ein detaillierteres Bild des untersuchten Diskurses könnte sicherlich eine umfassende Untersuchung von Print- und Online-Presse, Radio und Fernsehen, sozialen Medien und anderen Medien und deren Verschränkungen mit anderen Diskurssträngen zum Diskursstrang des Cyber Valley und seiner Initiative liefern.
Es könnte auch untersucht werden, wie sich die Diskursstränge zu anderen Kl-Standorten wie dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in Verbindung mit dem CYBERLAB oder dem Diskursstrang des Munich Center for Machine Learning (MCML) gestalten und welche Ähnlichkeiten und Unterschiede zum hier untersuchten Diskursstrang bestehen.
Des Weiteren könnten sich Folgefragen auf die konkreten Auswirkungen des Cyber Valley im breiteren soziologischen Kontext, einschließlich seiner sozialen, wirtschaftlichen und ethischen Implikationen, richten. In dieser Hinsicht könnte die Dispositivanalyse des Cyber Valley nach der Methode der KDA sicherlich hilfreich sein.
Bisher gibt es kaum wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wie genau das bestehende Konstrukt des Cyber Valley funktioniert und wie eine grundlegende Transformation des Cyber Valley aussehen könnte, die nicht den Prinzipien des neoliberalen Kapitalismus folgt und nicht (beabsichtigt oder unbeabsichtigt) darauf abzielt, den Status Quo mit all seinen Ungerechtigkeiten zu bewahren.
Zunächst sollte eine umfassende Dispositivanalyse nach Jäger (2015) durchgeführt werden. Darauf aufbauend sollte eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Das Ziel dieser Studie sollte sein, einen Weg zu finden, das Cyber Valley zu einem Ort zu entwickeln, an dem frei zugängliche Technologien entstehen, die allen Menschen auf der Erde die Möglichkeit bieten, sich frei zu entfalten und der Klimakrise entgegenzuwirken.34
Herausforderung und Schlussfolgerung
Während der Analyse der Diskursfragmente war es immer wieder persönlich herausfordernd, meine kritische Haltung aufrechtzuerhalten. Ich habe jedoch erkannt, dass der Diskurs rund um das Cyber Valley und seine Initiativen (sei es bewusst oder unbewusst) so gestaltet ist, dass er auf die Zustimmung dazu abzielt. Diese Feststellung der (einseitigen) Beeinflussung hilft mir dabei, mich nicht auf gänzlich unkontrollierte Art und Weise vom Diskursstrang beeinflussen zu lassen. Es wird mir dadurch deutlich, wie wichtig es ist, (zumindest ansatzweise) zu verstehen, wie Diskurse funktionieren. Die (Weiter-)Entwicklung einer kritischen Haltung, die über den herrschenden (und als alternativlos dargestellten) Status quo hinauszudenken vermag, welche die Möglichkeiten der Weiterentwicklung ausloten kann, erscheint mir dabei lebenswichtig.
X. Literaturverzeichnis
X. I. Literaturquellen
Angermuller, Johannes et. al., Hrsg. 2014. Diskursforschung: ein interdisziplinäres Handbuch (2Bde.). Bd. 1. Bielefeld: Transcript.
Bertram, Elena. 2021. „Zivilklauseln. Hochschulen zwischen Vision und Realpolitik“. IMI- Studie 3/2021 (Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V., Hrsg.).
BosanciC, Sasa, und Reiner Keller. 2022. Diskurse, Dispositive und Subjektivitäten: Anwendungsfelder und Anschlussmöglichkeiten in der wissenssoziologischen Diskursforschung. Wiesbaden [Heidelberg]: SpringerVS.
Christian, Brian. 2020. The alignment problem: machine learning and human values. First edition. New York: W.W. Norton & Company.
Crawford, Kate. 2021. Atlas of AI: power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence. New Haven: Yale University Press.
Daub, Adrian. 2021. Was das Valley denken nennt: über die Ideologie der Techbranche. 2. Auflage. Berlin: Suhrkamp.
Eggers, Thorsten. 2022. Der Begriff „Wutbürger“ im mediopolitischen Diskurs. Frankfurt/ M.: Wochenschau Verlag.
Elliker, Florian. 2022. „Diskursethnographie“. In: Poferl, Angelika und Norbert Schröer (Hrsg.) Handbuch Soziologische Ethnographie. Wiesbaden [Heidelberg]: Springer VS. S. 507-518.
Foucault, Michel. 1973. Archäologie des Wissens, Hrsg. Ulrich Köppen. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Foucault, Michel. 1988. Das Wahrsprechen des Anderen. 2 Vorlesungen von 1983/84, Hrsg. Ulricke Reuter. Frankfurt/M.: Materialis Verlag.
Friede, Judith et. al., 2022. Deutsche Rettung? eine kritische Diskursanalyse des Fluchtdiskurses um Carola Rackete und Moria. Münster: Edition des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung im UNRAST Verlag.
Fuchs, Christian. 2021. Das digitale Kapital: Zur Kritik der politischen Ökonomie des 21. Jahrhunderts. Wien Berlin: Mandelbaum.
Jäger, Siegfried. 2015. KritischeDiskursanalyse: eineEinführung. 7. vollständigüberarbeitete Auflage. Münster: Unrast.
Jäger, Siegfried und Jens Zimmermann, Hrsg. 2019. Lexikon Kritische Diskursanalyse: eine Werkzeugkiste. 2. Auflage. Münster: UNRAST-Verlag.
Klein, Naomi. 2023. „Der maskierte Raub - KI und die Halluzinationen der Tech-Konzerne“. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 23(6), 53-62.
Krausen, Jean-Marcel. 2023. Künstliche Intelligenz als Erfindung und Erfinder: patentrechtliche Auswirkungen des Fortschritts auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Tübingen: Mohr Siebeck.
Link, Jürgen. 2006. Versuch über den Formalismus. Wie Normalität produziert wird. 3., ergänzte, überarbeitete und neu gestaltete Auflage. Göttingen: Vandehoeck und Ruprecht.
Lovink, Geert. 2022. In der Plattformfalle: Plädoyer zur Rückeroberung des Internets. Bielefeld: transcript.
Madjlessi-Roudi, Sara. 2022. Ordnen und Regieren: eine postkoloniale Diskursanalyse des Konzepts >Zivilgesellschaft< in der deutschen Entwicklungspolitik = ..Mamachen. Mitwirken und Mitgestalten?“: eine postkoloniale kritische Diskursanalyse der Konstruktion von Zivilgesellschaft in der Entwicklungspolitik des BMZ unter besonderer Berücksichtigung Afrikas (1998-2013). Münster: Unrast Verlag.
Marischka, Christoph. 2020. Cyber Valley - Unfall des Wissens. Künstliche Intelligenz und ihre Produktionsbedingungen - Am Beispiel Tübingen. Köln: PapyRossa.
Marischka, Christoph. 2023. „FCAS. Ansatzpunkte für eine Kampagne am Beispiel Stuttgart“. In: Ausdruck. Magazin der Informationsstelle Militarisierung e.V. 21(Ausgabe 112). S. 55-60.
Mühlhoff, Rainer et al., Hrsg. 2019. Affekt Macht Netz: auf dem Weg zu einer Sozialtheorie der digitalen Gesellschaft. Bielefeld: transcript.
netzforma e.V. - Verein für feministische Netzpolitik, Hrsg. 2021. Wenn KI dann feministisch: Impulse aus WissenschaftundAktivismus. Berlin: netzforma.
O’Neil, Cathy. 2016. Weapons of math destruction: how big data increases inequality and threatens democracy. New York: Crown.
Rammert, Werner und Ingo Schulz-Schaeffer. 2020. „Technik und Gesellschaft“. In: Joas, Hans und Steffen Mau (Hrsg.) Lehrbuch der Soziologie. 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Frankfurt/M.: Campus. S. 659-690.
Schadt, Peter. 2022. Digitalisierung. Köln: PapyRossa.
Schwarz, Ori. 2021. Sociological theory for digital society: the codes that bind us together. Cambridge, UK; Medford, MA: Polity Press.
Simanowski, Roberto. 2023. „Narrative der Weltbeglückung. Die neue Sprach-KI und die Mathematisierung der Ethik“. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 23(6), 63-73.
Staab, Philipp. 2019. Digitaler Kapitalismus. Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit. Berlin: Suhrkamp.
Staab, Philipp. 2020. „Digitalisierung“. In: Joas, Hans und Steffen Mau (Hrsg.) Lehrbuch der Soziologie. 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Frankfurt/M.: Campus. S. 901-925.
Thiemeyer, Thomas et al., Hrsg. 2023. Cyber and the City. Künstliche Intelligenz bewegt Tübingen. Tübingen: Universitätsstadt Tübingen - Fachbereich Kunst und Kultur.
Vogel, Friedemann und Fabian Deus, Hrsg. 2020. Diskursintervention: normativer Maßstab der Kritik und praktische Perspektiven zur Kultivierung öffentlicher Diskurse. Wiesbaden [Heidelberg]: SpringerVS.
Vogl, Joseph. 2021. Kapital und Ressentiment. Eine kurze Theorie der Gegenwart. München: C.H.-Beck.
Zima, Peter. 2022. Diskurs und Macht: Einführung in die herrschaftskritische Erzähltheorie. Opladen Toronto: Verlag Barbara Budrich.
X. II. Internetquellen
AI Now Institute 2023: „2023 Landscape. Executive Summary“. URL: https://ainowinstitu- te.org/general/2023-landscape-executive-summary [letzter Aufruf: 29.08.2023].
Berg, Kim 05.06.2020: „Pressefreiheit: Die Aufgabe der Medien in Deutschland“. URL: https://www.deutschland.de/de/topic/kultur/pressefreiheit-die-aufgabe-der-medien-in-deutsch- land [letzterAufruf: 29.08.2023].
Bündnis gegen das Cyber Valley 2023: „Demonstration: Wissenschaft für die Menschen - nicht für die Industrie, Überwachung und Krieg“. URL: https://nocybervalley.de/?page_id=45 [letzter Aufruf: 02.08.2023].
Capiilcii 2023: „Neue Texte“. URL: https://capulcu.blackblogs.org/neue-texte/ [letzter Aufruf: 25.07.2023].
Cyber Valley 08.04.2021: „Ich sehe mich als Moderator, der den Dialog organisiert. Acht Fragen an Patrick Klügel, Cyber Valley Public Engagement Manager“. URL: https://www.cy- ber-valley.de/de/news/ich-sehe-mich-als-moderator-der-den-dialog-organisiert [letzter Aufruf: 29.08.2023].
Cyber Valley 13.12.2021: „Meilensteine. Highlights aus den ersten fünf Jahren Cyber Valley“. URL: https://cyber-valley.de/de/news/milestones [letzterAufruf: 30.08.2023].
Cyber Valley 2023a: „Europas größtes KI-Forschungskonsortium“. URL: https://cyber-val- ley.de/ [letzterAufruf: 26.06.2023].
Cyber Valley 2023b: „Häufig gestellte Fragen“. URL: https://cyber-valley.de/de/faqs [letzter Aufruf: 26.06.2023].
Cyber Valley 2023c: „Impressum/Anbieterkennzeichnung“. URL: https://cyber-valley.de/de/ imprint [letzterAufruf: 29.08.2023].
Cyber Valley 2023d: „Public Advisory Board“. URL: https://www.cyber-valley.de/de/public- advisory-board [letzterAufruf: 22.08.2023].
Cyber Valley 2023e: „Public Engagement“. URL: https://www.cyber-valley.de/de/pages/pu- blic-engagement [letzterAufruf: 22.08.2023].
Cyber Valley 2023f: „Ökosystem“. URL: https://cyber-valley.de/de/ecosystem [letzter Aufruf: 24.08.2023].
Daub, Adrian. 2022: „Ein Ort und unser aller Zukunft? Das Valley und wir“. URL: https:// www.kas.de/de/web/die-politische-meinung/artikel/detail/-/content/ein-ort-und-unser-aller- zukunft [letzterAufruf: 23.08.2023].
Forbes Billionaires 2023: „World's Billionaires List. The Richest People In The World“. URL: https://www.forbes.com/billionaires/ [letzterAufruf: 17.08.2023].
Morozov, Evgeny. 11.05.2023: „Kalte Krieger im Silicon Valley“. URL: https://monde-di- plomatique.de/artikel/!5915538 [letzterAufruf: 20.08.2023]. Resonanz Con(tra)sens 29.10.2017: „Cyber Valley: Gefährliche Mischung über den Dächern Tübingens“. URL: https://www.wueste-welle.de/sendung/view/id/204/tab/weblog/article/60873/Cyber_ValleyGef-auml-hrliche_Mischung_-uuml-ber_den_D-auml-chern_Tuuml bingens.html#topBlog [letzterAufruf: 29.08.2023].
Resonanz Con(tra)sens 07.12.2018: „Interview und Vortrag von CAPULCU...“. URL: https://www.wueste-welle.de/sendung/view/id/204/tab/weblog/article/67016/CAPULCU_- _keep_the_future_unwritten.html#topBlog [letzter Aufruf: 29.08.2023].
Platform Cooperativism Consortium 2023: „A hub that helps you start, grow, or convert to platform co-ops“. URL: https://platform.coop/ [letzter Aufruf: 29.08.2023].
VSZV (Verband SüdwestdeutscherZeitungsverleger e.V.) 31.12.2017: „Auflagenhöhen der Tageszeitungen in Baden-Württemberg“. URL: https://docslib.org/doc/7176216/auflagenh %C3%B6hen-der-tageszeitungen-in-baden-w%C3%BCrttemberg [letzter Aufruf: 30.08.2023].
X. III. Verzeichnis der in der Analyse verwendeten Quellen aus dem Material-Korpus
Allgöwer, Renate. 28.01.2022. „Das ist ein Forschungsparadies“. Interview mit Bernhard Schölkopf und Winfried Kretschmann, in: Stuttgarter Zeitung. S. 6. Aus dem SZ-Archiv.
Allgöwer, Renate. 21.02.2023. „Palmer will Bosch im Cyber Valley stützen“, in: Stuttgarter Zeitung Online. Aus dem SZ-Archiv.
Bachmann, Angelika. 23.10.2017: „Amazon baut ein Forschungszentrum in Tübingen. Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft“. URL: https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Amazon-baut-ein-Forschungszentrum-in-Tuebingen- Kooperation-mit-der-Max-Planck-Gesellschaft-351064.html [letzter Aufruf: 18.08.2023].
Baden-Württemberg.de. o.D.: „Den digitalen Wandel gestalten“. URL: https://www.baden- wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/erfolgreiches-baden-wuerttemberg/digitalisierung [letzter Aufruf: 22.08.2023].
Digitalisierungsstrategie 07.2017: Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg im Auftrag der Landesregierung Baden-Württemberg, Hrsg. Gestaltung und Produktion: Traumwelt GmbH, Stuttgart. URL: https://im.baden-wuerttemberg.de/de/ser- vice/publikation/did/digitalisierungsstrategie/ [letzter Aufruf: 30.08.2023].
Dpa. 27.01.2022. „Ellis-Institut in Tübingen soll Leuchtturm der KI-Strategie werden. Baden- Württemberg baut sein sogenanntes Cyber Valley aus, um das Kalifornien Europas zu werden“, in: Stuttgarter Zeitung. Online. Aus dem SZ-Archiv.
era. 08.11.2019. „Cyber Valley geht auf Wirtschaft zu“, in: Stuttgarter Zeitung. S. 1. Aus dem SZ-Archiv.
Martin-Jung, Helmut. 24.10.2017. „Amazon forscht in Tübingen“, in: Die Zeit. Seite Unbekannt. Aus dem Stadtarchiv Tübingen.
Mayr, Stefan. 21.02.2020. „Vestager und die klugen Köpfe. Die EU- Wettbewerbskommissarin fordert mehr Engagement der Regierungen für künstliche Intelligenz“, in: Süddeutsche Zeitung. S. 20.
MPG (Max-Planck-Gesellschaft) 15.12.2016: „Startschuss für das Cyber Valley“. URL: https://www.mpg.de/10857490/cyber-valley [letzter Aufruf: 30.08.2023].
Muschel, Roland. 16.12.2016. „Große Pläne mit Schwäbischem Valley“, in: Schwäbisches Tagblatt - Tübinger Chronik, S.1. Aus dem Stadtarchiv Tübingen.
Raidt, Erik. 24.06.2019. „Wer forscht, gewinnt. Stuttgart feiert erstmals ein Wissenschaftsfestival - die Unis treten bisher viel zu leise auf“, in: Stuttgarter Nachrichten. S. 2. Aus dem SZ-Archiv.
Raidt, Erik. 08.11.2019. „Die klügsten Köpfe gewonnen. Das Cyber Valley ist ein Erfolgsmodell - auch für die Wirtschaft der Region Stuttgart“, in: Stuttgarter Zeitung. Aus dem SZ-Archiv.
Raidt, Erik. 08.11.2019b. „Das Cyber Valley soll sich auszahlen“, in: Stuttgarter Nachrichten. S. 4. Aus dem SZ-Archiv.
Rekittke, Volker. 28.02.2023: „Amazon-Standort Tübingen: Kretschmann eröffnet Neubau. Ministerpräsident Winfried Kretschmann kam zur Eröffnung des vierten deutschen Forschungsstandortes des Online-Händlers“. URL: https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Tuebingen-ist-Amazon-Standort-579311.html [letzter Aufruf: 30.08.2023].
Schmitz, Jens. 28.08.2019. „In der Halle des Avatar. Baden-Württemberg kämpft um seine technologische Spitzenstellung. Es geht um eine europäische Antwort auf die BranchenRiesen“, in: Schwäbisches Tagblatt - Tübinger Chronik. Seite Unbekannt. Aus dem Stadtarchiv Tübingen.
Stegert, Gernot. 18.07.2018: „Initiative in Tübingen weist Vorwürfe der Militarisierung und des Ausverkaufs zurück“. URL: https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Zivile-Grundlagenforschung-379807.html [letzterAufruf: 16.05.2023].
Stegert, Gernot. 08.08.2019. „Auf dem "Cyber Mountain"“, in: SüdwestPresse. S. 6.
Universität Tübingen. 01.2018: „Aktuelles und Publikationen“. Newsletter Uni Tübingen aktuell Nr.01/2018: Forschung. URL: https://uni-tuebingen.de/universitaet/aktuelles-und-pu- blikationen/newsletter-uni-tuebingen-aktuell/2018/1/forschung/1/ [letzter Aufruf: 18.08.2023].
Westermann, Theo. 05.10.2022. „LernenvonPittsburgh“, in: SüdwestPresse. S. 6.
Zimmer, Lorenzo. 07.03.2019. „Wenn nicht hier dann woanders“, in: Schwäbisches Tagblatt - Tübinger Chronik, Seite Unbekannt. Aus dem Stadtarchiv Tübingen.
XI. Anhang
USB-Stick, auf dem sich PDF-Dateien in Ordnern mit folgenden Namen befinden:
- LR 2023_ANALYSE MATERIAL__72 Seiten
- LR 2023_IN DER ANALYSE VERWENDETE QUELLEN AUS DEM MATERIAL-KORPUS
- LR2023_INTERNETQUELLEN
- LR 2023_MATERIAL-DOSSIER__1569 Seiten__Chronologisch sortiert
- LR 2023_MATERIAL-KORPUS__2340 Seiten
- LR 2023_STRUKTURANALYSE-TABELLEN__88 Seiten
- LR 2023_HAUSARBEIT, ESSAYS UND LISTEN
Download-Seiten
LR 2023_Alternative-Linx-Liste: https://cloud.systemli.org/s/P4on2Y5XC4pHYCN
LR 2023_Alternative-WWW-Liste: https://cloud.systemli.org/s/ykGkjKLeHC6WQng
[...]
1 Der Status quo im Sinne der herrschenden sozialen, politischen und ökonomischen Strukturen, der meiner Meinung nach für die Mehrheit der Menschen seit jeher katastrophal ungerecht ist, führt auf allen Kontinenten weiterhin zu wachsender Macht- und Kapitalakkumulation. Die Vorstellung, der kapitalistisch dominierte Status quo könne durch Reformen verbessert werden, erscheint mir ebenso irreführend wie der Glaube an die Wiederherstellung vermeintlich besserer vergangener Zustände im Kapitalismus. Zudem zeigt sich tagtäglich, dass die Strukturen des Status quo nicht in der Lage sind, die elementaren Lebensgrundlagen zu sichern.
2 „Plattformkapitalismus“, weil dies die derzeit vorherrschende Form des Kapitalismus bzw. der Kapitalismen ist (vgl. Forbes Billionaires 2023; vgl. Fuchs 2021: 162; vgl. Staab 2019: 89). Wie der Verfasser in der Hausarbeit mit dem Titel Der Plattformkapitalismus und seine Auswirkungen auf den Menschen und die Gesellschaft, unter Bezugnahme auf u.a. Christian Fuchs (2021) und Philipp Staab (2019 & 2020) dargelegt hat (vgl. LR 14.03.2023: 3).
3 Für eine exemplarische Betrachtung von Alternativen in der digitalen Welt, die in eine befreiende Richtung weisen, wird auf die beigefügte PDF-Datei „LR 2023_Alternative-WWW-Liste“ verwiesen.
4 Wie Peter Zima (2022: 171f.) in seinem Buch Diskurs und Macht: Einführung in die herrschaftskritische Erzähltheorie ausführt, ist Ideologie auch als „Wertesystem“ zu verstehen. Zima erklärt: „Die Ideologen erreichen ihr Ziel, wenn es ihnen gelingt, Ideologie als „gesunden Menschenverstand“ zu naturalisieren, d.h. als normales, menschliches Denken anerkennen zu lassen“ (Zima 2022: 122).
5 Die neoliberale Ideologie des Silicon Valley, die ihre Wurzeln in der libertären Philosophie von Ayn Rand (Kapitel III. Genie), dem Denken von René Girard (Kapitel V. Begehren) und den (teilweise falsch interpretierten) Ideen von Joseph Schumpeter (Kapitel VI. Disruption) hat, arbeitete Adrian Daub in seinem Buch Was das Valley denken nennt: über die Ideologie der Techbranche welches im Jahr 2021 erschienen ist, heraus (vgl. Daub 2021). An anderer Stelle schreibt Daub (2022: 25) „Von Silicon Valley kann man sich einen Diskursstil, einen Politikstil abschauen, der für sich in Anspruch nimmt, Zukunft gestalten zu wollen, ohne die damit einhergehende Verantwortung auch ernst zu nehmen“. Auch Philipp Staab, Professor für Soziologie der Zukunft der Arbeit, weist auf die extrem neoliberale Ideologie im Silicon Valley hin, etwa wenn er den einflussreichen Vordenker Peter Thiel (Mitbegründer von PayPal und erster kapitalintensiver Unterstützer von Facebook) zitiert, der den Quasi-Monopolisten des kommerziellen Internets eine besondere gesellschaftliche Relevanz zuschreibt und sogar in ihren außerordentlichen Gewinnen aus der Monopolstellung einen Beitrag zum Wohle von Gesellschaft und Wirtschaft sieht (vgl. Staab 2019: 105).
6 Siehe die „Hefte zur Förderung des Widerstands gegen den Technologischen Angriff“ wie Disrupt!, Delete! und Diverge!, welche hier als PDF-Dateien kostenlos zur Verfügung stehen: https://capulcu.blackblogs.org/neue- texte/.
7 Aspekte und Ausprägungen dieser Wechselspiele in und mit der digitalen Welt hat der Verfasser in den beiden Essays Nietzsches Begriff des Ressentiment und seine heutige Anwendungsfähigkeit und Soziale Medien als Verstärker des Habitus u.a. mit Bezugnahme auf Joseph Vogl (2021) herausgearbeitet (vgl. LR 08.09.2021: 1f.; vgl.LR05.10.2021:2, 5ff.).
8 Siehe die Sammlung von Audiobeiträgen, die zwischen dem 23.11.2018 und dem 14.01.2019 entstanden sind. Abrufbar unter der URL: https://www.wueste-welle.de/sendung/view/id/204/tab/weblog/article/66824/No_Cy- ber_Valley auf_die_Stra-szlig-e_gegen_profitorientierte_Forschung.html.
9 Siehe IMI-Studie 3/2021 mit dem Titel Zivilklauseln. Hochschulen zwischen Vision und Realpolitik (vgl. Bertram04.03.2021).
10 Als Beispiel können das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (https://www.kit.edu/) zusammen mit dem CYBERLAB in Karlsruhe (www.cyberlab-karlsruhe.de), der geplante Ipai - Innovation Park Artificial Intelligence Baden-Württemberg (https://www.wirtschaft-digital-bw.de/ki-made-in-bw/innovationspark-kuenstliche- intelligenz-baden-wuerttemberg), die Offene Digitalisierungsallianz Pfalz (https://www.offenedigitalisierungsal- lianzpfalz.de/), oderdas Munich CenterforMachineLearning (MCML) (https://mcml.ai/) genannt werden.
11 Das Cyber Valley bezeichnet sich selbst als ein „Ökosystem“. Damit ist das gesamte Forschungskonsortium von Cyber Valley gemeint, das verschiedene Kooperationen zwischen akademischen Einrichtungen und privatwirtschaftlichen Unternehmen umfasst (Cyber Valley 2023f).
12 Wie im Werk Diskursforschung. Ein interdisziplinäres Handbuch beschrieben, lassen sich verschiedene Arten der KDA unterscheiden (vgl. Angermuller et al. 2014: 89). Gemein ist jedoch allen, dass sie interdisziplinär operieren. Diskurse sind in einem sozialen, historischen und politischen Kontext eingebettet und sind entsprechend als soziale Praxis zu verstehen. Ihr Hauptziel ist es, machtvolle ideologische und manipulative Zusammenhänge zwischen Sprache und Gesellschaft aufzudecken, um damit zur Verbesserung schwieriger Kommunikationsverhältnisse beizutragen, insbesondere bei sozialen Problemen mit sprachlichen Bezügen (vgl. ebd.). Diskurse werden außerdem als handlungsbezogene kommunikative Großmuster und Text übergreifende Zusammenhänge untersucht, um ihre Kontextabhängigkeit besser verstehen zu können (vgl. ebd.).
13 Dazu gehören die Zeitschrift kultuRRevolution und die Diskurswerkstatt Bochum/Dortmund (vgl. Jäger 2015: 25).
14 Unter „Thema“ versteht Jäger (2015: 80) „den inhaltlichen Kern einer Aussage, also das, wovon inhaltlich konzentriert die Rede ist“.
15 Wie Jäger (2015) auf Seite 73 beschreibt, ist ein Dispositiv nach Foucault eine komplexe und sich verändernde Konstellation von Diskursen, Institutionen, Technologien, Praktiken und sozialen Beziehungen, die miteinander verbunden sind und unsere Wahrnehmungen, Handlungen und Identitäten prägen. Ein Dispositiv umfasst also verschiedene materielle und soziale Aspekte. Dabei geht es Foucault auch um die Art und Weise, wie Macht und Wissen durch eine Vielzahl von Praktiken und Institutionen ausgeübt und verankert werden.
16 Für diese Behauptung wurde Jäger bzw. die KDA u.a. von Dominik Schrage und Reiner Keller kritisiert, nachzulesen in Angermuller et al. 2014, S. 409 bis 502.
17 Alle Texte, die in dieser Arbeit als Diskursfragmente bezeichnet werden, sind Texte, die in ihrer Originallänge, d.h. ungekürzt, vorliegen und/oder untersucht wurden.
18 Die öffentliche Bekanntgabe des Cyber Valley versteht der Verfasser als erstes diskursives Ereignis, auch wenn das Medienecho eher regional war.
19 Auch alle weiteren Texte wurden als PDF-Dateien gespeichert und befinden sich auf dem beigefugten USB-Stick.
20 Hier wären zum Beispiel das Public Advisory Board (PAB) und das Public Engagement zu nennen (vgl. Cyber Valley 2023d & 2023e).
21 „Prompt hat es im grünen Tübinger Milieu Ärger gegeben, weil auch Amazon Teil der Kooperation wurde“ (Raidt24.06.2019).
22 Im Sinne von Friede et. al. (2022) kann festgehalten werden, dass die aspektorientierte Analyse eine Methode darstellt, die es ermöglicht, bestimmte Aspekte eines Themas vertieft zu untersuchen und zu analysieren, indem ausgewählte Texte oder Textabschnitte unter bestimmten Fragestellungen untersucht werden. Die Durchführung der aspektorientierten Analyse erfolgt mit Hilfe der methodischen Werkzeuge der Feinanalyse der KDA (vgl. Friede et. al. 2022: 182), um Mechanismen, Tendenzen und kategorisierende Elemente im Bereich der Aussagen zu identifizieren (vgl. ebd.: 41f.).
23 Die entsprechenden Quellen der zwölf Textabschnitte sind im Literaturverzeichnis zu finden (vgl. MPG 15.12.2016; vgl. Muschel 16.12.2016; vgl. Bachmann 23.10.2017; vgl. Martin-Jung 24.10.2017; vgl. Universität Tübingen 01.2018; vgl. Stegert 18.07.2018 & 08.08.2019; vgl. Mayr 21.02.2020; vgl. Cyber Valley 13.12.2021; vgl. Westermann 05.10.2022; vgl. Thiemeyer et al. 2023; vgl. Baden-Württemberg.de. o.D.).
24 Die Äußerung, das Ellis-Institut solle Projekte durchführen, die „uns alle weiterbringen“ (LR 2023_Feinana- lyse 2022: Z. 47), kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass die Forschungsergebnisse allgemein zugänglich und von gesellschaftlichem Nutzen sein sollen (vgl. ebd.: Z. 45-47). Dies steht im Widerspruch zur Tendenz der anderen Antworten. Wobei nicht klar ist, wer mit „uns“ gemeint ist, vermutlich nur Menschen mit einem Ausweis eines EU-Landes und/oder nur Menschen mit einem deutschen Ausweis und/oder Menschen, die in Baden-Württemberg leben.
25 Damit sind insbesondere die in der Feinanalyse untersuchten Diskursfragmente gemeint, aber auch die in der Strukturanalyse untersuchten und zumindest dem oberflächlichen Eindruck nach die überwältigende Mehrheit der Diskursfragmente im Material- Korpus.
26 Dieses und weitere Implikate bzw. Implikationen von Kollektivsymbolen werden in den Feinanalysen im Anhang erläutert (vgl. LR 2023_Feinanalyse 2016: 7f.; vgl. LR 2023_Feinanalyse 2022: 9f.; vgl. LR 2023_Fein- analyse 2023: 9).
27 Siehe Seite 36f. dieser Arbeit.
28 Es ist anzunehmen, dass die Cyber Valley Initiative, die auf die Förderung der Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Forschung und der Industrie abzielt, dadurch nicht grundlegend verändert wird, sondern lediglich in ihrer Legitimität gestärkt wird.
29 Unabhängig vom untersuchten Diskursstrang vergleiche Daub 2021: 9, 52; Klein 2023: 55f.; Marischka 2020: 118; Staab2019: 105.
30 Siehe hierzu die PDF-Datei mit dem Namen „LR 2023_Ahernative-WWW-Liste“, die sich im Anhang befindet. Das Platform Cooperativism Consortium kann als Beispiel eines deutlich kontrastierenden Organisationsmodells zum Konstrukt von Cyber Valley genannt werden (vgl. Platform Cooperativism Consortium 2023).
31 Eine breite Auswahl an Nachrichten- und Informationsquellen könnte möglicherweise hilfreich sein. Für weitere Details hierzu bitte die PDF-Datei „LR 2023_Alternative-LINKS-Liste“ im Anhang einsehen.
32 Akteur*innen des Gegendiskurses könnten neben den aus dem Protest kommenden auch solche aus Tech-Kollektiven, der Open-Source-Bewegung und/oder Freie-Software-Projekten sein. Siehe hierzu „LR 2023_Alternative-WWW-Liste“ im Anhang.
33 Laut Jäger (2015: 88) stellt die Analyse einzelner Diskursstränge und ihrer Verknüpfungen einen Schritt hin zur Analyse des gesamtgesellschaftlichen Diskurses dar. Die Analyse einzelner Diskursstränge bleibt jedoch unvollständig, solange der gesamtgesellschaftliche Diskurs nicht untersucht wurde (vgl. Jäger 2015:88).
34 Dabei sollte selbstverständlich sein, dass bereits der Weg dorthin konsequent so gestaltet wird, dass er dem formulierten Ziel nicht entgegensteht.
Details
- Titel
- Ideologische Manipulation der Gesellschaft im Sinne des neoliberalen Cyber Valley
- Untertitel
- Eine Kritische Diskursanalyse des öffentlichen Diskurses über das Cyber Valley in der Region Stuttgart/Tübingen
- Note
- 1,3
- Autor
- Leo Rheinsberg (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2023
- Seiten
- 60
- Katalognummer
- V1554459
- ISBN (Buch)
- 9783389103289
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Cyber Valley Silicon Valley Künstliche Intelligenz Kritische Diskursanalyse KDA Max-Planck Stuttgart Tübingen Macht Foucault Cyber Valley - Unfall des Wissens
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 30,99
- Arbeit zitieren
- Leo Rheinsberg (Autor:in), 2023, Ideologische Manipulation der Gesellschaft im Sinne des neoliberalen Cyber Valley, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1554459
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-