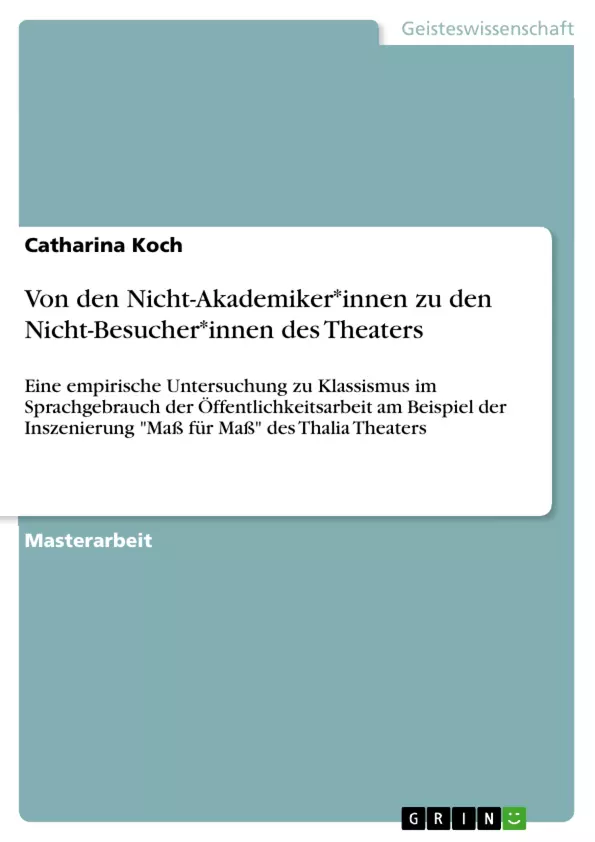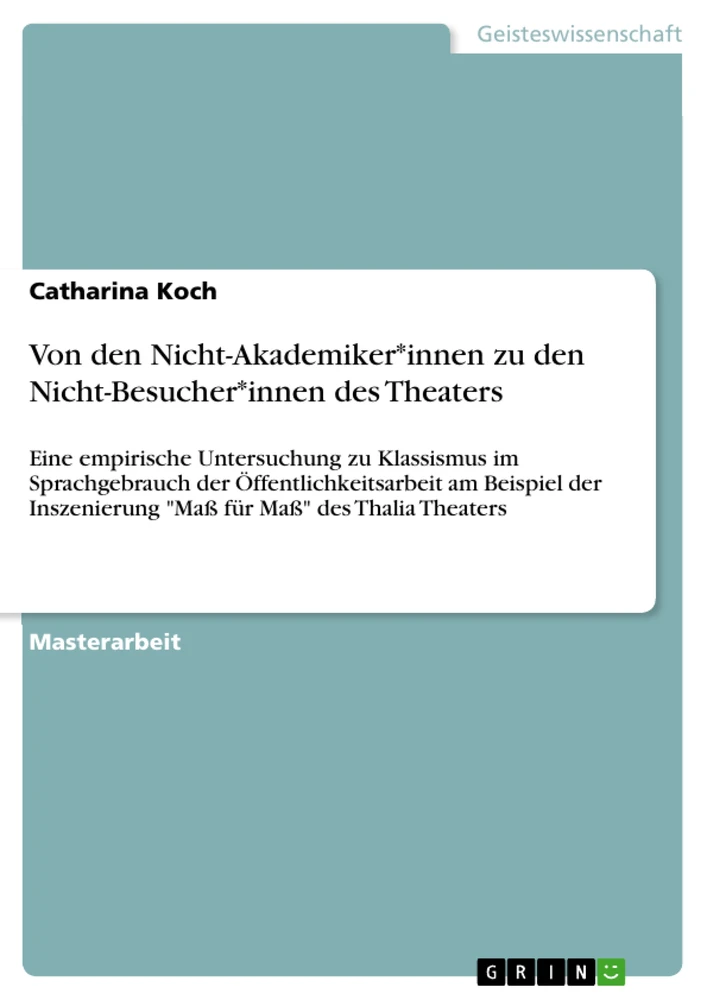
Von den Nicht-Akademiker*innen zu den Nicht-Besucher*innen des Theaters
Masterarbeit, 2021
196 Seiten, Note: 1.0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Klassismus als Diskriminierungsform in Deutschland
1.1 Definition und Prägung des Begriffs Klassismus
1.1.1 Definition und Auswirkungen von Klassismus
1.1.2 Bourdieus Kapitalsorten
1.1.3 Die Ursprünge der Diskriminierungskategorie Klassismus
1.1.4 Kritik an der Klassismustheorie
1.2 Klassismus aus intersektionaler Perspektive
1.2.1 Klassismus im Zusammenhang mit Sexismus
1.2.2 Klassismus im Zusammenhang mit Rassismus
1.3 Zwischenfazit zum Klassismus als Diskriminierungsform in Deutschland
2. Die Rolle der Sprache im Klassismus
2.1 Klassistische Wörter
2.2 Klassismus im Sprachgebrauch
2.3 Konzepte und Strategien für antiklassistische Sprache
3. Klassismus in der Institution Theater
3.1 Klassistische Strukturen in Bezug auf das Theaterpersonal
3.2 Klassistische Strukturen in Bezug auf das Theaterprogramm
3.3 Klassistische Strukturen in Bezug auf das Theaterpublikum
4. Das Forschungsdesign zur empirischen Untersuchung des Sprachgebrauchs der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß
4.1 Forschungsfragen
4.2 Datenerhebung
4.2.1 Studienteilnehmer*innen
4.2.2 Form der Datenerhebung
4.2.3 Transkription der Interviews
4.3 Datenauswertung
5. Darstellung und Interpretation der Forschungsergebnisse
5.1 Unverständliche Begriffe
5.2 . Unverständliche Ausdrucksformen
5.3 Subjektbedingte Barrieren der Interviewpartner*innen in Bezug auf den Inhalt der Öffentlichkeitsarbeit
5.4 Objektbedingte Barrieren, die anhand des Inhaltes der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß sichtbar werden
5.5 Motivation, ausgehend von der Öffentlichkeitsarbeit, die Inszenierung Maß für Maß zu rezipieren
6. Diskussion
6.1 Diskussion der Forschungsergebnisse
6.1.1 Unverständliche Begriffe und unverständliche Ausdrucksformen
6.1.2 Inhaltliche Barrieren
6.2 Zukunftsansätze der Öffentlichkeitsarbeit vom Thalia Theater
6.3 Limitationen der Studie
7. Schlusswort
8. Literaturverzeichnis
Anhang 1 - Leitfadeninterview
Anhang 2 - Beobachtungsbogen
Anhang 3 - Tabellarische Übersicht des Codierungssystems der Inhaltsanalyse
Anhang 4 - Transkribierte Interviews
Anhang 5 - Anfragen Interviews
Einleitung
Am 10. Januar 2019 fand im Rahmen der Stipendienvergabe an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig eine Ausstellung statt. Meine Eltern besuchten diese Ausstellung, da unter anderem zwei meiner Theaterarbeiten präsentiert wurden. Zu Beginn der Veranstaltung hielt die Hochschulleitung eine Rede, woraufhin sich alle Personen im Raum an Stehtischen, die mit Häppchen und Sekt ausgestattet waren, versammelten. An dem Tisch, an dem meine Eltern und ich Platz fanden, gesellten sich eine Dozentin und ein Mitarbeiter des Komitees dazu. Die Dozentin lobte meine Arbeit und spiegelte mir über die Verwendung fachspezifischer Begriffe wider, welche Tiefgründigkeit und Abstraktion sie in meiner Arbeit sehe. Ich bemerkte, dass meine Eltern während der Ansprache meiner Dozentin immer nervöser wurden. Als sich die Veranstaltung dem Ende zuneigte, suchten meine Eltern das Gespräch mit mir. Sie erläuterten mir, wie unwohl sie sich bei der Ausstellung gefühlt hätten und dass sie von dem Erzählten nur wenig verstanden hätten. Sie fühlten sich fehl am Platz.
Mein Vater arbeitet als Landwirt und verdient zusätzliches Geld als Lastkraftwagenfahrer. Meine Mutter ist neben ihrer Tätigkeit als Hausfrau, betreuende Großmutter und Unterstützerin auf dem Hof, außerdem in einer Grundschule als pädagogische Mitarbeiterin angestellt. Durch meine Schwestern und mich besuchten meine Eltern das erste Mal eine Universität oder Hochschule. Mit der Kunstszene kamen und kommen sie ausschließlich in Kontakt, wenn ich etwas präsentiere. In dem Gespräch nach der Ausstellung wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass meine eigene anfängliche Unsicherheit im Kontext der Kunsthochschule und Theaterszene ebenso wie die Wahrnehmung meiner Eltern mit der sozialen Herkunft zusammenhängen und als ein gesellschaftliches Problem eingeordnet werden müssen. Ab dem Zeitpunkt fing ich an, mich vermehrt mit der Diskriminierungstheorie Klassismus auseinanderzusetzen und arbeitete während meines Masterstudiums künstlerisch zu dem Thema in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz. Es stellte sich mir immer öfter die Frage, ob nicht nur Veranstaltungen wie die obige, sondern auch das Theater an sich eine abschreckende Wirkung auf Nicht-Akademiker*innen haben. Mit der Zeit festigte sich der Wunsch, in meiner Masterarbeit zu Klassismus am Theater zu forschen.
Als eines der bekanntesten Theater in Deutschland gilt das Thalia Theater in Hamburg. Es betreibt intensive Öffentlichkeitsarbeit, weshalb das Theater sowohl im Hamburger Stadtraum als auch in zahlreichen anderen Städten äußerst präsent ist. Ebenso setzt sich das Theater selbst mit Diskriminierungsformen auseinander, sodass sich eine Forschung zum Thema Klassismus an diesem Haus durchaus anbietet. Folglich wurde als Betrachtungsgegenstand die Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß des Thalia Theaters ausgewählt. Maß für Maß ist eine aktuelle Theaterinszenierung, die das zeitgenössische Thema der Pandemie aufgreift, aber auf der klassischen Textgrundlage von Shakespeare basiert, sodass für die Öffentlichkeitsarbeit viele Anknüpfungspunkte bestehen. Daher wird die Öffentlichkeitsarbeit anhand der Website, des Flyers, des Programmheftes, der Plakate sowie der Sticker zu der Inszenierung Maß für Maß untersucht, um folgende Fragestellung zu beantworten: Inwieweit erschwert der Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß den Zugang zum Thalia Theater für Nicht-Akademiker*innen?
Der Diskriminierungskategorie Klassismus wurde vor allem in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit geschenkt, weshalb der aktuelle Forschungsstand zu Klassismus in Deutschland im ersten Kapitel (Kapitel 1: Klassismus als Diskriminierungsform in Deutschland) dargestellt wird. Zunächst wird in dem Kapitel die Begriffsprägung erläutert und eine Definition von Klassismus dargelegt. Daran anknüpfend wird die intersektionale Perspektive von Klassismus, Sexismus und Rassismus beschrieben. Anschließend wird die Rolle der Sprache in Bezug auf Klassismus beleuchtet (Kapitel 2: Die Rolle der Sprache im Klassismus). In diesem Zuge werden klassistische Wörter und Klassismus im Sprachgebrauch erläutert. Darauf aufbauend werden Konzepte für eine diskriminierungsfreie Sprache vorgestellt. Im darauffolgenden Kapitel wird auf Klassismus in der Institution Theater eingegangen (Kapitel 3: Klassismus in der Institution Theater). Klassismus im Theater wird hierbei anhand von Personal, Programm und Publikum aufgeschlüsselt. Der zweite Teil dieser Arbeit enthält die empirische Untersuchung der Öffentlichkeitsarbeit der Inszenierung Maß für Maß. Dabei werden zu Beginn das Forschungsdesign und die Forschungsfragen sowie die Methoden der Datenerhebung und Datenauswertung vorgestellt (Kapitel 4: Das Forschungsdesign zur empirischen Untersuchung des Sprachgebrauchs der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß ). Bei der Befragung wird sich auf zwei verschiedene Gruppen konzentriert. Eine Gruppe besteht aus fünf Nicht-Akademiker*innen und die Kontrollgruppe setzt sich aus fünf Akademiker*innen zusammen. Anschließend wird die Befragung dargestellt und ausgewertet (Kapitel 5: Darstellung und Interpretation der Forschungsergebnisse). Unter Berücksichtigung der Theorie des ersten Teils werden schließlich im 6. Kapitel die Ergebnisse der Studie interpretiert und diskutiert. Anknüpfend an die Diskussion werden Zukunftsansätze für den Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit formuliert und die Limitationen der Forschung dargelegt (Kapitel 6: Diskussion). In der Schlussbetrachtung der Arbeit werden die Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst. Ferner wird für die weitere Forschung ein Ausblick formuliert (Kapitel 7: Schlusswort).
1. Klassismus als Diskriminierungsform in Deutschland
Während der gegenwärtigen Corona-Pandemie entsteht immer mehr ein Bewusstsein für fehlende Chancengleichheit. Den Zeitungsleser*innen begegnen Titelüberschriften wie „Experten: Corona schadet der Chancengleichheit in der Bildung“ 1. Bourdieu beschreibt, dass eine chancengleiche Gesellschaft wie ein Roulettespiel aussehen müsste:
„Beim Roulette z.B. kann in kürzester Zeit ein ganzes Vermögen gewonnen und damit gewissermaßen in einem einzigen Augenblick ein neuer sozialer Status erlangt werden; im nächsten Augenblick kann dieser Gewinn aber bereits wieder aufs Spiel gesetzt werden und vernichtet werden. Das Roulette entspricht ziemlich genau dem Bild eines Universums vollkommener Konkurrenz und Chancengleichheit, einer Welt ohne Trägheit, ohne Akkumulation und ohne Vererbung von erworbenen Besitztümern und Eigenschaften.“1 2
Laut Bourdieu ist in einem Roulette jeder Moment unabhängig von dem Vorherigen. Auf Chancengleichheit bezogen bedeutet das, dass jede Person jedes Ziel verwirklichen kann. Allerdings besitzen alle Menschen durch ihre individuelle, soziale Herkunft unterschiedliche Erfolgschancen und Zugänge, sodass es keine umfassende Chancengleichheit geben kann.3 Laut der PISA-Studie von 2019 hängt besonders in Deutschland, im Vergleich zu allen anderen Ländern der OECD 4, die soziale Herkunft bedeutend mit dem Bildungserfolg zusammen.5
1.1 Definition und Prägung des Begriffs Klassismus
Um darzulegen, inwiefern die soziale Herkunft für Benachteiligungen in der Sprache im Theaterbetrieb sorgen kann, muss die Diskriminierungskategorie Klassismus genau festgelegt und definiert werden. Aufbauend darauf kann anschließend die Sprache und der Theaterbetrieb im Hinblick auf Klassismus analysiert werden. In den folgenden Kapiteln soll dementsprechend der Kern von Klassismus bestimmt, die Prägungen und Ursprünge dargelegt sowie die Kritik an der Diskriminierungskategorie diskutiert werden.
1.1.1 Definition und Auswirkungen von Klassismus
Die Benachteiligung und Unterdrückung von Menschen aus den unteren Klassen, wie zum Beispiel von erwerbslosen, wohnungslosen, einkommensarmen und körperlich arbeitenden Menschen sowie deren Familien, werde laut Seeck und Theißl als Klassismus bezeichnet. Dabei geht es vor allem um die „Abwertung, Ausgrenzung und Marginalisierung“6 von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder Position. Neben dem Bildungserfolg wirkt sich Klassismus insbesondere auf Macht, politische sowie soziale Teilhabe, Anerkennung, Geld, Wohnraum und die Lebenserwartung der betroffenen Menschen aus.7
Seeck und Theißl beschreiben, dass Klassismus offenkundig sein kann, wenn zum Beispiel sichtbare Hetze gegenüber erwerbslosen Menschen betrieben wird, wie in dem Artikel „Faulster Arbeitsloser jubelt - Jetzt gibt’s Hartz IV auf dem Silbertablett“8 der Bild-Zeitung vom November 2019. Oftmals ist Klassismus jedoch unsichtbar. In Deutschland existiert die Annahme, dass wir eine Leistungsgesellschaft seien und wir demnach alle alles erreichen könnten, wenn wir hart dafür arbeiten. Gemäß Seeck und Theißl ist dem jedoch entgegenzusetzen, dass in Deutschland jährlich etwa 400 Milliarden Euro ausschließlich vererbt werden und dadurch Erbschaften in Deutschland circa ein Drittel des Gesamtvermögens umfassen. Jedoch werden die Klassenprivilegien, die zum Beispiel anhand von Erbschaften entstehen, selten benannt.9 Nach Kemper und Weinbach soll die Auffassung von Deutschland als Leistungsgesellschaft zur Verschleierung von Klassismus führen, sodass die Auswirkungen von Klassismus nur schwer erkennbar sind. Selbst in den vom Europäischen Gesetz geregelten Antidiskriminierungsrichtlinien gibt es keine Kriterien zur sozialen Herkunft oder zum Vermögen. Folglich finden seitens der Europäischen Union weder empirische Studien noch Forschungen zu dem Thema statt.10
Gemäß Seeck und Theißl werden Klassenzugehörigkeiten durch das verfügbare Kapital11, den Namen, den Wohnort, die Sprache und den Geschmack sichtbar.12 Schäfer beschreibt, dass die Sprache und der Geschmack der Angehörigen der unteren Klassen oftmals abgewertet und als normabweichend wahrgenommen werden. Folglich nehmen die unteren Klassen seltener an Veranstaltungen in öffentlichen Räumen teil, „da man die geltende Norm nicht bedienen kann, weil die Spielregeln unbekannt sind.“13 Außerdem werden die normabweichenden Zuschreibungen von den von Klassismus betroffenen Menschen verinnerlicht und sie gehen immer mehr davon aus, dass sie Vorurteilen entsprechen und weniger Würdigung verdienen.14 Laut Seeck und Theißl sorgt der Vorgang der Verinnerlichung wiederum dafür, dass sich die Betroffenen nicht gegen die Diskriminierung auflehnen. Ebenso spielt die Scham über die eigene soziale Herkunft eine große Rolle. Statt sich zu verbinden und dagegen vorzugehen, neigen die Betroffenen oft dazu, sich von Menschen mit ähnlichen Problemen abzugrenzen.15 Umso bedeutender ist es, Strukturen in der Gesellschaft fortlaufend zu analysieren, damit Klassismus aufgedeckt werden kann.
1.1.2 Bourdieus Kapitalsorten
Klassistische Strukturen können beispielsweise mit Hilfe von Bourdieus Aufschlüsselung von Kapital hinterfragt werden. Die soziale Herkunft und die Klassenposition, die als Ausgangspunkte der klassenspezifischen Diskriminierung gelten, werden durch die Verfügbarkeit und Verinnerlichung von Kapital geprägt. Bourdieu beschreibt, dass die Strukturen in der Gesellschaft nur zu erfassen sind, wenn der „Begriff des Kapitals in allen seinen Erscheinungsformen eingeführt“16 wird. Er richtet seine Überlegungen an der französischen Gesellschaft aus. Laut Kim-Heinrich seien Bourdieus Überlegungen daher auf das klassische Kulturverständnis der Franzosen zurückzuführen. Seine Theorie sei demzufolge vor allem an Frankreich geknüpft, da die Voraussetzung für einen Klassenaufstieg in Frankreich das kulturelle und soziale Kapital sei.17 Dennoch können Bourdieus Kapitalsorten ebenfalls auf die deutsche Gesellschaft übertragen werden, da Studien, wie die eingangs erwähnte PISA-Studie von 201918 den Zusammenhang zwischen Klassenaufstieg und sozialer Herkunft in Deutschland belegen.
Laut Bourdieu kann das Kapital in drei Unterkategorien aufgeschlüsselt werden: das ökonomische Kapital, das kulturelle Kapital und das soziale Kapital. Zum ökonomischen Kapital gehört Geld, aber auch alle weiteren Güter, die sich unmittelbar als solches umwandeln lassen. Demnach wird unter dem ökonomischen Kapital das gesamte Eigentum einer Person oder Personengruppe verstanden. Dazu zählen beispielsweise Wohneigentum und Erbschaften. Das kulturelle und das soziale Kapital sind eng mit dem ökonomischen Kapital verknüpft, da sich beide Kapitalformen unter spezifischen Umständen in ökonomisches Kapital konvertieren lassen.19
Nach Bourdieu muss das kulturelle Kapital in drei Unterformen eingeteilt werden. Bei der ersten Form handelt es sich um dauerhaft verinnerlichtes kulturelles Kapital (inkorporiertes Kulturkapital), wie beispielsweise das Spielen eines Instruments oder die Körperhaltung beim Ballett. Das erlernte Kulturkapital gilt, nach Bourdieu, als „Besitztum, das zu einem festen Bestandteil der .Person’, zum Habitus geworden ist“20. Um inkorporiertes Kulturkapital zu erwerben, muss von einer Person selbst Zeit investiert werden bzw.21 muss bei Kindern die Familie ermöglichen, dass Zeit zur (Weiter-)Bildung gegeben wird. Da die familiäre Situation die Umstände der Aneignung bestimmt, wird das inkorporierte Kulturkapital der Familie übertragen, wie zum Beispiel die Sprechweise in Bezug auf das Vokabular oder den Dialekt. Familien, die viel inkorporiertes Kulturkapital besitzen, bilden ihren Nachwuchs gemäß des eigenen kulturellen Geschmacks, indem sie gewisse Zugangscodes vermitteln. Infolgedessen wird der Wert des kulturellen Kapitals von der kulturellen Bildung und der Ressourcen der Familie bestimmt und vorhandene gesellschaftliche Strukturen werden reproduziert. Demnach wird das inkorporierte Kulturkapital, selbst wenn es durch die Verinnerlichung an ein Individuum gebunden ist, durch die soziale Vererbung weitergeben und ist somit die versteckteste Form der erblichen Kapitalübertragung.22
Weiter beschreibt Bourdieu, dass sich die zweite Form des kulturellen Kapitals auf alle kulturellen Güter bezieht. Dabei handelt es sich um Gegenstände, die einen gewissen Status anzeigen (objektiviertes Kulturkapital), wie Gemälde, Bücher, Lexika oder Klavierflügel. Zugleich beinhalten diese Gegenstände auch ökonomisches Kapital. Folglich sind kulturelle Güter als Eigentum auf andere Personen übertragbar, jedoch setzt die tatsächliche Aneignung des objektivierten Kapitals voraus, dass auch inkorporiertes Kapital vorhanden ist. Erst wenn eine Person über die beiden Formen des kulturellen Kapitals verfügt, ist beispielsweise der Genuss eines Gemäldes möglich. Als Orte, an denen die kulturellen Auseinandersetzungen stattfinden, gelten unter anderem Museen, Theater und Universitäten.23
Gemäß Bourdieu wird als dritte Form des kulturellen Kapitals das Erlangen von Qualifikationen über Institutionen verstanden (institutionalisiertes Kulturkapital). Dem institutionalisierten Kulturkapital werden beispielsweise höhere Schulabschlüsse, Studienabschlüsse und Titel zugeordnet. Durch die institutionellen Errungenschaften und Titel wird das inkorporierte Kapital objektiviert, schulisch sanktioniert und rechtlich geltend gemacht. Eine Person mit kulturellem Zeugnis muss ihr kulturelles Kapital nicht mehr beweisen, sondern bekommt dauerhaft eine kulturelle Kompetenz zugeschrieben. Damit geht die institutionelle Anerkennung und die Möglichkeit, sich mit Personen mit gleichem Titel zu vergleichen oder gegebenenfalls deren Position zu übernehmen, einher. Für den Erwerb eines bestimmten institutionellen Kapitals sind bestimmte Eigenmittel wichtig, sodass sogar ein Wechselkurs vom institutionalisierten Kapital und ökonomischen Kapital errechnet werden könnte. Dadurch wird deutlich, dass auch institutionalisiertes Kapital mit ökonomischem Kapital verknüpft ist.24
Nach Bourdieu bezeichnet das soziale Kapital die gesamten Ressourcen an Beziehungen einer Person, die mit Gruppenzugehörigkeiten einhergehen. Damit Sozialkapitalbeziehungen fortlaufend existieren können, müssen Tauschbeziehungen auf materieller oder symbolischer Ebene stattfinden. Darüber hinaus kann soziales Kapital durch institutionelle Gegebenheiten geschaffen werden, indem zum Beispiel ein Name übernommen und dadurch zugleich eine „Zugehörigkeit zu einer Familie, einer Klasse, einem Stamm oder auch einer Schule, einer Partei usw. [gekennzeichnet“25 wird. Der Wert des sozialen Kapitals einer Person ist abhängig von der Menge der nutzbaren Beziehungen und der Höhe des ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapitals des Netzwerkes. Das soziale Kapital steht folglich ebenfalls mit dem ökonomischen und kulturellen Kapital in Verbindung, gleichwohl das soziale Kapital nicht ausschließlich auf die anderen beiden Kapitalformen zu reduzieren ist. Grund für die Verknüpfung der drei Kapitalsorten ist, dass die Tauschbeziehungen bedingen, dass eine grundlegende Homogenität in der Gruppe herrscht und sich das soziale Kapital wie ein „Multiplikatoreffekt auf das tatsächlich verfügbare Kapital“26 auswirkt.
1.1.3 Die Ursprünge der Diskriminierungskategorie Klassismus
Bourdieus Analyse über die Verzahnung des ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapitals zeigt, wie Benachteiligungen im Kapital zu Klassismus in der Gesellschaft führen können. Dennoch ist die Diskriminierungskategorie Klassismus im Vergleich zu anderen Diskriminierungen weniger bekannt. Dabei wurde sich bereits in den 80er-Jahren mit Klassismus auseinandergesetzt. Laut Bunch und Myron sind die ersten Aufzeichnungen zum Begriff Klassismus im gleichen politischen Kontext und ungefähr zur gleichen Zeit wie der Begriff „Sexismus“ entstanden. Die Auseinandersetzung mit den zwei Diskriminierungsformen ging aus der amerikanischen Lesben-Gruppe The Furies hervor, die sich 1974 in ihren Texten mit Diskriminierungen bezüglich der sozialen Herkunft von Arbeiter*innen- töchtern beschäftigte. Sie benannten klassistische Verhaltensweisen der Politik und forderten zugleich, dass das Politische als persönlich und das Persönliche als politisch anerkannt werden sollte. Jedoch stießen sie mit ihren Forderungen auf große Kritik. Ihnen wurde Romantisierung und die Abwärtsmobilität [19] der jungen Mittelschicht vorgeworfen. [20] In Deutschland wurde die Auseinandersetzung mit Klassismus ebenfalls von lesbischen Feministinnen angestoßen, die sich laut Seeck und Theißl als Proll-Lesbengruppen bezeichneten. Ende der 80er-Jahre schlossen sich Lesben aus Arbeiter*innenfamilien, von Bauernhöfen und aus Heimen zusammen und intervenierten antiklassistisch, indem sie beispielsweise Umverteilungskonten einrichteten.[21] Der Begriff Klassismus wurde laut Kemper und Weinbach zuerst von lesbischen Gruppierungen verwendet, weil vor allem die Existenz von homosexuellen Frauen durch die kapitalistischen und patriarchalen Strukturen gefährdet war. Sie konnten sich nicht darauf verlassen, von Männern ökonomisch versorgt zu werden. Die Herkunft aus einer Familie, die wenig ökonomisches Kapital besaß, spitzte die Situation weiter zu.[22]
Darüber hinaus wurde sich an den Universitäten um 1980 kritisch zum Thema Klassismus geäußert, wie es zum Beispiel Hannelore Bublitz in ihrer Publikation Ich gehöre irgendwie nirgends hin... Arbeitertöchter an der Hochschule tat . Sie beschreibt, dass das selbstsichere Auftreten und die theoriebasierte sowie die dominante Arbeitsweise der Student*innen aus bürgerlichen Familien die Arbeiter*innentöchter einschüchterte. Anknüpfend daran wird auch die Sprache im universitären Kontext thematisiert. Die Arbeiter*innentöchter sprachen mit Bublitz in Interviews darüber, dass sie sich Diskussionen in der Universität entziehen würden, um höflichen Kommentaren zu entgehen, die ihnen verdeutlichen, dass sie nicht auf dem gleichen Wissensstand wie die Kommiliton*innen aus Akademikerhaushalten sind.[23] Darüber hinaus wird ihnen vermittelt, dass sie sich an die Universitäten und die damit einhergehenden Werte anpassen müssen, womit sie sich von ihrer sozialen Herkunft entfernen. Dadurch kommt es für die Arbeiter*innentöchter zu einer isolierten Situation, in der sie sich weder ihrer sozialen Herkunft noch der Universität zuordnen können.[24] Auch Bublitz konzentrierte sich in ihrer Forschung auf die Befragung von Frauen aus Nichtakademiker*innen-Familien und zeigt dadurch ebenso wie The Furies und die Proll- Lesbengruppe die Mehrdimensionalität von Diskriminierungen auf. Somit wurde bereits einer der wichtigen Grundsteine für die Intersektionalitätstheorie gelegt.
1.1.4 Kritik an der Klassismustheorie
Die Frauengruppierungen hatten zugleich auch mit starker Kritik zu kämpfen, die sich bis heute hartnäckig hält. Laut der Friedrich-Ebert-Stiftung vom Landesbüro Thüringen sind die Kritiken an der Klassismustheorie vor allem auf Missverständnisse zurückzuführen. Einer der Vorwürfe gegenüber dem Klassismusansatz bezieht sich auf den Kapitalismus und die „Annahme, antiklassistische Ansätze böten die Möglichkeit, sich mit den kapitalistischen Strukturen zu arrangieren“[25]. Dabei soll Klassismus in keiner Weise Formen, wie Streiks gegen den Kapitalismus, verdrängen und für eine Akzeptanz von Kapitalismus plädieren, sondern vielmehr zur Aufklärung von Klassenstrukturen beitragen. So kann unter anderem herauskristallisiert werden, warum sich so selten gegen Unterdrückungen aufgelehnt wird. Ferner bezeichnen Kritiker*innen Klassismus als kein legitimes Konzept, da im Gegensatz zu Rassismus und Sexismus keine biologischen Unterschiede erkennbar seien. Anzumerken bleibt jedoch, dass auch die Diskriminierung von Geschlechtern nicht ausschließlich biologisch betrachtet werden darf und Klassismus ebenso körperlich sichtbar werden kann. Das belegt zum Beispiel die Krankheits- und Sterberate in Bezug auf vom Klassismus betroffene Menschen. Ein weiterer Kritikpunkt besagt, dass die Arbeiter*innenkultur in der Klassismustheorie als primär angesehen wird und dadurch Sexismus, Rassismus, Heterosexismus und Antisemitismus legitimiert und ausgeblendet werden sollten. Allerdings wird Klassismus ausschließlich als eine parallele Diskriminierungsform zu den weiteren Diskriminierungen verstanden, sodass vor allem auch die intersektionale Perspektive mitgedacht wird.[26] Die intersektionale Perspektive von Klassismus wird im nächsten Kapitel ausführlicher beschrieben.
1.2 Klassismus aus intersektionaler Perspektive
Der Begriff Intersektionalität wurde erstmals von Crenshaw verwendet, um das Überschneiden von Diskriminierungskategorien zu thematisieren. Crenshaw arbeitet als Juristin und verklagte Firmen, die Women of Color27 diskriminierten. Eine Firma brachte als Verteidigung hervor, dass eine solche Diskriminierung in ihrem Betrieb nicht stattfinde, da sie sowohl schwarze Männer als auch weiße Frauen beschäftigen würden.28 Dass aber insbesondere die Überschneidung von mehreren Diskriminierungen zu einer anderen Dimension von Diskriminierung führt, verdeutlicht Crenshaw mit ihrer Illustration von Intersektionalität als Verkehrskreuzung. Nach Crenshaw sei jede Straße als ein Weg zu verstehen, der eine Diskriminierungskategorie darstellt. So kommt es an Kreuzungen zur Überlappung von mehreren Diskriminierungskategorien und es können Unfälle passieren, an denen mehr als eine Diskriminierungsform beteiligt ist.29
Einhergehend mit Crenshaws Überlegungen muss bei der Betrachtung einer Diskriminierungskategorie auch die Überschneidung mit weiteren Diskriminierungen mitgedacht werden. Die Wichtigkeit dessen wurde unter anderem bei den Feminismusbewegungen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts stattfanden, deutlich. Die Frauen, die der Bewegung angehörten, stammten vor allem aus der höheren Mittelschicht und wollten ihre Barrieren durch Ehe und Mutterschaft durchbrechen. Ihre Forderungen übertrugen sie auch auf die Frauen der Arbeiterklasse, ohne zu hinterfragen, welche Unterschiede vorlagen.30
An dieser Stelle könnten unzählige weitere Beispiele folgen, die ebenfalls thematisieren würden, dass neben Geschlecht, Hautfarbe und Klasse beispielsweise auch Diskriminierungen aufgrund von Alter, Religion, Gesundheit und Attraktivität hinzugezogen werden könnten. In dieser Arbeit wird Klassismus jedoch ausschließlich im intersektionalen Zusammenhang mit Sexismus und Rassismus beschrieben, da der Umfang dieser Arbeit begrenzt werden muss. Darüber hinaus soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass der Begriff der Intersektionalität nach Winker und Degele umstritten ist. Zurückzuführen ist die Kritik auf Crenshaws Illustration von der Kreuzung, weil von isolierten Kategorien ausgegangen und eine Verschmelzung dessen in den gesellschaftlichen Strukturen nicht deutlich wird.31 Allerdings benennt der alternative Begriff Interdependenz nicht das Problem der Mehrdimensionalität und beschränkt sich nur auf ein Merkmal der Intersektionalität, das ebenfalls bei der Aufschlüsselung von Intersektionalität deutlich wird. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit der Begriff Intersektionalität genutzt.
1.2.1 Klassismus im Zusammenhang mit Sexismus
Die Diskriminierungsformen Klassismus und Sexismus sind eng miteinander verknüpft. Das wird zum einen an den beschriebenen Ursprüngen von Klassismus deutlich, zum anderen an der Schwierigkeit, die Klassenstellung einer heterosexuellen und verheirateten Mutter zu bestimmen. Gemäß Meulenbelt kann „die Klassenstellung von Frauen nicht einfach von der des ihr nächststehenden Mannes [abgeleitet werden], aber wir können auch nicht so tun, als ob die Klassenstellung der Frauen völlig von der der Männer losgelöst wäre.“32 Obwohl Meulenbelt ihr Buch bereits 1988 verfasste und die Erwerbsquote von Frauen in Deutschland seitdem um ungefähr 20% gestiegen ist,33 sind ihre Feststellungen auch heute noch relevant. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zeigt mit der Gender Care Gap auf, dass sich immer noch wesentlich mehr Frauen als Männer um die Hausarbeit und Kinderbetreuung kümmern. Das Resultat der ungleich verteilten Care-Work sind häufigere Teilzeitbeschäftigungen, niedrigere Einkommen und geringere eigenständige Altersabsicherungen von Frauen.34 Folglich kommt es häufig zu einer finanziellen Abhängigkeit heterosexueller Frauen. Für die Ermittlung der Klassenstellung von Frauen muss, nach Meulenbelt, dementsprechend neben der Frage nach der Berufsausübung auch die Frage nach dem Familienstand geklärt werden. Wenn eine Frau mit einem Mann verheiratet sein sollte, spielt ebenfalls die Tätigkeit des Mannes eine Rolle für die Ermittlung der Klassenzugehörigkeit der Frau.35 Bei Ehen und Scheidungen wechseln heterosexuelle Frauen ebenfalls häufiger ihre Klassenstellung, als dies bei heterosexuellen Männern der Fall ist, wodurch Frauen durch Scheidungen öfter von Armut bedroht sind.36
In Meulenbelts Theorie würden demgegenüber homosexuelle Frauen aus diesen Abhängigkeitsstrukturen herausfallen und sind dadurch gezwungen, ihr eigenes Einkommen zu erwerben.37 Auch mit den folgenden Überlegungen bezieht sich Meulenbelt ausschließlich auf homosexuelle Frauen. Entsprechend unserer diversen Gesellschaft werden Meulenbelts Annahmen in dieser Arbeit auf alle weiblich gelesenen Personen ausgeweitet, die unter FLINTA*38 zusammengefasst werden und sich in keiner heterosexuellen Ehe befinden.
Wenn eine FLINTA* Person aus der Arbeiterklasse ohne einen Mann lebt oder finanziell unabhängig leben möchte, bedeutet das nach Meulenbelt, dass ein Klassenaufstieg für sie notwendig ist. Grund dafür ist, dass Männer mit der gleichen Ausbildung und dem gleichen Job durchschnittlich mehr verdienen. Dadurch „führt das Selbstständigbleiben oftmals zu Einbußen im Lebensstandard“39. Demnach ist die Klasseneinordnung40 von FLINTA* Personen41 ein Komplex,42 der43 neben44 der Klassenzugehörigkeit45 durch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sowie die46 Stellung im47 „sex-gender-system“48 bestimmt werden muss.
Obwohl der Zusammenhang von Klassismus und Sexismus schon bei der Bestimmung der Klassenzugehörigkeiten von FLINTA* Personen sehr ersichtlich wird, gibt es dennoch wenige Studien, die die Überschneidung der zwei Diskriminierungskategorien konkret untersuchen. Laut Meulenbelt sei McRae eine der ersten Forscher*innen, die eine thematisch entsprechende Studie dazu durchgeführt habe. McRae untersuchte Ehen, in denen die Frau in einem besser bezahlten Beruf tätig ist und dadurch eine höhere Stellung in der Gesellschaft besitzt als der Ehemann. Das Ergebnis der Studie war, dass nur einer der Ehemänner kein Problem damit hatte, dass seine Frau die Hauptverdienerin der Familie ist. In allen weiteren Familien versuchten die Frauen, ihre finanzielle Überlegenheit für das Selbstwertgefühl der Männer herunterzuspielen, um Konflikte zu vermeiden.49 Ebenso kam eine Studie, die 2019 von der Ökonomin Syrda veröffentlicht wurde, zu dem Ergebnis, dass Männer enormen psychischen Stress bekämen, wenn die Ehefrau mehr als 40 Prozent zum Gesamteinkommen beisteuern würde. Auffällig ist, dass das Stresslevel des Mannes auch steigt, wenn die Frau weniger als 40 Prozent des Geldes verdient und er somit der Hauptversorger ist. Dennoch ist der Stress als Hauptversorger wesentlich geringer, als würde die Frau über 40 Prozent des Gesamteinkommens verdienen.50
Nach Meulenbelt sei die Angst der Männer, „ihre überlegene Stellung zu verlieren, eine wirkungsvolle Bremse für die Entwicklung der Frauen.“51 Beispielsweise werden Ausbildungen über den zweiten Bildungsweg von Frauen teilweise abgebrochen, weil ihre Ehemänner die Weiterentwicklung nicht befürworten und die Frauen nicht wollen, dass die Ehe daran zerbricht. Folglich ist Sexismus ein Faktor, von dem die Klassenstellung der Frauen stark beeinflusst wird. Gleiches geschieht nicht nur in heterosexuellen Beziehungen, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt. In vielen Bereichen ist es für Frauen schwer, die Führungsebene zu erreichen, da einige Männer Frauen in dieser Position nicht akzeptieren und es ihnen dadurch besonders schwer machen. Darüber hinaus werden immer noch Ansichten vertreten, dass Frauen für bestimmte Berufe wie Feuerwehr, Polizei oder Marine nicht geeignet seien. Solche Ansichten und die daran anknüpfenden Verhaltensweisen zeigen: Eine Unterdrückung der Männer, die oftmals durch die Vorgesetzten am Arbeitsplatz ausgeübt wird, wird von ihnen erträglicher gemacht, indem sie die Frauen unterdrücken.
Denn durch die Unterdrückung anderer kann das eigene Überlegenheitsgefühl (zurück)- erlangt werden.52 Dieser Vorgang findet ebenso im Rassismus statt.
1.2.2 Klassismus im Zusammenhang mit Rassismus
Rassismus ist in der Gesellschaft allgegenwärtig. Das verdeutlichte auch die Ermordung des Afroamerikaners George Floyd in den USA im Mai 2020 und die damit einhergehenden Black Lives Matter- Proteste. Auch in den europäischen Städten protestierten laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in diesem Kontext rund zehntausende Menschen.53 Durch die Proteste wurde zum rassismuskritischen Denken aufgerufen, sodass in Unternehmen, Bildungsinstitutionen und Kultureinrichtungen vermehrt Workshops durchgeführt wurden. Unter anderem wurden solche Workshops von Tupoka Ogette, einer zentralen Aktivistin dieser Bewegung, angeboten. 54 Der intersektionale Zusammenhang von Rassismus und Klassismus wurde bei der Tötung von George Floyd, der als Lastkraftwagenfahrer und Türsteher arbeitete,55 wenig beachtet. Dabei ist offensichtlich, dass People of Color besonders unter dem Zusammenspiel von Klassismus und Rassismus leiden. Nach Meulenbelt haben sie nachweislich schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und gelangen seltener in hohe Positionen als weiße Menschen. Dies hängt nicht zuletzt mit der Vergangenheit zusammen. People of Color wurden oftmals als Arbeiter*innen in der Kolonialzeit von 1520 bis 1914 nach Europa geholt oder in den deutschen Kolonien für die Wirtschaft ausgebeutet.56
Laut Hamade liege auch heute noch eine rassistische Klassenausbeutung vor, die unter anderem anhand von Zahlen in Deutschland sichtbar wird: Im Niedriglohnsektor arbeiten acht Millionen Menschen, wovon 40 Prozent Migrant*innen sind. Dabei haben die Migrant*innen oft höhere Qualifikationen. Darüber hinaus ist bekannt, dass von diesen 40 Prozent besonders Personen aus nicht europäischen Staaten extrem ausgebeutet werden. Beispielsweise zeigten sich in der Fleischindustrie während der Corona Pandemie die prekären Arbeitsumstände.57
Ferner verdeutlichte die Corona Pandemie nach Wasenmüller, dass der Staat intersektionale Diskriminierungen oftmals nicht mitdenkt und folglich Betroffene unter der Situation leiden müssen. Beispielsweise waren alle Informationen zu den Anträgen der Soforthilfen nur in z [52] Vgl. ebd.: S. 144. deutscher Sprache verfügbar. Die Situation wirkte sich auch auf die heranwachsende Generation aus. Obwohl Arbeiter*innenkinder von Migrant*innen schon unter dem Mangel an Ressourcen und den Hürden eines sozialen Aufstiegs leiden, brachte das unvorbereitete Homeschooling für sie besondere Schwierigkeiten mit sich. Kinder aus Arbeiter*innen- familien, deren Eltern in systemrelevanten Berufen beschäftigt sind, hatten stärker mit den digitalen Aufgaben zu kämpfen. Infolgedessen wurden Klassenprivilegien verstärkt und vermehrt Zugänge verschlossen.58
1.3 Zwischenfazit zum Klassismus als Diskriminierungsform in Deutschland
Klassismus wird als Benachteiligung und Unterdrückung von Personen mit einer sozialschwächeren Herkunft oder Position definiert. Die Diskriminierungsform hat konkrete Auswirkungen auf Macht, Anerkennung, Geld, Wohnraum, Lebenserwartung, politische und soziale Teilhabe. Unterschieden wird in offensichtlichen und versteckten Klassismus. Letzteres trägt vor allem dazu bei, dass sich die Betroffenen selten dagegen auflehnen und die klassistischen Zuschreibungen verinnerlichen. Um klassistische Strukturen in der Gesellschaft zu analysieren, kann Bourdieus Ausschlüsselung der Kapitalsorten genutzt werden. Bourdieu unterscheidet Kapital in drei Formen von Kapital. Er definiert Geld und geldwerte Güter als ökonomisches Kapital, Bildung als kulturelles Kapital und Beziehungen als soziales Kapital. Alle drei Formen beeinflussen sich gegenseitig und führen zu homogenen Gruppierungen, sodass Personen mit weniger verfügbarem Kapital marginalisiert werden können.
Obwohl die Auseinandersetzung mit der Diskriminierungskategorie Klassismus in der gleichen Zeit wie zum Sexismus entstand, ist Klassismus im Vergleich noch unbekannt. Angestoßen wurden die Überlegungen zum Klassismus von lesbischen Gruppierungen, da sie besonders durch das patriarchale System gefährdet sind. An Universitäten lehnten sich zuerst Arbeiter*innentöchter auf. Allerdings waren die Gruppierungen mit starker Kritik konfrontiert, welche auch heute noch in Bezug zu Klassismus angeführt wird. Unter anderem wird der Klassismustheorie vorgeworfen, sie wolle sich mit kapitalistischen Strukturen arrangieren, sie sei kein legitimes Konzept und wolle andere Diskriminierungsformen in den Hintergrund stellen. Diese Vorwürfe basieren aber vor allem auf Missverständnissen.
Klassismus soll als parallele Diskriminierungsform, neben den anderen Diskriminierungsformen mitgedacht und somit auch intersektional betrachtet werden. In Bezug zum Klassismus und Sexismus bedeutet dies, dass zur Bestimmung der Klassenstellung einer FLINTA* Person, auch immer ihre Position im „sex-gender-system“59 beachtet werden muss.
Hinzukommt, dass die Angst von Männern, ihren Überlegenheitsstatus zu verlieren, auch immer noch eine wirkungsvolle Karrierebremse für Frauen sein kann. Um den Zusammenhang zwischen Klassismus und Rassismus zu verdeutlichen, reicht ein Verweis auf die koloniale Vergangenheit. Bis heute liegt eine rassistische Klassenausbeutung in unserer Gesellschaft vor, sodass People of Color der Arbeiter*innenklasse mit der Überschneidung der beiden Diskriminierungskategorien besonders zu kämpfen haben.
2. Die Rolle der Sprache im Klassismus
Sprache wird nach dem Metzler Lexikon als ein Kommunikationsmittel definiert, das eine hohe Relevanz besitzt und artspezifisch für Menschen ist. Es dient dem Austausch von Informationen, organisiert Denkprozesse und erfüllt eine kognitive und affektive Funktion. Die Verwendung des Begriffes geht mit zwei Bedeutungen einher: Zum einen ist mit Sprache die menschlich angeborene Begabung zum Sprechen gemeint. Zum anderen kann Sprache als Einzelsprache verstanden werden[40] und steht folglich in Beziehung zu „einer bestimmten Sprachgemeinschaft, zu einer bestimmten Zeit und in einem bestimmten geographischen Raum und deren Ausdruck in konkreten Kommunikationsereignissen.“[41] In der vorliegenden Arbeit wird sich ausschließlich auf die letztere Bedeutung der Definition konzentriert, insbesondere auf die Sprache eines konkreten Kommunikationsereignisses. In diesem Kapitel wird zunächst auf klassistische Wörter Bezug genommen, um daraufhin den allgemeinen Sprachgebrauch in Bezug auf Klassismus zu betrachten. Im Anschluss werden Konzepte für eine antiklassistische Sprache vorgestellt.
2.1 Klassistische Wörter
Laut Kemper und Weinbach lägen bisher kaum Forschungen zu der Verwobenheit von Klassismus und Sprache vor, dabei ist der Zusammenhang offensichtlich. Schließlich transportieren viele Wörter der deutschen Sprache klassistische Bilder.[42] Beispielsweise werde laut Meulenbelt die Berufsbezeichnung Bauer häufig auch als Beleidigung genutzt und verdeutliche infolgedessen die Klassenstellung von Landwirt*innen. Bei dem Versuch antiklassistisch zu sprechen oder zu schreiben, sollten Begriffe vermieden werden, die als abwertend und unterdrückend gegenüber Menschen genutzt werden. Auch mit den Begriffen „oben“ und „unten“ werden Bilder generiert, bei denen auf die einen hinauf- und auf die anderen herabgeschaut wird. Jedoch gestaltet es sich schwierig, die allgemeinen Bezeichnungen der unteren und oberen Klassen wegzulassen. Demnach ist es allem Anschein nach unmöglich, so zu schreiben, dass Klassismus nicht reproduziert wird und zugleich Klassenstrukturen sichtbar gemacht werden.[43]
Dennoch sollten nach Kemper und Weinbach klassenspezifische Wörter hinterfragt werden, indem sie auf Klassismuskontexte überprüft werden. Dabei ergibt sich allerdings der Widerspruch, dass die Wissenschaft und das Diskurssystem in ihren Strukturen selbst klassistisch aufgebaut sind. Das Hinterfragen von Wörtern kann dementsprechend nur gelingen, wenn die Forscher*innen sich selbst sowie ihren Blickwinkel hinterfragen.[44]
2.2 Klassismus im Sprachgebrauch
Neben den einzelnen Wörtern, die Klassismus offensichtlich reproduzieren, sollte der allgemeine Sprachgebrauch betrachtet werden. Im Vergleich zu klassistischen Wörtern ist Klassismus im Sprachgebrauch wesentlich unsichtbarer. Laut Quenzel und Hurrelmann können jedoch bereits bei sehr jungen Kindern aus verschiedenen Schichten unterschiedliche Sprachstände festgestellt werden. Bei Kindern ab der höheren Mittelschicht wird die „Sprache als zentrales Instrument der Erziehung, Bildung und auch der Disziplinierung und Lenkung“60 gebraucht. Sie lernen im Alltag mit ihren Eltern zu diskutieren, zu handeln sowie eigene Rechte und Wünsche einzufordern. Im Gegensatz dazu fand Lareau bei Kindern der Arbeiter*innenklasse heraus, dass sie Sprache mehr als ein anweisendes Instrument kennenlernen. Hinzu kommt, dass bei Konversationen insgesamt weniger Begriffe genutzt wurden, da Kinder ihre Eltern wesentlich seltener in Gespräche verwickelten und keine Diskussionen geführt wurden.61
Laut Meulenbelt sei ein zusätzliches Problem der sprachlichen Sozialisation, dass der erlernte Wortschatz von Arbeiter*innenkindern in offiziellen Dokumenten, wie zum Beispiel in Lehrbüchern, kaum vorkommt. Beispielsweise kennen Kinder von Seefahrer*innen wesentlich mehr Begriffe über Schiffe, ebenso wie Kinder von Landwirt*innen mehr Wörter in Bezug auf die Natur beherrschen. Sobald die Kinder allerdings eingeschult werden, merken sie, dass viele ihrer bekannten Begriffe im System Schule gar nicht gebraucht werden und sie sich anpassen müssen. Aufgrund dessen verwenden sie ihre herkunftsspezifischen Begriffe im Laufe der Zeit oftmals nicht mehr und werden sprachärmer, als sie zuvor waren.62 Ähnlich verhält es sich mit Ausdrucksformen. Beispielsweise werden Dialekte oftmals als ungebildet abgewertet. In dem Buch Zeige deine Kasse. Die Geschichte meiner sozialen Herkunft. beschreibt die Autorin Daniela Dröscher, wie der Dialekt ihrer Heimat zu Scham führte, sodass dieser im Sprachgebrauch von ihr vermieden wurde.63 Gemäß Meulenbelt bedeutet dieser Umgang mit Sprache, dass der Sprachgebrauch der oberen Klassen als elementar gewertet und der Sprachgebrauch der Arbeiterinnen unterdrückt wird.64 „Es zeigt sich also, daß zwischen Klasse und Sprache ein direkter Zusammenhang besteht, ebenso wie zwischen Sprachgebrauch und Unterdrückung.“65
Auch für Bourdieu sollen, laut Müller, die sozialen Ungleichheiten anhand von Sprache bereits in der Kindheit deutlich geworden sein. Bourdieus Akzent, der in Frankreich oft als „linkisch, unbeholfen, bäuerlich ungeschliffen und ein bisschen dumm“66 gewertet wurde, blieb für ihn in Bildungsinstitutionen mit Peinlichkeit und Scham verbunden.67 Neben der männlichen Herrschaft ist die Sprache für Bourdieu die prägnanteste Form von symbolischer Gewalt und Herrschaft.68 Seine eigenen Erfahrungen mit sozialer Ungleichheit werden der Ausgangspunkt für seine Analysen zur Sprache als inkorporiertes Kulturkapital. Bourdieu beschreibt, dass eine sprachliche Gewandtheit als deutlichster Indikator für kulturelles Kapital gelte. Zugleich befähigt eine sprachliche Gewandtheit die Teilhabe in der Gesellschaft, da Codes der Sprache entschlüsselt werden können. Darüber hinaus wirken gewandte Sprecher*innen autoritär.69
Bourdieu fiel bei der näheren Betrachtung von besonders gewandter und angesehener Sprache auf, dass Begriffe und Redewendungen der Alltagssprache durch sehr ausgewählte und seltene Ausdrücke ersetzt werden würden. Oftmals ist eine als gehoben geltende Sprache sehr eigenwillig und die Sprecher*innen oder Verfasser*innen setzen sich über die Regeln der Grammatik hinweg oder spielen bewusst mit ihnen. Ebenso spielerisch wird mit dem Wortschatz umgangen, sodass bei Adressat*innen, die das Spiel der Sprache nicht beherrschen, eine große Verunsicherung ausgelöst wird. Bourdieu betitelt diesen Vorgang als „Strategie der Herablassung“70. Selbst wenn eine solche Strategie nicht bewusst angewendet wird, löst sie dennoch bei den Adressat*innen das Gefühl aus, dass jedes Wort, jeder Satz und jede Satzlänge korrekt gewählt werden muss. Durch die Verunsicherung trauen sie sich nicht, Rückfragen zu stellen, auch wenn sie wenig von der gewandten Sprache verstanden haben. Des Weiteren entsteht eine Blockade, sodass sich die Adressat*innen beim nächsten Mal seltener trauen, das Wort zu ergreifen. Unterhaltungen in diesem Kontext werden bei den Adressat*innen als sehr unangenehm und erzwungen abgespeichert.71
Die Sprecher*innen oder Verfasser*innen der gewandten Sprache, die sich im Gegenteil dazu ungezwungen über alle Regeln der Sprache hinwegsetzen, verkörpern laut Bourdieu, dass sie selbst die Regeln gestalten. Sie repräsentieren dementsprechend den „Schiedsrichter über die Formen des guten Geschmacks, deren Übertretungen nicht etwa Fehler, [oder] Verstöße darstellen“72, sondern als eine neue Norm verstanden werden sollen. Die Ungezwungenheit setzt voraus, dass keine Belastung durch die anderen Kapitalsorten und dadurch Wohlstand vorliegt. Die Personen oder Institutionen, die demzufolge den Einfluss ausüben können, dürfen so sein, wie sie sind und die Regeln der Gesellschaft daran anpassen. Durch ihre gewandte Sprache drücken sie ihren Besitz aus, stellen sich auf eine höhere Stufe und verstärken die Distanz zu den unteren Klassen.73
Folglich ist es nach Seeck und Theißl offensichtlich, dass durch den Sprachgebrauch auch die Teilhabe in der Gesellschaft bestimmt werden kann. Des Öfteren werden Zugänge für Menschen erschwert, weil zu komplex gesprochen oder geschrieben wird und Fremdwörter anstatt gängiger Begriffe verwendet werden.74 Zusätzlich wird häufig erwartet, „dass man schon alle möglichen Theorien und Konzepte kennt. Das schreckt viele Leute ab.“75
2.3 Konzepte und Strategien für antiklassistische Sprache
Um sprachlichen Barrieren entgegenzuwirken, wurden unter anderem die Konzepte der einfachen Sprache und der leichten Sprache entwickelt. Das Verfassen von Texten in einfacher Sprache zielt laut Kellermann darauf ab, dass die Inhalte eines Textes auch von fachfremden Personen verstanden werden können. Bei der einfachen Sprache dürfen auch Nebensätze und elementare Fremdwörter genutzt werden, wobei letztere erklärt werden müssen. Dadurch grenzt sich die einfache Sprache von der leichten Sprache deutlich ab. Die leichte Sprache zeichnet sich durch die ausschließliche Verwendung von Hauptsätzen und Satzellipsen aus. Zusammengesetzte Namenwörter werden in diesem Konzept getrennt, der Doppelpunkt wird als hinweisendes Signal eingesetzt und zu guter Letzt soll der Text von Menschen mit Lernschwierigkeiten überprüft werden. Die Zielgruppe von Texten der leichten Sprache sind vor allem Menschen mit Beeinträchtigungen im Lern-, Lese- und Sprachvermögen.76
Um Klassismus in Texten grundsätzlich zu vermeiden, eignet sich daher vor allem das Konzept der einfachen Sprache. Nach Baumert müsse bei allen schriftlichen Veröffentlichungen die Lesekompetenz der Leser*innen beachtet werden. Da in Deutschland nicht einmal die Hälfte der Erwachsenen die mittlere Stufe der Lesekompetenz erreicht, sind Texte in einfacher Sprache eine große Hilfe. „Dabei ist einfache Sprache kein Verstoß gegen die Forderung nach gutem Deutsch. Im Gegenteil! Ein Sachtext kann ausschließlich dann brillant sein, wenn er sich am Leser77 orientiert.“78 Um leser*innengerechte Texte zu formulieren, muss sich damit auseinandergesetzt werden, wen der Text erreichen soll und welches Wissen bei den Leser*innen bereits vorhanden ist.79 Jedoch solle laut der Bundeszentrale für politische Bildung auch überprüft werden, ob durch die Verwendung von einfacher Sprache Inhalte verloren gehen. Dieses Problem ergibt sich aber nicht nur bei Übersetzungen in einfache Sprache, sondern bei jeder Art von Übersetzung. Des Weiteren gibt es den Kritikpunkt, dass einfache Sprache und leichte Sprache, je nach Übersetzung, wie Kindersprache klingen kann und sich die Adressat*innen dadurch nicht ernst genommen fühlen könnten.80 Außerdem wird ein Text von Institutionen oft in zweifacher Form angeboten, wie zum Beispiel die Informationsbroschüre des Bundesministeriums zum Elterngeld zeigt.81 82 Es stellt sich die Frage, warum es keine einheitliche und einfach verständliche Broschüre gibt, sondern eine Unterscheidung in einfacher und normaler Sprache erfolgen muss.
Während das Konzept der einfachen Sprache vor allem eine antiklassistische Lösung für die schriftliche Sprache sein könnte, stellt Drexler in dem Buch Solidarisch gegen Klassismus. Organisieren, intervenieren, umverteilen vier Strategien vor, um mit Klassismus in der gesprochenen Sprache umzugehen. Ihre Strategien können aber ebenso auf das Geschriebene übertragen werden. Drexlers erste Strategie lautet „Finde deine eigene Sprache“ 87. Wenn beispielsweise eine Person einen Bildungsaufstieg durchlaufen hat, verändert sich auch ihre Sprache. Das führt im Umfeld der Herkunftsklasse zu einer Entwurzelung, aber auch in der neuen Klasse wird die Ausdrucksweise noch als anders wahrgenommen. Die erste Strategie ruft dazu auf, sich zu überlegen, „wie man sich in Zukunft präsentieren möchte“83 und sich der eigenen Position und Sprache bewusst zu werden.84
In der zweiten Strategie wird dafür plädiert, mit Irritationen zu spielen. Das bewusste Austesten von Grenzen sowie das Initiieren von Irritationen kann dazu beitragen, einen Zugang zur eigenen Sprache zu bekommen. Drexler beschreibt, dass sie ganz bewusst ihren Dialekt und das Fluchen im alltäglichen Sprachgebrauch einbindet und immer wieder von Reaktionen überrascht wird. Grund dafür ist, dass der Sprachgebrauch bei Akade- miker*innen ohnehin ein Teil der Selbstinszenierung ist, ein Spiel mit der Sprache Konventionen aufbricht und darüber hinaus Freude bereitet.85
Drexlers dritte Strategie lautet: „Hilf anderen“86 und besagt, dass die Verwobenheit von Klassismus und Sprache nicht nur theoretisch betrachtet werden dürfe. Klassistische Äußerungen von anderen dürfen nicht kommentarlos hingenommen werden und eigene Publikationen sollten in verständlicher Sprache verfasst werden. Damit an den Problemen der Klassenstrukturen gearbeitet werden kann, müssen bereits sensibilisierte Menschen im eigenen Umfeld Klassismus thematisieren und für eine weitere Sensibilisierung sorgen.87 88 Die vierte und letzte Strategie ruft dazu auf, die eigene Sprache zu reflektieren. Drexler beschreibt, dass sie selbst von Klassismus betroffen ist und dennoch Personen, die sie beispielsweise anrempelten, als Proleten beschimpfte. Es zeigt, dass sich alle Menschen, egal ob betroffen oder nicht, mit Begriffen auseinandersetzen müssen, „die abwertende Konnotationen beinhalten“93. Durch Reflexion und Zurückhaltung kann zu einer faireren Gesellschaft beigetragen werden.89 Obwohl die Strategien nach Drexler gute Sprachkenntnisse voraussetzen, da, wie Bourdieu beschreibt, ein Spiel mit der Sprache nur durch Selbstsicherheit stattfinden kann,90 helfen sie dennoch, Diversität sichtbarer zu machen. Laut Drexler ist das Sichtbarmachen von Klassismus in der Sprache zwar nur ein kleiner, aber ein sehr wichtiger Schritt.91
3. Klassismus in der Institution Theater
Seit Ausbruch der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 waren die Theater in ganz Deutschland die meiste Zeit geschlossen und befinden sich, wie viele weitere Kulturinstitutionen, in einer Krise. Laut den Theatermacher*innen Annoff und Demir sind nun alle Kunstinteressierten in einer Situation, die für viele andere Menschen schon lange Alltag bedeutet:
„Im Jahr 2018 haben lediglich zehn Prozent der Menschen in Deutschland wenigstens einmal eine öffentlich geförderte Kulturinstitution besucht. Kann es sein, dass das [...] Theater für die Mehrheit der Menschen schon immer im Lockdown gewesen ist? Liegt es daran, dass sich das Theater und sein Publikum schon vor Corona in Social Distancing geübt haben?“92
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Theaterpublikums fiel Bourdieu seiner Zeit auf, dass zu der geringen Anzahl der Theaterbesucher*innen vor allem die herrschende Klasse, die über alle drei Kapitalsorten verfügt, gehört. Diese Klasse besucht jedoch nicht nur den Kulturbetrieb Theater, sondern bestimmt auch die Gestaltung des Theaters grundlegend mit. Zurückzuführen ist die Macht des elitären Publikums auf die enge Verknüpfung und Klassenübereinstimmung von Rezipient*innen und Produzent*innen. In keinem anderen Kontext wird die Homogenität von Gruppen so deutlich, wie am Beispiel der Theaterkunst. Eine Inszenierung, die beim Publikum Erfolg feiert, ist immer auch eine Inszenierung, bei der die Interessensysteme des Publikums und der Produzent*innen übereinstimmen.93
Auch Dröscher beschreibt, dass in der Theaterkunst die Spitze der Ungleichheit zu erkennen ist, die sich im Bildungssystem in Deutschland formt. Es ist wichtig, sich bewusst zu werden, dass das Theater auch heute noch sehr elitär und Klassismus dort sehr präsent ist. Laut Dröscher benannte Terkessidis den passenden Dreiklang von „Personal, Programm, Publikum“94, der verwendet werden kann, um den Kulturbereich auf Diskriminierungen zu überprüfen.95 Aus diesem Grund wird Klassismus am Theater in den folgenden Kapiteln anhand der drei Kategorien von Personal, Programm und Publikum analysiert.
3.1 Klassistische Strukturen in Bezug auf das Theaterpersonal
Damit klassistische Strukturen im Theater aufgedeckt werden können, müssen zunächst die Zugänge zu den Studiengängen der Theaterkunst überprüft werden. Infolgedessen kann betrachtet werden, wer die Entscheidungsträger*innen im Theater sind. Von 2014 bis 2016 wurde das Projekt Art.School.Differences an drei schweizerischen Kunsthochschulen durchgeführt, das sich mit der sozialen Herkunft von Kunststudierenden befasst. In dem Projekt wurde an den Kunsthochschulen erforscht, wie die Studierenden rekrutiert, evaluiert und ausgewählt werden. Das Resultat der sozialstrukturellen Analyse zeigt, dass Studierende aus den oberen, privilegierten Klassen die deutliche Mehrheit bilden. Auffällig an den Ergebnissen ist, dass vor allem in den Studiengängen des Theaters und der Musik die Zusammensetzung der Studierenden in Bezug auf die soziale Herkunft ähnlich ausfällt wie bei Elite-Studiengängen der Medizin. Grundsätzlich ist das Feld der Kunsthochschulen zwar intersektional, jedoch ist bei den Studierenden die Intersektionaliät sehr stark an eine privilegierte Herkunft gebunden.96
Klassismus spielt bei der Auswahl der Student*innen daher bereits eine Rolle. Zumal laut der eben genannten Studie inkorporiertes Kulturkapital in Form von besonderem Vorwissen, besonderer Bildung und Erfahrung im Kunstkontext als Zugangsvoraussetzungen gelten. Außerdem können das ökonomische Kapital und das Alter der Bewerber*innen den Zugang zur Kunsthochschule erleichtern.97 Durch die starke, gegenseitige Verknüpfung vom ökonomischen, sozialen und kulturellen Kapital in der Kunstszene haben es benachteiligte Studierende besonders schwer, wie auch Karabulut beschreibt: „Du hast nicht die gleichen Chancen, wenn du parallel zu deinem Studium ein unbezahltes Praktikum machst und trotz BAföG zwei Nebenjobs machen musst, um dir die Miete in München leisten zu können.“98 Gemäß eines Interviews zwischen dem Zeit- Redakteur Twickel, der Anthropolog*in und Antidiskriminierungstrainer*in Seeck sowie der Künstlerin Brakonier ist nicht nur der Zugang zur Kultur- und Theaterszene besonders schwierig, sondern auch die ökonomische Existenz im Feld. Die Szene ist im Vergleich zu anderen Bereichen klassenmäßig homogen und um künstlerisch aktiv zu werden, sind Gelder für Training, Probenräume bzw. Ateliers und Materialien notwendig. Die oftmals geringe Bezahlung der Tätigkeiten in der Kunst- und Kulturszene reicht als alleinige Grundversorgung nicht aus und ist in Kombination mit Existenzängsten, die viele Arbeiter*innenkinder seit ihrer Kindheit begleiten, schwieriger auszuhalten.99 Laut dem Bericht der Wiener Zeitung mit Seeck und Stengele gibt es darüber hinaus im Theater große Einkommensunterschiede zwischen der Intendanz, den Assistenzen, den Bühnenarbeiter*innen und den Reinigungskräften.100
Auch Dröscher beschreibt, dass durch die Ressourcen der sozialen Herkunft „auch der Verbleib im Feld“101 reguliert wird. Um dauerhaft und professionell im Theaterkontext zu arbeiten, brauchen die Theaterschaffenden dementsprechend entweder eine der seltenen Festanstellungen oder die Möglichkeit, eine Vielzahl von Nebentätigkeiten zu bewältigen. Alternativen für eine Absicherung bestehen lediglich in einer Partnerschaft mit Besserverdienenden, die allerdings, wie im Kapitel 1.2.1 erläutert, ebenso Schwierigkeiten mit sich bringt oder durch den Erhalt eines Erbes. Infolgedessen können sich nicht alle Menschen die Existenzängste leisten, die eine Theaterarbeit mit sich bringt. Laut Dröscher werden die unterschiedlichen Produktionsbedingungen für die Theaterarbeit meistens verschleiert, sodass klassistische Erfahrungen von Betroffenen oft nicht kommuniziert werden können. Dadurch wird in den meisten Fällen auch die Herkunft von der Identität der Betroffenen selbst abgespalten und nach dem Vorgehen aus Kapitel 1.1.1 verleugnet, sodass sich auch die Arbeiter*innenkinder an die Elite im Theater anpassen. Das Theater als elitäres System wird reproduziert und die elitären Ansichten werden auf alle Bereiche des Theaters, wie auch auf das Programm und die daran anknüpfende Öffentlichkeitsarbeit, ausgeweitet.102
3.2 Klassistische Strukturen in Bezug auf das Theaterprogramm
Bei einem Blick in die Programmhefte der Theater fällt auch Seek auf, dass vor allem Inszenierungen gespielt werden, die sich mit den Geschichten und Interessen der Oberklasse auseinandersetzen. Menschen mit wenig ökonomischem Kapital werden in Theaterinszenierungen selten repräsentiert „und wenn, dann werden sie meist ziemlich klischeehaft dargestellt, mit Bierdose in der Hand und weißem Unterhemd.“103
Neben Themen, die vor allem die Oberklasse adressieren, wird außerdem an Theatern oftmals mit Codes gespielt, die für die unteren Klassen schwer zu erschließen sind. Wie in Kapitel 1.1.2 beschrieben, werden durch die familiäre Bildung bestimmte Codes vermittelt und ein kultureller Geschmack erlernt. Bourdieu beschreibt, dass die Kunst nur auf Interesse und Anerkennung bei Rezipient*innen stoßen kann, wenn diese auch die kulturelle
Kompetenz bzw. die entsprechenden Codes beherrschen. Gerade die Codes der Klassiker auf den Theaterbühnen können erst umfassend gedeutet werden, wenn Kenntnis über die Epoche, die Prägung der Autorinnen und der enthaltenen Logik der Werke vorliegt.104 „Wem der entsprechende Code fehlt, der fühlt sich angesichts dieses scheinbaren Chaos an Tönen und Rhythmen, Farben und Zeilen ohne Vers und Verstand nur mehr überwältigt und .verschlungen’.“105 Brakonier berichtet ebenfalls über das kennzeichnende Gefühl, dass sie als Performerin aus einer Arbeiter*innenfamilie auf der Bühne steht und zugleich weiß, dass ihre Familie sich im Publikum „fehl am Platz“106 fühlt, weil dieser bestimmte Codes fehlen.107 In dem Buch Nicht-Besucher-Forschung schlüsselt Renz auf, dass es für viele Nicht- Besucher*innen eine besondere Herausforderung darstellt, eine Inszenierung als eine Vielfalt von Bedeutungszuschreibungen zu begreifen. Das Zusammenspiel von bedeutungstragenden Zeichen in Requisite, Kostüm, Lichtdesign und Bühnenbild kann von vielen Zuschauer*innen nicht decodiert werden, da durch die Übertragung auf den klassischen Text ein hohes kulturelles Kapital benötigt wird. Dadurch werden die theaterästhetischen Mittel und deren Bedeutung von Gelegenheits-Besucher*innen ausgeblendet, die
Interpretationsleistung reduziert sich und der Erfolg des Theaterbesuches wird lediglich an dem inhaltlichen Verstehen gemessen. Gerade bei einer Neuinszenierung von Klassikern kann eine solche Rezeptionshaltung zu negativen Erfahrungen im Theater führen, wenn die Bühnendarstellung mit dem historischen Sprachgebrauch nicht übereinstimmt.108
Im Gegensatz dazu kommt es laut Renz bei zeitgenössischen Theaterstoffen nicht zu dem Bruch der Erwartungshaltung, vorausgesetzt die Thematik und der Sprachgebrauch lassen sich für das Publikum einordnen. Die unerfahrenen Besucher*innen nehmen das moderne Spiel mit den theaterästhetischen Mitteln und den Inhalt der Inszenierung als Einheit wahr, wodurch keine negative Theatererfahrung entsteht. Darüber hinaus ist eine besonders spannende Beobachtung, dass der Bruch der Erwartungshaltung der gelegentlichen Theaterbesucher*innen als weniger schlimm wahrgenommen wird, wenn der modernisierte Klassiker nicht im klassischen Theatergebäude gezeigt wird: „Allein ein anderer Ort und die damit einhergehende Veränderung der Konnotation von Theater kann dann eine Rezeptionsstrategie fördern, welche eben nicht auf der Erwartung nach klassischem Bühnenbild basiert.“109 Ein ähnlicher Effekt kann erzeugt werden, wenn der Titel der Inszenierung den unerfahrenen Theaterbesucher*innen keinen Klassiker verspricht. Sofern der Titel in der Öffentlichkeitsarbeit transparent macht, dass eine Aktualisierung des Klassikers vorliegt, können dementsprechend die Erwartungen einer konventionellen Theateraufführung nicht aufgebaut und auch nicht gebrochen werden. In diesem Fall wird eine moderne Inszenierung als Mehrwert wahrgenommen und die kulturelle Bildung gefördert.110
Wenn jedoch durch die Öffentlichkeitsarbeit Inszenierungen weniger transparent gemacht werden, wird das Theater zu einem Ort, an dem das kulturelle Kapital und die Beherrschung von Codes mitbestimmen, ob ein Theaterprogramm als positiv oder negativ gewertet wird. Nach Seeck habe besonders das Theater das Potenzial, gesellschaftliche Strukturen zu verändern. Im Theaterprogramm kann eine neue Thematik verhandelt und sich von alten Strukturen losgelöst werden.111 Nach Dröscher könnte sich das Theater dadurch „zunehmend als einen Ort verstehen, der weniger feine Unterschiede reproduziert, sondern stattdessen den Klassenkampf in die Gesellschaft trägt.“112
3.3 Klassistische Strukturen in Bezug auf das Theaterpublikum
Die Statistiken über Besucher*innen von Theaterveranstaltungen der letzten Jahre zeigen nach Renz deutlich, dass nur etwa fünf bis dreizehn Prozent der Bevölkerung in regelmäßigen, monatlichen Abständen eine Inszenierung besuchen. Die Prozentzahl der Besucher*innen steigt zwar mit der Verlängerung der Abstände zwischen den Besuchen, jedoch überschreitet diese in keiner Studie die „analog fallenden Nicht-Besucheranteile“113. Es bleibt festzuhalten, dass die öffentlich finanzierten Theater nur von einer Minderheit der Bevölkerung besucht werden.114 Unter den Befragten sind laut Renz „extrem überdurchschnittlich“115 viele Besucherinnen mit Abitur und Hochschulabschlüssen, sodass sich ein Zusammenhang zwischen Bildungsstatus und dem Besuch eines Theaters nicht leugnen lässt.116
Renz beschreibt, dass Theaterinstitutionen, auch mit einer homogenen Gruppe und einer geringen Anzahl von Besucher*innen, einen hohen Nutzen für die Gesellschaft haben, da vor allem die Oberklasse das Theater besuche und diese wiederum in Führungspositionen einen direkten Einfluss auf Nicht-Besucher*innen haben würden. Beispielsweise können so Denkanstöße, die durch die Kunst beim Publikum ausgelöst wurden, an Dritte herangetragen werden.117 Problematisch wird es jedoch, wenn sich Theater auf dem kleinen, elitären Kreis, den sie mobilisieren, ausruhen und dadurch bestimmte Gruppierungen nicht mehr versuchen anzusprechen oder sie sogar ausgrenzen.
Renz unterscheidet in seiner Forschung zum Theaterpublikum zwischen objekt- und subjektbedingten Barrieren, wobei die Grenzen zwischen den Kategorien verschwimmen.
Dadurch existieren Faktoren, die als subjektbedingte und als objektbedingte Barrieren einzuordnen sind. Die objektbedingten Barrieren beziehen sich direkt auf die kulturelle Institution des Theaters und somit auf die institutionell bedingten Barrieren, wohingegen sich die subjektbedingten Barrieren auf die persönlichen Sozialisations- und Strukturbedingungen der möglichen Besucher*innen beziehen. Dazu zählt ebenfalls das ökonomische, kulturelle und soziale Kapital einer Person. Demnach können auch Wissenslücken über die Theater, mangelnde Begleitungen und zeitliche oder finanzielle Verfügbarkeiten zu subjektbedingten Barrieren werden.118 Gerade die subjektbezogenen Barrieren hängen folglich unmittelbar mit der sozialen Herkunft zusammen. Besucher*innen mit weniger kulturellem Kapital können laut Renz beispielsweise durch das Bildungs-Image der Theater und den dadurch vermuteten Verhaltenszwängen abgeschreckt werden.119
Bei den objektbezogenen Barrieren unterscheidet Renz in zwei Formen von Barrieren. Die erste objektbezogene Barriere bezieht sich auf die mangelnde kulturelle Infrastruktur. Durch Letzteres haben insbesondere Menschen, die auf dem Land wohnen, schlechtere Chancen, eine kulturelle Veranstaltung zu besuchen, selbst wenn Interesse und Besuchsabsicht vorhanden sind. Ausgenommen von Kulturbesuchen im Urlaub ist folglich auch die Entfernung zwischen dem Veranstaltungsort zum Wohnort für einen Besuch im Theater entscheidend.120
Als zweite objektbezogene Barriere führt Renz das Marketing an. Unter Marketing fasst Renz Eintrittspreise, Programm, Distribution, Serviceleistungen, Nebenprodukte und die Kommunikation der Öffentlichkeitsarbeit von Theatern zusammen.121 Die Distribution, Serviceleistungen, Eintrittspreise und Nebenprodukte werden mitgedacht, jedoch erfolgt aufgrund des begrenzten Umfangs der vorliegenden Arbeit keine ausführliche Beschreibung. Da bereits ausführlich im Kapitel 3.2 beschrieben wurde, welche Rolle Klassismus im Programm des Theaters spielt, sind die Barrieren dieser Kategorie bereits bekannt und müssen nun im Zusammenhang mit der Kommunikation der Öffentlichkeitsarbeit mitgedacht werden. Zumal die Sprache nicht losgelöst vom Kommunikationsereignis betrachtet werden kann, wie bereits die Definition von Sprache in Kapitel 2 zeigte.122
Die Kommunikation der Öffentlichkeitsarbeit gilt laut Renz als Haupttätigkeit des operativen Marketings, da der Ansprache eines potenziellen Publikums bei der nicht- besucher*innenorientierten Marketingpolitik eine Schlüsselrolle zukommt. Dennoch wird die Kommunikation der Öffentlichkeitsarbeit oftmals als ausbaufähig wahrgenommen, so das Ergebnis einer Studie der Europäischen Kommission von 2003. Gemäß der Forschungsergebnisse finden beispielsweise Jugendliche, dass sich die Theater nicht aktiv bemühen, ihnen das Programm näher zu bringen.123 Wenngleich sich die Studie auf subjektive Wahrnehmungen bezieht, zeigt diese nach Renz, dass Nicht-Besucher*innen die Informationspolitik der Theater als ungenügend empfinden. Inwiefern der Einsatz von spezifischen Medien zur Besuchsentscheidung beiträgt, wurde noch nicht umfassend untersucht.124
In Bezug auf Menschen mit einem geringen kulturellen Kapital fand Frank bereits heraus, dass die Mehrzahl derer ein eher situationsbedingtes und spontanes Informationsverhalten hat. Dabei wird die Quelle der Informationen vor allem durch den Zufall bestimmt und spielt somit eine untergeordnete Rolle.125 Demzufolge ist in zukünftigen Forschungen zur Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klassismus weniger interessant, welche Medien genutzt werden, sondern viel mehr welche Inhalte als Kommunikationsereignis ausgewählt und mit welchem Sprachgebrauch diese dargestellt werden. Daran anknüpfend ist, laut Seeck, ein wesentliches Problem der Öffentlichkeitsarbeit von Kulturinstitutionen, dass den Menschen aus den unteren Klassen nachgesagt wird, sie würden sich nicht für Kultur interessieren und somit nicht als Zielgruppe gelten. Solche Klischees dürfen weder die Programmauswahl beeinflussen, noch zu einem, wie im Kapitel 2.2 beschriebenen klassistischen Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit führen, da es Künstler*innen und Kunstinteressierte aus allen Klassen gibt.126 Demzufolge sollte die Öffentlichkeitsarbeit von Theatern auf fachspezifische Codes und den damit zusammenhängenden Sprachgebrauch überprüft werden. Insbesondere, weil Nicht-Besucher*innen, laut Klein, häufig aufgrund von Verständnisschwierigkeiten zurückschrecken, dadurch die soziale Teilhabe eingeschränkt und Klassismus reproduziert werden könnte.127
Obwohl die Öffentlichkeitsarbeit dementsprechend durchaus diskriminierende Strukturen reproduzieren kann, wurden bisher keine wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zum klassistischen Sprachgebrauch in der Öffentlichkeitsarbeit von Theatern bzw. kulturellen Institutionen verfasst. An diese Forschungslücke knüpft der zweite Teil dieser Arbeit an.
4. Das Forschungsdesign zur empirischen Untersuchung des Sprachgebrauchs der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß
Im ersten Teil dieser Arbeit wurde dargestellt, was die Diskriminierungskategorie Klassismus ausmacht und wo sie in der Sprache sowie im Theater zu verorten ist. Mit Hilfe dieses Verständnisses wird nun im zweiten Teil der Arbeit die Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß betrachtet und empirisch untersucht. Dementsprechend wird in den anschließenden Kapiteln das Forschungsdesign vorgestellt. Im Zuge dessen wird zunächst das Forschungsinteresse hinsichtlich der Forschungsfragen erläutert, um darauf aufbauend die Datenerhebung darzustellen. Letzteres setzt sich aus den Kapiteln der Studien- teilnehmer*innen, der Form der Datenerhebung und der Transkription zusammen. Anschließend wird die Methode der Datenauswertung veranschaulicht.
4.1 Forschungsfragen
Im Mittelpunkt der folgenden empirischen Untersuchung steht der Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit des Thalia Theaters und inwieweit dieser den Zugang für Nicht- Akademiker*innen erschwert. Damit der Umfang der Arbeit eingehalten werden kann, wird die Öffentlichkeitsarbeit am Thalia Theater ausschließlich am Beispiel der Inszenierung Maß für Maß128 betrachtet. Wie bereits zuvor beschrieben wurde, sind Diskriminierungen aufgrund der sozialen Herkunft allgegenwärtig und daher auch in der Sprache zu finden. Ebenso sind klassistische Strukturen im Theater zu erkennen, wenn das Personal, das Programm und das Publikum genauer betrachtet werden. Jedoch ist nicht bekannt, inwieweit der Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit vom Thalia Theater den Zugang für Nicht- Akademiker*innen erschwert. Dadurch ist zugleich der Raum gegeben, diesen Forschungsgegenstand anhand der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß des Thalia Theaters zu untersuchen. In dem Zusammenhang werden sowohl der Sprachgebrauch, welcher in dieser Untersuchung in Begriffe und Ausdrucksform129 unterteilt wird, als auch die inhaltlichen Codes der Öffentlichkeitsarbeit überprüft. Anhand dieser Untersuchungen bietet sich zudem die Chance und Möglichkeit, die Öffentlichkeitsarbeit des Thalia Theaters für die Zukunft weiterzudenken.
Die leitende Forschungsfrage der Studie lautet: Inwieweit erschwert der Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß den Zugang zum Thalia Theater für Nicht-Akademiker*innen? Damit die Fragestellung eingehend untersucht werden kann, erfolgt eine Differenzierung in drei spezifische Teilfragen. Die Teilfragen grenzen die leitende Forschungsfrage ein und strukturieren deren Beantwortung. Die erste Teilfrage lautet: (1) Welche Begriffe und welche sprachlichen Ausdrucksformen sind in der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß vom Thalia Theater unverständlich? Die Grundlage für die Beantwortung und Analyse dieser ersten Teilfrage bilden die im zweiten Kapitel aufgeführte Theorie zu Klassismus im Sprachgebrauch und die ausgewerteten Interviews mit den Studienteilnehmer*innen. Hierbei wird nicht zwischen objektbedingten und subjektbedingten Barrieren unterschieden, da ausschließlich die objektbedingte Barriere der Kommunikation der Öffentlichkeitsarbeit aus der Sicht der Studienteilnehmer*innen untersucht wird. Bei der Darstellung der Ergebnisse werden die Perspektiven der Nicht- Akademiker*innen und Akademiker*innen gegenübergestellt. Nach der Betrachtung der Begriffe und der sprachlichen Ausdrucksform der Öffentlichkeitsarbeit soll das Kommunikationsereignis in der zweiten Teilfrage näher beleuchtet werden: (2) Welche Inhalte der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß können Nicht- Akademiker*innen nicht einordnen? Die zweite Teilfrage zielt darauf ab, herauszufinden, ob und welche inhaltlichen Codes das Thalia Theater in der Öffentlichkeitsarbeit nutzt und dadurch möglicherweise objektbedingte Barrieren aufbaut. Zugleich kann durch die Fragestellung offengelegt werden, inwiefern das inhaltliche Wissen der Studienteil- nehmer*innen mit den Anforderungen der Öffentlichkeitsarbeit übereinstimmt und welche subjektbedingten Barrieren gegebenenfalls damit einhergehen. Demzufolge werden bei der zweiten Teilfragen zum Inhalt der Öffentlichkeitsarbeit sowohl die objektbedingten als auch die subjektbedingten Barrieren beleuchtet. Zuletzt sollen in der dritten Teilfrage die Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit untersucht werden: (3) Welche Elemente der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß vom Thalia Theater sprechen Nicht-Akademiker*innen an und welche Chancen sind darüber hinaus erkennbar? Mit der dritten Teilfrage wird gezielt danach gesucht, welche Elemente in der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß für Nicht-Akademiker*innen funktionieren. Außerdem soll mit Hilfe dieser Teilfrage die Öffentlichkeitsarbeit weitergedacht werden können, für den Fall, dass die Antworten der vorherigen Fragen aufzeigen, dass die Öffentlichkeitsarbeit ausbaufähig ist.
4.2 Datenerhebung
Die empirische Untersuchung zur Sprache in der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß des Thalia Theaters fand in dem Zeitraum von Juni 2021 bis Juli 2021 statt. Im Zentrum der Untersuchung standen die subjektiven Einschätzungen von Akademiker*innen und Nicht-Akademiker*innen zur Öffentlichkeitsarbeit von Maß für Maß. Diese Auseinandersetzung stellt dementsprechend ein einzelnes Fallbeispiel dar. „Fallanalysen sind ein hervorragendes Anwendungsgebiet ihrer eher offenen, eher deskriptiven, eher interpretativen Methodik.“ 130 Es wurden daher fokussierte, leitfadengestützte Interviews als empirische Erhebungsmethode gewählt, die im Anschluss in Bezug auf die Forschungsfragen dargelegt und interpretiert werden. Da in der vorliegenden Studie Klassismus im Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit anhand eines Beispiels untersucht wird, steht die Rekonstruktion von Sinn und subjektiven Sichtweisen im Vordergrund. Laut Helfferich ist daher zu diesem Zeitpunkt eine quantitative Forschung weniger passend.131
In Anbetracht der Fragestellung steht die Gruppe der Nicht-Akademiker*innen im Vordergrund der Studie. Die Gruppe der Akademiker*innen dient als Kontrollgruppe. Trotz der Gegenüberstellung der zwei Gruppen wird in der vorliegenden Arbeit nicht von einer eigenständigen quantitativen Forschung gesprochen, da der Umfang der Studienteil- nehmer*innen zu gering ist und somit bei den Ergebnissen nicht von einer Allgemeingültigkeit ausgegangen werden kann.
4.2.1 Studienteilnehmer*innen
Für die Durchführung der Studie wurden insgesamt 24 Personen individuell kontaktiert und gefragt, ob sie an der Studie teilnehmen möchten. Es wurde sich für diesen direkten Weg der Kommunikation entschieden, um potentielle Teilnehmer*innen gezielt anhand bestimmter Kriterien auszuwählen. Ein zentrales Kriterium war es, sowohl Teilnehmer*innen für die Gruppe der Nicht-Akademiker*innen als auch für die Kontrollgruppe der Akademiker*innen zu finden. Außerdem sollte keine*r der Studienteilnehmer*innen im Theaterkontext beruflich tätig sein. Das Mindestalter der Teilnehmer*innen lag bei 23 Jahren, um zu gewährleisten, dass im deutschen Schulsystem ein akademischer Abschluss erworben werden konnte. Ein weiterer Aspekt für den sich die persönliche Kontaktaufnahme anbot, war, dass Personen aus verschiedenen Altersgruppen, Geschlechtern und mit unterschiedlichen ethnischen Herkünften befragt werden sollten. Besonders aus intersektionaler Perspektive war es von großer Bedeutung, dass auch People of Color in beiden Gruppen vertreten waren. Da die Studie aus dem Blickwinkel einer weißen Person erstellt wurde, sollte mit der letzten Frage des Interviewleitfadens132 in der Studie Raum gegeben werden, unbeachtete Perspektiven zu ergänzen. Ebenso wurde bei der Einordnung der Frauen aus der Studie der intersektionale Zusammenhang von Sexismus und Klassismus mitgedacht, der im Kapitel 1.2.1 beschrieben wurde. Demnach wurde eine verheiratete Frau nur als Nicht- Akademiker*in eingeordnet, wenn sie und ihr Mann keine akademische Laufbahn absolviert haben.
Durch den vorgegebenen Umfang der Arbeit, den Anspruch auf Diversität in der Studie und Absagen von angefragten Personen belief sich die finale Zahl der Studienteilnehmer*innen auf zehn Befragte. Als Vorbereitung auf das anstehende Interview erhielten die Studienteilnehmer*innen eine Mail mit dem Link zum Online-Meeting und den Beobachtungsbogen133 mit einer Aufgabe. Der Beobachtungsbogen diente primär als Impuls, sodass darauf aufbauend das Interview geführt werden konnte. Bei drei Nicht- Akademiker*innen war ein Online-Meeting durch technische Barrieren nicht möglich, sodass die Interviews mit Maske und Abstand in Präsenz geführt wurden.
4.2.2 Form der Datenerhebung
Der Beobachtungsbogen bildete den ersten Teil der Datenerhebung und besteht aus ausgewählten Elementen der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß vom Thalia Theater Hamburg. Die Auswahl wurde maßgeblich von den Formen der Öffentlichkeitsarbeit, bei denen der Sprachgebrauch eine besondere Rolle spielt, beeinflusst. Folglich wurden auf dem Beobachtungsbogen die Website, der erste deutschsprachige Ausschnitt aus dem Programmheft, Sticker und ein Plakat abgebildet.134 Der Flyer wurde nicht separat aufgenommen, da der Text auf dem Flyer dem auf der Website entspricht. Auf der Website sind jedoch zusätzlich die Pressestimmen, Überschriften und Bildelemente enthalten. Von dem Programmheft wurden lediglich drei Seiten mit aufgenommen, da das gesamte Heft zu viel Raum eingenommen hätte und ausschließlich ein Eindruck dessen vermittelt werden sollte. Darüber hinaus reicht der Anfang des Programmheftes aus, um herauszufinden, ob Leser*innen weitergelesen oder das Heft zur Seite gelegt hätten. Auf den Stickern und dem Plakat sind Begriffe abgedruckt, sodass sie ebenfalls aufgenommen wurden.135 InstagramPosts, Videos, Podcasts und weitere Fotos der Inszenierung wurden nicht berücksichtigt. Obwohl sie entscheidende Teile der Öffentlichkeitsarbeit sind, spielt der abgedruckte Sprachgebrauch bei diesen Medien eine untergeordnete Rolle.
Auf dem Beobachtungsbogen ist zu Beginn die Beobachtungsaufgabe abgebildet: „Auf den folgenden Seiten siehst du die Website, einen Ausschnitt aus dem Programmheft, Sticker und ein Plakat. Markiere alle Wörter und Sätze, die du unverständlich findest.“136 Die Beobachtungsaufgabe und die Eindrücke der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß werden als Reize genutzt, um darauf aufbauend ein fokussiertes und leitfadengestütztes Interview mit den Studienteilnehmer*innen zu führen. Laut Poscheschnik biete sich ein fokussiertes Interview an, wenn ein Impuls, wie zum Beispiel der Beobachtungsbogen zur Öffentlichkeitsarbeit der Inszenierung Maß für Maß, präsentiert wurde und „mithilfe eines Interviewleitfadens dessen Wirkung auf die Probanden erfasst“137 werden soll. Da die Studie ebenso das Ziel verfolgt, die subjektive Wirkung der Sprache der Öffentlichkeitsarbeit auf die Nicht-Akademiker*innen und Akademiker*innen zu prüfen, stellte sich ein Interview in fokussierter Form als passend heraus.
Nach Betrachtung der Inhalte des Beobachtungsbogens konnte anhand dessen ein Interviewleitfaden138 entwickelt werden. Im Sinne von Misoch soll der Leitfaden die verschiedenen Inhalte strukturieren, steuern und in Bezug auf die Fragestellung thematisch einrahmen.139 Mit Hilfe des Leitfadens wurden in den Interviews zu Beginn einleitende Fragen gestellt. Unter anderem wurden, wie es laut Poscheschnik in einem fokussierten Interview üblich ist, auch unspezifische Fragen gestellt, die sich allgemein auf die Wirkung beziehen. Es folgten spezifischere Fragen, die bestimmte Elemente der Öffentlichkeitsarbeit aufgreifen. Zu guter Letzt können auch Nachfragen gestellt werden, da eine Tiefgründigkeit beim fokussierten Interview erwünscht ist.140 Ebenso wurde dabei die Möglichkeit für narrative und offene Gespräche eingeplant, damit auch der Raum für intersektionale Betrachtungen gegeben war.141
Die Interviews wurden in Einzelgesprächen und mehrheitlich über das Videokonferenztool Zoom geführt. Anlass für das digitale Treffen waren die Vorsichtsmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. Die Einzelgespräche sollten allen Studienteilnehmer*innen die Möglichkeit geben, die Fragen eigenständig zu beantworten, ohne sich durch die Interaktion mit anderen beeinflussen zu lassen. Durch Audio-Aufnahmen wurden die Interviews festgehalten und dokumentiert. An dieser Stelle sollte jedoch angemerkt werden, dass die digitale Form die Interviewsituation beeinflusst haben könnte, da digitale Medien je nach Kenntnisstand seitens der Teilnehmer*innen zu Hemmungen führen können und nonverbale Kommunikation schwieriger zu erfassen ist.
4.2.3 Transkription der Interviews
Durch die auditive Form der Datenerhebung bot es sich für die weitere Untersuchung an, die Audio-Aufnahmen zu transkribieren und anhand der Verschriftlichung die Analyse und Interpretation durchzuführen. Nach Kuckartz gibt es viele Optionen, die Audio-Aufnahmen zu transkribieren, weshalb Regeln für die Transkription festgelegt werden sollten.142
Zu Beginn der Transkription wurde aufgeführt, ob ein*e Akademiker*in oder Nicht- Akademiker*in interviewt wurde. Zusätzlich wurde das Alter, das Geschlecht und die ethnische Herkunft angegeben, um Intersektionalität gegebenenfalls mitdenken zu können. Die Angaben wurden als Kürzel, zum Beispiel wA25 (weiblich, Akademker*in, 25 Jahre alt), bei den Sprecher*innenwechseln genutzt, um die Anonymisierung der Teilnehmer*innen zu gewährleisten. Ebenso wurden Sprecher*innenwechsel durch Absätze markiert.
Die Inhalte der Interviews wurden „wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte [wurden] nicht mit transkribiert, sondern möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt.“143 Im Sinne von Kuckartz’ Regeln orientierten sich die Sprache sowie Interpunktion an der deutschen Schriftsprache. Lautäußerungen und Pausen wurden in den Transkripten in Klammern sichtbar gemacht.144 Sobald in den Interviews personenbezogene Daten, wie Namen oder Ortsangaben, preisgegeben wurden, erfolgte eine Umschreibung der Daten in geschweiften Klammern, wie zum Beispiel {Name der Tochter}. „Mit der Verwendung der geschweiften Klammern wird visuell hervorgehoben, dass textliche Änderungen vorgenommen wurden.“145 Die zehn Transkripte sind im Anhang, nach Nicht-Akademiker*innen und Akademiker*innen sortiert, zu finden.
4.3 Datenauswertung
Die Datensätze, die in Form von Interviews erhoben wurden, sollen in Bezug auf die Fragestellung analysiert und gedeutet werden. Bei der Auswertung der Interviews geht es weder um ein richtig oder falsch noch um Verallgemeinerungen. Vielmehr sollen die Interviewinhalte intensiv untersucht, analysiert und möglichst unvoreingenommen ausgewertet werden. Damit eine gründliche Deutung der Daten vollzogen werden kann, wird auf die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz zurückgegriffen. Kuckartz’ Analysemethode wird durch eine bestimmte Theorie und den daraus resultierenden Kategorien geleitet.146 Die zuvor dargelegten Kapitel zu Klassismus in der Sprache und in der Institution Theater bilden die theoretische Grundlage der folgenden Kategorien und Analyse. Mit Hilfe der Kategorien kann der Inhalt der Interviews auf Ähnlichkeiten und Unterschiede überprüft werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, durch das Vorgehen alle relevanten Aussagen für die Forschungsfrage herauszuarbeiten.147
Laut Kuckartz gibt es drei verschiedene Techniken in Bezug auf die qualitative Inhaltsanalyse: die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse, die evaluative qualitative Inhaltsanalyse und die typenbildende qualitative Inhaltsanalyse. Durch die Forschung mit zwei Gruppen, den Nicht-Akademiker*innen und den Akademiker*innen, scheint sich die typenbildende qualitative Inhaltsanalyse für diese Studie anzubieten. Laut Kuckartz gibt es bei der typenbildenden qualitativen Inhaltsanalyse das Konzept vom Merkmalsraum. Eine Analyse mit Hilfe eines Merkmalsraumes eignet sich besonders, um Klassismus aus intersektionaler Perspektive in der Sprache der Öffentlichkeitsarbeit zu beleuchten. Grund ist, dass sie sich nicht nur auf eine Eigenschaft der Befragten konzentriert, „sondern auf mehrere, d.h. mindestens auf zwei [Merkmale]“148. Allerdings kann Klassismus aufgrund des vorgegebenen Rahmens der Masterarbeit nur intersektional mitgedacht und nicht ausführlich in einem Merkmalsraum analysiert werden. Folglich wird in dieser Arbeit mit der nach Kuckartz weniger komplexen149 aber zugleich sehr bewährten, ausführlichen und strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse gearbeitet.150
Im ersten Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse werden fünf Oberkategorien ausgehend von der Theorie des ersten Teils der Arbeit gebildet und auf das Textmaterial angewendet. Daraufhin können Oberkategorien anhand der Daten überarbeitet und durch Unterkategorien ergänzt werden, um die Datensätze hiernach erneut zu codieren. Im Anschluss erfolgt die Auswertung und Interpretation.151 „Durch Vergleichen und Kontrastieren von [...] Gruppen - häufig nach soziodemografischen Merkmalen differenziert - gewinnt die kategorienbasierte Auswertung und Darstellung an Differenziertheit, Komplexität und Erklärungskraft.“152 Aus diesem Grund wird bereits bei der Codierung zwischen Nicht-Akademiker*innen und Akademiker*innen unterschieden. Zuletzt wird die Fragestellung anhand der vollzogenen Analyse beantwortet.
Damit die Interviewinhalte den einzelnen Kategorien präzise zugeordnet werden können, wurde in einer Analyseübersicht jede Kategorie definiert und durch ein Ankerbeispiel aus den Interviews vervollständigt.153 Es ergibt sich aus der Theorie des ersten Teils dieser Arbeit folgendes Kategoriesystem, das in der empirischen Untersuchung überprüft und gegebenenfalls ausdifferenziert wird:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
5. Darstellung und Interpretation der Forschungsergebnisse
In dem fünften Kapitel und dritten Teil der Arbeit werden nun die fokussierten und leitfadengestützten Interviews dargelegt und interpretiert. Dabei werden zunächst die Aussagen der Nicht-Akademiker*innen und anschließend die der Akademiker*innen aufgeführt. Die Darstellung erfolgt anhand der Reihenfolge der Kategorien, die jeweils in einem Zwischenfazit mit Interpretation münden.
5.1 Unverständliche Begriffe
Perspektive der Nicht-Akademiker*innen
Zu Beginn der Interviews äußerten die Nicht-Akademiker*innen wenig Kritik zu der Öffentlichkeitsarbeit der Inszenierung Maß für Maß. Bei der Frage, welche Begriffe unverständlich erschienen, wurde immer wieder betont, dass die Wörter grundsätzlich in Ordnung seien:
„Nee die Wörter waren ganz okay.“154
„Ja deswegen da war ich auch raus, ähm aber der Rest war halt eigentlich so weit so gut [...]“155
Im Laufe des Interviews widersprachen die Nicht-Akademiker*innen ihrer Aussage und beschrieben, dass ihnen doch einige Begriffe, die entweder stückspezifisch oder seltener in der Alltagssprache zu finden sind, unbekannt seien:
„Emm solche Worte wie zum Beispiel dieses schwedische Odem oder was war da noch?“156
„Die Website, ja weiß nicht, ich wüsste jetzt zum Beispiel überhaupt nichts. Maß okay, das würde ich jetzt mal stumpf mit Bier verbinden, auch wenn das jetzt vielleicht anders geschrieben wird, ne, oder?“157
„Hier unten sind halt auch so ein paar Wörter, also ich habe, also ich hab mich ein bisschen dämlich gefühlt, als ich den Text gelesen habe, teilweise, stellenweise, weil ich mir dachte, okay, kennst du wirklich so viele Wörter nicht oder? Ist das jetzt schlecht, oder? Da sagt mir z.B. Am, Amduval, Ambuvalenz sagt mir jetzt nichts, Galan sagt mir auch nichts und diesen Satz habe ich auch nicht verstanden: Johannes Hegemann gibt seinem Claudio bemerkenswerte Kontur. Also das wird wahrscheinlich irgendwas damit zu tun haben, wie das dargestellt wird, weil hinterher kommt ja noch irgendwie und so und so glänzt in einem beeindruckenden Schnellsprech-Monolog, dann wird das ja auch irgendwas sein. Aber das ist halt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, was ich darunter verstehen soll.“158
Besonders im letzteren Absatz wurde beschrieben, dass die unverständlichen Begriffe abwertend auf den eigenen Intellekt bezogen werden. Außerdem wurden fremdsprachliche Begriffe ebenso als unverständlich betitelt:
„Ja, da kam viel Englisches und das konnte ich nicht verstehen, weil ich das nicht gelernt hab, ich hab kein Englisch gehabt in der Schule.“159
„Ja gut. Und ich, ich weiß nicht, was ist das für eine Sprache? Im Text?“160
Während die englischen Wörter teilweise noch eingeordnet werden konnten, waren die lateinischen Begriffe für die meisten befragten Nicht-Akademiker*innen nicht entschlüsselbar. Nur eine von ihnen wusste, dass es sich bei der Phrase um die lateinische Sprache handelt.161 Die Nicht-Akademiker*innen betonten, dass sie die Fremdsprache nicht erlernt haben:
„Aber ich kann kein Latein. Sag mir ja auch gar nichts.“162
„Verstehe ich halt auch nicht. Genau.“163
Vor allem durch die Häufung der unbekannten Begriffe in den Texten der Öffentlichkeitsarbeit zu Maß für Maß habe ein Nicht-Akademiker grundsätzliche Verständnisschwierigkeiten:
„[...] Problem bei mir ist halt das dann zum Beispiel mehrere komplizierte Wörter hintereinander kommen, dass ich dann halt auch irgendwann mal mich so sehr auf das jetzt kommende Wort, was ich lese, halt konzentrieren muss, dass ich das Vorherige eigentlich schon fast vergessen habe, weil das, ähm, mein Hirn sonst glaube ich nicht verarbeiten könnte.“164
Von dem Problem, dass aufgrund von einzelnen unverständlichen Begriffen ganze Sätze nicht verstanden werden konnten, berichtete ebenso eine andere Nicht-Akademikerin.165 Außerdem führten die falsch getrennten Begriffe zu einem großen Verständnisproblem. Zwei befragte Nicht-Akademiker*innen berichteten, dass sie länger brauchten, um die Begriffe lesen zu können. Dennoch fanden sie positiv, dass die Trennung der Begriffe Aufmerksamkeit erregt hat:
„Musste ich ehrlich gesagt auch erst einmal einmal .ah ja, okay. Also so nicht, nicht gleich beim ersten Hingucken und dann ah Spiel-triebe und so. Sondern einmal hingeguckt und hä, und dann erst beim längeren Blick, aber das finde ich für mich zum Beispiel gar nicht, gar nicht schlimm, weil ich finde das, jetzt fehlt mir das Wort. Sozusagen es fesselt einen.“166
„Dadurch, dass es anders ist, ist es eigentlich wieder cool. Aber du musst halt tatsächlich, man muss halt zwei Mal hingucken. Teilweise... Also wie schon gesagt, bei diesen Quadraten hier, musste ich, hatte ich beim ersten auch erstwas anderes gelesen.“167
Demgegenüber konnten die restlichen Nicht-Akademiker*innen die falsch getrennten Begriffe nicht decodieren. Sie fühlten sich durch das Spiel mit der Trennung der Begriffe nicht angesprochen und aufgrund der Probleme beim Decodieren ungebildet:
„Eigentlich auch halt ein bisschen komisch, weil wenn ich das jetzt halt versuchen würde zu sprechen oder so dann würd das ja auch nicht gehen, also halt von der, äh wie soll ich das jetzt sagen? So hier zum Beispiel Politik a is Beruf, is a Beruf wäre für mich schon verständlicher, als a is Beruf, also das wär halt auch so ein bisschen, weiß ich nicht...“168
„Irritiert mich total. Zum einen, weil ich mich frage, was wollt ihr mir damit mitteilen? Bin ich zu doof zum Lesen? Also das mach tatsächlich bei mir was mit, mit meiner meinem Intellekt.“169
„Welchen Hintergrund es hat, weiß ich nicht und hier fühlte ich mich doof. Weil ich das "als" nicht zusammensetzen konnte, sondern gedacht hab, bringen die jetzt zwei Sprachen zusammen?“170
Perspektive der Akademiker*innen
In den Interviews mit den Akademiker*innen wurden vor allem stückspezifische Begriffe durch Markierungen als unverständlich eingeordnet. Eine Akademikerin markierte beispielsweise die Namen der Figuren aus der Inszenierung. Dennoch führten die unbekannten Namen nicht zu grundsätzlichen Verständnisschwierigkeiten, da die Akademikerin trotzdem die Wörter als Namen identifizieren konnte:
„Achso und dann da unten, habe ich einfach nur emm Escalus und Scharfrichter markiert, emm weil mir im ersten Moment nicht klar ist was ein Escalus, Escalus? Wahrscheinlich ein Name und ein Scharfrichter ist...“171
„Stimmt Escalus ist ein Name, ja, emm und genau dann hier im Text habe ich zwei Sachen markiert, emm genau emm als der „schwedische Odem“ zu wüten beginnt, Odem sagt mir nichts [...]“172
Die stückspezifische Phrase „schwedischer Odem“173 , die von Melle und Pucher im Stück als Synonym zur Corona-Pandemie verwendet wurde, markierten alle Akademiker*innen.174 Die Bedeutung der Phrase wusste keine Person. Aus diesem Grund wurde die Verwendung dieser Begriffe in der Öffentlichkeitsarbeit von einer Akademikerin auch als „doof"175 bezeichnet:
„Ja, da fand ich, emmm, als der schwedische Odem zu wüten beginnt. Was ist ein schwedischer Odem? Spielt das das Odem Atem ist, aber man weiß ja nicht, spielt das Ganze vielleicht in Schweden? Machen, üben die Macht aus? Oder so? Na ja. Das fand ich z.B. doof. Das hat mir nichts gesagt. Ich weiß, dass die Schweden ja auch in Norddeutschland einiges gemacht haben. Aber trotzdem.“176
„Meine erste Markierung ist der schwedische Odem, ich habe es sogar gegoogelt. Ich habe nichts gefunden. Ich habe keine Ahnung, was das ist.“177
Weitere Begriffe, die ebenso als unverständlich betitelt wurden, waren die lateinischen Wörter im Ankündigungstext. Eine der Akademiker*innen beherrschte zwar die lateinische Sprache, konnte jedoch nur die Hälfte des Satzes einordnen.178 Alle anderen konnten den Satz als Latein identifizieren berichteten aber, dass sie kein Latein erlernt haben und die Begriffe deshalb nicht verstanden.179 Eine Akademikerin beschrieb zusätzlich, dass sie davon ausgeht, dass die Sätze nichts elementar Wichtiges enthalten und sie dementsprechend den Text verstehen wird, auch ohne Latein zu verstehen.180 Ein anderer Akademiker kritisierte die Verwendung der lateinischen Sprache in Bezug auf den Adressat:
„Wem nützt es und dann was ist das? Lateinisch? Oder was ist das? „Cui bono“ - also ich hatte Französisch, gab kein Latein. Also sagt mir schon mal nix. Finde ich, finde ich auch irgendwie... Also das ist ja immer die Frage, wen will man da eigentlich ansprechen? Wenn man da professionelle Theatergänger ansprechen will, gut, die mögen da vielleicht irgendwas mit anfangen können, aber wenn man, wenn man auch andere damit ansprechen will...“181
Von der 69 Jahre alten Akademikerin wurden neben den lateinischen Begriffen auch die Fremdwörter einschließlich der englischen Wörter kritisiert. Zugleich beschrieb sie, dass vor allem in der Theaterszene versucht wird, sich in sehr gewandter Sprache auszudrücken, obwohl es auch in einfacher Sprache möglich wäre. Dadurch wurde der Lesekomfort ihrer Meinung nach ohne besonderen Grund eingeschränkt:
„Da höre ich auch gerne zu und manchmal denke ich auch, dort könnte man das auch ohne das Fremdwort ausdrücken. Also Theaterleute sind oft auch sehr, ja, die wollen immer alles so toll darstellen und ich finde immer einfach gesagt ist es eigentlich besser.“182
„Und warum muss das ganze „a great man said, everything is about sex. Sex ist about power.“ Warum auf Englisch? Ja, warum nicht auf Deutsch, dann wenigsten hinterher die Übersetzung. Also ich kann zwar Englisch, aber ich finde es manchmal mühsam, wenn ich den Englisch lesen muss und so.“183
Trotz der Kritik an den Fremdwörtern wurde betont, dass die einzelnen Begriffe nicht die Verständlichkeit der Texte einschränken würden:
„Es war gar nicht, dass da so viel Fremdwörter drin sind. Also das das ist es nicht. Es ist einfach diese Länge der Sätze.“184
„Also ich weiß nicht, ob du da jetzt was mit anfangen kannst, weil ich dir jetzt so die einzelnen Wörter hier nicht so markieren, markieren kann, weil die Wörter für sich sind alle verständlich, bis auf vorne, die wie die Sachen, die ich da eben schon gesagt habe, aber hier geht es eigentlich mehr um, um stilistische, um den Satzbau, der das so, so, so grottenschlecht macht, für meine, für mein Verständnis.“185
Bei der Betrachtung der Titel und der Sticker, die jeweils Begriffe mit einer falschen Trennung beinhalten, wurde von Irritationsmomenten berichtet.
„Muss erst einmal im Moment gucken und bist ein bisschen irritiert. Und, und dann, naja, okay, das ist halt Kunst.“186
„[...] ich fand es eher seltsam, sagen wir es so, ja.“187
Vor allem drei befragte Akademikerinnen berichteten dennoch sehr positiv von dem Irritationsmoment, da das Spiel mit der Trennung für ihre Aufmerksamkeit gesorgt hat. Alle Akademiker*innen empfanden die Wörter trotz der Trennung als lesbar und verständlich.188 Eine Akademikerin berichtete von einem Lesekompetenztest, an den sie durch das Spiel mit der Trennung erinnert wurde:
„Ich also es hat auf mich gewirkt. Man kann es natürlich direkt lesen, man kann es erkennen. Es gab früher so einen, wie so einen Intelligenztest für Kinder, glaube ich, wo die Wörter, wo die Worte, wo im Prinzip alle Wörter miteinander verbunden waren, wo im Prinzip versucht wurde festzustellen, wie, wie gut ist das Lese, Leseverständnis der Kinder bzw. der Erwachsenen? Wie schnell können die oder wie können sie den Text erfassen, auch wenn es gar keine Trennung, gar keine Interpunktion gibt. Daran fühlte ich mich so ein bisschen erinnert.“189
Zwischenfazit zu den unverständlichen Begriffen
Werden die Perspektiven der Nicht-Akademiker*innen und der Akademiker*innen bezüglich unverständlicher Begriffe gegenübergestellt, fällt auf, dass die Akademiker*innen vor allem stückspezifische Begriffe, wie zum Beispiel Namen, nicht einordnen konnten. Bei den Nicht- Akademiker*innen wurden teilweise auch Wörter, die in ihrem alltäglichen Sprachgebrauch selten vorkommen, wie beispielsweise Kontur, zur Verständnisbarriere. Ein weiterer Unterschied wird bei der lateinischen Phrase im Ankündigungstext deutlich. Zwar konnte keine*r der Befragten die Phrase vollständig übersetzen, dennoch wussten alle Akademiker*innen, dass es sich bei der Phrase um Latein handelt. Demgegenüber konnte nur eine Person unter den Nicht-Akademiker*innen die Fremdsprache als Latein identifizieren. Alle anderen Nicht-Akademiker*innen hätten sich nicht weiter mit der Phrase auseinandersetzen können. Durch die Häufungen von unverständlichen Begriffen wurden die Werbetexte zur Inszenierung Maß für Maß laut einigen Nicht-Akademiker*innen in ihrer Verständlichkeit eingeschränkt. Dies empfanden die Akademiker*innen nicht, vor allem weil unbekannte Begriffe von ihnen oftmals trotzdem kontextualisiert werden konnten.
Der spielerische Umgang mit der Trennung von Wörtern sorgte grundsätzlich für Irritationsmomente. Die Akademiker*innen konnten die Wörter jedoch entschlüsseln, sodass einige das sprachliche Spiel als spannend und fesselnd werteten. Bei einigen Nicht- Akademiker*innen führte das Spiel mit der falschen Trennung zu Problemen beim Decodieren der Wörter und zugleich bekamen sie das Gefühl vermittelt, dass sie nicht intelligent genug für die Rezeption der Werbung seien.
An dieser Stelle wird die Problematik deutlich, die sich auch an anderen Stellen im Interview zeigte. Sobald die Nicht-Akademiker*innen in der Öffentlichkeitsarbeit zu Maß für Maß Begriffe nicht einordnen konnten, wurde weniger der Text, sondern viel mehr das eigene Wissen kritisiert. Sie lehnten sich nicht gegen die Unverständlichkeiten auf, sondern verorteten das Rezeptionsproblem bei sich selbst, indem sie beispielsweise betonten, dass sie der Fremdsprache nicht mächtig sind. Demgegenüber wurde bei den Akademiker*innen ersichtlich, dass sie die Unverständlichkeit der Begriffe, wie bei schwedischer Odem, als eine Diskrepanz in der Öffentlichkeitsarbeit verorten. Sie kritisierten und reflektierten die verwendeten Begriffe der Öffentlichkeitsarbeit und machten Verbesserungsvorschläge.
5.2 . Unverständliche Ausdrucksformen
Perspektive der Nicht-Akademiker*innen
Alle Nicht-Akademiker*innen beschrieben in den Interviews, dass die Texte der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß unverständliche Ausdrucksformen beinhalten. Bereits beim Lesen des Ankündigungstextes wurde von Schwierigkeiten berichtet. Eine Nicht-Akademikerin beschrieb ihre Rezeptionsprobleme sehr präzise und führte diese auf den fehlenden Zusammenhang zwischen den Sätzen zurück:
„Der, also ich muss grundsätzlich aber auch sagen, diesen ersten Abschnitt hätte ich wahrscheinlich, vom Inhalt hätte ich wahrscheinlich alles markieren können. Ich habe, weil ich hab, also ich hab zwar Satz für Satz, verstehe ich ungefähr was da drin steht, aber diesen Zusammenhang dazwischen verstehe ich nicht.“190
Auch die anderen Nicht-Akademiker*innen beschrieben Verständnisprobleme, antworteten jedoch teilweise auf resultierenden Fragen, dass der Text doch in Ordnung sei:
„Aber sonst der Rest ging eigentlich klar. Wüsste ich jetzt halt nicht so, da musste ich halt auch nochmal, wo war das jetzt hier, hier Dilettanten musste ich auch nochmal zweimal lesen, aber dann ist mir das auch nochmal, ähm, eingefallen. Sonst war das eigentlich alles so gut.“191
Die Ausdrucksform der Pressestimmen beachteten und kommentierten ausschließlich zwei der Nicht-Akademikerinnen. Eine lobte die Pressemitteilungen, da diese konkret weitere Informationen zu den Schauspieler*innen wiedergeben:
„Also die Pressestimmen fand ich zum Beispiel auch gut. So ist mir das nochmal klarer geworden, weil die eine zum Beispiel genau sagt, die in der Mitte, welcher Schauspieler oder Schauspielerin da was darstellt.“192
Die andere nahm die Pressestimmen als unverständlich wahr, da zu viele unbekannte Begriffe enthalten waren, welche bereits im vorherigen Kapitel erläutert wurden.193 Im Kontrast zu den Pressestimmen nahmen alle Nicht-Akademiker*innen auf den Text des Programmheftes Politik als Beruf Bezug. Keine*r der befragten Nicht-Akademiker*innen konnte den Auszug aus dem Programmheft gut verstehen:
„Weil ich das alles nicht richtig versteh und, äh, das auch das alles nicht so kapieren tu, wie diese Politik das eigentlich...“194
„Ja das ist ja das, wo ich, ähm, also tatsächlich müsste, ich würd ihn mir jetzt wahrscheinlich zwei bis dreimal durchlesen, um dann nochmal nach und nach, äh, es zu verstehen, em, ja, weil auch so viele Wörter da drin sind, die so im Alltag nicht unbedingt so nutzt, formulierst, also ich jedenfalls ähm nicht.“195
„Nein, ne weil das jetzt mich halt schon so, die etwas längeren Satzbauten, die sind nicht ganz so gut, kurz und knapp wäre für mich halt besser. Weil nämlich ich bin mehr so der Hörtyp eher...“196
Als Grund für die Unklarheiten wurde neben den fachspezifischen Begriffen und Satzlängen, mehrfach ein unvertrauter sprachlicher Ausdruck genannt. Dabei fiel es den Nicht- Akademiker*innen teilweise schwer, einzuordnen, ob es sich um älteres Deutsch, einen plattdeutschen Dialekt oder einen gehobenen Sprachgebrauch handelt:
„Ja schon halt ein bisschen schwierig, aber wenn du schon ein, zwei Hörspiele zum Beispiel hattest oder so, dann ist das halt auch so, dass die da des Öfteren mal auf platt - du holde Mach oder sowas, halt sprechen. Das geht dann eigentlich auch, also bei mir jetzt.“197
„So sprech ich halt nicht. Und wenn man so dann auch in der Presse irgendwie sieht.“198
„Ja so wie damals, äh, was ich mal im Fernsehn so gesehen hab, ähm, eine Theateraufführung Romeo und Julia, was ich aber auch als Fernsehfilm gesehen hab, ähm, diese Art mag ich persönlich gar nicht. Also da wird so komisch gesprochen, das ist nicht meine Sprache das ist, wie als wenn mir jetzt einer auf Russisch, Türkisch einer erzählt, wo ich jetzt sag oder denken würde red verständlich mit mir, dann weiß ich was du willst aber diese Wortwahl hat man vor 100, 300 Jahren so gesprochen, keine Ahnung, aber, ähm, das schreckt mich dann tatsächlich ab, da kann ich mich nicht, ähm, kann ich mich nicht, äh, mitidentifizieren.“199
Die Rezeptionsprobleme führten die meisten Nicht-Akademiker*innen nicht auf die Ausdrucksformen der Texte der Öffentlichkeitsarbeit, sondern auf ihre mangelnde Konzentration zurück:
„sonst kann ich den Text in der Tat lesen und wenn ich etwas geistiger aufnahmefähig bin, dann hätte ich jetzt auch mehr behalten.“200
„[...] weil das, ähm, mein Hirn sonst glaube ich nicht verarbeiten könnte.“201
Perspektive der Akademiker*innen
Die Akademiker*innen kritisierten die Ausdrucksform der Texte der Öffentlichkeitsarbeit stark. Vor allem die Länge und der Bau der Sätze führten nach ihren Aussagen zu Verständnisschwierigkeiten:
„Also [...] hier geht es eigentlich mehr um, um stilistische, um den Satzbau, der das so, so, so grottenschlecht macht, für meine, für mein Verständnis.“202
Während eine Akademikerin den Ankündigungstext der Website, welcher ebenso auf den Flyern verwendet wurde, als eher kurz und einfach beschrieb203, kritisierten zwei Akade- miker*innen bereits diesen ersten Text des Beobachtungsbogens:
„Also erst einmal das. Im Grunde kann man das dreimal lesen, damit man eigentlich weiß, worum es da gehen soll. Und selbst wenn ich es dreimal lese, dann frage ich mich immer noch, Mensch! Also wenn ich den Text gelesen habe, dann suche ich eigentlich zwischen den verschiedenen Absätzen erst einmal die Zusammenhänge. Das ist für mich ist das irgendwie völlig zusammenhanglos, was da steht.“204
„Natürlich verstehe ich die Sätze, aber ich verstehe überhaupt nicht, was das soll.“205
In den Aussagen wird deutlich, dass die Befragten den Text lesen konnten, ihnen aber die Kontextualisierung der Sätze und Inhalte fehlte. Die Akademiker*innen berichteten, dass sie von einem Ankündigungstext erwarten, dass der Inhalt der Inszenierung konkret entnommen werden kann:
„Weil der Absatz sagt einem eigentlich viel zu wenig und normalerweise müsste man in der Lage sein, in diesem, in diesem Umfang hier, in diese drei Absätze, etwas reinzubringen, aus dem auch ein unbedarfter Theatergänger irgendwie ein Gefühl kriegt, worum geht es da eigentlich. Was ist das eigentlich und ja, womit, womit, womit beschäftigt sich das ganze Thema hier eigentlich? Also ja, kann ich da nicht raus erkennen.“206
Demgegenüber äußerte ein anderer Akademiker, dass er erst ab den darauffolgenden Pressestimmen beginnen musste, den Text mehrmals zu lesen und aus diesem Grund den Ankündigungstext in Ordnung fand.207 Ebenso wie eine weitere Akademikerin, die ausschließlich die Fremdwörter in dem Ankündigungstext kritisierte.208 Die Ausdrucksform der Pressestimmen wurde darüber hinaus als verständlich eingeordnet, wie folgendes Beispiel deutlich macht:
„Wenn man dann weiter guckt, hier in den Pressestimmen, und sich einfach den Schreibstil anguckt, da fällt geradezu auf, dass man die Presse-Fritzen, die die haben einfach ein anderes Talent zu schreiben. Ja, da fällt geradezu auf, dass es einfach ein unterschiedlicher Schreibstil, völlig unterschiedlicher Schreibstil. Vielleicht sollte man tatsächlich so ein Presse-Fritzen mal bitten so eine kurze Zusammenfassung zu machen.“209
Als besonders unverständlich wurde der erste deutschsprachige Text im Programmheft wahrgenommen, der von Max Weber zitiert wurde. Während die Akademiker*innen den Beginn des Textes als gut lesbar einordneten, musste ab dem zweiten Absatz mehrmals gelesen werden:
„Ja, den ersten Absatz konnte man gut lesen. Also ich konnte ihn gut lesen und konnte ihn auch beim ersten Mal lesen verstehen. Beim zweiten Absatz hat es mich aus den Schuhen gehauen. Da waren Sätze drin... Ich habe, wie gesagt, drei, vier, fünfmal gelesen.“210
„Ich hab's dreimal gelesen und dann hab ich gesagt, das ist manchmal so, wie wenn Politiker ’ne Frage gestellt wird und die antworten ganz ausschweifend und die weiß man nicht, was sie gesagt haben. So, so kam mir das vor, als ich mit diesem ganzen Abschnitt, muss ich sagen, konnte ich nichts anfangen.“211
„Und bei dem Text hier von Max Weber, musste ich schon zum Teil die Sätze zwei Mal lesen. Em, weil er viel, auch einfach eingeschoben hat, em, deswegen da, die Satzstruktur ist einfach komplizierter, so...“212
Als Grund für das mehrfache Lesen wurden die Satzlängen angeführt. Ohne dass ein Nachfragen im Interview nötig war, äußerten zwei Akademiker*innen konstruktive Kritik und beschrieben teilweise sogar, wie sie im Arbeitskontext mit dem Text umgegangen wären:
„Also eigentlich hätte man, wenn man, wenn das ein Text gewesen wäre, den ich hätte durcharbeiten müssen, um, was weiß ich, darüber ein Referat zu halten, hätte ich mir da so halbe Sätze draus gemacht und die dann hinterher wieder zusammen gepackt.“213
„Also wenn ich jetzt beruflich unterwegs bin und müsste sowas lesen, dann, dann, dann müsste ich mir echt für den ganzen Text, müsste ich dreimal lesen und müsste mir echt Zeit nehmen. Das Ding würde ich sofort in die Ecke schmeißen und denjenigen, der das formuliert hat, sagen, versuch mal einen verständlichen Text dahin zu kriegen und emm, die erste Bedingung ist mal keine Sätze mehr als zwei Zeilen, maximal drei Zeilen, damit man das flüssig lesen kann.“214
Im letzteren Absatz wurde angedeutet, dass die Unverständlichkeiten im sprachlichen Ausdruck als Fehler der Verfasser*innen, folglich als Fehler der Öffentlichkeitsarbeit vom Theater, angesehen werden. Zwar äußerten zwei Akademiker*innen in den Interviews, dass die Probleme der Rezeption auch an ihrem eigenen Versagen liegen könnten, jedoch revidierten sie diese These durch ein anschließendes aber:
„Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd dafür. Das mag sein. Aber wenn man, wenn man ein breiteres Publikum ansprechen will, ich glaube, da muss man einfach mehr in die in die praktische deutsche Sprache rein. Ja und nicht in diese, in dieses hochstilisierte Vokabular. Und dann eingeschobene Sätze, Klammern noch da rein.“215
„Ja, manchmal denke ich, bin ich dann auch zu blöd. Aber wenn ich das dann auch so kritisch angucke, wenn so ein langer Satz ist. Also finde ich einfach schlecht.“216
Zwischenfazit zu den unverständlichen Ausdrucksformen
Sowohl die Nicht-Akademiker*innen als auch fast alle Akademiker*innen berichteten von unverständlichen Ausdrucksformen in der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß. Von dem Ankündigungstext erwarteten die Akademiker*innen, dass konkret der Inhalt der Inszenierung entnommen werden kann. Da jedoch der Zusammenhang zwischen den einzelnen Sätzen unverständlich war, wurden ihre Erwartungen gebrochen und der Ankündigungstext dementsprechend kritisiert. Im Vergleich fiel den meisten Nicht- Akademiker*innen die Begründung schwer, weshalb der Ankündigungstext als unverständlich wahrgenommen wurde. Auf resultierende Fragen wichen die Nicht-Akade- miker*innen aus, indem sie den Ankündigungstext doch als positiv werteten. Bei den Pressestimmen war ein ähnliches Vorgehen zu beobachten. Zunächst betitelte eine Nicht- Akademiker*in die Pressestimmen in ihrer Ausdrucksweise als aufschlussreich. Im Verlauf des Interviews wurden diese dann jedoch als unverständlich eingeordnet. Demgegenüber lobten die meisten Akademiker*innen die Pressestimmen in ihrer kurzen und präzisen Ausdrucksform und kritisierten ausschließlich die Fremdwörter.
Als besonders schwer verständlich empfanden beide Gruppierungen den Text aus dem Programmheft Politik als Beruf. Die Akademiker*innen beschrieben die langen Schachtelsätze als problematisch und einige nannten Verbesserungsvorschläge. Durch ihr Vorgehen wurde deutlich, dass ihnen die grammatikalischen Regeln für verständliche Texte durchaus bewusst sind, sie diese beherrschen und somit den Text auch dahingehend kritisch hinterfragen können. Zugleich wurde erkennbar, dass die Befragten die Unverständlichkeiten in der Ausdrucksform als Fehler der Öffentlichkeitsarbeit vom Theater ansehen.
Die Nicht-Akademiker*innen ordneten zwar die langen Sätze und den unvertrauten sprachlichen Ausdruck als Verständnisbarriere ein, jedoch fiel es ihnen darüber hinaus schwerer, die Sprache in dem Text einzuordnen. Sie verglichen den Text mit dem
Mittelhochdeutschen, Plattdeutschen oder auch mit einem gehobenen Sprachgebrauch. Außerdem fiel auf, dass die Nicht-Akademiker*innen die Verständnisschwierigkeiten häufig auf sich selbst bezogen und eigene Schwächen, wie Konzentrationsschwierigkeiten, aufzählten.
5.3 Subjektbedingte Barrieren der Interviewpartner*innen in Bezug auf den Inhalt der Öffentlichkeitsarbeit
Perspektive der Nicht-Akademiker*innen
Laut zwei Nicht-Akademiker*innen wurden ihre bisherigen Theaterbesuche des Öfteren durch inhaltliche Verständnisschwierigkeiten erschwert.217 Deswegen würden vor allem Opern gemieden werden, wobei zwischen Oper und Operette von der Nicht-Akademiker*in unterschieden wird:
„Ne ich geh bloß nicht gerne zu einer Oper. Wenn da irgendwie ne Oper ist. Ne Operette wohl. Aber keine Oper. Weil ich das nicht nachvollziehen kann, was da alles drin vorkommt.“218
In Bezug auf die verschiedenen Theaterformen fragten Nicht-Akademiker*innen außerdem im Interview, ob ihre Favoriten der darstellenden Künste überhaupt als Theater definiert werden könnten:
„Also so tatsächlich, also gerade kann man ja nichts machen, aber vorher bin ich, zählt GOP zum Theater?“219
„Zählt, man das jetzt als Theater. Ich weiß nicht, dieses Rudelsingen?“220
Drei befragte Nicht-Akademiker*innen, die alle unter 40 Jahre alt sind und selten oder noch nie das Theater besucht haben, erzählten von ihrer Vermutung, dass die Theater vor allem Inszenierungen für ältere Leute zeigen. Auch die Inszenierung Maß für Maß wird durch die klassische Dramenvorlage als Theater für ältere Leute eingeordnet:
„Was wird denn im Theater gespielt? Das sind ja meist so dieser altmodischer Kram, weil ich kenn jetzt gerade kein Theaterstück, was von, ja, wann geht man denn selber mal ins Theater? Ich war, jetzt sonst so selber war ich da noch nie.“221
„Auch eher weniger, die sind so fest gefahren, mehr auf diese alten Sachen zum Beispiel, ähm, ich bin der Meinung, halt Theater müsste mehr auf Kinder gehen“222
„Ich meine, es muss ja nicht immer nur klassisches, dieses typisch klassische Theater sein. Man kann ja auch mal ein bisschen was Frisches miteinbringen, das kann ja mal mehr was sein, was auch, sag mal, junge Leute interessiert oder was.“223
„Aber so was ich im Kopf habe, ist halt immer eher noch so das, was ich von früher kenne, was meine Oma und meine Eltern gucken, dieses Theater, ja, oder habe ich früher auch geguckt. Aber das ist so im Kopf. Wenn ich an Theater denke, denke ich halt eher an sowas.“224
Der Name Shakespeare ist einem der Nicht-Akademiker*innen unbekannt gewesen, Romeo und Julia sagten ihm jedoch etwas. Allerdings setzte er bei der Frage, ob ihn ein klassisches Drama zu einem Theaterbesuch motivieren würde, klassische Dramen mit alten Filmen gleich:
„Ja also ich kenn den jetzt ja so überhaupt gar nicht, ich weiß ja nicht, worum es da geht.“225
„Ja, Romeo und Julia klar, aber so weiß ich nicht, schwierig... ich glaub ich würde mir schon lieber fast den älteren [Film] angucken, als den komplett neu aufgelegten, weil der ältere ist dann halt ja ursprünglicher... hat sich ja Jahrhunderte gehalten und wie der Neue ist, das dann halt auch so, wenn ich den einen Neuen dann einmal gesehen hätte und der schlecht wäre, obwohl der etwas ältere oder der ursprüngliche oder dies ursprüngliche Theaterstück dann halt das würde glaube ich mir eher zusagen, das Ältere einmal zu gucken, anstatt das Neue dann direkt zu sehen. Ist ja halt sowas, wie vor Spoilern, das neue halt mit irgendwo in Futurama-Zeit, das muss nicht sein.“226
Ebenso berichteten zwei Nicht-Akademiker*innen, dass sie den klassischen Theaterstoff von
Shakespeare durch den Film William Shakespeare’s Romeo und Julia kennen. Der Film würde eine der beiden motivieren und die andere jedoch abschrecken, ins Theater zu gehen:
„Ja das hab ich nämlich schon mal im Fernsehen gesehen.“227
„Ne motivieren also das ist ganz gut so.“228
„Ja so wie damals, äh, was ich mal im Fernsehn so gesehen hab, ähm, eine Theateraufführung Romeo und Julia, was ich aber auch als Fernsehfilm gesehen hab, ähm diese Art mag ich persönlich gar nicht.“229
Perspektive der Akademiker*innen
Zwei Akademiker*innen erzählten im Interview über ihre regelmäßigen Theaterbesuche und sprachen in diesem Zusammenhang auch über ihre Vorlieben für verschiedene Sparten und Darstellungsweisen im Theater:
„Schauspiel und Ballett. Das finde ich besonders schön.“230
„Eher motivieren, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade klassische Theaterstücke, emm, in modernen Inszenierungen nochmal ganz anders dargestellt werden als man das vielleicht, em, klischeehaft mit klassischen Theaterstücken verbindet.“231
Eine der Akademiker*in konnte sogar über die Entwicklung von Programmheften berichten, die sie seit Jahren sammelt.232 Die weiteren befragten Akademiker*innen, die sich zwar nicht als regelmäßige Theatergänger*innen bezeichneten, haben trotzdem des Öfteren schon ein Theater besucht:
„Mh, ist eine gute Frage, als Kind war ich häufiger im Theater, weil meine Mutter mich äh quasi mitgezogen hat und es hat mir auch Spaß gemacht. Em, ich sag mal so, seitdem ich eigenständiger bin, ich weiß nicht 12, 13, 14, war ich ganz selten im Theater.“233
„Dann wohnen wir in der Region, wo zwar {Stadtname}, {Stadtname} und so, da sind wir schon hingefahren. Wir sind auch im Theater gewesen. Aber wenn, dann eigentlich eher für mich, eher eine Oper und Oper finde ich spannender als Theater. Das liegt aber vielleicht auch an den zwei, drei Stücken, die wir mal gesehen haben. Wobei ich jetzt nicht mal sagen kann, was das war. Und Kindertheater natürlich auch, Janosch rauf und runter, aber das ist nicht das, was zählt.“234
Im letzteren Absatz erläuterte auch die Akademikerin, die sich selbst nicht als regelmäßige Theatergängerin beschreiben würde, ihre Vorlieben zu den verschiedenen Sparten des Theaters. Außerdem verdeutlichte sie an anderer Stelle, dass ihr das Thalia Theater und der Verfasser aus dem Programmheft Max Weber bereits bekannt sind.235 Demgegenüber berichtete ein anderer Akademiker, dass für ihn der erste Theaterbesuch eine große Überwindung war, da er als Arbeiter*innenkind keine Berührungspunkte mit dem Theater hatte und lediglich durch ein dazugewonnenes soziales Umfeld an die Institution Theater herangeführt wurde:
„Aber es ist tatsächlich so, wenn man so innerfamiliär irgendwie die Themen mal Revue passieren lässt, um die es ging, da ging es um 90 Prozent der Fälle, ging es einfach um, um das Thema Landwirtschaft, hoch, runter, kreuz, quer und die restlichen 10 Prozent hat man sich dann über die Nachbarn unterhalten oder so... Aber im Theater also war wirklich null Thema. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, wenn ich nicht in der Uni auf meine Frau getroffen wäre, wäre ich wahrscheinlich bis heute nicht einmal im Theater gewesen. Also nicht, dass sie regelmäßige Theatergängerin ist, aber die kommt halt aus einem anderen sozialen Umfeld, em, wo, wo dann ja vielleicht die Perspektiven dann etwas breiter gestreut sind, was sowas angeht.“236
Zwischenfazit zu den Subjektbedingten Barrieren
Im Hinblick auf das Wissen über die verschiedenen Sparten des Theaters zeigten sich zwischen den zwei Gruppierungen deutliche Unterschiede. Während neben zwei Akademikerinnen auch eine Nicht-Akademikerin auf die Oper als Sparte Bezug nahm, waren darüber hinaus große Unsicherheiten bei der Einordnung von Theaterformen seitens der Nicht-Akademiker*innen zu erkennen. Die Nicht-Akademiker*innen fragten, ob bestimmte Formen auch als Theater bezeichnet werden können und die Jüngeren von ihnen vermuteten, dass ausschließlich „altmodisches“237 Theater gespielt wird. Darüber hinaus wurde Vorwissen aus Filmen miteinbezogen und direkt auf das Theater übertragen. Ein Nicht-Akademiker konnte auch den Namen Shakespeare nicht kategorisieren. Im Kontrast dazu beschrieben die meisten Akademiker*innen ihre favorisierten Theatersparten und eine Akademikerin ordnete sogar den Verfasser aus dem Programmheft Max Weber ein. Ein Akademiker wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das theaterspezifische Wissen auch immer mit der Prägung innerhalb des sozialen Umfeldes zusammenhängt. Anhand der getätigten Aussagen wurde deutlich, dass die Befragten unterschiedliches theaterspezifisches Wissen haben. In der Gegenüberstellung wussten die Akademiker*innen mehr über das Theater als die Nicht-Akademiker*innen und konnten dementsprechend Inhalte der Öffentlichkeitsarbeit besser einordnen.
5.4 Objektbedingte Barrieren, die anhand des Inhaltes der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß sichtbar werden
Perspektive der Nicht-Akademiker*innen
Im Hinblick auf die Inhalte der Inszenierungen am Theater war ein Nicht-Akademiker der Meinung, dass seine Interessen nicht in Theaterstücken verhandelt werden:
„Überhaupt null, ja also meine Interessen sowieso, ich sag mal im Theater ziemlich schwierig umzusetzen, äh, weil ich glaube, da gibt es glaube ich nicht ein Stück und davon wird es auch nicht ein Stück geben.“238
Vor allem ein klassisches Drama, wie Maß für Maß, sprach die meisten der befragten Nicht- Akademiker*innen als Programmpunkt weniger an. Sie ordneten die Inszenierung als altmodisch und langweilig ein:
„Eher klassisch, da denke ich mir. Also stelle ich es mir eigentlich langweilig vor. Ich kann es eigentlich gar nicht genau beschreiben, aber für mich ist halt klassisch irgendwie langweilig.“239
„Em, und wenn ich da merken würde, oh, oh die reden da auch so seltsam. Dann wäre ich wahrscheinlich raus. Das ist aber auch einfach ich, weil ich da nicht so den, weil ich das einfach nicht so mag.“240
„Weil es gibt ja Filme, die sind halt, ich sag jetzt mal, ähm, mehr so auf altertümlich oder halt auch ein bisschen - ja, die sprechen halt nicht jeden an und mich würde so Theater jetzt persönlich auch nicht ansprechen [...]“241 6
Einige Nicht-Akademiker*innen betonten, dass Programmhefte mit kurzen Texten und hervorgehobenen Aussagen durchaus hilfreich und ansprechend sein könnten.242 Jedoch hätte keine*r der Nicht-Akademiker*innen Interesse im Programmheft zur Inszenierung Maß für Maß weiterzulesen243, weil die Texte ihnen zu lang erschienen:
„Ja, viel zu viel irgendwie halt, da wäre auch kurz und knapp lieber, besser für mich, als wenn es hier so endlos lang ist, weil das ist wie so ein langer Witz. Wenn du einmal vorne anfängst, ne, bist du dann halt zum Ende kommst, bis es dann wirklich lustig werden könnte oder so, da hat derjenige der zuhört, vielleicht schon gar keine Lust mehr, weil du ihn dann halt schon damit angefangen hast zu langweilen. Ich finde diese kurzen knappen Dinger oder halt Stumpf ist Trumpf immer besser, als ähm ja irgendwie halt voll aufgepusht und lange erzählt. Irgendwie so, da ist irgendwie halt in meinen Augen weniger mehr.“244
Neben der Länge der Texte führte auch die Darstellung des Theaterprogramms durch die unklaren Angaben und das sprachliche Spiel zu grundsätzlichen Verständnisschwierigkeiten und Irritationen:
„Das Programm müsste deutlicher sein und dass man das besser da den Film oder das Theaterstück, was die da machen, dass man das richtig kapiert auch. Wenn du das bloß so guckst weißte den Hintergrund nicht so.“245
„Ich glaube tatsächlich, weil mich diese Überschriften völlig irritieren, wo ich nicht weiß, was wollt ihrvon mir?“246
Infolgedessen vermutete eine Nicht-Akademikerin, dass in erster Linie sehr gebildete Personen vom Theater adressiert werden:
„Wenn man sowas schreibt, muss man ja auch erst mal wissen, was für die Zielgruppe man hat und dann, wenn halt nicht so, ja wenn die halt eher hochgebildete Leute haben möchten, die das alles verstehen, dann. Es gibt ja auch Leute, die, ähm, die finden sich dann besonders cool bei sowas.“247
Perspektive der Akademiker*innen
Die klassischen Dramen wie Maß für Maß können ausschlaggebend für einen Theaterbesuch sein, wie eine Akademikerin beschrieb:
„Also mich interessiert immer erstmal der Hintergrund, also auch der klassische. Also wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie so ein Stück sehe und ich sehe, dass es von, von Shakespeare, dann würde ich gerne auch etwas wissen wollen über Shakespeare und aus was für einem Grund er das geschrieben hat und wie dann gerade so seine, sein Erleben war und so.“248
Sie betonte aber zugleich, dass ihr transparent gemacht werden soll, was Shakespeares Intention war, Maß für Maß zu verfassen. Folglich können auch bekannte Namen von Theatermacher*innen dazu beitragen, dass Akademiker*innen das Theater besuchen.249 Jedoch werde eine Transparenz und klare Struktur in Bezug auf die Verbindung von klassischen Dramen und moderner Ästhetik bevorzugt, wie die folgende Aussage einer Akademikerin verdeutlicht:
„Sagen wir, oftmals ist der Versuch, für mich, für mich am Theater, das alte in das neue zu transformieren, aber zu viel von dem alten zu lassen... Dann finde ich es spannender zu sagen, ich gucke mir ein Theaterstück an, in dem alten mit dem, mit dem entsprechenden Kostüm. [...] Oder wenn ich transformiere in die heutige Zeit, dann auch mit allem anderen in die heutige Zeit transformiert. Trotzdem kann ich ja den Grundgedanken von Shakespeare lassen. Ich finde eher so dieses, dieses Mischen. Wo ich dann, was moderne Elemente habe, mit, mit, mit altem verquickt, da komme ich dann oftmals einfach nicht mit.“250
Mit den traditionellen Kostümen und den modernen Elementen nahm die Akademikerin direkten Bezug zur Öffentlichkeitsarbeit von der Inszenierung Maß für Maß. Es wurde deutlich, dass eine Transparenz über die Verwendung alter und neuer Elemente in der Öffentlichkeitsarbeit von Maß für Maß ihrer Meinung nach nicht vorhanden ist. Allerdings wurde das moderne Bühnenbild auf den Bildern auch gelobt:
„Ja, das Bild war dann ja auch richtig schön. Die dicken Insekten da, das hat mir gut gefallen.“251
Inhaltlich wurden die Texte der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere der Text über die Eigenschaften von Politiker*innen, von den Akademiker*innen als interessant und aktuell beschrieben:
„Also in dem Stück geht es um Politik und, em, gerade wenn man sich dieses Jahr anschaut, die Bundestagswahlen stehen an, em, Politik ist halt nach wie vor, em, ein top aktuelles und superwichtiges Thema und ich glaube, dass sich Theater das zum Thema macht, em, spricht mich an, weil ich ein politikinteressierter Mensch bin [,..]“252
„Ja, emm, grundsätzlich die Überlegung fand ich interessant, em, bezüglich was Politiker mitbringen sollten, einfach nur, weil ich da sehr gezielt eigene Meinungen habe, aber es ist mir glaube ich einfach zu anstrengend das zu lesen, das ist glaube ich das Thema.“253
„Das glaube ich, ist echt interessant, ja, gerade hier dieser Absatz hier, wo man versucht zu, zu erklären, was, was eigentlich der Beruf des Politikers da so für, für, für Anforderungen hat. Also das ist, inhaltlich ist das sehr interessant, aber es ist derart schwer zu lesen und umständlich zu lesen, dass man da relativ schnell aussteigt. “254 9
Trotz des interessanten Inhaltes beschrieben die meisten Akademiker*innen, dass sie im Programmheft nicht weiterlesen würden, da der Text komplexe Formulierungen beinhaltet und dadurch der Lesekomfort nicht gegeben war.255 Besonders eindrücklich beschrieb der Akademiker aus der Arbeiter*innenfamilie, dass die Texte der Öffentlichkeitsarbeit sehr intellektuell wirken und zugleich viele Menschen ausgrenzen würden:
„Also ich hab, ich habe echt den Eindruck, auch nachher bei dem anderen Text hier. Man versucht da krampfhaft so, so, so intellektuelles, intellektuellen Touch reinzubringen. Und das glaube ich, es ist grundverkehrt, wenn man, wenn man Leute in etwas breiterer Masse ansprechen will.“256
„Naja, also könnte jetzt auch böswillig sagen, man versucht sich bewusst abzuschotten und bewusst Leute da raus zu drängeln. Oder, oder Leute dafür für die Leute raus zu selektieren. Die, die jetzt intellektuell nicht, nicht ganz weit vorne sind, sag ich mal, indem man solche Texte schreibt.“257
Der Kritikpunkt, dass durch den Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit nur ein geringer Personenkreis erreicht wird, wurde auch in Bezug auf die Publikumsgenerierung an- geführt.258 In diesem Zusammenhang stellte der Akademiker die Vermutung an, dass sich seine Geschwister aus der Arbeiter*innenklasse nicht angesprochen fühlen würden, aber sich auch nicht trauen würden, die Barrieren der Öffentlichkeitsarbeit des Theaters in der Form zu kritisieren, wie er es als Akademiker getan hat:
„Würde ich das meinen Geschwistern aus der Landwirtschaft zeigen, die würden ein Drittel davon lesen und dann würden sie es sofort in Mülleimer schmeißen. Die würden aber es nicht kommentieren in der Form, dass sie sagen, da verstehe ich ja kein Wort.
[...] ich denke meine Geschwister würden sich nicht trauen, es so zu kritisieren.“259
Zwischenfazit zu den Objektbedingten Barrieren
Die Inszenierung Maß für Maß wird von den Akademiker*innen inhaltlich als interessanter Theaterprogrammpunkt wahrgenommen. Auch Shakespeares Stückvorlage Maß für Maß spricht die meisten Akademiker*innen an. Allerdings beurteilte eine Akademikerin die Kombination der klassischen Stückvorlage mit der modernen Ästhetik als verwirrend, sodass mehr Transparenz in der Darstellung gewünscht wird und dementsprechend der Text der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß konkret den Inhalt widerspiegeln sollte. Im Vergleich dazu spricht die klassische Dramenvorlage von Shakespeare die Nicht- Akademiker*innen weniger an. Es wird der Wunsch nach modernen und vielfältigen Inhalten kommuniziert, da das Theater auf die Nicht-Akademiker*innen veraltet wirkt. Die Darstellung der Inszenierung Maß für Maß, insbesondere das sprachliche Spiel mit den Titeln und die unklaren Angaben zur Inszenierung, sorgen für Unverständlichkeiten.
Von ähnlichen Beobachtungen berichten auch die Akademiker*innen. Nach ihrem Verständnis werden die Inhalte der Inszenierung Maß für Maß zu kompliziert dargestellt, sodass sie besonders intellektuell wirken. Die Wahrnehmungen der Nicht-Akademiker*innen und der Akademiker*innen führen zu demselben Ergebnis: Die Inhalte und vor allem die Darstellungsweise der Inhalte der Inszenierung Maß für Maß sind für sehr gebildete Personen ansprechend aufbereitet.
5.5 Motivation, ausgehend von der Öffentlichkeitsarbeit, die Inszenierung Maß für Maß zu rezipieren
Perspektive der Nicht-Akademiker*innen
In den Interviews erzählten zwei Nicht-Akademiker*innen, dass sie grundsätzlich gerne ins Theater gehen, dies allerdings aufgrund von zeitlichen Verfügbarkeiten nicht regelmäßig realisieren können:
„Wenn ich die Zeit dazu finde, ja. Also ich hab ja auch schon mal ein Theaterabo gehabt und fand das auch sehr gut, aber wir haben es dann oft zeitlich dann nicht auf die Reihe gekriegt, ja, aber prinzipiell bin ich an Theater generell interessiert.“260
„Geh ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr, weil Opa dann...ich hab ja den dann. Sonst würd ich. Sind damals immer ins Theater gegangen.“261
Eine von ihnen beschrieb in diesem Zusammenhang, dass sie ebenso sehr interessiert sei, die Inszenierung Maß für Maß anzusehen.262 Ihre Motivation begründete sie in dem Film zur Inszenierung Maß für Maß, den sie gesehen habe. Zugleich sagte sie, dass sie die Texte der Öffentlichkeitsarbeit ohne den Film nicht verstehen würde:
„[...] weil man das Stück schon gesehen hat im Fernsehen und denn kannste dir da ein Bild draus machen. Sonst würdeste das nämlich nicht verstehen können.“263
Die anderen Nicht-Akademiker*innen erläuterten, dass sie durch die vielen Irritationen in der Öffentlichkeitsarbeit wenig motiviert sind, sich die Inszenierung anzusehen:
„Dass sie mich nicht gekriegt haben. Ich glaube, das ist schon der erste Passus so gewesen. Das ist der erste Passus, der mich total verwirrt hat.“264
„Ich glaube tatsächlich, weil mich diese Überschriften völlig irritieren, wo ich nicht weiß, was wollt ihr von mir? Zweitens dieses, öhm, wie hast du das eben ausgedrückt? Keine Ahnung, was, was so in Richtung, mhh, diese, dieses, ähm...“265
„...klassische Hintergrund, mhh ja dieses Wort kenn ich ja selber, mhh, ähm das wahrscheinlich und, pff, ja ich glaube das ist eigentlich schon so vom, vom ersten schon so das was mich jetzt nicht...“266
Der letzte Absatz zeigt, dass der klassische Hintergrund von einigen Nicht-Akademiker*innen als weniger ansprechend wahrgenommen wird. Darüber hinaus wurde das Desinteresse an der Inszenierung in der Länge der Texte und den vielen enthaltenen Informationen begründet:
„Ähm den zweiten Part weiß ich nicht, da hätte ich halt, nee, also diese Pressemitteilung war das, glaube ich, da, ne, also da hatte ich ja gesagt, hätte ich, glaub ich, zu Anfang schon gar nicht mehr weitergelesen, weil es einfach für mich zu viel.“267
Trotz der vielen Informationen wird laut einer Nicht-Akademiker*in dennoch nicht deutlich, wovon die Inszenierung handelt. Die Texte enthalten zu viele unverständliche Elemente, die die Motivationslosigkeit, die Inszenierung Maß für Maß zu rezipieren, verstärken:
„Also auf jeden Fall schon in dem ersten Text, was du gesagt hast, was wohl auch auf den Flyer kommt. Emm, solche Worte wie zum Beispiel dieses schwedische Odem oder was war da noch? Also was ich zum Beispiel ganz interessant fand, hat diese eine in der Presse gesagt. Wie gesagt, man weiß ja nicht richtig, um was es da eigentlich in diesem Stück geht.“268
Perspektive der Akademiker*innen
Zu Beginn der Interviews beschrieben ebenfalls zwei Akademikerinnen, dass sie das Theater regelmäßig und gerne als kulturelle Institution besuchen:
„Also wenn nicht gerade Corona ist, gehe ich sehr gerne ins Theater und jetzt gerade wo Corona ist, merke ich auch, dass ich das auf jeden Fall sehr vermisse. Mh, ich glaube, ich würde, ich kann gar nicht sagen, wie häufig ich ins Theater gehen würde, aber ich würde schon sagen regelmäßig und immer wieder, je nachdem welche Stücke aufgeführt werden.“269
„Ich habe seit ich weiß nicht seit wie vielen Jahrzehnten ein Abo im Theater. Also das es schon eine Regelmäßigkeit und ich interessiere mich einfach dafür und ich gehe auch in mal, wenn ich das so mitkriege, in andere Theater.“270
Durch das aktuelle politische Thema und die klassische Dramenvorlage der Inszenierung Maß für Maß vom Thalia Theater in Hamburg besteht auch bei einer von ihnen großes Interesse, die Inszenierung zu rezipieren:
„Genau einfach zum einen, weil ich es spannend finde, dass es ist ein klassisches Theaterstück ist, was, ähm, ja durchaus auf die heutige Zeit übertragbar ist. Also die Themen sind ja nach wie vor aktuell und wie gesagt, was ich gerade vorgelesen habe, darin finde ich mich selbst so ein bisschen wieder, deswegen, ähm, ja, also das fände ich spannend.“271
Des Weiteren kristallisierte sich heraus, dass die Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeitsarbeit von Maß für Maß grundsätzlich auch weitere Akademiker*innen zu einem Theaterbesuch motivierte und Interesse auslöste:
„Ich wurde jetzt aber aufjeden Fall, em, angefixt, mal wieder ins Theater zu gehen (lacht).“272
Jedoch waren die weiteren befragten Akademiker*innen weniger motiviert, in die Vorstellung von Maß für Maß zu gehen. Als Gründe für die mangelnde Motivation wurden fehlende Informationen zu Shakespeare und die komplexe Thematik der Inszenierung genannt:
„Nach der Werbung. Ne, nicht unbedingt. Da wurde mir jetzt ein bisschen, ja, der Shakespeare Hintergrund und so fehlen. Nee, hätte ich, hätte ich vom Thema nicht so eine große Lust.“273
„Es ist, äh, ich bin ein großer Fan von keep it simple and stupid häufig und es hat mir jedenfalls von der Werbung her, den Eindruck gegeben, dass es sehr, ein sehr komplexes Schauspiel ist und das ist nicht unbedingt das, also für mich als Interessent ist Schauspiel eher was, wo ich hingehe, um so ein bisschen andere Gedanken zu bekommen und nicht noch tiefer in so komplexe Themen reinzugehen, sondern eher ein bisschen Unterhaltung, äh, und ein bisschen abschalten von dem, was sonst immer überall passiert und ich glaube nicht, dass das so jedenfalls, wie es inszeniert wird in der Werbung, emm, dass es so sein wird, ja, mh.“274 275
Die Komplexität in der Darstellung der Werbung, die bereits im letzten Absatz genannt wurde, bemängelten ebenfalls weitere Akademiker*innen. Die Problematik wird dabei weniger in dem Thema verortet, sondern vielmehr im Sprachgebrauch. Dennoch wäre auch der komplizierte Sprachgebrauch ausschlaggebend für die Entscheidung, die Inszenierung Maß für Maß nicht zu rezipieren:
„Aber wenn ich jetzt als {Bewohnerin eines bestimmten Dorfes} nach Hamburg fahre, für drei Tage und sage, ich möchte auch etwas Kulturelles machen, würde ich auch den Theaterplan vom Thalia-Theater mir angucken, ja. Wenn ich das gelesen hätte, hätten {Name ihres Mannes} und ich was anderes gemacht. Es hätte uns nicht angesprochen, obwohl wir bereit gewesen wären. “280
„Und, und ich glaube, dass dieses, dieses inhaltlich, dieses Thema, dass das echt spannend sein kann. Das ist, glaube ich schon. Und ich würde sogar so weit gehen, dass wenn man, wenn man so ein Programmheft kriegen würde, was, was, was so geschrieben ist, damit man, dass man das komfortabel schnell erfassen kann, dass man da auch mich davon begeistern könnte, da mal hinzugehen.“276
Zwischenfazit zur Motivation, ausgehend von der Öffentlichkeitsarbeit, die Inszenierung Maß für Maß zu rezipieren
Zwei Nicht-Akademiker*innen und zwei Akademiker*innen beschrieben, dass sie durchaus gerne das Theater besuchen. Jedoch gelingt es nur den zwei Akademiker*innen, regelmäßig einen Theaterbesuch zu realisieren. Die Inszenierung Maß für Maß vom Thalia Theater schaffte es ausschließlich bei einer Akademikerin und einer Nicht-Akademikerin, Interesse bezüglich eines Theaterbesuches zu wecken. Die Begründungen des Interesses fielen allerdings sehr unterschiedlich aus. Während die Akademikerin vor allem die aktuelle Interpretation eines klassischen Dramas und den Bezug zu ihrer Lebensrealität lobte, fühlte sich die Nicht-Akademikerin durch die Öffentlichkeitsarbeit an einen Film erinnert, der ihr gefällt. Nur aufgrund des positiven Filmerlebnisses hätte sich die Nicht-Akademikerin auch die Inszenierung Maß für Maß angeschaut, da sie ansonsten Verständnisprobleme mit den Texten der Öffentlichkeitsarbeit hatte. Von Verständnisproblemen berichtete die interessierte Akademikerin nicht.
In den Aussagen der weiteren befragten Nicht-Akademiker*innen wird deutlich, dass der klassische Hintergrund der Inszenierung, die Länge der Texte sowie der sprachliche Ausdruck zu Irritationsmomenten bei der Rezeption der Öffentlichkeitsarbeit führten.
Ausgehend davon bestand kein Interesse, die Inszenierung Maß für Maß anzusehen. Allein durch die Betrachtung der Texte der Öffentlichkeitsarbeit wurde folglich keine*r der Nicht- Akademiker*innen motiviert, das Thalia Theater zu besuchen.
Die darüber hinaus befragten Akademiker*innen wünschten sich eine unterschiedliche thematische Aufbereitung der Öffentlichkeitsarbeit, wenngleich das Thema der Inszenierung als spannend wahrgenommen wurde. Um zur Rezeption von Maß für Maß angetrieben zu werden, hätten einige eine thematische Reduzierung gebraucht, andere mehr Informationen zu Shakespeare. Die meisten aber kritisierten vor allem den Sprachgebrauch der Texte, sodass nur eine Akademikerin durch die Betrachtung der Texte der Öffentlichkeitsarbeit zum Theaterbesuch motiviert wurde. Die anderen Akademiker*innen finden zwar thematisch spannende Anknüpfungspunkte, beurteilen aber den Sprachgebrauch als demotivierend.
6. Diskussion
Im sechsten Kapitel werden nun die Ergebnisse der Studie, welche jeweils in einem Zwischenfazit im fünften Kapitel zusammengefasst wurden, in Beziehung zu der Theorie aus dem ersten Teil der Arbeit gesetzt und diskutiert. Im Anschluss wird die Forschung kritisch reflektiert und die Öffentlichkeitsarbeit am Thalia Theater weitergedacht.
6.1 Diskussion der Forschungsergebnisse
Alle Interviews, die zur Untersuchung des Sprachgebrauchs der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß, geführt wurden, müssen als Einzelfälle betrachtet und für allgemeingültige Aussagen quantitativ überprüft werden. Dennoch kristallisierten sich bereits bei den qualitativen Interviews dieser Studie Ergebnisse heraus, die im Zusammenhang mit der zuvor dargelegten Theorie diskutiert werden sollten.
6.1.1 Unverständliche Begriffe und unverständliche Ausdrucksformen
Alle befragten Personen berichteten in den Interviews von Verständnisproblemen beim Lesen der Texte zur Inszenierung Maß für Maß. So gaben beispielsweise alle befragten Personen an, dass ihnen Begriffe unbekannt waren. Vor allem einige Nicht- Akademiker*innen hatten mit der Menge und der Kontextualisierung von unbekannten Begriffen zu kämpfen. Die vielen Fremdwörter und Begriffe, die laut eigenen Aussagen selten im alltäglichen Sprachgebrauch vorkommen,277 sorgten für Verunsicherungen und abwertende Gefühle. Nach Bourdieu ist diese Verunsicherung eine typische Folge von gewandter Sprache. Bereits anhand der ausgewählten und seltenen Begriffe ist erkennbar, dass mit dem Wortschatz gespielt wird und somit Bourdieus Theorie zur „Strategie der Herablassung“278 auch im Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß zu finden ist.279
Noch deutlicher wird allerdings die „Strategie der Herablassung“280 anhand der falsch getrennten Wörter bei den Überschriften und auf den Stickern. Das Thalia Theater setzt sich durch die falsche Trennung der Begriffe über die Regelungen der deutschen Grammatik hinweg und spielt bewusst mit ihr. Durch den spielerischen Umgang mit der falschen Trennung, der laut einer Akademikerin Ähnlichkeiten zum schulischen Lesekompetenztest aufweist,281 wurden die meisten Nicht-Akademiker*innen stark verunsichert und fühlten sich stellenweise sogar ungebildet. Mehrere Nicht-Akademiker*innen konnten auch nach mehrfachem Lesen die Begriffe nicht decodieren,282 wodurch der spielerische Umgang mit der Worttrennung eine Distanz zwischen dem Thalia Theater und den Nicht- Akademiker*innen aufbaute.
Laut Bourdieu ist die Distanz auf das kulturelle Kapital zurückzuführen, das das Thalia Theaters als Besitz ausdrückt, indem es die Regeln von Grammatik selbst gestaltet und sich dadurch auf eine höhere Ebene stellt.283 Resultierend aus den Problemen beim Decodieren schafften es die meisten der befragten Nicht-Akademiker*innen nicht, auf dieser Ebene zu kommunizieren.
Demgegenüber wirkt die „Strategie der Herablassung“284 bei den Akademikerinnen nicht. Die meisten Akademiker*innen fanden die falsche Trennung interessant. Infolgedessen war die soziale Teilhabe nur für die Nicht-Akademiker*innen, die das Spiel mit der Sprache nicht decodieren konnten, eingeschränkt. Dadurch wird Klassismus reproduziert.
Bei der Betrachtung der sprachlichen Ausdrucksformen werteten die Nicht-Akade- miker*innen und Akademiker*innen die zitierten Pressestimmen durch die konkreten Angaben als verständlichstes Element der Öffentlichkeitsarbeit. Die Akademiker*innen kritisierten besonders viel an den Texten der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß und gaben Verbesserungsvorschläge für eine bessere Ausdrucksform. Dadurch zeigten sie, dass sie die Regeln der deutschen Grammatik und das Schreiben verständlicher Texte beherrschen. Die Akademiker*innen konnten folglich ihre Ansprüche an den Text klar kommunizieren und nahmen durch ihre Kritik die Rolle der Schiedsrichter*innen ein, die über einen gelungenen Sprachgebrauch entscheiden.285 Somit stehen sie auf derselben Ebene, wie das Team des Thalia Theaters, die sich nach Bourdieu durch die freie Gestaltung der Sprache ebenfalls als Schiedsrichter*innen der gewandten Sprache einordnen lassen.286 Bourdieu geht zwar in Bezug zur sprachlichen Gewandtheit nicht gesondert auf das institutionalisierte Kulturkapital ein, macht aber an anderer Stelle durchaus den Einfluss des institutionalisierten Kulturkapitals deutlich: Wenn eine Person einen Studienabschluss erlangt, besitzt diese neben den erlernten Fähigkeiten des Studiums ein kulturelles Zeugnis und zugleich eine dauerhaft zugeschriebene kulturelle Kompetenz.287 Für die befragten Akademiker*innen bedeutet dies, dass sie sich durch ihren Abschluss ihrer höheren Stellung in der Gesellschaft sicher sein können und aufgrund dessen auch genug Selbstbewusstsein haben, um die Texte der Öffentlichkeitsarbeit vom Thalia Theater zu kritisieren. Zudem sind Diskutieren und Kritisieren feste Bestandteile der universitären Lehre, wie im Kapitel 1.1.3 erwähnt.288
In diesem Zusammenhang ist es nachvollziehbar, dass einigen Nicht-Akademiker*innen das Kritisieren und Begründen der unverständlichen Ausdrucksformen schwerer fiel und es in ihren Äußerungen des Öfteren zu Widersprüchen kam. Anstatt an der Ausdrucksform der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß Kritik zu üben, so wie die Akademi- ker*innen es taten, führte ein Großteil der Nicht-Akademiker*innen die Rezeptionsprobleme auf eigenes Versagen zurück.289 Gemäß Meulenbelt zeigt sich durch die Selbstzweifel, dass die Nicht-Akademiker*innen den Sprachgebrauch des Thalia Theaters als elementar werten und dadurch eher an ihrer eigenen Sprache zweifeln, anstatt an der Sprache der Öffentlichkeitsarbeit.290 Ebenso weisen die Selbstzweifel laut Seeck und Theißl auf die Verinnerlichung von Klassismus hin. Da die befragten Nicht-Akademiker*innen durch die Verinnerlichung das klassistische Spiel der Sprache nicht als Fehler der Öffentlichkeitsarbeit vom Thalia Theater sahen, erfolgte diesbezüglich auch keine Kritik oder Auflehnung dagegen.291 Zusätzlich vermittelten die Texte der Öffentlichkeitsarbeit den Nicht-Akademi- ker*innen das Gefühl, unzureichende Fähigkeiten zur Rezeption zu besitzen, verstärkten dadurch den bereits verinnerlichten Klassismus und schreckten somit vor einem möglichen Theaterbesuch ab.
6.1.2 Inhaltliche Barrieren
Bei der Betrachtung von möglichen subjektbedingten Barrieren fällt auf, dass die befragten Akademiker*innen mehr Wissen und somit mehr kulturelles Kapital als die Nicht- Akademiker*innen bezüglich des Theaters besitzen. Vielen Nicht-Akademiker*innen fiel es schwer, die Sparten des Theaters zu unterscheiden sowie Theaterautor*innen und Theaterformen zu identifizieren. Oft wurde auf Filme mit ähnlichen Themen zurückgegriffen und das entsprechende Filmwissen inhaltlich direkt auf das Theaterstück übertragen.292 Bourdieu beschreibt, dass gerade die Kenntnisse über Epochen, Theaterautor*innen und Werke als Voraussetzung gelten, damit Klassiker wie Maß für Maß umfassend gedeutet werden können. Da allerdings einige Nicht-Akademiker*innen bereits die Theaterformen nicht einordnen konnten, verursachten die weiteren Codierungsanforderungen, wie beispielsweise die Einordnung der Epoche, eine große Überforderung.293 Laut Renz können in solchen Fällen die Rezipierenden das Gesamtbild der Inszenierung, inklusive der theaterästhetischen Mittel, gar nicht mehr wahrnehmen, da sich die Interpretationsleistung reduziert und nur noch das inhaltliche Verstehen im Fokus steht. Somit wird anhand des inhaltlichen Verständnisses der Erfolg einer Inszenierung gemessen.294
Dieses Muster zeigte sich in den Interviews vor allem daran, dass die gesamte Inszenierung von den meisten Nicht-Akademiker*innen als altmodisch betitelt wurde.295 Obwohl zusätzlich Bilder bei dem Beobachtungsbogen296 zur Öffentlichkeitsarbeit der Inszenierung Maß für Maß zu sehen waren, wurde vor allem aufgrund der Sprache in den Texten die gesamte Inszenierung beurteilt. Demgegenüber fiel es den Akademiker*innen leicht, die Theatersparten, Theaterformen und Autor*innen einzuordnen und zu bewerten.297 Folglich beherrschen die befragten Akademiker*innen einige theaterspezifische Codes und konnten dadurch die Öffentlichkeitsarbeit differenzierter betrachten.
Darüber hinaus wurde der Inhalt der Öffentlichkeitsarbeit von den Akademiker*innen als interessant beschrieben und stellte folglich keine objektbedingte Barriere dar.298 Das Interessensystem der Akademiker*innen stimmte somit mit dem des Thalia Theaters überein, was nach Bourdieu auf eine Homogenität von Produzent*innen und Publikum hinweist.299 Seitens der Nicht-Akademiker*innen wurde die Inszenierung Maß für Maß hingegen als weniger interessant eingeordnet, da unter anderem die eigenen Interessen in dem Stück nicht wiedererkannt wurden.300 Auch Seeck beschreibt, dass die Interessen der Arbeiter*innenklasse im Theater unterrepräsentiert sind und sich im Theater überwiegend mit den Geschichten der Oberklasse befasst wird.301 Dementsprechend stimmten die Interessensysteme von den Nicht-Akademiker*innen und dem Thalia Theater in der Öffentlichkeitsarbeit zu Maß für Maß nicht überein, sodass der Inhalt durchaus als eine objektbedingte Barriere für die Nicht-Akademiker*innen bezeichnet werden kann. Das Übereinstimmen des Interessensystems mit den Akademiker*innen und die Diskrepanzen mit den Nicht- Akademiker*innen entsprechen auch dem Bericht von Twickel über das elitäre Theater- personal.302
Allerdings äußerten auch Akademiker*innen Kritik: Die Kombination von moderner Ästhetik und einem Theaterklassiker in der Darstellung der Öffentlichkeitsarbeit führe zu Verwirrungen. Die Akademiker*innen wünschten sich mehr Transparenz und eine vereinfachte Darstellungsweise.303 Diesen Wunsch teilten auch die Nicht-Akademiker*innen, da auch sie von dem Gefühl berichteten, dass die Öffentlichkeitsarbeit von der Inszenierung Maß für Maß durch die komplexe Darstellung vor allem Akademiker*innen adressiert.304 Ebenso plädiert Renz für mehr Transparenz in der Öffentlichkeitsarbeit an Theatern, da diese für positive Theatererlebnisse sorgt und Zugänge zum Theater öffnen kann. Mit seinen Überlegungen bezieht sich Renz nur auf einzelne Elemente, wie den Titel einer Inszenierung oder den Spielort.305 Da jedoch aus den Ergebnissen der Studie hervorgegangen ist, dass auch die Summe von Irritationen zu grundsätzlichen Verständnisproblemen führen kann, sollte die Transparenz in der Öffentlichkeitsarbeit konsequent gedacht werden.
Insgesamt wird deutlich, dass das Thalia Theater Inhalte verwendet, die vor allem mit dem Wissen und den Interessen der Akademiker*innen übereinstimmen. Zwischen dem Wissen, den Interessen der Nicht-Akademiker*innen und den Inhalten der Öffentlichkeitsarbeit vom Thalia Theater kommt es zu Diskrepanzen. Dadurch wird die Rezeption der Öffentlichkeitsarbeit vor allem für die Nicht-Akademiker*innen schwer.
6.2 Zukunftsansätze der Öffentlichkeitsarbeit vom Thalia Theater
Grundsätzlich schilderten die meisten Befragten in den Interviews, dass sie das Theater interessant finden und sie sich durchaus vorstellen könnten, in Zukunft thematisch ansprechende Inszenierungen zu besuchen. Diese Aussagen tätigten sowohl Aka- demiker*innen als auch Nicht-Akademiker*innen, sodass nach eigenen Aussagen viele Befragte mögliche Theatergänger*innen werden könnten.306 Auch Seeck beschreibt im Interview mit Twickel, dass das Interesse am Theater in allen Klassen vorhanden ist.307 Damit jedoch die Öffentlichkeitsarbeit an Theatern Personen aus allen Klassen erreichen kann, müssen objektbedingte Barrieren bestmöglich unterbunden werden. Als eine Barriere kristallisierte sich der Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit in den Interviews heraus.
Um eine leichtere Rezeption der Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen, sollte das Konzept der einfachen Sprache , welches in Kapitel 2.3 erläutert wurde,308 in allen Ankündigungstexten angewendet werden. In Anlehnung an die Strategien von Drexler sollten darüber hinaus die verfassten Ankündigungstexte in einfacher Sprache reflektiert werden, indem beispielsweise ein nicht-akademisches Personal diese diskutiert und überprüft.309 Es ist von großer Wichtigkeit, dass in den Prozessen im Theater immer wieder Meinungen von Personen eingeholt werden, die aus nicht-akademischen Kontexten stammen, da wie in Kapitel 3.1 beschrieben, das Theaterpersonal oftmals sehr homogen und privilegiert ist.310 Die Gefahr, ein ebenso homogenes Publikum zu adressieren, kann unter Einbezug von Perspektiven von Nicht- Akademiker*innen verringert werden. Beispielsweise hätte das Thalia Theater durch ein solches Vorgehen, das Spiel mit der falschen Trennung von Begriffen hinterfragen können.
Bei der Verwendung der einfachen Sprache sollten jedoch nicht, wie es zur Zeit häufig von Unternehmen gemacht wird, zwei Texte entstehen. Die Unterscheidung von einem Text in einfacher Sprache und in normaler Sprache reproduziert durch die Abstufung ebenso Klassismus. Zudem können bei den Texten in einfacher Sprache künstlerische Elemente bzw. Texte aufgenommen werden, solange diese transparent gestaltet werden. Die Transparenz von Textformen, die auch in den Interviews immer wieder kritisiert wurde,311 kann gewährleistet werden, indem künstlerische Texte mit Kennzeichnungen von einfachen, funktionalen Texten getrennt und abgehoben werden.
Neben den Verständnisproblemen im Sprachgebrauch wurde auch der dargestellte Inhalt zur objektbedingten Barriere. Zum einen wurde die Themenauswahl der Theater, zum anderen die Darstellung der Inhalte kritisiert. Vor allem die Nicht-Akademiker*innen beschrieben in den Interviews, dass die Inhalte komplex wirken und sie deshalb kurze und klare Angaben auf Flyern oder Websiten zum inhaltlichen Verständnis favorisieren würden.312 Dementsprechend sollten neben einem nachvollziehbaren Ankündigungstext, Schlagwörter oder Untertitel aufgeführt werden, die in Kurzform verdeutlichen, worum es in der Inszenierung geht. Dabei sollte in jedem Fall die Verwendung moderner und klassischer Elemente transparent gemacht werden, sodass zeitgenössische Inszenierungen als solche identifiziert werden können. So könnte ein Untertitel zu Maß für Maß zum Beispiel lauten: Shakespeares unterhaltsames Theaterstück wird zur Textgrundlage einer Auseinandersetzung mit den Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie. Darüber hinaus könnten zu jeder Inszenierung Ansprache-Slogans entwickelt werden, die darauf verweisen, wen die Inszenierung thematisch adressiert. In dem Ansprache-Slogan können auch bewusst Begriffe genutzt werden, die sehr umgangssprachlich sind und nach Drexler ebenso Irritationsmomente bezüglich des elitären Theaterimages hervorrufen können313: Maß für Maß ist ein Theaterstück für all diejenigen, denen die Corona-Pandemie gerade so richtig auf den Sack geht.
Ein Programmheft kann ebenfalls zum besseren Verständnis einer Inszenierung beitragen, jedoch sollte das Programmheft transparent aufgebaut sein. Neben der Verwendung von einfacher Sprache und der Abgrenzung zu den künstlerischen Texten scheint es sinnvoll, am Anfang eines Programmheftes weitere Verständnishilfen, wie Inhaltsangaben, Informationen zu den Autor*innen und zur Epoche, aufzuführen. Im Laufe des Programmheftes könnten dann Zitate, wie der Text von Max Weber und tiefergehende Informationen folgen. Eine solche Aufbereitung würde signalisieren, dass auch Personen, die weniger inkorporiertes Kulturkapital besitzen im Theater willkommen sind und dass die Theaterschaffenden keinen höheren Bildungsabschluss für die Rezeption der Inszenierung voraussetzen.
In diesem Kapitel konnten ausschließlich Vorschläge aufgeführt werden, wie das Theater die Barrieren des Sprachgebrauches der Öffentlichkeitsarbeit weiterdenken kann. Für weitere Auseinandersetzungen zur Vermeidung von Klassismus im Kulturbetrieb soll an dieser Stelle auf die Internetseite zum Kulturkodex Manifest314 verwiesen werden, welche unter anderem durch die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit beeinflusst wurde.315
6.3 Limitationen der Studie
Die Intention der Studie war es, beispielhafte Szenarien aufzuzeigen. Repräsentative Ergebnisse sollten nicht präsentiert werden. Folglich gilt es zu beachten, dass durch den Umfang der Studie lediglich ein Einblick zum Thema Klassismus in der Öffentlichkeitsarbeit von Theatern gegeben wurde. Für repräsentative Forschungsergebnisse bedarf es weiterer Untersuchungen zu diesem Thema und die Ergebnisse dieser qualitativen Forschung sollten weiterführend durch eine quantitative Untersuchung überprüft werden.
Um Klassismus im Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit von Theaterhäusern differenziert zu betrachten, müssen weitere Inszenierungen vom Thalia Theater auf einen klassistischen Sprachgebrauch überprüft und die Öffentlichkeitsarbeit weiterer Theaterhäuser untersucht werden. Je höher die Anzahl befragter Proband*innen und untersuchter Texte der Öffentlichkeitsarbeit von verschiedenen Theatern, desto repräsentativer und aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Wenn mehr Forschung in diesem Bereich betrieben wird, können klassistische Strukturen im Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit am Theater, die sich bereits in dieser Arbeit angedeutet haben, gezielt unterbunden werden. Somit könnte ein Theater geschaffen werden, das die Menschen gleichermaßen und unabhängig von der sozialen Herkunft zur Kunst-Rezeption einlädt.
Darüber hinaus muss auch die Forschung zum Thema Klassismus hinterfragt und weitergedacht werden. Bereits beim Anfragen der Proband*innen zeigte sich, dass seitens vieler Nicht-Akademiker*innen Selbstzweifel in Bezug auf das Interview auftraten. Während sich die angefragten Akademiker*innen direkt bereit erklärten ein Interview zu geben, sagten zwei Nicht-Akademiker*innen ab und weitere zweifelten an dem Interview.316 Dementsprechend scheinen schon die Form der Datenerhebung und die Begriffe, wie Studie oder Interview, derart akademisch besetzt, sodass es als zu anspruchsvoll und abschreckend auf einige Nicht-Akademiker*innen wirken kann. Es wird deutlich, wie tief Klassismus in den Strukturen verwurzelt ist und dass eine Studie zur Sichtbarmachung von Klassismus ebenso klassistische Strukturen reproduziert. Die große Problematik nach Kemper und Weinbach, dass die Diskurssysteme und die wissenschaftliche Forschung klassistisch aufgebaut sind, stellt die Nicht-Akademiker*innen somit bereits vor Barrieren. Beispielsweise wurde in dieser Arbeit auch das Einfordern von Kritik zur Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß zur Barriere für Nicht-Akademiker*innen, da das Äußern von Kritik immer auch mit Wissen und Selbstvertrauen einhergeht. Folglich sollten für zukünftige Forschungen im Bereich Klassismus die bestehenden Formen der Datenerhebung genau hinterfragt und gegebenenfalls antiklassistische Formate entwickelt werden. Es gilt in der Zukunft zu klären, wie Forschungen im Bereich Klassismus funktionieren können, ohne dass Klassismus reproduziert wird.
Des Weiteren sollte in zukünftigen Klassismus-Untersuchungen neben den Kategorien Akademiker*innen und Nicht-Akademiker*innen, auch die Kategorie der Erst- Akademiker*innen hinzugezogen werden. Im Laufe der Interviews wurde ersichtlich, dass der Interviewpartner mA57 ein Arbeiter*innenkind ist und in erster Generation seiner Familie studiert hat. Dadurch nahm er in dem Interview die Perspektive des Akademikers ein, aber reflektierte auch immer wieder die Position seiner Familie und damit die Perspektive der Nicht-Akademiker*innen. Dies unterstützte die Erkenntnisse dieser Auseinandersetzung sehr. Wenn ein Interview gezielt auf Erst-Akademiker*innen ausgerichtet wird, können diese Zwischenpositionen und die subjektiven Gegenüberstellungen besonders erkenntnisreich sein.
Zu guter Letzt müssen in weiteren Forschungen zum Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit von Theatern auch die intersektionalen Zusammenhänge genauer untersucht werden. Die intersektionale Perspektive bzw. die Diskriminierungsformen Sexismus und Rassismus wurden bei der offen gestellten Frage in den Interviews von keiner der befragten Personen thematisch aufgegriffen. Somit spielt Intersektionalität vor allem bei der Auswahl der Interviewpartner*innen dieser Arbeit eine Rolle, jedoch wird die intersektionale Perspektive in den Aussagen der Interviewpartner*innen nicht explizit erkannt. Da in den Interviews von den Studienteilnehmer*innen auf weitere Diskriminierungen nicht eingegangen wurde, sollten gezielt Fragen zu den einzelnen Formen gestellt werden, sodass herausgefunden werden kann, inwiefern die verschiedenen Diskriminierungen einander beeinflussen.
7. Schlusswort
Die vorliegende Arbeit verfolgte das Ziel, den Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß des Thalia Theaters in Hamburg zu betrachten und auf die Zugänglichkeit für Nicht-Akademiker*innen zu prüfen. Nach der theoretischen Grundlage zum Klassismus in der Sprache und im Theater wurde sich daher mit der Fragestellung Inwieweit erschwert der Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß den Zugang zum Thalia Theater für Nicht-Akademiker*innen? auseinandergesetzt. Zur Beantwortung der Fragestellung wurde eine empirische Fallstudie durchgeführt. Aufbauend auf ausgewählten Elementen der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß konnten Interviews mit jeweils fünf Nicht-Akademiker*innen und Akademiker*innen geführt und als Fallbeispiele analysiert werden. Die Gruppe der Akademiker*innen diente als Kontrollgruppe, sodass folgende Interpretationsergebnisse hinsichtlich der Fragestellung zusammengefasst werden können:
Zusammenfassung zu den Unverständlichkeiten hinsichtlich der Begriffe und der Ausdrucksform:
- Die Texte der Öffentlichkeitsarbeit verursachten bei Nicht-Akademiker*innen vor allem durch Fremdwörter und ausgewählte Begriffe, welche stückspezifisch oder theaterspezifisch waren, Rezeptionsprobleme. Akademiker*innen waren die stück- und theaterspezifischen Begriffe unbekannt, allerdings konnten sie diese im Gegensatz zu den Nicht-Akademiker*innen kontextualisieren und dadurch besser verstehen.
- Das spielerische Element der falschen Trennung von Begriffen konnte ausschließlich von Nicht-Akademiker*innen nicht decodiert werden, sodass Verwirrungen und ein niedriges Selbstwertgefühl bei ihnen ausgelöst wurden.
- Die Ausdrucksform der Öffentlichkeitsarbeit gezielt zu kritisieren und die Probleme zu verorten, fiel Nicht-Akademiker*innen im Vergleich zu Akademiker*innen schwer, sodass es des Öfteren zu widersprüchlichen Aussagen kam.
- Verständnisprobleme projizierten Nicht-Akademiker*innen daher vor allem auf ihr eigenes Können und kritisierten bei Rezeptionsproblemen sich selbst und nicht wie Akademiker*innen die Ausdrucksform der Öffentlichkeitsarbeit. Durch die Projektion des eigenen Versagens zeigten Nicht-Akademiker*innen bereits verinnerlichten Klassismus, der durch den spielerischen Umgang mit Sprache der Öffentlichkeitsarbeit verstärkt wurde.
- Anhand der Fremdwörter, der ausgewählten Begriffe und des spielerischen Umgangs mit den Regeln der Rechtschreibung können in den Texten der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß Parallelen zu Bourdieus „Strategie der Herablassung“317 gezogen werden. Nicht-Akademiker*innen wurde, neben den Unverständlichkeiten, zusätzlich durch den spielerischen Umgang mit Sprache ein unterlegenes und abwertendes Gefühl vermittelt, wodurch der Zugang zu einem möglichen Theaterbesuch erheblich erschwert wurde.
Zusammenfassung zu den inhaltlichen Barrieren:
- Für Nicht-Akademiker*innen waren die Unterscheidung der Sparten, der Theaterformen und die Einordnung der Autor*innen in der Gegenüberstellung schwer. Bei Fragen nutzten Nicht-Akademiker*innen ihr Wissen aus Filmen und übertrugen dies auf das Theater. Es zeigte sich, dass Akademiker*innen auf mehr kulturelles Kapital bei der inhaltlichen Einordnung der Öffentlichkeitsarbeit zurückgreifen konnten.
- Durch die vielen unterschiedlichen Codierungsanforderungen, wie die Einordnung der Theaterform, der Ästhetik der Bilder oder des Autors von Maß für Maß, wurden Nicht- Akademiker*innen überfordert, sodass sie die Inszenierung ausschließlich anhand der verwendeten Sprache beurteilten und als altmodisch bezeichneten. Akademiker*innen konnten die theaterspezifischen Codes weitestgehend kontextualisieren und dadurch die Öffentlichkeitsarbeit differenzierter betrachten.
- Thematisch fanden die meisten Nicht-Akademiker*innen die Texte der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß uninteressant, da sie ihre Interessen nicht repräsentiert sahen. Demgegenüber wurden die Texte von Akademiker*innen als inhaltlich interessant beschrieben, sodass eine Übereinstimmung des Interessensystems ausschließlich zwischen dem Thalia Theater und Akademiker*innen vorliegt.
- In der Darstellungsweise von Texten der Öffentlichkeitsarbeit wird sich von Nicht- Akademiker*innen und Akademiker*innen mehr Transparenz gewünscht. Der Wunsch manifestierte sich bei Nicht-Akademiker*innen durch das Gefühl, dass durch die komplexen Inhalte der Texte vor allem Akademiker*innen adressiert werden sollen. Einige Akademiker*innen wiederum waren durch die Kombination von moderner Ästhetik und dem Theaterklassiker verwirrt. Daher sollte dies transparent gemacht werden.
Zusammenfassung zu den Zukunftsansätzen der Öffentlichkeitsarbeit:
- Damit der Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit in Zukunft besser rezipiert und die „Strategie der Herablassung“318 vermieden werden kann, sollte in allen Ankündigungstexten das Konzept der einfachen Sprache verwendet werden.
- Neben dem Konzept der einfachen Sprache sollte die Öffentlichkeitsarbeit unter Einbezug der Perspektiven von Nicht-Akademiker*innen entstehen bzw. von ihnen kontrolliert werden, damit ein klassistischer Sprachgebrauch oder klassistische Elemente unterbunden werden können und auch Nicht-Akademiker*innen adressiert werden.
- Ebenso sollten die Texte der Öffentlichkeitsarbeit transparent gestaltet sein, sodass durch wiederkehrende Kennzeichnungen entnommen werden kann, ob es sich beispielsweise um einen künstlerischen Text, also einen Auszug aus dem Stück oder um allgemeine Informationen zur Inszenierung handelt.
- Zur inhaltlichen Orientierung sollten Schlagwörter oder Untertitel in der Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden, die in Kurzform die Inhalte der Inszenierung verdeutlichen. Hierbei soll insbesondere transparent gemacht werden, inwiefern die Inszenierung moderne und klassische Elemente aufgreift.
- Außerdem könnten Ansprache-Slogans für jede Inszenierung formuliert werden. Mit Hilfe dessen kann veranschaulicht werden, für welche Personen die Inszenierung thematisch interessant sein könnte. Darüber hinaus bieten die Slogans die Möglichkeit, Umgangssprache gezielt zu nutzen und dadurch spannende Irritationsmomente hervorzurufen.
- Die Programmhefte können auch weiterführende Aufklärung zur Inszenierung betreiben. So könnten zu Beginn eines Programmheftes beispielsweise Verständnishilfen, wie Inhaltsangaben und Informationen zur Epoche und den Autor*innen, aufgeführt werden. Im weiteren Verlauf des Programmheftes können dann tiefergreifende Informationen folgen.
Abschließend lässt sich zur Untersuchung des Sprachgebrauches der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß dieser Arbeit festhalten, dass die Rezeption der Texte für Nicht-Akademiker*innen durch die Kombination von unbekannten Begriffen, langen Sätzen, sprachlichem Spiel und theaterspezifischem Wissen erschwert wurde. Besonders problematisch ist, dass die Nicht-Akademiker*innen die Verständnisprobleme vor allem auf eigenes Versagen zurückführten, sodass bereits verinnerlichter Klassismus verstärkt wurde. Infolge des ausgelösten Gefühls, zu ungebildet für die Rezeption der Öffentlichkeitsarbeit zu sein, wurde eine Distanz zum Thalia Theater aufgebaut. Keine*r der befragten Nicht- Akademiker*innen wurde aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit zur Inszenierung Maß für Maß zu einem Theaterbesuch angeregt. Damit Nicht-Akademiker*innen in Zukunft ebenso vom Theater adressiert werden können, muss an der Transparenz und Zugänglichkeit von Texten der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet werden.
Dergleichen muss auch das Studiendesign der Arbeit überdacht und reflektiert werden. Weitere Untersuchungen zu unterschiedlichen Inszenierungen und an verschiedenen Theaterhäusern sind für allgemeingültigere Aussagen nötig. Darüber hinaus sollte der Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit in nachfolgenden Forschungen gezielt intersektional untersucht werden. Außerdem scheint es überlegenswert, eine weitere Gruppe, bestehend aus Akademiker*innen in erster Generation, zu dem Thema zu befragen. Besonders wichtig ist es, Forschungen im Bereich Klassismus weiterzudenken. Die Studie der vorliegenden Arbeit zeigt, dass bereits die Form der Datenerhebung Selbstzweifel bei den Nicht-Akademiker*innen hervorrief, weil Klassismus in den Strukturen der Forschung tief verwurzelt ist. Um antiklassistische Forschung betreiben zu können, müssen die bestehenden Formen von Datenerhebungen reflektiert und weitergedacht werden. Schließlich können auch Institutionen wie das Theater nur vollumfassend auf Klassismus analysiert werden, wenn für die marginalisierten Studienteilnehmer*innen ein uneingeschränkter, diskriminierungsfreier Forschungsraum geschaffen wird.
Obwohl der Weg zu diskriminierungsfreien Räumen noch weit ist, bedeuten die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit für mich, dass an der Zugänglichkeit von Theatern mit ganz unterschiedlicher Reichweite weitergearbeitet werden kann. Ich möchte mich in meiner Arbeit als Künstlerin und Pädagogin immer erneut hinterfragen und mit Nicht- Akademiker*innen in den Austausch treten. Die Zukunftsansätze, die aus dieser Arbeit resultierten, werde ich beim Verfassen der Ankündigungstexte für mein Performance- Kollektiv rio.rot319 oder auch für320 theaterpädagogische321 Inszenierungen322 wie eine323 Checkliste betrachten324 und weiterdenken.
8. Literaturverzeichnis
Annoff, Michael; Demir, Nuray: Showcase im Splitscreen. Videobotschaften an die Dominanzkultur. In: Impulse Thearter Festival (Hrsg.): Lernen aus dem Lockdown. Nachdenken über freies Theater. Berlin 2020.
Baumert, Andreas: Einfache Sprache in Zeiten des Wandels. Zur Notwendigkeit einer verständlichen Wissenschaft. Wiesbaden 2019.
Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 27. Auflage. Frankfurt am Main 2020.
Bourdieu, Pierre: Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: Kreckel, Reinhard (Hrsg.): Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt. Sonderband 2. Göttingen 1983.
Bublitz, Hannelore: Ich gehöre irgendwie so nirgends hin. Arbeitertöchter an der Hochschule. Giessen 1980.
Bunch, Charlotte; Myron, Nancy (Hrsg.): Class and Feminism. A Collection Of Essays From The Furies. Baltimore 1974.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Elterngeld, ElterngeldPlus und Elternzeit. Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. 23. Auflage. Berlin 2020.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Gender Care Gap - ein Indikator für die Gleichstellung. Kindererziehung, Pflege von Angehörigen, Hausarbeit, Ehrenamt: Frauen wenden pro Tag im Durchschnitt 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer. Dieser Unterschied wird als „Gender Care Gap" bezeichnet. URL: <https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/gender-care-gap/indikator-fuer-die-gleichstellung/gender-care-gap-ein-indikator-fuer-die-gleichstellung-137294> (24.08.2021).
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Hier geht es um das Eltern-Geld, das Eltern-Geld-Plus und die Eltern-Zeit. 5. Auflage. Berlin 2020.
Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Die Pisa Studie. Ein Interview mit Prof. Dr. Marcel Helbig. URL: <https://www.bpb.de/mediathek/304215/die-pisa-studie> (24.08.2021).
Crenshaw, Kimberle: Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. In: Chicago Unbound (Hrsg.): University of Chicago Legal Forum. Chicago 1989.
Drexler, Anita: Klassismus und Sprache. In: Seeck, Francis; Theißl, Brigitte (Hrsg.): Solidarisch gegen Klassismus. Organisieren, intervenieren und umverteilen. Münster 2020.
Dröscher, Daniela: Zeige deine Klasse. Die Geschichte meiner sozialen Herkunft. Hamburg 2018.
Dröscher, Daniela: Zeige deine Klasse. Soziale Herkunft und freies Theater. In: Impulse Thearter Festival (Hrsg.): Lernen aus dem Lockdown? Nachdenken über freies Theater. Berlin 2020.
Dzubilla, Anael: Was ist eigentlich... FLINTA*? URL: https://frauenseiten.bremen.de/blog/was-ist-eigentlich-flinta/> (24.08.2021).
European Commission: European Cultural Values. In: Special Eurobarometer (2007), H. 278: S. 17.
Frank, Bernwald; Maletzke, Gerhard; Müller-Sachse, Karl H.: Kultur und Medien. Angebote - Interessen - Verhalten. Eine Studie der ARD/ZDF-Medienkommission. BadenBaden 1991.
Frankfurter Allgemeine (Hrsg.): Rassismus ist ein Virus. URL: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nach-tod-von-george-floyd-proteste-gegen- rassismus-in-europa-16805010.html> (24.08.2021).
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Klassismus. Eine Bestandsaufnahme. Erfurt 2016.
Fuß, Susanne; Karbach, Ute: Grundlagen der Transkription. 2. Auflage. Opladen, Toronto 2019.
Ghormesabzi, Pantea; Freitag, Kim (u.a.): Pluralität & Teilhabe im Kulturbetrieb. Repräsentation von marginalisierten Gruppen (AK/AH, BPoC, FLINTA*, Menschen mit Behinderung etc.) und gleichberechtigte Ressourcen-Umverteilung im Kulturbetrieb. URL: <https://kulturkodex.tumblr.com> (30.09.2021).
Gl ück, Helmut (Hrsg.): Metzler Lexikon Sprache. 4. Auflage. Stuttgart, Weimar 2010.
Hamade, Houssam: Eng verwandt. Linke denken Klassenverhältnisse nicht genügend mit. Denn Klassenausbeutung und Rassismus greifen ineinander und sind keine Gegensätze. URL: <https://taz.de/Rassismus-und-Klassismus/!5706370/> (25.08.2021).
Helfferich, Cornelia: Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews. 4. Auflage. Wiesbaden 2011.
Karabulut, Pinar: Augenhöhe. In: Barankow, Maria; Baron, Christian (Hrsg.): Klasse und Kampf. Berlin 2021.
Kellermann, Gudrun: Leichte und Einfache Sprache - Versuch einer Definition. URL: <https://www.bpb.de/apuz/179341/leichte-und-einfache-sprache-versuch-einer-definition> (25.08.2021).
Kemper, Andreas; Weinbach, Heike: Klassismus. Eine Einführung. 3. Auflage. Münster 2020.
Klein, Hans-Joachim; Bachmayer, Monika; Satz, Helga: Museum und Öffentlichkeit. Fakten und Daten, Motive und Barrieren. Berlin 1981.
Kim-Heinrich, Hyun-Suk: Lebensstil und Ästhetik in der Kulturtheorie Georg Simmels. Theoretische Beiträge zur Auseinandersetzung mit der Kultursoziologie Pierre Bourdieus. Bielefeld 2012.
Kuckartz, Udo: Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 4. Auflage. Weinheim, Basel 2018.
Kürthy, Stephan: Faulster Arbeitsloser jubelt - Jetzt gibt’s Hartz IV auf dem Silbertablett. URL: <https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/kaum-noch-sanktionen-deutschlands-faulster-arbeitsloser-hartz-iv-auf-dem-silbert- 65867524,view=conversionToLogin.bild.html> (25.08.2021).
Madler, Undine: Lockdown verstärkt Nachteile einiger Schüler. Die durch die CoronaPandemie verursachten veränderten Schulbedingungen wirken sich insbesondere bei ohnehin benachteiligten Schülergruppen nochmals nachteilig aus, sagen Experten. URL: <https://www.weser-kurier.de/region/wuemme-zeitung_artikel,-lockdown-verstaerkt- nachteile-einiger-schueler-_arid,1943609.html> (24.08.2021).
Mayring, Phillip: Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken. Weinheim, Basel 2002.
Meulenbelt, Anja: Scheidelinien. Über Sexismus, Rassismus und Klassismus. Reinbek 1988.
Misoch, Sabina: Qualitative Interviews. Berlin 2015.
Müller, Hans-Peter: Pierre Bourdieu. Eine systematische Einführung. 3. Auflage. Berlin 2019.
Ogette, Tupoka: Referenzen. URL: <https://www.tupoka.de/booking/> (25.08.2021).
Paterno, Petra: Bildungsbürger unter sich? Ein Gespräch mit Francis Seeck und Julischka Stengele über Klassismus in der Kunst und die vergessenen Benachteiligungen. URL: <https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/buehne/2101585-Welche-Folgen-hat-der- bildungsbuergerliche-Habitus-in-Kultureinrichtungen.html?fbclid=IwAR1DB1CqCmAekvZLFT8XeoGjyGeQIEGa2EiGDj2qMN Fa59SxACQSXBJEAMc> (25.08.2021).
Poscheschnik, Gerald; Hug, Theo: Empirisch forschen. Studieren, aber richtig. 2. Auflage. Wien 2015.
Quenzel, Gudrun; Hurrelmann, Klaus (Hrsg.): Bildungsverlierer. Neue Ungleichheiten. Wiesbaden 2010.
Renz, Thomas: Nicht-Besucher-Forschung. Die Förderung kultureller Teilhabe durch Audience Development. Bielefeld 2016.
Ripper, Kirsten: „Sanfter Riese" oder „high" - Wer war George Floyd? URL: <https://de.euronews.com/2021/04/02/sanfter-riese-oder-krimineller-wer-war-george-floyd> (25.08.2021).
Rubin, Gayle: The Traffic in Women. Noten on the „Political Economy“ of Sex. In: Reiter, Rayna (Hrsg.): Toward an Anthropology. New York/London 1975.
Schäfer, Philipp: Klassismus - (k)ein Thema für die Soziale Arbeit?! In: Seeck, Francis; Theißl, Brigitte (Hrsg.): Solidarisch gegen Klassismus. Organisieren, intervenieren und umverteilen. Münster 2020.
Saner, Philippe; Vögele, Sophie; Vessely, Paulin e: Schlussbericht Art.School.Differences. Researching Inequalities and Normativites in the Field of Higher Art Education. Zürich 2016.
Seeck, Francis; Theißl, Brigitte: „Klassismus vermischt sich oft mit Rassismus“. Ein schriftliches Interview mit Minoas Andriotis über Klassismus in der Linker und Strategien für eine breite politische Organisierung. In: Seeck, Francis; Theißl, Brigitte (Hrsg.): Solidarisch gegen Klassismus. Organisieren, intervenieren und umverteilen. Münster 2020.
Seeck, Francis; Theißl, Brigitte (Hrsg.): Solidarisch gegen Klassismus. Organisieren, intervenieren und umverteilen. Münster 2020.
Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Erwerbsquoten und Erwerbstätigenquoten alte und neue Bundesländer nach Geschlecht 1960 - 2019. In % der Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren. URL: <https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/tabIV31 .pdf> (24.08.2021).
Syrda, Joanna: Husbands’ stress increases if wives earn more than 40 per cent of household income - new research. Study of US data shows persistent social norms about male breadwinning can harm men’s health. URL:https://www.bath.ac.uk/announcements/husbands-stress-increases-if-wives-earn-more- than-40-per-cent-of-household-income-new-research/> (24.08.2021).
Terkessidis, Mark: Alte Strukturen und neue Bedürfnisse. Interkulturelle Herausforderungen für den Kulturbetrieb der Zukunft. In: dramaturgie. Zeitschrift der Dramaturgischen Gesellschaft (2011), S. 15-18.
Thalia Theater (Hrsg.): Maß für Maß. URL: <https://www.thalia-theater.de/stueck/mass-fuer- mass-2020> (14.09.2021).
Twickel, Christoph: „Wenns im Theater um Armut geht, trägt oft wer ein Feinripp-Shirt.“ Woher kommen Armutzsklischees und bildungsbürgerlicher Habitus in der Kulturszene? Die Performerin Verena Brakonier und die Anthropolog*in Francis Seeck im Interview. URL: <https://www.zeit.de/hamburg/2021-04/klassismus-kunstszene-bildungsbuergertum-verena- brakonier-francis-seeck> (25.08.2021).
Wasenmüller, Julia: Migrantische Selbstorganisation gegen Klassismus und Rassismus. In: Seeck, Francis; Theißl, Brigitte (Hrsg.): Solidarisch gegen Klassismus. Organisieren, intervenieren und umverteilen. Münster 2020.
Winker, Gabriele; Degele, Nina: Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten. 2009 Bielefeld.
Anhang 1 - Leitfadeninterview
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 2 - Beobachtungsbogen
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Quelle des Beobachtungsbogens: Thalia Theater (Hrsg.): Maß für Maß. URL: <https://www.thalia-theater.de/stueck/mass-fuer-mass-2020> (14.09.2021).
Anhang 3 - Tabellarische Übersicht des Codierungssystems der Inhaltsanalyse
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 4 - Transkribierte Interviews
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 5 - Anfragen Interviews
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Madler, Undine: Lockdown verstärkt Nachteile einiger Schüler. Die durch die Corona-Pandemie verursachten veränderten Schulbedingungen wirken sich insbesondere bei ohnehin benachteiligten Schülergruppen nochmals nachteilig aus, sagen Experten. URL: <https://www.weser- kurier.de/region/wuemme-zeitung_artikel,-lockdown-verstaerkt-nachteile-einiger-schueler- _arid,1943609.html> (24.08.2021).
2 Bourdieu, Pierre: Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: Kreckel, Reinhard (Hrsg.): Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt. Sonderband 2. Göttingen 1983: S. 183.
3 Vgl. ebd.
4 Der OECD gehören an: Australien, Belgien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Korea, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türke, Ungarn, Vereinigte Staaten. Vgl. OECD: Mitgliedsländer. URL: <https://www.oecd.org/ueber- uns/mietglieder-und-partner/> (07.09.2021).
5 Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Die Pisa Studie. Ein Interview mit Prof. Dr. Marcel Helbig. URL: <https://www.bpb.de/mediathek/304215/die-pisa-studie> (24.08.2021).
6 Vgl. Seeck, Francis; Theißl, Brigitte (Hrsg.): Solidarisch gegen Klassismus. Organisieren, intervenieren und umverteilen. Münster 2020: S.11.
7 Vgl. ebd.: S. 12.
8 Kürthy, Stephan: Faulster Arbeitsloser jubelt - Jetzt gibt’s Hartz IV auf dem Silbertablett. URL: <https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/kaum-noch-sanktionen-deutschlands-faulster- arbeitsloser-hartz-iv-auf-dem-silbert-65867524,view=conversionToLogin.bild.html> (25.08.2021).
9 Vgl. Seeck, Francis; Theißl, Brigitte 2020: S. 18.
10 Vgl. Kemper, Andreas; Weinbach, Heike: Klassismus. Eine Einführung. 3. Auflage. Münster 2020: S. 33.
11 Der Begriff Kapital wird im folgenden Kapitel 1.1.2 definiert.
12 Vgl. Seeck, Francis; Theißl, Brigitte 2020: S. 18.
13 Schäfer, Philipp: Klassismus - (k)ein Thema für die Soziale Arbeit?! In: Seeck, Francis; Theißl, Brigitte (Hrsg.): Solidarisch gegen Klassismus. Organisieren, intervenieren und umverteilen. Münster 2020: S.215.
14 Vgl. ebd.
15 Vgl. Seeck, Francis; Theißl, Brigitte 2020: S. 18.
16 Bourdieu, Pierre 1983: S.184.
17 Vgl. Kim-Heinrich, Hyun-Suk: Lebensstil und Ästhetik in der Kulturtheorie Georg Simmels. Theoretische Beiträge zur Auseinandersetzung mit der Kultursoziologie Pierre Bourdieus. Bielefeld 2012: S. 131.
18 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.).
19 Abwärtsmobilität bezeichnet die freie Entscheidung einer Person, eine Tätigkeit in der Gesellschaft auszuüben, die weniger anerkannt ist als die vorherige Arbeit.
20 Vgl. Bunch, Charlotte; Myron, Nancy (Hrsg.): Class and Feminism. A Collection Of Essays From The Furies. Baltimore 1974: 36.
21 Vgl. Seeck, Francis; Theißl, Brigitte 2020: S. 17.
22 Vgl. Kemper, Andreas; Weinbach, Heike 2020: S. 37.
23 Vgl. Bublitz, Hannelore: Ich gehöre irgendwie so nirgends hin. Arbeitertöchter an der Hochschule. Giessen 1980: S. 14.
24 Vgl. ebd.: S.272.
25 Friedrich-Ebert-Stiftung Landesbüro Thüringen (Hrsg.): Klassismus. Eine Bestandsaufnahme. Erfurt 2016: S. 11.
26 vgl. ebd.: S. 11-12.
27 Es werden die englischen Begriffe Women of Color, People of Color, Person of Color benutzt, da es im Deutschen noch keine adäquate und diskriminierungsfreie Übersetzung gibt.
28 Vgl. Crenshaw, Kimberle: Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine. Feminist Theory and Antiracist Politics. In: Chicago Unbound (Hrsg.): University of Chicago Legal Forum. Chicago 1989: S. 144-145.
29 Vgl. ebd.: S. 149.
30 Vgl. Meulenbelt, Anja: Scheidelinien. Über Sexismus, Rassismus und Klassismus. Reinbek 1988: S.124-125.
31 Vgl. Winker, Gabriele; Degele, Nina: Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten. Bielefeld 2009: S. 13.
32 Meulenbelt, Anja 1988: S. 117.
33 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Erwerbsquoten und Erwerbstätigenquoten alte und neue Bundesländer nach Geschlecht 1960 - 2019. In % der Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren. URL: <https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/tabIV31 .pdf> (24.08.2021).
34 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Gender Care Gap - ein Indikator für die Gleichstellung. Kindererziehung, Pflege von Angehörigen, Hausarbeit, Ehrenamt: Frauen wenden pro Tag im Durchschnitt 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer. Dieser Unterschied wird als „Gender Care Gap“ bezeichnet. URL: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/gender-care-gap/indikator-fuer-die- gleichstellung/gender-care-gap-ein-indikator-fuer-die-gleichstellung-137294> (24.08.2021).
35 Vgl. Meulentbelt, Anja 1988: S. 117.
36 Vgl. ebd.: S. 120-121.
37 Vgl. ebd.: S.117.
38 Unter dem Begriff FLINTA* werden cis- F rauen, L esben und i ntergeschlechtliche, n icht-binäre, t ans und a gender Personen zusammengefasst. Vgl. Dzubilla, Anael: Was ist eigentlich... FLINTA*? URL: <https://frauenseiten.bremen.de/blog/was-ist-eigentlich-flinta/> (24.08.2021).
39 Meulenbelt, Anja 1988: S. 118.
40 Vgl. Glück, Helmut (Hrsg.): Metzler Lexikon Sprache. 4. Auflage. Stuttgart, Weimar 2010: S. 635.
41 Ebd.
42 Vgl. Kemper, Andreas; Weinbach, Heike 2020: S. 31.
43 Vgl. Meulenbelt, Anja 1988: S. 63.
44 Vgl. Kemper, Andreas; Weinbach, Heike 2020: S. 31.
45 Quenzel, Gudrun; Hurrelmann, Klaus (Hrsg.): Bildungsverlierer. Neue Ungleichheiten. Wiesbaden 2010: S. 509.
46 Vgl. ebd.
47 Vgl. Meulenbelt, Anja 1988: S. 102 -103.
48 Vgl. Dröscher, Daniela: Zeige deine Klasse. Die Geschichte meiner sozialen Herkunft. Hamburg 2018: S. 22-23.
49 Vgl. Meulenbelt, Anja 1988: S. 104 -105.
50 Ebd.: S. 104.
51 Müller, Hans-Peter: Pierre Bourdieu. Eine systematische Einführung. 3. Auflage. Berlin 2019: S. 17.
52 Vgl. ebd.
53 Vgl. ebd.: S. 308.
54 Vgl. Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 27. Auflage. Frankfurt am Main 2020: S. 397.
55 Ebd.
56 Vgl. ebd.
57 Ebd.: S. 398.
58 Vgl. ebd.: S. 398 - 399.
59 Vgl. Seeck, Francis; Theißl, Brigitte: „Klassismus vermischtsich oft mitRassismus“. Ein schriftliches Interview mit Minoas Andriotis über Klassismus in der Linker und Strategien für eine breite politische Organisierung. In: Seeck, Francis; Theißl, Brigitte (Hrsg.): Solidarisch gegen Klassismus. Organisieren, intervenieren und umverteilen. Münster 2020: S. 181.
60 Ebd.
61 Vgl. Kellermann, Gudrun: Leichte und Einfache Sprache - Versuch einer Definition. URL: <https://www.bpb.de/apuz/179341/leichte-und-einfache-sprache-versuch-einer-definition> (25.08.2021).
62 Unter Leser werden auch alle weiteren Geschlechter verstanden.
63 Baumert, Andreas: Einfache Sprache in Zeiten des Wandels. Zur Notwendigkeit einer verständlichen Wissenschaft. Wiesbaden 2019: S. 40.
64 Vgl. ebd.: S. 40-41.
65 Vgl. Kellermann, Gudrun.
66 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Elterngeld, ElterngeldPlus und Elternzeit. Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. 23. Auflage. Berlin 2020. - vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Hier geht es um das ElternGeld, das Eltern-Geld-Plus und die Eltern-Zeit. 5. Auflage. Berlin 2020.
67 Drexler, Anita: Klassismus und Sprache. In: Seeck, Francis; Theißl, Brigitte (Hrsg.): Solidarisch gegen Klassismus. Organisieren, intervenieren und umverteilen. Münster 2020: S. 259.
68 Drexler, Anita 2020: S. 260.
69 Vgl. ebd.: S. 259-260.
70 Vgl. ebd.: S. 260-261.
71 Ebd.: S. 261.
72 Vgl. ebd.: S. 261-262.
73 Ebd.: S. 263.
74 Vgl. ebd.: S. 262-263.
75 Vgl. Bourdieu, Pierre 2020: S. 397.
76 Vgl. Drexler, Anita 2020: S. 263.
77 Annoff, Michael; Demir, Nuray: Showcase im Splitscreen. Videobotschaften an die Dominanzkultur. In: Impulse Thearter Festival (Hrsg.): Lernen aus dem Lockdown. Nachdenken über freies Theater. Berlin 2020: S. 22.
78 Vgl. Bourdieu, Pierre 2020: S. 368-371.
79 Terkessidis, Mark: Alte Strukturen und neue Bedürfnisse. Interkulturelle Herausforderungen für den Kulturbetrieb der Zukunft. In: dramaturgie. Zeitschrift der Dramaturgischen Gesellschaft (2011): S. 1518.
80 Vgl. Dröscher, Daniela: Zeige deine Klasse. Soziale Herkunft und freies Theater. In: Impulse Thearter Festival (Hrsg.): Lernen aus dem Lockdown? Nachdenken über freies Theater. Berlin 2020: S. 159.
81 Vgl. Saner, Philippe; Vögele, Sophie; Vessely, Pauline: Schlussbericht Art.School.Differences. Researching Inequalities and Normativites in the Field of Higher Art Education. Zürich 2016: S. 24.
82 Vgl. ebd.: S. 409-418.
83 Karabulut, Pinar: Augenhöhe. In: Barankow, Maria; Baron, Christian (Hrsg.): Klasse und Kampf. Berlin 2021: S. 92.
84 Vgl. Twickel, Christoph: ..Wenns im Theater um Armut geht, trägt oft wer ein Feinripp-Shirt.“ Woher kommen Armutzsklischees und bildungsbürgerlicher Habitus in der Kulturszene? Die Performerin Verena Brakonier und die Anthropolog*in Francis Seeck im Interview. URL: <https://www.zeit.de/hamburg/2021-04/klassismus-kunstszene-bildungsbuergertum-verena-brakonier- francis-seeck> (25.08.2021).
85 Vgl. Paterno, Petra: Bildungsbürger unter sich? Ein Gespräch mit Francis Seeck und Julischka Stengele über Klassismus in der Kunst und die vergessenen Benachteiligungen. URL: <https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/buehne/2101585-Welche-Folgen-hat-der-bildungsbuergerliche-Habitus-in-Kultureinrichtungen.html?fbclid=IwAR1DB1CqCmAekvZLFT8XeoGjyGeQIEGa2EiGDj2qMNFa59SxA CQSXBJEAMc> (25.08.2021).
86 Dröscher, Daniela 2020: S. 159.
87 Vgl. ebd.: S. 159-160.
88 Paterno, Petra 2021.
89 Vgl. European Commission: European Cultural Values. In: Special Eurobarometer (2007), H. 278: S. 17.
90 Vgl. Renz, Thomas 2016: S. 146-147.
91 Vgl. Frank, Bernwald; Maletzke, Gerhard; Müller-Sachse, Karl H.: Kultur und Medien. Angebote - Interessen - Verhalten. Eine Studie der ARD/ZDF-Medienkommission. Baden-Baden 1991: S. 217.
92 Vgl. Twickel, Christoph 2021.
93 Vgl. Klein, Hans-Joachim; Bachmayer, Monika; Satz, Helga: Museum und Öffentlichkeit. Fakten und Daten, Motive und Barrieren. Berlin 1981: S. 198.
94 Weitere Informationen zur Inszenierung sind im Beobachtungsbogen zu finden. Vgl. Anhang 2 - Beobachtungsbogen: S. 76-80.
95 Der Sprachgebrauch wird in dieser Untersuchung in Begriffe und Ausdrucksform unterteilt, um differenziertere Ergebnisse zu erhalten. Unter Ausdrucksform werden alle Satzbauten und Sprach- bzw. Schreibstile verstanden.
96 Ebd: S. 77.
97 Poscheschnik, Gerald; Hug, Theo: Empirisch forschen. Studieren, aber richtig. 2. Auflage. Wien 2015: S.103.
98 Vgl. Anhang 1 - Leitfadeninterview: S. 75.
99 Vgl. Misoch, Sabina: Qualitative Interviews. Berlin 2015: S. 66.
100 Vgl. Poscheschnik,Gerald: S. 103.
101 Vgl. Anhang 1 - Leitfadeninterview: S. 75.
102 Vgl. Kuckartz, Udo: Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 4. Auflage. Weinheim, Basel 2018: S. 166.
103 Kuckartz, Udo 2018: S. 167.
104 Vgl. ebd.
105 Fuß, Susanne; Karbach, Ute: Grundlagen der Transkription. 2. Auflage. Opladen, Toronto 2019: S.99.
106 Vgl. Kuckartz, Udo 2018: S. 5.
107 Vgl. Kuckartz, Udo 2018: S. 31-32.
108 Ebd.: S. 146.
109 Vgl. ebd.: S. 143.
110 Vgl. ebd.: S. 97.
111 Vgl. ebd.
112 Ebd.
113 Vgl. Anhang 3 - Tabellarische Übersicht des Codierungssystems der Inhaltsanalyse: S. 81-82.
114 Ebd.: S. 241-241.
115 Vgl. ebd.: S. 242.
116 Vgl. Twickel, Christoph 2021.
117 Dröscher, Daniela 2020: S. 162.
118 Renz, Thomas 2016: S. 130.
119 Vgl. ebd.
120 Ebd.: S. 166.
121 Vgl. ebd.
122 Vgl. ebd.: S. 27.
123 Vgl. ebd.: S. 153-158.
124 Vgl. ebd.: S. 154-155.
125 Vgl. ebd.: S. 139.
126 Vgl. ebd.: S. 141-153.
127 Vgl. Kapitel 2: S. 18.
128 Vgl. European Commission: European Cultural Values. In: Special Eurobarometer (2007), H. 278: S. 17.
129 Vgl. Renz, Thomas 2016: S. 146-147.
130 Vgl. Frank, Bernwald; Maletzke, Gerhard; Müller-Sachse, Karl H.: Kultur und Medien. Angebote Interessen Verhalten. Eine Studie der ARD/ZDF-Medienkommission. Baden-Baden 1991: S. 217.
131 Vgl. Twickel, Christoph 2021.
132 Vgl. Klein, Hans-Joachim; Bachmayer, Monika; Satz, Helga: Museum und Öffentlichkeit. Fakten und Daten, Motive und Barrieren. Berlin 1981: S. 198.
133 Weitere Informationen zur Inszenierung sind im Beobachtungsbogen zu finden. Vgl. Anhang 2 Beobachtungsbogen: S. 76-80.
134 Der Sprachgebrauch wird in dieser Untersuchung in Begriffe und Ausdrucksform unterteilt, um differenziertere Ergebnisse zu erhalten. Unter Ausdrucksform werden alle Satzbauten und Sprachbzw. Schreibstile verstanden.
135 Mayring, Phillip: Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken. Weinheim, Basel 2002: S. 23.
136 Vgl. Helfferich, Cornelia: Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews. 4. Auflage. Wiesbaden 2011: S. 21.
137 Vgl. Anhang 1 Leifadeninterview: S. 75.
138 Vgl. Anhang 2 Beobachtungsbogen: S. 76-80.
139 Vgl. ebd.
140 Vgl. ebd.: S. 80.
141 Ebd: S. 77.
142 Poscheschnik, Gerald; Hug, Theo: Empirisch forschen. Studieren, aber richtig. 2. Auflage. Wien 2015: S. 103.
143 Vgl. Anhang 1 Leitfadeninterview: S. 75.
144 Vgl. Misoch, Sabina: Qualitative Interviews. Berlin 2015: S. 66.
145 Vgl. Poscheschnik,Gerald: S. 103.
146 Vgl. Anhang 1 Leitfadeninterview: S. 75.
147 Vgl. Kuckartz, Udo: Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computeruntersttzung. 4. Auflage. Weinheim, Basel 2018: S. 166.
148 Kuckartz, Udo 2018: S. 167.
149 Vgl. ebd.
150 Fuß, Susanne; Karbach, Ute: Grundlagen der Transkription. 2. Auflage. Opladen, Toronto 2019: S. 99.
151 Vgl. Kuckartz, Udo 2018: S. 5.
152 Vgl. Kuckartz, Udo 2018: S. 31-32.
153 Ebd.: S. 146.
154 Vgl. ebd.: S. 143.
155 Vgl. ebd.: S. 97.
156 Vgl. ebd.
157 Ebd.
158 Vgl. Anhang 3 Tabellarische Übersicht des Codierungssystems der Inhaltsanalyse: S. 81-82.
159 Anhang 4 - Transkribierte Interviews: Abs. 11 (wN75).
160 Ebd.: Abs. 271 (mN32).
161 Ebd.: Abs. 418 (wN30).
162 Ebd.: Abs. 295 (mN32).
163 Ebd.: Abs. 466 (wN25).
164 Ebd.: Abs. 13 (wN75).
165 Ebd.: Abs. 390 (wN30).
166 Vgl. ebd.: Abs. 135 (wN43).
167 Ebd.: Abs. 464 (wN25).
168 Ebd.: Abs. 391 (wN30).
169 Ebd.: Abs. 299 (mN32).
170 Ebd.: Abs. 135 (wN43).
171 Ebd.: Abs. 404 (wN30).
172 Ebd.: Abs. 470 (wN25).
173 Ebd.: Abs. 307 (mN32).
174 Ebd.: Abs. 181 (wN43).
175 Ebd.: Abs. 193 (wN43).
176 Ebd.: Abs. 529 (wA25).
177 Ebd.: Abs. 531 (wA25).
178 Anhang 2 - Beobachtungsbogen: S. 76.
179 Vgl. Forth, Stefan : Obacht vorm Schwedischen Odem! URL:< https://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=18647&Itemid=111 > (25.07.2021).
180 Anhang 4 - Transkribierte Interviews: Abs. 704 (wA69).
181 Ebd. (wA69).
182 Ebd.: Abs. 778 (wA57).
183 Vgl. ebd.: Abs. 782 (wA57).
184 Vgl. ebd.: Abs. 570 (mA24), Abs. 704 (wA69).
185 Vgl. ebd.: Abs. 531 (wA25).
186 Ebd.: Abs. 645 (mA57).
187 Ebd.: Abs. 691 (wA69).
188 Ebd.: Abs. 704 (wA69).
189 Ebd.: Abs. 730 (wA69).
190 Ebd.: Abs. 659 (mA57).
191 Ebd.: Abs. 669 (mA57).
192 Ebd.: Abs. 592 (mA24).
193 Vgl. ebd.: Abs. 537 (wA25); Abs. 838 (wA57); Abs. 738 (wA69).
194 Ebd.: Abs. 836 (wA57).
195 Ebd.: Abs. 460 (wN25).
196 Ebd.: Abs. 275 (mN32).
197 Ebd.: Abs. 394 (wN30).
198 Vgl. ebd.: Abs. 466 (wN25); Abs. 418 (wN30).
199 Ebd.: Abs. 21 (wN75).
200 Ebd.: Abs. 151 (wN43).
201 Ebd.: Abs. 303 (mN32).
202 Ebd.: Abs. 277 (mN32).
203 Ebd.: Abs. 420 (wN30).
204 Ebd.: Abs. 129 (wN43).
205 Ebd.: Abs. 135 (wN43).
206 Ebd.: Abs. 299 (wN32).
207 Ebd.: Abs. 659 (mA57).
208 Vgl. ebd.: Abs. 533 (wA25)
209 Ebd.: Abs. 639 (mA57).
210 Ebd.: Abs. 774 (wA57).
211 Ebd.: Abs. 647 (mA57).
212 Vgl. ebd.: Abs. 570 (mA24).
213 Vgl. ebd.: Abs. 704 (wA69).
214 Ebd.: Abs. 651 (mA57).
215 Ebd.: Abs. 820 (wA57).
216 Ebd.: Abs. 708 (wA69).
217 Ebd.: Abs. 533 (wA25).
218 Ebd.: Abs. 820 (wA57).
219 Ebd.: Abs. 655 (mA57).
220 Ebd.
221 Ebd.: Abs. 726 (wA69).
222 Vgl. ebd: Abs. 79 (wN75); Abs. 127f. (wN43).
223 Ebd.: Abs. 93 (wN75).
224 Ebd.: Abs. 440 (wN25).
225 Ebd.: Abs. 354 (wN30).
226 Ebd.: Abs. 289 (mN32).
227 Ebd.: Abs. 335 (mN32).
228 Ebd.: Abs. 516 (wN25).
229 Ebd.: Abs. 358 (wN30).
230 Ebd.: Abs. 311 (mN32).
231 Ebd.: Abs. 313 (mN32).
232 Ebd.: Abs. 52 (wN75).
233 Ebd.: Abs. 53 (wN75).
234 Ebd.: Abs. 129 (wN43).
235 Ebd.: Abs. 689 (wA69).
236 Ebd.: Abs. 539 (wA25).
237 Vgl. ebd.: Abs. 764 (wA69).
238 Ebd.: Abs. 560 (mA24).
239 Ebd.: Abs. 772 (wA57).
240 Vgl. ebd.: Abs. 810 (wA57); Abs. 846 (wA57).
241 Ebd.: Abs. 635 (mA57).
242 Ebd.: Abs. 289 (mN32).
243 Ebd.: Abs. 341 (mN32).
244 Ebd.: Abs. 414 (wN30).
245 Ebd.: Abs. 201 (wN43).
246 Ebd.: Abs. 285 (mN32).
247 Vgl. ebd.: Abs. 130 (wN43); 177 (wN43); 327 (mN32).
248 Vgl. ebd.: Abs. 19 (wN75); Abs. 173 (wN43); 303 (mN32); 370 (wN30); 478 (wN25).
249 Ebd.: Abs. 317 (wN32).
250 Ebd.: Abs. 83 (wN75).
251 Ebd.: Abs. 207 (wN43).
252 Ebd.: Abs. 508 (wN25).
253 Ebd.: Abs. 746 (wA69).
254 Vgl. ebd.
255 Ebd.: Abs. 840 (wA57).
256 Ebd.: Abs. 704 (wA69).
257 Ebd.: Abs. 547 (wA25).
258 Ebd.: Abs. 584 (mA24).
259 Ebd.: Abs. 657 (mA57).
260 Vgl. ebd.
261 Ebd.: Abs. 651 (mA57).
262 Ebd.: Abs. 673 (mA57).
263 Vgl. ebd.: Abs. 673 (mA57); Abs. 844 (wA57); Abs. 553 (wA25).
264 Ebd.: Abs. 679 (mA57).
265 Ebd.: Abs. 119 (wN43).
266 Ebd.: Abs. 71 (wN75).
267 Vgl. ebd.: Abs. 65 (wN75).
268 Ebd.: Abs. 67 (wN75).
269 Ebd.: Abs. 500 (wN25).
270 Ebd.: Abs. 207 (wN43).
271 Ebd.: Abs. 209 (wN43).
272 Ebd.: Abs. 502 (wN25).
273 Ebd.: Abs. 418 (wN30).
274 Ebd.: Abs. 523 (wA25).
275 Ebd.: Abs. 685 (wA69).
276 Ebd.: Abs. 541 (wA25).
277 Ebd.: Abs. 608 (mA24).
278 Ebd.: Abs. 748 (wA69).
279 Ebd.: Abs. 598 (mA24).
280 Ebd.: Abs. 844 (wA57).
281 Ebd.: Abs. 671 (mA57).
282 Bourdieu, Pierre 2020: S. 397.
283 Vgl. ebd.
284 Ebd.
285 Vgl. Kapitel 5.1: S. 40.
286 Vgl. ebd.: S. 41.
287 Vgl. Bourdieu, Pierre 2020: S. 398-399.
288 Ebd: S. 397.
289 Vgl. Kapitel 5.2: S. 45.
290 Vgl. Bourdieu, Pierre 2020: S. 398.
291 Vgl. Bourdieu, Pierre 1983: S. 191.
292 Vgl. Bublitz, Hannelore 1980: S. 14.
293 Vgl. Kapitel 5.2: S. 45-46.
294 Vgl. Meulenbelt, Anja 1988: S. 104.
295 Vgl. Seeck, Francis; Theißl, Brigitte 2020: S. 18.
296 Vgl. Kapitel 5.3: S. 48-49.
297 Vgl. Bourdieu, Pierre 2020: S. 19.
298 Vgl. Renz, Thomas 2016: S. 236-239.
299 Vgl. Kapitel 5.3: S. 48.
300 Vgl. Anhang 2 - Beobachtungsbogen: S. 76.
301 Vgl. Kapitel 5.3: S. 49.
302 Vgl. Kapitel 5.4: S. 51.
303 Vgl. Bourdieu, Pierre 2020: S. 368-371.
304 Vgl. Kapitel 5.4: S. 49.
305 Vgl. Paterno, Petra 2020.
306 Vgl. Twickel, Christoph 2020.
307 Vgl. Kapitel 5.4: S. 52.
308 Vgl. ebd.
309 Vgl. Renz, Thomas 2016: S. 241-242.
310 Vgl. Kapitel 5.5: S. 53-54.
311 Vgl. Twickel, Christoph 2021.
312 Vgl. Kapitel 2.3: S. 18-19.
313 Vgl. Drexler, Anita 2020: S. 263.
314 Vgl. Kapitel 3.1: S. 22-23.
315 Vgl. Kapitel 5.4: S. 52.
316 Vgl. Kapitel 5.5: S. 56.
317 vgl. Anhang 5 - Anfragen Interviews: S. 190.
318 Vgl. Drexler, Anita 2020: S. 259.
319 Vgl. Ghormesabzi, Pantea; Freitag, Kim (u.a.): Pluralität & Teilhabe im Kulturbetrieb. Repräsentation von marginalisierten Gruppen (AK/AH, BPoC, FLINTA*, Menschen mit Behinderung etc.) und gleichberechtigte Ressourcen-Umverteilung im Kulturbetrieb. URL: <https://kulturkodex.tumblr.com> (30.09.2021).
320 Vgl. ebd.: Über uns.
321 vgl. Anhang 5 - Anfragen Interviews: S. 190.
322 Bourdieu, Pierre 2020: S. 397.
323 Ebd.
324 Weitere Informationen zum Performance-Kollektiv rio.rot unter riorot.de.
Details
- Titel
- Von den Nicht-Akademiker*innen zu den Nicht-Besucher*innen des Theaters
- Untertitel
- Eine empirische Untersuchung zu Klassismus im Sprachgebrauch der Öffentlichkeitsarbeit am Beispiel der Inszenierung "Maß für Maß" des Thalia Theaters
- Hochschule
- Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Institut für Performative Künste und Bildung)
- Note
- 1.0
- Autor
- Catharina Koch (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 196
- Katalognummer
- V1557558
- ISBN (Buch)
- 9783389107140
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Klassismus, Theater
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 46,99
- Arbeit zitieren
- Catharina Koch (Autor:in), 2021, Von den Nicht-Akademiker*innen zu den Nicht-Besucher*innen des Theaters, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1557558
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-