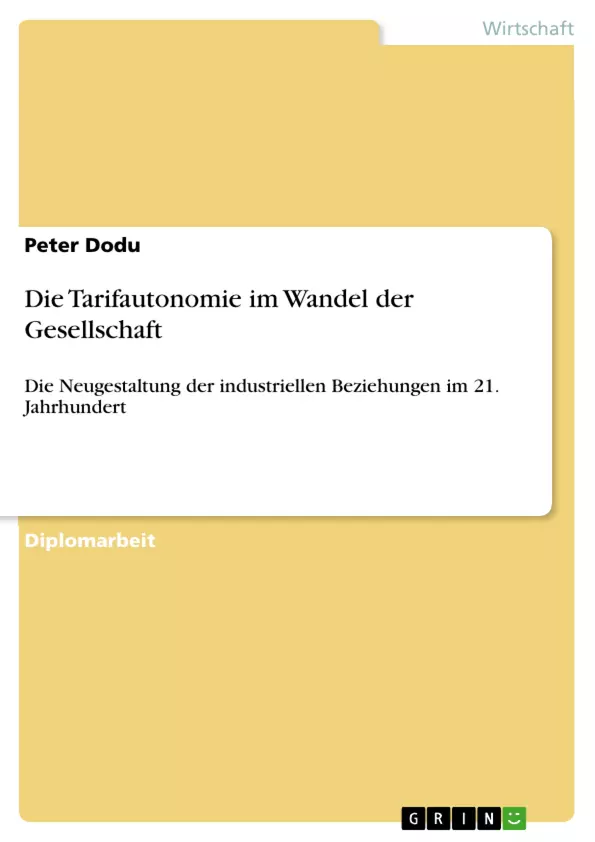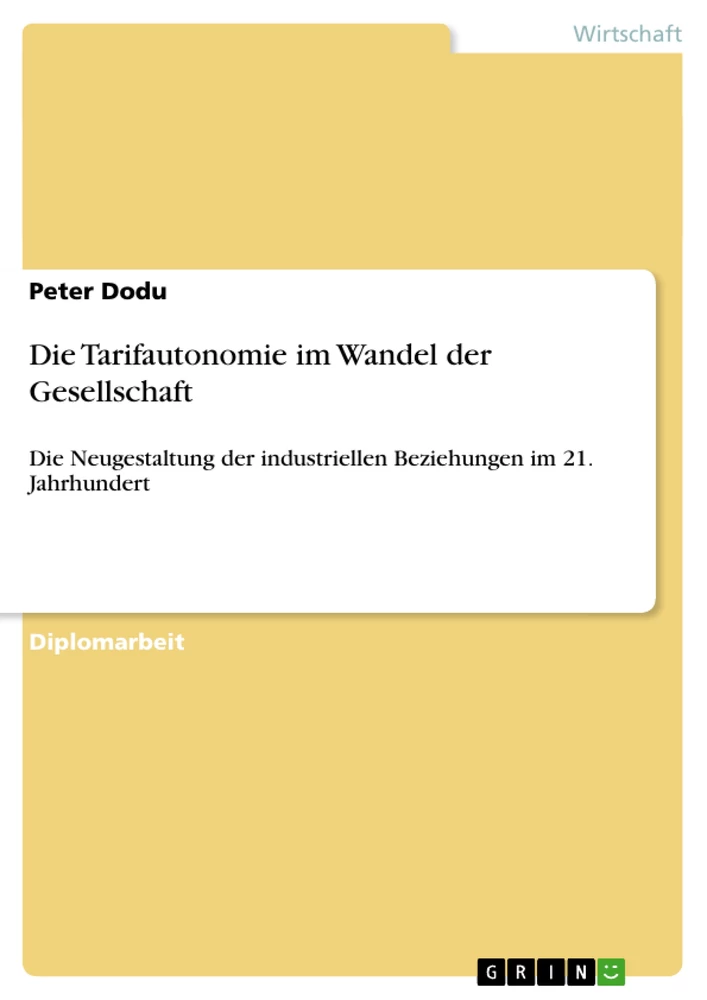
Die Tarifautonomie im Wandel der Gesellschaft
Diplomarbeit, 2010
92 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Teil I: Theoretischer Bezugsrahmen
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Der regulationstheoretische Ansatz
- 2.2 Die Gewerkschaften
- 2.3 Die Arbeitgeberverbände
- 2.4 Der Staat
- 2.4.1 Arbeitsgesetzgebung und Arbeitsrechtsprechung
- 2.4.2 Sozialpolitik und Sozialversicherung
- 2.4.3 Arbeitsverwaltung und Arbeitsmarktpolitik
- 2.4.4 Einkommenspolitik
- 3. Die Tarifautonomie als Instrument der industriellen Partner
- 3.1 Merkmale und Funktionen der Tarifautonomie
- 3.2 Die Dualität der Tarifautonomie
- Teil II: Die Entwicklung der Tarifautonomie
- 4. Die Historie der Tarifautonomie
- 4.1 Die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen der Gesellschaft durch den technologischen Fortschritt
- 4.2 Der gewerkschaftliche Zusammenschluss
- 4.3 Die Entstehung der Arbeitgeberverbände
- 4.4 Die Entstehung der Tarifautonomie
- 4.5 Die Entstehung der industriellen Beziehungen und der Tarifautonomie
- 4.6 Die Institutionalisierung des Tarifvertragswesens
- 4.7 Die Tarifautonomie ab 1945
- Teil III: Probleme und Lösungsansätze der heutigen industriellen Beziehungen
- 5. Der Strukturwandel von Gesellschaft und Wirtschaft
- 5.1 Der Wandel von der Industriewirtschaft zur Dienstleistungswirtschaft
- 5.2 Eine neue Definition des Begriffs Arbeitnehmer
- 5.3 Die Erosion des Flächentarifvertrages und die Gefahr für den Arbeitnehmer
- 6. Die Dezentralisierung der Tarifautonomie
- 6.1 Der Mitgliederschwund in den Arbeitgeberverbänden
- 6.2 Der Mitgliederschwund in den Gewerkschaften
- 6.3 OT-Mitgliedschaft als Mittel gegen den Mitgliederschwund in den Arbeitgeberverbänden
- 6.4 Gewerkschaftsmaßnahmen gegen den Mitgliederschwund
- 7. Öffnungs- und Differenzierungsklauseln
- 7.1 Öffnungs- und Differenzierungsklauseln zur Dezentralisierung tariflicher Bestimmungen
- 7.2 Problematik der tariflichen Dezentralisierung durch Öffnungs- und Differenzierungsklauseln
- 8. Das System der Zielvereinbarungen als dezentrale Verhandlungsform
- 8.1 Positive Aspekte des Zielvereinbarungssystems
- 8.2 Negative Aspekte des Zielvereinbarungssystems
- 8.3 Die Position der Arbeitgeber
- 8.4 Die Position der Arbeitnehmerinteressenvertretungen und der Gewerkschaften
- 8.5 Rahmenregelungen für Zielvereinbarungssysteme und die unmittelbaren Folgen für die industriellen Partner
- 9. Tarifliche Module als Verhandlungssystem
- 9.1 Das Modell der tariflichen Module
- 9.2 Kritik an tariflichen Modulen
- 9.3 Tarifpluralisierung und Tarifkollision
- 10. Fazit
- 11. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Veränderungen der Tarifautonomie im Kontext des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels. Sie analysiert, ob die Tarifautonomie weiterhin den Bedürfnissen von Gewerkschaften, Arbeitgebern und dem Staat gerecht wird und welche Anpassungsstrategien notwendig sind, um ihre Funktion als Verhandlungsinstrument zu sichern.
- Wandel der industriellen Beziehungen im 21. Jahrhundert
- Entwicklung und Herausforderungen der Tarifautonomie
- Der Einfluss des Strukturwandels auf die Tariflandschaft
- Dezentralisierungstendenzen und ihre Auswirkungen
- Alternative Verhandlungsmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel des deutschen Tarifsystems hin zu mehr Differenzierung und Dezentralisierung, betont den Rückgang des Flächentarifvertrags und führt die zentrale Forschungsfrage ein: Kann die Tarifautonomie die Anforderungen der industriellen Partner noch erfüllen und wie kann sie umgestaltet werden, um Ordnungs- und Planungssicherheit zu gewährleisten?
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt den theoretischen Rahmen der Arbeit fest, indem es den regulationstheoretischen Ansatz erläutert und die Rollen von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und dem Staat als Akteure der industriellen Beziehungen beschreibt. Es analysiert die jeweiligen Funktionen und Einflussmöglichkeiten dieser Akteure im Kontext der Tarifautonomie.
3. Die Tarifautonomie als Instrument der industriellen Partner: Dieses Kapitel beleuchtet die Merkmale und Funktionen der Tarifautonomie, insbesondere deren Dualität als sowohl kooperatives als auch konfliktträchtiges Instrument der Interessensvertretung. Es analysiert wie die Tarifautonomie als Instrument der industriellen Partner funktioniert und welche Funktionen sie erfüllt.
4. Die Historie der Tarifautonomie: Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung der Tarifautonomie, beginnend mit den wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen durch den technologischen Fortschritt, über die Entstehung von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden bis hin zur Institutionalisierung des Tarifvertragswesens. Es analysiert den historischen Kontext und die Entwicklungsschritte der Tarifautonomie.
5. Der Strukturwandel von Gesellschaft und Wirtschaft: Der Strukturwandel von der Industrie- zur Dienstleistungswirtschaft, neue Definitionen des Begriffs „Arbeitnehmer“ und die Erosion des Flächentarifvertrags werden in diesem Kapitel behandelt. Es werden die Herausforderungen für die Tarifautonomie durch den Strukturwandel analysiert.
6. Die Dezentralisierung der Tarifautonomie: Hier wird der Mitgliederschwund in Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden und die damit verbundenen Folgen für die Tarifautonomie erörtert. Es werden Maßnahmen gegen den Mitgliederschwund und die Auswirkungen der Dezentralisierung untersucht.
7. Öffnungs- und Differenzierungsklauseln: Dieses Kapitel analysiert Öffnungs- und Differenzierungsklauseln als Mechanismen der tariflichen Dezentralisierung, ihre Auswirkungen auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und die damit verbundenen Probleme.
8. Das System der Zielvereinbarungen als dezentrale Verhandlungsform: Das Kapitel untersucht Zielvereinbarungssysteme als Alternative zur traditionellen Tarifverhandlung, analysiert deren positive und negative Aspekte aus der Sicht von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und beleuchtet die Notwendigkeit von Rahmenregelungen.
9. Tarifliche Module als Verhandlungssystem: Das Kapitel stellt das Modell der tariflichen Module vor und diskutiert dessen Kritikpunkte sowie die Problematik der Tarifpluralisierung und Tarifkollision. Es werden alternative Verhandlungsmodelle im Kontext der Dezentralisierung untersucht.
Schlüsselwörter
Tarifautonomie, industrielle Beziehungen, Strukturwandel, Dezentralisierung, Flächentarifvertrag, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Zielvereinbarungen, tarifliche Module, Globalisierung, Arbeitsrecht, Sozialpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die Tarifautonomie im Wandel"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Veränderungen der Tarifautonomie im Kontext des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels. Sie analysiert, ob die Tarifautonomie weiterhin den Bedürfnissen von Gewerkschaften, Arbeitgebern und dem Staat gerecht wird und welche Anpassungsstrategien notwendig sind, um ihre Funktion als Verhandlungsinstrument zu sichern. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Dezentralisierung der Tarifautonomie und alternativen Verhandlungsmodellen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit umfasst die theoretischen Grundlagen der Tarifautonomie, ihre historische Entwicklung, den Einfluss des Strukturwandels (insbesondere der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungswirtschaft), den Mitgliederschwund in Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, die zunehmende Dezentralisierung durch Öffnungs- und Differenzierungsklauseln, sowie alternative Verhandlungsmodelle wie Zielvereinbarungen und tarifliche Module. Die Rolle des Staates und die Problematik der Tarifpluralisierung und Tarifkollision werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Akteure werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Rolle von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und dem Staat als zentrale Akteure der industriellen Beziehungen im Kontext der Tarifautonomie. Der Fokus liegt auf deren Interaktionen und den jeweiligen Herausforderungen durch den Wandel der Arbeitswelt.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf einen regulationstheoretischen Ansatz und analysiert die beschriebenen Phänomene auf Grundlage einer umfassenden Literaturrecherche und der Auswertung relevanter Daten. Die Methode ist deskriptiv-analytisch.
Welche zentralen Herausforderungen für die Tarifautonomie werden identifiziert?
Zentrale Herausforderungen sind der Strukturwandel der Wirtschaft, der Mitgliederschwund in Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, die zunehmende Dezentralisierung der Tarifverhandlungen und die damit verbundene Erosion des Flächentarifvertrags. Die Arbeit untersucht, wie diese Entwicklungen die Ordnungs- und Planungssicherheit gefährden.
Welche Lösungsansätze werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Lösungsansätze, darunter alternative Verhandlungsmodelle wie Zielvereinbarungen und tarifliche Module. Es wird untersucht, inwieweit diese Modelle die Herausforderungen der Dezentralisierung bewältigen und die Funktion der Tarifautonomie als Instrument der Interessensvertretung sichern können. Auch die Rolle von Öffnungs- und Differenzierungsklauseln wird kritisch bewertet.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen und bewertet die Zukunftsfähigkeit der Tarifautonomie im Lichte der analysierten Herausforderungen und Lösungsansätze. Es werden mögliche Strategien zur Anpassung der Tarifautonomie an die veränderten Bedingungen der Arbeitswelt aufgezeigt.
Welche Literatur wird verwendet?
Ein ausführliches Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit listet alle verwendeten Quellen auf.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Tarifautonomie, industrielle Beziehungen, Strukturwandel, Dezentralisierung, Flächentarifvertrag, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Zielvereinbarungen, tarifliche Module, Globalisierung, Arbeitsrecht, Sozialpolitik.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Politik und alle, die sich mit den Veränderungen der Arbeitswelt und den Herausforderungen für die Tarifautonomie auseinandersetzen.
Details
- Titel
- Die Tarifautonomie im Wandel der Gesellschaft
- Untertitel
- Die Neugestaltung der industriellen Beziehungen im 21. Jahrhundert
- Hochschule
- Bergische Universität Wuppertal (Arbeits- und Sozialrecht)
- Note
- 1,7
- Autor
- Peter Dodu (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 92
- Katalognummer
- V156062
- ISBN (eBook)
- 9783640691159
- ISBN (Buch)
- 9783640691296
- Dateigröße
- 870 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Tarifautonomie Wandel Gesellschaft Neugestaltung Beziehungen Jahrhundert Industrielle Partner
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Peter Dodu (Autor:in), 2010, Die Tarifautonomie im Wandel der Gesellschaft, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/156062
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-