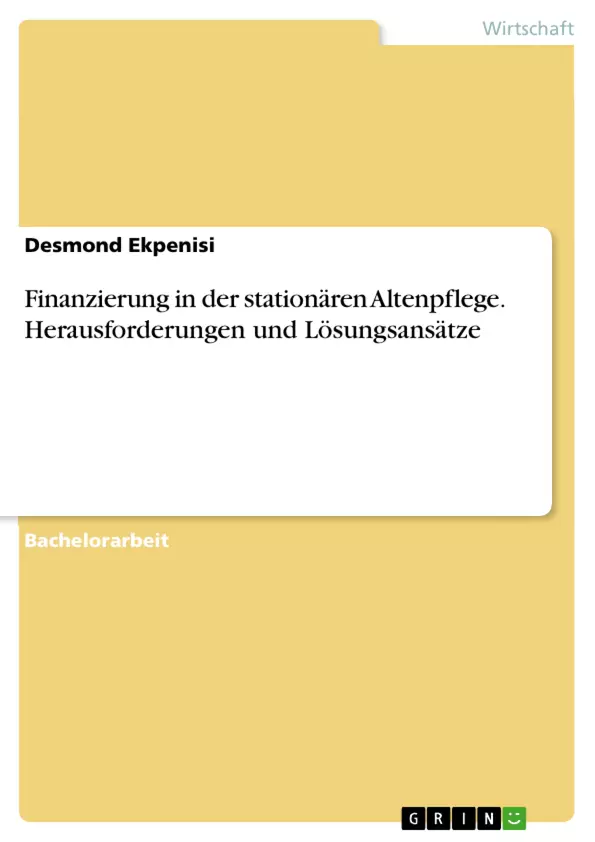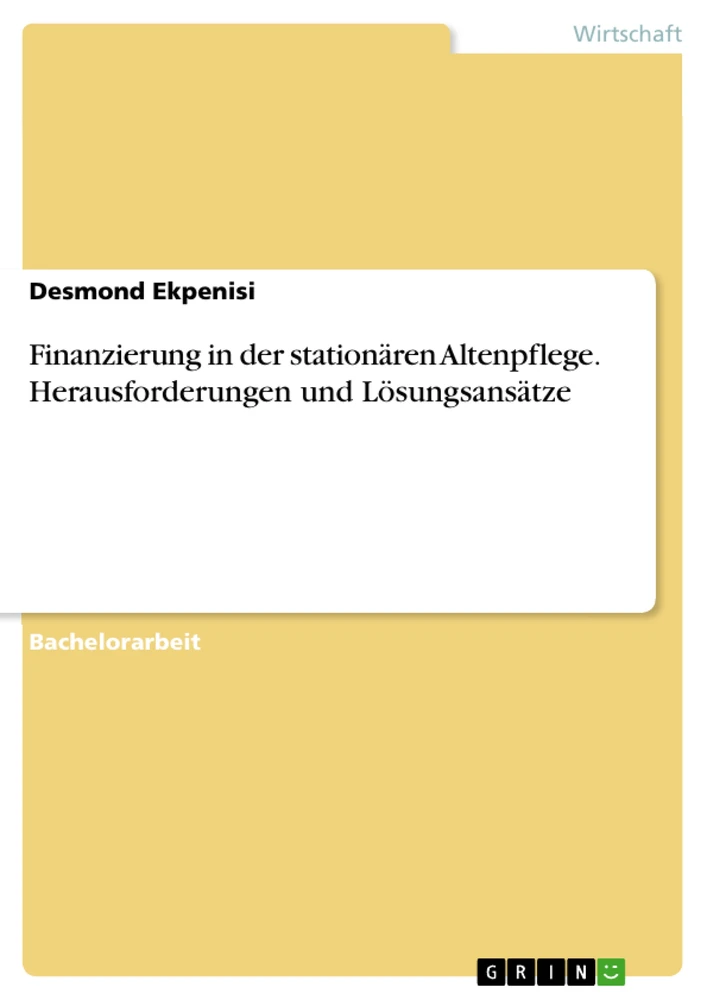
Finanzierung in der stationären Altenpflege. Herausforderungen und Lösungsansätze
Bachelorarbeit, 2025
157 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Hinweis geschlechtsneutrale Schreibweise
1. Einleitung
1.1 Problemstellung und Relevanz des Themas
1.2 Zielsetzung der Arbeit
1.3 Methodische Vorgehensweise
1.4 Aufbau der Arbeit
2. Einführung stationäre Altenpflege und Finanzierung .
2.1 Merkmale der stationären Altenpflege
2.2 Pflegebedürftigkeit und Leistungen
2.3 Grundlagen der Finanzierung
2.3.1 Dreieckssystem der sozialrechtlichen Finanzierung
2.3.2 Eigenanteil der Pflegebedürftigen
2.3.3 Soziale vs. private Pflegeversicherung
2.3.4 Weitere Finanzierungsquellen
3. Aktuelle Probleme und zukünftige Entwicklung
3.1 Einnahmen- und Ausgaben Entwicklung der Kostenträger
3.2 Steigerung der Eigenanteile
3.3 Demographischer Wandel und Bedeutung für die Finanzierung
3.4 Auswirkung der Pflegereformen auf die Finanzierung
3.4.1 Leistungsbezogene Reformen
3.4.2 Personalbezogene Reformen
3.5 Finanzierungslücke innerhalb der Pflegeeinrichtungen
4. Mögliche Lösungsansätze und Reformvorschläge
4.1 Pflege-Bürgerversicherung
4.2 Private Vorsorgemodelle
4.3 Generationenvertrag der PKV
4.4 Weitere mögliche Maßnahmen
5. Empirische Untersuchung
5.1 Forschungsdesign
5.2 Aufbau des Leitfadens
5.3 Auswahl der Experten
5.4 Datenerhebung und Datenverarbeitung
5.5 Datenanalyse
5.6 Ergebnisdarstellung
5.6.1 Kategorie 1: Pflege-Bürgerversicherung
5.6.2 Kategorie 2: Private Vorsorgemodelle
5.6.3 Kategorie 3: Generationenvertrag
5.6.4 Kategorie 4: Steuerfinanzierung
5.6.5 Kategorie 5: Präventionsmaßnahmen
5.6.6 Kategorie 6: Digitalisierungsmaßnahmen
5.7 Diskussion der Ergebnisse
6. Fazit
6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
6.2 Beantwortung der Fragestellung
6.3 Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Dreieckssystem der sozialrechtlichen Finanzierung
Abbildung 2: Finanzierungsquellen von Non-Profit-Organisationen (NPOs).
Abbildung 3: Einnahmen- und Ausgabenentwicklung SPV
Abbildung 4: Beitragssatzentwicklung SPV. 21
Abbildung 5: Einnahmen- und Ausgabenentwicklung PPV
Abbildung 6: Leistungsausgaben der Sozialhilfe nach SGB
Abbildung 7: Prognose über die Beitragssatzentwicklung
Abbildung 8: Kostensteigerung der stationären Pflege
Abbildung 9: Pflegevorausberechnung bis 2070
Abkürzungsverzeichnis
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Hinweis geschlechtsneutrale Schreibweise
Hinweis:
In der vorliegenden Arbeit wurde zur besseren Lesbarkeit die männliche Form verwendet. Auf eine Doppelnennung in männlicher und weiblicher Form wurde demnach verzichtet. Folglich beziehen sich die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen, sofern nicht anders kenntlich gemacht, auf alle Geschlechter und sollen keine Verletzung des Gleichheitszustandes darstellen.
1. Einleitung
1.1 Problemstellung und Relevanz des Themas
Seit dem Jahr 1994 gibt es in Deutschland das System der gesetzlichen Pflegeversicherung. Der Zweck dieser neu errichteten Versicherung bestand darin, eine soziale bzw. finanzielle Absicherung für pflegebedürftige Menschen zu etablieren.1 Allerdings haben sich in den letzten Jahren bzgl. der Finanzierung der Pflege wie z.B. im Bereich der stationären Altenpflege einige Herausforderungen ergeben, die u.a. zu deutlichen Finanzierungslücken geführt haben. Die stationären Einrichtungen haben z.B. steigende Pflegekosten aufgewiesen, die nicht von der Pflegeversicherung, sondern eigenständig von den Pflegebedürftigen in Form von sogenannten einrichtungseinheitlichen Eigenanteilen getragen werden mussten.2 Die steigenden Eigenanteile führen folglich dazu, dass die Pflegebedürftigen verstärkt auf Sozialhilfe angewiesen werden, um diese hohen Kosten tragen zu können.3 Weiterhin hat sich aufgrund des demografischen Wandels ebenso das Problem gezeigt, dass die Anzahl an Beitragszahler immer geringer werden, die in die Pflegeversicherung einzahlen, während gleichzeitig der Finanzierungsbedarf von diesen jeweiligen Trägern aufgrund der steigenden Pflegefälle größer wird.4
Somit wird deutlich, dass die Finanzierung in der stationären Altenpflege einer dringenden Anpassung oder einer systematischen Veränderung bedarf, um diese nachhaltig sicherzustellen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: Wie lässt sich die Finanzierung im Bereich der stationären Altenpflege langfristig so anpassen, dass die Pflegebedürftigen ohne zu große Abhängigkeit von Sozialhilfeträgern die Kosten für Pflege tragen können und ohne dass die Kostenträger in ihren Ausgaben zu sehr belastet sind?
1.2 Zielsetzung der Arbeit
Das Ziel dieser vorliegenden Arbeit besteht darin die Herausforderungen der stationären Altenpflegfinanzierung zu identifizieren und zu analysieren, um schlussendlich effektive Lösungsansätze zu formulieren, die auch aus politischer Sicht umgesetzt werden könnten. Dabei soll insbesondere auf die Rolle der beteiligten Kostenträger eingegangen werden, die ihren jeweiligen Anteil der Leistungsausgaben an die Einrichtungen beitragen. Es ist gezielt zu untersuchen, ob die formulierten Lösungsansätze für die Probleme bzw. Defizite der Finanzierung in der Theorie sinnvoll umgesetzt werden könnten. Das bedeutet, dass bei der Untersuchung, soweit möglich, eine kritische Betrachtung ebenso zu berücksichtigen ist. Die Arbeit soll im Wesentlichen einen Beitrag zur Diskussion über nachhaltige Finanzierungskonzepte leisten, sodass schließlich auf hohem, qualitativem Niveau die Pflege an bedürftigen Menschen sichergestellt wird, ohne, dass sich die Nutzer oder die Einrichtungen zu große finanzielle Sorgen machen müssen.
1.3 Methodische Vorgehensweise
Um die in Punkt 1.1 genannte Fragestellung untersuchen und beantworten zu können, wird in dieser Arbeit überwiegend Literatur- und Internetrecherche von seriösen Verfassern oder Herausgebern verwendet. Diese Methode dient zunächst dem Zweck, sämtliche Informationen zu den Grundlagen des Themas zu sammeln und überleitend die Herausforderungen der Finanzierungen zu benennen und zu analysieren. Im weiteren Verlauf wird insbesondere die Literaturarbeit für die Formulierung der Lösungsansätze mit der Durchführung von Experteninterviews verknüpft, um ein breiteres Spektrum an Informationen und kritischen Aspekten zu beschreiben, zu denen es dazu eventuell noch keine weitreichende Literatur gibt. Ebenso wird mit dieser Methode eine praxisbezogene Darstellung zum Thema präsentiert. Mit den beiden genannten Methoden soll am Ende der Arbeit die Tauglichkeit bzw. Umsetzbarkeit der beschriebenen Lösungsansätze unter allen wichtigen Aspekten wie z.B. rechtlichen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen untersucht und evaluiert werden.
1.4 Aufbau der Arbeit
Im nächsten Kapitel dieser Arbeit wird sich zunächst mit den theoretischen Grundlagen zur stationären Altenpflege und dem Finanzierungssystem sowie allen beteiligten Stakeholdern befasst. Im weiteren Verlauf wird die Entwicklung sowie die aktuelle Situation der stationären Altenpflegefinanzierung erläutert. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls die Herausforderungen der Finanzierungslage beschrieben, sowie mögliche Aussichten ohne schnelles Handeln dargelegt. Danach werden mögliche Lösungsansätze formuliert und diese im Rahmen einer empirischen Untersuchung auf ihre Effektivität evaluiert. Abschließend werden alle Ergebnisse in einem Fazit zusammengefasst.
2. Einführung stationäre Altenpflege und Finanzierung
Bevor die Herausforderungen der stationären Altenpflegefinanzierung behandelt werden, ist es notwendig sich mit den wesentlichen Grundlagen zum Aufbau der Finanzierung und den beteiligten Akteuren der stationären Altenpflege vertraut zu machen. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden daher ein paar grundlegende Basisinformationen zur stationären Altenpflege, zur Pflegebedürftigkeit und anschließend zum gesamten Finanzierungssystem beschrieben und deren Zusammenhänge erläutert.
2.1 Merkmale der stationären Altenpflege
Bei der stationären Altenpflege handelt es sich um pflegerische Versorgung in voll- oder teilstationären Pflegeeinrichtungen, wo Pflegebedürftige entweder nur zu bestimmten Zeiten am Tag oder ganztägig untergebracht und gepflegt werden.5 Bei der teilstationären Pflege hingegen handelt es sich um Tagespflege, wenn die pflegerische Versorgung nur tagsüber stattfindet und umgekehrt ist von Nachtpflege die Rede, wenn diese nur nachtsüber stattfindet. Mit der teilstationären Pflege ist es also den Pflegebedürftigen weiterhin möglich, zu Hause zu wohnen und entsprechend von dort aus versorgt zu werden, da sie schließlich nur zu bestimmten Tageszeiten in einer Einrichtung pflegerisch versorgt und betreut werden.6
Neben der voll- und teilstationären Pflege gibt es außerdem noch die Form der Kurzzeitpflege, bei welcher es sich um eine auf maximal acht Wochen beschränkte, pflegerische Versorgung handelt.7 Die Kurzzeitpflege dient entweder als Übergang auf eine vollstationäre Versorgung oder als Alternativangebot, wenn für den betroffenen Pflegebedürftigen zeitweise keine ausreichend häusliche oder teilstationäre Pflege gewährleistet werden kann.8
Pflegeeinrichtungen werden in Deutschland im Allgemeinen durch verschiedene Pflegeanbieter differenziert. Diese unterscheiden sich dabei zwischen drei verschiedenen Trägerschaften, zu denen öffentliche, freigemeinnützige und private Träger gehören.9 Bei den öffentlichen Trägern der stationären Pflegeeinrichtungen handelt es sich um Körperschaften des öffentlichen Rechts, während es sich bei den freigemeinnützigen Trägern hauptsächlich um die Wohlfahrtsverbände als freie Träger handelt. Im Gegensatz zu den privaten Trägern liegt bei den öffentlichen und freigemeinnützigen Trägern keine Gewinnerzielungsabsicht vor, sondern lediglich der soziale Zweck.10 Zwar geben die unterschiedliche Trägerformen keine direkten Rückschlüsse auf die Ausgestaltung der Pflegeangebote, allerdings ließ sich nachweisen, dass private Träger trotz Gewinnerzielungsabsicht zum Teil günstigere Pflegeversorgung anbieten als die anderen beiden Trägerschaften.11
2.2 Pflegebedürftigkeit und Leistungen
Im Sinne des SGB XI gilt diejenige Person als pflegebedürftig, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeit ausweist und deshalb auf Hilfe durch Andere angewiesen ist. Die Pflegebedürftigkeit muss dabei außerdem für mindestens sechs Monate voraussichtlich bestehen.12
Seit dem Jahr 2017 gibt es dazu den gesetzlich definierten Pflegebedürftigkeitsbegriff. Es handelt sich um ein System zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit in sogenannte Pflegegrade, welche die ehemaligen Pflegestufen ablöste.13 Die Einstufung in diese Pflegegrade erfolgt auf Antrag an die entsprechende Pflegekasse, woraufhin diese den medizinischen Dienst damit beauftragt, die Pflegebedürftigkeit der jeweils betroffenen Person zu prüfen. Bei einer festgestellten Pflegebedürftigkeit erfolgt die Einstufung in einen der Pflegegrade 1 bis 5. Diese stellen im Grunde die Schwere der Pflegebedürftigkeit dar, wobei 1 die geringste und 5 die höchste Schwere darstellt.14
Die Einstufung in einen Pflegegrad spielt eine wichtige Rolle für die Pflegeversicherung bzw. für die Pflegekassen, wenn es um die stationäre Versorgung in einer Einrichtung geht. Je nach Pflegegrad haben Pflegebedürftige nämlich einen unterschiedlichen und gesetzlich festgelegten Anspruch auf Geldleistungen von der Pflegekasse. Es ist dabei anzumerken, dass lediglich Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 einen Anspruch auf vollstationäre Pflege in Einrichtungen haben.15 Für die vollstationäre Pflege erhalten die Pflegebedürftige mit einen Pflegegrad 2 jeweils 770€ pro Kalendermonat, bei Pflegegrad 3 sind es wiederum 1262€, bei Pflegegrad 4 sind es 1775€ und bei Pflegegrad 5 sind es 2005€.16 Für den Pflegegrad 1 bekommen Pflegebedürftige lediglich einen Aufwendungszuschuss in Höhe von 125€ von der Pflegekasse.17 Bei der teilstationären Pflege besteht ebenfalls nur für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 ein Anspruch auf die entsprechende Versorgung, allerdings zahlt die Pflegekasse wiederum etwas andere Beträge. In diesem Fall bekommen die Pflegebedürftigen mit einem Pflegegrad 2 jeweils 689€ pro Kalendermonat, bei Pflegegrad 3 sind es 1298€, bei Pflegegrad 4 sind es 1612€ und bei Pflegegrad 5 sind es 1995€.18 Schließlich sind auch im Bereich der Kurzzeitpflege die Pflegebedürftigen des Pflegegrades 1 von einem Anspruch auf die pflegerische Versorgung ausgeschlossen. Hier zahlt die Pflegekasse für den Gesamtzeitraum der Inanspruchnahme einen maximalen Gesamtbetrag von bis zu 1776€ pro Kalenderjahr.19
2.3 Grundlagen der Finanzierung
Wie bereits im letzten Unterkapitel erläutert wurde, zahlt die Pflegekasse in Abhängigkeit vom Pflegegrad und der Form der stationären Pflege eine bestimmte Leistung für die pflegerische Versorgung des jeweiligen Pflegebedürftigen. Dies umfasst jedoch bloß einen Teil dessen, aus was sich eine stationäre Einrichtung finanziert, da die Pflegeversicherung nur für die Grundversorgung in der Pflege aufkommt.20 Nachfolgend wird sich daher intensiv mit dem sozialrechtlichen Finanzierungssystem, den verschiedenen Kostenträgern sowie weiteren verschiedenen Finanzierungsquellen in der stationären Altenpflege befasst.
2.3.1 Dreieckssystem der sozialrechtlichen Finanzierung
Das sozialrechtliche Finanzierungssystem oder auch Dreiecksystem genannt, ist ein Modell zur Veranschaulichung der finanzierungsrechtlichen Beziehungen zwischen den zugehörigen Leistungsgruppen. Diese ist ebenfalls anwendbar auf weitere Einrichtungen der Sozialwirtschaft.21 Die folgende Abbildung soll dieses Modell des Dreiecksystems, sowie die Verhältnisse der Gruppen schematisch darstellen.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Dreieckssystem der sozialrechtlichen Finanzierung
Quelle: Möller, 2022, S. 48
Wie in der Abbildung zu erkennen ist, besteht das Dreiecksverhältnis aus Leistungserbringer, Leistungsempfänger und Leistungsträger. Mit Leistungsträger ist gemäß der Definition des Sozialgesetzbuchs diejenige Körperschaft, Anstalt oder Behörde gemeint, die für die entsprechende Sozialleistung zuständig ist.22 Im Fall der stationären Altenpflege sind gemäß SGB XI die Pflegekassen die Leistungsträger in der sozialen Pflegeversicherung.23 In Abgrenzung zu den Leistungsträgern handelt es sich bei den Leistungserbringern um diejenigen, die die entsprechende Leistung anstelle bzw. im Auftrag der Leistungsträger auch erbringen.24 Dies wären stationäre Pflegeeinrichtungen, die pflegerische Versorgung in Form von Dienstleistungen erbringen.25 Schließlich handelt es sich beim Leistungsempfänger um diejenigen, die entsprechende Leistungen in Form von Geldern, Sach- oder Dienstleistungen erhalten.26 Da hier der Pflegebedürftige als Klient derjenige ist, der seine Leistung in Form von Dienstleistung erhält, ist er auch der entsprechende Leistungsempfänger.27
Gemäß der Darstellung in der oben aufgeführten Abbildung hat der Pflegebedürftige gegenüber der Pflegeversicherung bzw. den Pflegekassen einen Leistungsanspruch in Form von Geldleistungen. Wie bereits in Kapitel 2.2 genannt wurde, richtet sich die Höhe der Leistungsbeträge nach dem Pflegegrad. Diese Geldleistungen der Pflegeversicherung werden anteilig durch Versicherungsbeiträge der Mitglieder und deren Arbeitgeber finanziert.28 Dies setzt natürlich voraus, dass Arbeitsentgelt aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung vorliegt.29 Allerdings sind unter anderem ebenso Zahlbeträge aus der Rente beizutragen,30 was im Falle der stationären Altenpflege eher auf den Pflegebedürftigen zutreffen würde. Zum derzeitigen Stand liegt der Beitragssatz für die soziale Pflegeversicherung bei 3,4% der versicherungspflichtigen Einnahmen für die Mitglieder, wohingegen noch ein Zuschlagssatz von 0,6% zu leisten ist, sofern die Mitglieder kinderlos sind und das 23. Lebensjahr vollendet haben.31 Ansonsten gilt der Beitragssatz in Höhe von 3,4% als die Hälfte des Gesamtbeitrages, wobei der Arbeitgeber die andere Hälfte beiträgt.32
Zwischen der Pflegeversicherung und den stationären Pflegeeinrichtungen liegt das Verhältnis darin, dass sie eine Leistungsvereinbarung abschließen. Bei diesen Leistungsvereinbarungen schließen die Pflegeeinrichtungen mit den Pflegekassen Versorgungsverträge ab, sodass die Einrichtungen eine Versorgung bzw. Leistungserbringung im Auftrag der Pflegekassen garantieren.33 Im Gegenzug übernimmt die Pflegekasse die in Kapitel 2.3 genannten Kosten mit der Leistung, auf die der Pflegebedürftige gesetzlichen Anspruch hat.34
Schließlich liegt das Verhältnis zwischen der stationären Pflegeeinrichtung und den Pflegebedürftigen darin, dass die Einrichtung, wie in Kapitel 2.2 genannt, nach festgestellter Pflegebedürftigkeit die Leistungen erbringen. Dies geschieht im Rahmen eines Vertrages, aus die sich für den Pflegebedürftigen wiederum Kostenverpflichtungen ergeben.35
Ein wesentlicher Grund dafür, dass es dieses System gibt, liegt darin, dass derartige Leistungen in der Sozialwirtschaft nur in wenigen Fällen von den Leistungsempfängern eigenständig bezahlt werden könnten und die sozialen Einrichtungen inklusive der stationären Pflegeeinrichtungen nicht marktfähig wären.36 Daher werden diese Leistungen über Sozialversicherungen von den bereits genannten, öffentlichen Leistungs- bzw. Kostenträgern 37 getragen.37
2.3.2 Eigenanteil der Pflegebedürftigen
Neben den in Punkt 2.3 genannten Kosten für pflegerische Versorgung bzw. Grundversorgung, gibt es in stationären Einrichtungen ebenfalls die sogenannten Hotelkosten, zu denen einerseits Kosten für Unterkunft und Verpflegung zählen und andererseits eine Investitionskostenpauschale.38 Zuvor mussten Pflegebedürftige den Differenzbetrag zwischen den individuellen Pflegekosten und die von der Pflegekasse erstatteten Leistungen selbst begleichen. Mit dem im Jahr 2017 eingeführten zweiten Pflegestärkungsgesetz wurde allerdings der sogenannte einrichtungseinheitliche Eigenanteil eingeführt, worin jeder Pflegebedürftige eines Heimes unabhängig vom Pflegegrad fortan denselben Eigenbetrag zu zahlen hatte.39 Dieser Eigenanteil ist für jede Einrichtung individuell nach der Kostenstruktur zu ermitteln.40 Während die Pflegeversicherung Kosten für Pflege, Betreuung und Ausbildungskosten übernimmt, zahlen die Pflegebedürftigen die o.g. Hotelkosten.41 Bei der vollstationären Pflege zahlt die Pflegeversicherung jedoch gesetzlich festgelegte Leistungszuschläge des zu zahlenden Eigenanteils, die je nach Verweildauer von 15 bis 75% gestaffelt sind.42
Sofern Pflegebedürftige außerstande sind, den Eigenanteil der Pflegeeinrichtung selbst zu zahlen, sind ggf. Angehörige dem Pflegebedürftigen gegenüber unterhaltpflichtig.43 Unterhaltsansprüche für den Verbleib in einer stationären Einrichtung bestehen z.B. bei Verwandten des ersten und zweiten Grades, wenn das Jahreseinkommen 100.000€ übersteigt.44 Ebenso ist verwertbares Vermögen in Form von Bar- oder sonstigen Geldwerten einzusetzen, wobei dieser allerdings nur bis zu einem Schonvermögen von 10.000€ verwertet werden kann.45
Sollten schließlich weder das Einkommen noch das Vermögen ausreichen, um die Kosten zu bezahlen, besteht für den Pflegebedürftigen möglicherweise Anspruch auf Wohngeld. Andernfalls besteht Anspruch auf Leistungen des Sozialamtes.46 Die Leistungen des Sozialamtes sind wiederum steuerfinanzierte Sozialhilfeausgaben auf Basis des SGB XII. Im Jahr 2014 entfielen insgesamt 3,5 Mrd. € von 26,5 Mrd. € auf Hilfe zur Pflege.47
2.3.3 Soziale vs. private Pflegeversicherung
In der gesetzlichen Pflegeversicherung existiert neben der sogenannten sozialen Pflegeversicherung gleichzeitig auch die private Pflegeversicherung, bei der jeder versichert sein muss, der auch bei einer privaten Krankenversicherung entsprechend versichert ist. Ansonsten ist jeder in der sozialen Pflegeversicherung versichert, der in der gesetzlichen Krankenversicherung genauso versichert ist.48 Wie schon bereits in Kapitel 2.3.1 erwähnt, gibt es in der sozialen Pflegeversicherung einen abzuleistenden einheitlichen Beitragssatz von aktuell bis zu vier Prozent des versicherungspflichtigen Einkommens. Dabei ist zu beachten, dass es eine Beitragsbemessungsgrenze sowie eine Versicherungspflichtgrenze gibt. Während die Beitragsbemessungsgrenze den Höchstbetrag des Bruttoeinkommens beschreibt, von dem Beiträge zum entsprechenden Beitragssatz erhoben werden können, beschreibt die Versicherungspflichtgrenze den Höchstbetrag des Bruttoeinkommens, bis zu dem als Versicherter gesetzlich krankenversichert ist.49 Da jeder Versicherte in der Pflegeversicherung auf derselben Grundlage wie in der Krankenversicherung gesetzlich oder privat versichert ist, gelten dieselben Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen der gesetzlichen Krankenversicherung für die soziale Pflegeversicherung genauso. Nach aktuellem Stand liegt die Beitragsbemessungsgrenze bei 62.100€ jährlich bzw. 5.175€ monatlich.50 Das bedeutet, dass alles, was über den Betrag hinaus verdient wird, beitragsfrei ist. Die Versicherungspflichtgrenze wiederum liegt bei 69.300€ bzw. 5.775€ monatlich, was bedeutet, dass man sich bei einem Einkommen über den Betrag hinaus privat versichern lassen kann.51 Ansonsten gibt es für bestimmte Personengruppen nach §5 SGB V gesonderte Regelungen, die sie von einer Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- bzw. Pflegeversicherung befreien, wie z.B. für Beamte, die Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge besitzen.52
In der privaten Pflegeversicherung hingegen sind die abzuleistenden Beiträge eines Mitglieds u.a. abhängig vom Gesundheitszustand oder vom Alter, welches allerdings nicht die Pflegeversicherung selbst, sondern die private Krankenversicherung kalkuliert.53 Anders als in der sozialen Pflegeversicherung werden die Leistungen der privaten Pflegeversicherung nicht direkt mit den Leistungserbringern abgewickelt, sondern die Leistung basiert auf dem Prinzip der Kostenerstattung nach den gesetzlichen oder vertraglichen Grundlagen.54 Das System der privaten Pflegeversicherung basiert auf dem Prinzip einer Kapitaldeckung, was bedeutet, dass in jeder Generation die Beitragszahler durch die Bildung von Altersrückstellungen einen Kapitalstock für ihre zukünftige Vorsorge aufbauen.55 Die sozialen Pflegeversicherung hingegen basiert auf dem Prinzip der Umlagefinanzierung, womit die gegenwärtig eingezahlten Beiträge für gegenwärtige Pflegekosten eingesetzt werden und keine Vorsorge gebildet wird.56 Zu den Leistungen der privaten Pflegeversicherung gibt es zunächst zwei Arten von staatlich geförderten Zusatzversicherungen. Zum einen gibt es die Pflegekostenversicherungen, bei denen die tatsächlich angefallenen Pflegekosten abgedeckt werden, die nicht von der sozialen Pflegeversicherung gedeckt werden. Zum anderen gibt es die Pflegetagegeldversicherung, bei der ein vertraglich festgelegter Geldbetrag an den Pflegebedürftigen ausgezahlt wird.57
2.3.4 Weitere Finanzierungsquellen
Zuletzt gibt es neben all den genannten Kosten und Finanzierungsquellen weitere bestimmte Fremd- bzw. Außenmittel, die stationäre Einrichtungen beziehen können.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Finanzierungsquellen von Non-Profit-Organisationen (NPOs)
Quelle: Moos/Schneider, 2019, S. 106
Der oben dargestellten Abbildung sind die verschiedenen Finanzierungsquellen zu entnehmen, welche nach Innen- und Außenfinanzierung untergliedert sind. Dabei ist allerdings zu beachten, dass es sich bei Non-Profit-Organisationen in der Sozialwirtschaft um nicht gewinnorientierte Einrichtungen handelt.58 In stationären Pflegeeinrichtungen zählen dazu lediglich die Einrichtungen von öffentlichen oder freigemeinnützigen Trägern stammen (siehe Kapitel 2.1).
Eine dieser in der Abbildung dargestellten Außenfinanzierungsquellen wäre z.B. das sogenannte Sponsoring, wo der Einrichtung eine Leistung für eine gewisse Gegenleistung von einem Unternehmen gewährt wird.59 Die Gegenleistung kann dabei z.B. in Form von Werbemaßnahmen für das Unternehmen getätigt werden,60 sowie es z.B. vom Caritasverband in Krefeld geleistet wird.61
Als weitere Finanzierungsmöglichkeit ist es als NPO möglich, Geld- oder Sachspenden zu beziehen, welche im NPO-Sektor vor allem in der freien Wohlfahrtspflege als meistgenutzte Finanzierungsquelle verwendet wird.62 Eine Erweiterung der Spendenfinanzierung wäre das sogenannte Fundraising, womit eine professionelle Form der Spendenakquise beschrieben wird.63 Ähnlich wie beim Sponsoring ist hier das Ziel, Leistungen durch Marketingstrategien zu gewinnen, ohne, dass das Unternehmen eine Gegenleistung fordert.64 Weiterhin kann eine stationäre Einrichtung wie ein gewerbliches Unternehmen Bankkredite aufnehmen, wobei allerdings auch bei NPOs oder Sozialeinrichtungen gewisse Bedingungen im Rahmen eines Ratings gelten.65
Schließlich können stationäre Einrichtungen neben den o.g. privaten Zuschüssen auch öffentliche Zuschüsse bzw. Zuwendungen von Bund und Ländern erhalten. Diese dienen allerdings nur der Schließung von Finanzierungslücken, weshalb die sozialen Einrichtungen entsprechendes Eigenkapital nachweisen müssen.66 Mit den Zuwendungen können entweder sämtliche Aufgaben oder bestimmte Projekte der Einrichtung gefördert werden.67
3. Aktuelle Probleme und zukünftige Entwicklung
Nachdem nun alle wesentlichen Grundlagen zur Finanzierung der stationären Altenpflege erklärt worden sind, wird es in diesem Abschnitt darum gehen, die Entwicklung sowie die aktuelle Situation zur Finanzierung unter verschiedenen Aspekten zu erklären und daraus die entsprechenden Probleme und Herausforderungen herzuleiten. Des Weiteren soll prognostiziert werden, wie sich die Probleme ohne Handeln entwickeln könnten.
3.1 Einnahmen- und Ausgaben Entwicklung der Kostenträger
Zum Einstieg wird zunächst einmal betrachtet, wie sich die Einnahmen im Verhältnis zu den Ausgaben in der sozialen und privaten Pflegeversicherung entwickelt haben. Anschließend soll auch die Ausgabenentwicklung der Sozialhilfeträger dargestellt werden.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Einnahmen- und Ausgabenentwicklung SPV
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von BMG, Zugriff: 22.10.2024
Wie bereits zu Anfang in der Einleitung erwähnt wurde die Pflegeversicherung im Jahr 1994 als weitere Säule des Sozialversicherungssystems eingeführt. Die Leistungen der Pflegeversicherung verliefen zunächst so, dass zum 01. Januar 1995 zunächst einmal nur Beiträge in Höhe von 1% des versicherungspflichtigen Einkommens erhoben wurden, um einen Finanzpolster anzulegen.68 Erst ab dem 01. Juli 1996 wurden Leistungen für die vollstationäre Pflege in die entsprechenden Einrichtungen ausgezahlt.69
In der oben dargestellten Abbildung wird die jeweilige Entwicklung der gesamten Einnahmen und der Ausgaben graphisch von 1995 bis 2023 dargestellt. Dabei werden diese zur Vereinfachung in fünf Jahresabständen dargestellt, wobei nach 2020 nur das Jahr 2023 angegeben wird, da dann zum aktuellen Zeitpunkt die letzte vollständige Erhebung stattfand. Neben den Ausgaben für die stationäre Pflege werden ebenfalls auch die Gesamtausgaben abgebildet. Die in der Grafik dargestellten Werte basieren dabei auf den Zahlen zur Finanzentwicklung des Bundesministeriums für Gesundheit (siehe Anhang 1).
Zunächst ist zu erkennen, dass die Gesamteinnahmen in einem ähnlichen Verhältnis zu den Ausgaben in den abgebildeten Zeiträumen ansteigen. Bei den in der Grafik dargestellten Ausgaben für die stationäre Pflege sind neben der vollstationären Pflege ebenso die Ausgaben für die Tages- und Nachtpflege sowie Kurzzeitpflege und Vergütungszuschläge enthalten. Wie in der Grafik zu erkennen ist, übersteigen die Gesamteinnahmen diese jeweiligen Ausgaben um etwas mehr als das Doppelte. Müsste die soziale Pflegeversicherung mit denselben Einnahmen nur die Ausgaben für die stationäre Pflege abdecken, würde sie erhebliche Überschüsse erzielen, wodurch eventuell nur noch kleinere Beitragssätze gesetzt werden könnten oder auch eventuell ein größerer Teil zum einrichtungseinheitlichen Eigenanteil geleistet werden könnte. Allerdings kommen zu den Ausgaben für stationäre Pflege weiterhin noch Ausgaben in Form von Geldleistung, Pflegesachleistung, Ausgaben für Hilfsmittel usw. hinzu, die schließlich die Gesamtausgaben ausmachen. Nichtsdestotrotz ist zu erkennen, dass sich bis auf das Jahr 1995 die Gesamteinnahmen und -ausgaben in den jeweiligen Jahren auf nahezu gleicher Höhe befinden. Im Jahr 2000 und 2005 liegen die Ausgaben leicht über den Einnahmen, während in den abgebildeten Jahren danach die Einnahmen etwas über den Ausgaben liegen. Das bedeutet, dass die Höhe der Ausgaben nicht drastisch über der Höhe der Einnahmen liegt.
Es ist also festzuhalten, dass sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung stetig steigen. Jetzt könnte die Vermutung aufstellt werden, dass, wenn die Einnahmen in den abgebildeten Jahren auf ähnlicher Höhe mit den Gesamtausgaben liegen und nur eine leichte Abweichung vorliegt, sich diese langfristig durch die erzielten Einnahmeüberschüsse für die Jahre ausgleichen, an denen die Ausgaben über den Gesamteinnahmen liegen.
Wenn man nun für die gesamten Jahre von 1995 bis 2023 die jeweiligen Überschüsse zusammenrechnet, erhält man für die Überschüsse der Einnahmen eine Summe von insgesamt 18,79 Mrd.€. Die Summe für die Überschüsse der Ausgaben bzw. Defizite im selben Zeitraum liegt wiederum bei insgesamt 12,39 Mrd.€.70 Schlussfolgernd lässt sich also durchaus sagen, dass die steigenden Ausgaben mit den ebenso steigenden Einnahmen über einen längeren Zeitraum kompensiert werden können. Es ist in der Tat auch so, dass die soziale Pflegeversicherung dem Grundsatz der Beitragsstabilität unterliegt und sicherstellen muss, dass ihre Leistungsausgaben nicht die Einnahmen übersteigen.71
Die Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen von der Redaktion entfernt.
Abbildung 4: Beitragssatzentwicklung SPV
Quelle: vdek, Zugriff: 23.10.2024
Die Problematik besteht folglich darin, dass sich die steigenden Leistungsausgaben der sozialen Pflegeversicherung unmittelbar auf die Beiträge bzw. den Beitragssatz auswirken, die ein Mitglied zu zahlen hat. Die oben abgebildete Grafik stellt genau diese Auswirkung dar, indem gezeigt wird wie sich die Beitragssätze über die Jahre von 1995 bis 2023 erhöht haben. Das bedeutet, dass die Einnahmen über einen höheren Beitragssatz zu den jeweiligen Ausgaben ausgeglichen werden.
Um jetzt hervorheben zu können, wie sehr die Beitragssatzerhöhung eine Belastung für Beitragszahler bildet, ist es notwendig sich anschauen, wie sich das Einkommensniveau kurzfristig im Verhältnis zur Inflationsrate entwickelt. Hierzu betrachten wir die beiden Jahre 2022 und 2023. Im Jahr 2022 lag das Durchschnittsbruttoeinkommen bei insgesamt 4.244€ während es 2023 bei insgesamt 4.479€ lag.72 Nimmt man nun diese beiden Beträge und berechnet die jeweilige Einkommenssteigerung daraus, kommt man auf ein Ergebnis von 5,54%. Schaut man sich nun allerdings die Inflationsrate im Jahr 2023 an, dann ist zu sehen, dass diese im Vergleich zum Vorjahr 2022 mit 5,9% höher liegt als die oben berechnete Einkommenssteigerung.73 Da die Inflationsrate per Definition einen Preisanstieg und damit eine einhergehende Kaufkraftminderung darstellt,74 ist es aus Sicht des Beitragszahlers dramatisch, wenn das Einkommen nicht im selben Niveau ansteigt wie die Inflationsrate, die wie bereits beschrieben die durchschnittliche Kaufkraft absenkt. Wenn dann darauffolgend eine Beitragssatzerhöhung hinzukommt, wie es im Jahr 2023 der Fall war (siehe Abbildung 4), verringert es das Nettoeinkommen des Beitragszahlers noch weiter, was in jedem Fall eine Belastung darstellt.
In der privaten Pflegeversicherung lässt sich für den Zeitraum von 1997 bis 2022 ebenfalls eine stetige Ansteigung der Einnahmen und der Ausgaben erkennen.75 Allerdings liegen diese Ausgaben im Gegensatz zu denen der sozialen Pflegeversicherung in jedem Jahr weit unter den erzielten Einnahmen. Auch diese Entwicklung soll nun in der nachfolgenden Abbildung grafisch veranschaulicht werden.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Einnahmen- und Ausgabenentwicklung PPV
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Statista, Zugriff: 27.10.2024
Hier wurden zur Vereinfachung die Beträge der Einnahmen und Ausgaben von 1997 bis 2022 in drei Jahresabständen abgebildet und nach 2021 zusätzlich die Werte für das Jahr 2022 hinzugefügt. Die dargestellten Zahlen basieren hierbei auf den von Statista veröffentlichten Zahlen zur Entwicklung der Beitragseinnahmen und zur Entwicklung der Versicherungsleistung (siehe Anhang 2).
Es ist zu erkennen, dass die Einnahmen in einigen Jahren leicht schwanken, allerdings steigen diese langfristig sehr an. Dies ist vor allem in den Jahren 2018 bis 2022 zu erkennen. Dass es in der privaten Pflegeversicherung einen solch hohen jährlichen Überschuss gibt, lässt sich folgendermaßen erklären:
Schaut man sich beispielsweise das Jahr 2021 an, ist festzustellen, dass es zum Jahresende knapp fünf Millionen Pflegebedürftige gab.76 In der privaten Pflegeversicherung betrug die Anzahl der Leistungsempfänger im selben Jahr allerdings nur 292.520, während sie im darauffolgenden Jahr 311.580 betrug (siehe Anhang 3).77 In der gesetzlichen Krankenversicherung gab es 2021 und 2022 rund 57 Millionen beitragszahlende Mitglieder. Wie bereits in Punkt 2.3.3 erwähnt worden ist, sind diejenigen Mitglieder, die gesetzlich krankenversichert sind, auch in der sozialen Pflegeversicherung entsprechend versichert. Gleiches Prinzip gilt auch bei der privaten Krankenversicherung. Das bedeutet also, dass es in dem Zeitraum rund 57 Millionen Mitglieder in der sozialen Pflegeversicherung gab. Im selben Zeitraum gab es in der privaten Krankenversicherung rund 8,7 Millionen Versicherte und damit auch genauso viele privat Pflegeversicherte (siehe Anhang 4).78
Vergleicht man nun das jeweilige Verhältnis von Pflegebedürftigen zu Beitragszahlern, dann ist festzustellen, dass dies in der sozialen Pflegeversicherung etwas höher ist und somit auch die Ausgaben dort höher geprägt sind. Neben den 8,7 Millionen privat Versicherten, gab es 2022 ebenso 29,3 Millionen private Zusatzversicherungen, zu denen ein Teil auch auf private Pflegezusatzversicherungen fällt.79 Die Beitragseinnahmen der privaten Pflegeversicherung können auch außerdem höher sein als der zur Beitragsbemessungsgrenze angesetzte Höchstbeitrag in der sozialen Pflegeversicherung. Derzeit beläuft sich der Höchstbeitrag der privaten Pflegeversicherung auf 175,96€ im Monat,80 während der Höchstbeitrag der sozialen Pflegeversicherung mit einer Beitragsbemessungsgrenze in Höhe von 5.175€ ohne den Arbeitgeberanteil bei 119,03€ im Monat liegen würde und mit Kindern bei 87,98€ (siehe Kapitel 2.3.3). Vereinfacht gesagt ist die private Pflegeversicherung also etwas teurer als die soziale Pflegeversicherung.
Sowohl im Fall der sozialen als auch der privaten Pflegeversicherung sind Einnahmen- und Ausgabensteigerungen zu erkennen. Es lässt sich auch in der privaten Pflegeversicherung darauf schließen, dass diese Entwicklung über Beitragserhöhung kompensiert wird, wenn man die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung (siehe Abbildung 5) mit der stagnierenden Entwicklung der Versichertenanzahl in der privaten Krankenversicherung vergleicht (siehe Anhang 4). Ganz unabhängig davon, welcher Anteil der Ausgaben auf stationäre Pflegeeinrichtungen entfällt, müssen die Gesamtausgaben betrachtet werden, da die sozialen und privaten Pflegekassen über die stationäre Altenpflege hinaus mehr Leistungen tragen, wie z.B. Leistungen für ambulante Pflege, Pflegeberatung, Verwaltung etc. (siehe Anhang 1). Daher besteht die Herausforderung für die Pflegeversicherung auf jeden Fall darin, dass steigende Pflegeausgaben zwangsläufig über die Beitragseinnahmen wieder eingenommen werden müssen, um zahlungsfähig zu bleiben. Gleichzeitig ist dies für den Beitragszahler eine Herausforderung, wenn er aus seinem Einkommen höhere Beiträge zahlen muss, vor allem wenn sein Einkommen, wie bereits erwähnt, nicht im selben Verhältnis steigt wie die Beitragssätze bzw. die zu zahlenden Beiträge.
Schließlich soll nun betrachtet werden, wie es bei den Leistungsausgaben der Sozialhilfe nach SGB XII aussieht. Wie bereits in Kapitel 2.3.2 zahlen die Träger der entsprechenden Sozialhilfe eine gewisse Leistung an Bedürftige, womit sie als Kostenträger ebenfalls an der Finanzierung beteiligt sind. Nachfolgend sollen nun auch hier die Ausgaben der Sozialhilfe graphisch dargestellt werden.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Leistungsausgaben der Sozialhilfe nach SGB XII
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Destatis, Zugriff: 29.10.2024
Auch hier basieren die Zahlen auf der Erhebung des statistischen Bundesamts (siehe Anhang 5). Dargestellt werden zunächst die Bruttoausgaben für Pflegehilfe nach dem siebten Abschnitt des SGB XII neben den Gesamtausgaben der Sozialhilfe nach SGB XII. Auffällig ist hierbei, dass die Ausgaben für die Hilfe zur Pflege im Vergleich zu den Gesamtausgaben der Sozialhilfe noch relativ gering ausfallen. Dies ist vor allem an dem Anstieg der Gesamtausgaben von 2005 bis 2019 zu erkennen, die im Verhältnis zu den Ausgaben zur Pflegehilfe entsprechend stärker angestiegen sind. Allerdings sollte dies nicht vom Schein trügen, dass die Ausgaben für Pflegehilfe konstant geblieben wären, denn diese sind ebenfalls durchaus gestiegen. Bei näherer Betrachtung ist sogar festzustellen, dass die Ausgaben der Sozialhilfeträger im Bereich der Pflegehilfe höher sind als die Ausgaben der privaten Pflegeversicherung (siehe Abbildung 5). Es lässt sich anhand der Ausgaben für Pflegehilfe nicht genau feststellen, welcher Anteil an stationäre Pflegeeinrichtungen geht. Jedoch lässt sich darauf schließen, dass das meiste dieser Ausgaben an stationäre Einrichtungen fließen, dadurch, dass sich die meisten Leistungsempfänger in stationären Einrichtungen befinden (siehe Anhang 6).
Es lässt sich schließlich festhalten, dass alle genannten Kostenträger bzw. Leistungsträger von steigenden Ausgaben betroffen sind, die sich zum Teil darauf auswirken, dass der Leistungsempfänger höhere Beiträge zahlen muss. Diese sind für die Kostenträger nicht nur notwendig, sondern sie sind dazu auch gesetzlich verpflichtet die Beitragseinnahmen ggf. zu erhöhen, um ihre Zahlungsfähigkeit als Kostenträger aufrechtzuerhalten.81 Die Träger der Sozialhilfe werden wie bereits erwähnt, aus Steuermitteln finanziert und erheben somit keine Beiträge, allerdings müssen auch sie bei Bedarf Leistungen gewähren, dessen gesamte Ausgabenhöhe stetig steigt, wie in Abbildung 6 zu sehen ist. Die zentralen Probleme bestehen demnach darin, dass alle Beitragszahler immer mehr aufwenden müssen und die Leistungsträger ohne Anpassung der Beitragssätze an die Grenzen ihrer Zahlungsfähigkeit stoßen.
In Anbetracht der dargestellten und erläuterten Einnahmen- und Ausgabensteigerungen der Kostenträger ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass diese noch weiter steigen werden. Im Fall der sozialen Pflegeversicherung ist damit mit weiteren Beitragssatzerhöhungen zu rechnen, da vor allem die Auswirkungen der Beitragssatzdifferenzierung nach Kinderanzahl von der neuesten Pflegereform, dem Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz, noch unklar sind.82 Auch durch die Anpassung des Eigenanteil-Zuschlags nach §43c SGB XI sind enorme Mehrausgaben zu erwarten.83
Daher ergeben sich verschiedene Prognosen bezüglich der zukünftigen Beitragssatzentwicklung. Eine eher pessimistische Prognose geht von zwei verschiedenen Szenarien aus.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Prognose über die Beitragssatzentwicklung
Quelle: Bahnsen, 2024, S. 5
Im ersten Szenario (Kostendruckszenario A) ist davon auszugehen, dass die Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung bis 2028 unter verschiedenen Dynamisierungen ansteigen werden und ab 2029 dann jährlich um fünf Prozent Dynamisierung weiter ansteigen.84 Diese Annahme beruht vor allem auf den Leistungsausweitungen der vergangenen Pflegereformen. Im zweiten Szenario (Kostendruckszenario B) wird bereits zu Anfang der Projektion mit einer jährlichen Dynamisierung von fünf Prozent gerechnet, sodass sich für dieses Szenario höhere Beitragssätze ergeben.85
Diese Entwicklungen sind rein hypothetisch und liefern keine präzise Aussage darüber, wie sich die Beitragssätze tatsächlich entwickeln werden, liefern allerdings eine Tendenz, in welche Richtung es gehen könnte, was im schlimmsten Fall die wäre, dass diese im Jahr 2040 bei sechs Prozent Beitragssatz lägen (siehe Abbildung 7). Es ist in beiden Berechnungen ebenso die Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen, welche in der Abbildung durch die grauen Schattierungen dargestellt wird. Bei einer eher jüngeren Bevölkerung lägen die Beiträge tendenziell am oberen Rand der Skala, wohingegen sie bei einer eher älteren Bevölkerung am unteren Ende zu finden wären.
3.2 Steigerung der Eigenanteile
Nicht nur für die Leistungsträger sind Kostensteigerungen festzustellen, sondern diese sind auch in den stationären Einrichtungen selbst seit der ersten Pflegestatistik 1999 kontinuierlich zu beobachten.86
In Kapitel 2.3.2 wurde bereits erläutert, dass es neben den Leistungen der Pflegeversicherung einen Betrag gibt, der vom Pflegebedürftigen selbst getragen wird, welcher im Grunde sämtlichen Kosten der Einrichtung entspricht, die über die Leistungen der Pflegeversicherung hinausgeht. Die Leistungssätze der Pflegeversicherung haben sich in den Jahren zwischen 1995 und 2008 nicht erhöht. Lediglich in den Jahren 2009 bis 2013 sind die Leistungssätze der Pflegestufe 3 vom ehemaligen Pflegestufensystem schrittweise angehoben worden.87 Auch die Leistungsbeträge für die jeweiligen Pflegegrade sind seit 201788 dieselben Beträge, die die Pflegeversicherung aktuell leistet (siehe Kapitel 2.2).
Dies bedeutet also, dass sich die Leistungshöhe der Pflegeversicherung in der Vergangenheit kaum verändert hat, während die Kosten der Einrichtungen dennoch weiter anstiegen.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Kostensteigerung der stationären Pflege
Quelle: Rischard, 2019, S. 186
In der abgebildeten Grafik sind die durchschnittlichen jährlichen Kostensteigerungen im Zeitraum von 1995 bis 2015 der stationären Einrichtung pro Region in Deutschland dargestellt.
Ebenso ist links in der Grafik die durchschnittliche Steigerung für ganz Deutschland in dem Zeitraum angegeben, wo neben der Kostensteigerung auch die jährliche Inflationsrate und Leistungssteigerung der sozialen Pflegeversicherung zu sehen sind. Daran ist deutlich zu erkennen, dass die Kosten für die Pflege in stationären Einrichtungen im Durchschnitt stärker angestiegen sind als die Inflationsrate und die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung.
Dies lässt sich darauf schließen, dass die Kostensteigerungen der Einrichtungen hauptsächlich zu Lasten der Pflegebedürftigen fallen, da diese durch steigende Eigenanteile wieder aufgebracht werden müssen.89 Besonders für Pflegebedürftige aus dem Saarland oder aus Thüringen ist dies besonders belastend. Dies führt folglich dazu, dass immer mehr Menschen auf Sozialhilfe angewiesen werden, obwohl eigentlich die Anzahl an Leistungsempfängern der Sozialhilfe mit der Einführung der Pflegeversicherung reduziert werden sollte.90
3.3 Demographischer Wandel und Bedeutung für die Finanzierung
Der demographische Wandel definiert „die Veränderung der Alterszusammensetzung in einer Gesellschaft, die z.B. durch Naturkatastrophen, Kriege oder Veränderungen der Geburtenrate“ bedingt werden.91 Zur heutigen Zeit ist im Zuge des demographischen Wandels von der sogenannten „demographischen Wende“ die Rede. Hiermit ist die Zeit nach dem Jahr 2000 gemeint, in der die Anzahl der über 60-Jährigen in Deutschland erstmals die Anzahl der über 20-Jährigen übersteigt.92 Sowohl die absolute als auch die relative Anzahl an älteren Menschen im Verhältnis zu den jüngeren Menschen steigt durch höhere Lebenserwartung und anhaltenden Geburtendefizit an.93
Dieser Wandel hat Auswirkungen auf die Ausgaben für die Pflege, insbesondere auf denen der sozialen Pflegeversicherung. Denn durch den demographischen Wandel wird zukünftig auch die Anzahl an Pflegebedürftigen weiter steigen.94
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 9: Pflegevorausberechnung bis 2070
Quelle: Statistisches Bundesamt, Zugriff: 01.11.2024
Die oben abgebildete Grafik stellt die vorausberechnete Entwicklung der Pflegebedürftigen Anzahl unter zwei verschiedenen Varianten dar. Die erste Variante mit dem blauen Graph stellt eine etwas moderatere Entwicklung gemäß der Annahme dar, dass die Anzahl der Pflegebedürftigen allein durch die demographisch bedingte Alterung konstant ansteigen wird.95 Die zweite Variante mit dem roten Graphen stellt die Entwicklung gemäß der Annahme dar, dass die Anzahl der Pflegebedürftigen durch die Effekte des in 2017 erweiterten Pflegebedürftigkeitsbegriffs noch stärker ansteigen wird.96 Dabei wird davon ausgegangen, dass dieser Anstieg bis zum Jahr 2027 andauern wird und danach, wie die erste Variante, konstant ansteigt.97 Nach letzterer Berechnung steigt die Anzahl der Pflegebedürftigen bis 2070 auf etwa 7,7 Mio. Das entspräche einer Erhöhung um 2,7 Mio. Pflegebedürftige bzw. einer Erhöhung um 54% entsprechend der Ausgangshöhe von fünf Millionen Pflegebedürftigen im Jahr 2020.
Langfristig wird diese Entwicklung die Kosten der sozialen Pflegeversicherung noch stärker erhöhen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Erhöhung der Pflegebedürftigen um 54% keine Erhöhung der Pflegebedürftigen um denselben Prozentsatz bewirkt, da hierzu Faktoren wie Inflation, Leistungsverbesserungen und Pflegereformen mitberücksichtigt werden müssen.98 Daher lässt sich nicht genau vorhersagen, wie hoch die Ausgaben sein werden. Ebenso wenig lässt sich aussagen, wie hoch der Anteil für stationäre Einrichtungen sein wird, dadurch dass der Anteil der Pflegeausgaben an die stationären Einrichtungen über den Zeitraum von 1995 bis 2023 etwas abgenommen hat (siehe Abbildung 3).
Der demographische Wandel hat allerdings nicht nur drastische Auswirkungen auf die Ausgaben der Pflegeversicherung, sondern auch auf die Beitragseinnahmen. Neben der steigenden Lebenserwartung verringert sich, wie bereits erwähnt, die Geburtenrate. Dies führt in der sozialen Pflegeversicherung dazu, dass immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter da sind, um entsprechende Beiträge in die Pflegeversicherung einzahlen zu können.99 Da die private Pflegeversicherung mit ihrem kapitalgedeckten Finanzierungssystem für einen solchen demographischen Wandel aufgebaut ist, besteht das Problem hauptsächlich für die soziale Pflegeversicherung, die mit ihren Umlageverfahren einer großen Herausforderung ausgesetzt sind.100
Im Großen und Ganzen lässt sich damit schließlich sagen, dass in der sozialen Pflegeversicherung die Einnahmen sinken, während die Ausgaben steigen. Dies stellt langfristig ohne Handeln eine große Hürde für die soziale Pflegeversicherung dar.
3.4 Auswirkung der Pflegereformen auf die Finanzierung
Seit der Einführung der Pflegeversicherung 1994 gab es bis heute einige Reformen bezüglich der pflegerischen Versorgung, die allerdings auch einen wesentlichen Beitrag zu den Auswirkungen auf die Finanzierung geleistet hatten.
3.4.1 Leistungsbezogene Reformen
Unter anderem relevant für die stationäre Versorgung war zunächst das PflegeWeiterentwicklungsgesetz, welches 2008 in Kraft trat.101 Dies war die erste große Reform seit Einführung der Pflegeversicherung, die im Wesentlichen höhere Leistungssätze beinhaltete, insbesondere für Menschen, die aufgrund einer demenziellen Erkrankung auf besondere Betreuung angewiesen waren.102 Dieses Gesetz führte erstmalig zu einer Beitragssatzerhöhung um 0,25% (siehe Punkt 3.2), um die erhöhten Leistungen der sozialen Pflegeversicherung auszugleichen.103
Nach dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz folgten die Pflegestärkungsgesetze. Mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz, welches im Jahr 2015 in Kraft trat, wurden die Leistungen der Pflegebedürftigen ausgebaut, sodass z.B. Demenzerkrankte in der teilstationären Pflege oder Kurzzeitpflege Leistungen erhielten, die sie zuvor nicht bekamen.104 Im selben Jahr wurden auch gleichzeitig die Beitragssätze um insgesamt 0,3% angehoben (siehe Abbildung 4). In Hinblick auf den demographischen Wandel wurde mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz außerdem ein Pflegevorsorgefonds angelegt, bei dem jährlich 0,1% der Beiträge zugelegt werden sollen, um absehbare Beitragssteigerungen abzumildern.105 Zwei Jahre später trat das zweite Pflegestärkungsgesetz in Kraft (siehe Punkt 2.3.2). Mit diesem Gesetz folgte, wie bereits erwähnt, eine komplette Umstrukturierung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs, indem man die ehemaligen Pflegestufen abschaffte und dafür die Pflegegrade einführte. Zuvor gab es insgesamt 4 Pflegestufen, nämlich die Pflegestufen 0-4.106 Die Leistungen für die Pflegebedürftigen der ehemaligen Pflegestufen sah in der stationären Versorgung dabei folgendermaßen aus:
In der Kurzzeitpflege gab es für jede Pflegestufe einen Anspruch auf bis zu 1.612€ im Monat, wobei die Kurzzeitpflege auf maximal 4 Wochen pro Kalenderjahr beschränkt war.107 In der teilstationären Pflege gab es für Pflegebedürftige der Pflegestufe 0 einen Anspruch auf bis zu 231€ monatlich, für die Pflegestufe 1 bis zu 689€, die Pflegestufe 2 erhielt Anspruch auf bis zu 1.298€ und die Pflegestufe 3 insgesamt 1.612€ monatlich.108 In der vollstationären Pflege gab es schließlich für die Pflegestufe 0 ähnlich wie beim Pflegegrad 1 des heutigen Systems keine Leistung der Pflegeversicherung. Für die Pflegestufe 1 hingegen leistete die Pflegeversicherung eine Pauschale von 1.064€ pro Monat, während sie für die Pflegestufe 2 insgesamt 1.330€ und schließlich bis zu 1.995€ für Pflegestufe 3 leistete.109
Vergleicht man schließlich die Leistungen der ehemaligen Pflegestufen mit den heutigen Pflegegraden (siehe Punkt 2.2), dann ist festzustellen, dass die Leistungen der Pflegegrade deutlich höher geworden sind. Auch im Jahr 2017 sind damit die Beitragssätze um 0,2% angestiegen.110 Der Zweck dieser Reform besteht unter anderem darin, das Pflegesystem zu verbessern und für gleichberechtigten Zugang der Leistungen für die Pflegebedürftige zu sorgen.111 Ebenso sollte durch den einrichtungseinheitlichen Eigenanteil dafür gesorgt werden, dass die finanzielle Belastung für Pflegebedürftige mit einem höheren Pflegegrad nicht mehr länger die der Pflegebedürftigen mit einem geringeren Pflegegrad übersteigen soll.112 Allerdings hat diese Reform auch tatsächlich dazu geführt, dass die Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung höher wurden als erwartet.113 Die Ausgaben seien bis zum Zeitpunkt 2019 um etwa 10 Mrd. € gestiegen, nachdem es im Jahr 2017 hieß, dass die soziale Pflegeversicherung ihr größtes Defizit in Höhe von 2,4 Mrd. € zu dem Zeitpunkt erzielt habe.114
Zuletzt gab es als weitere Reform das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz im Jahr 2023.115 Für die stationäre Pflege sah die Reform vor, dass die Leistungszuschläge zu den Eigenanteilen etwas ansteigen, um die pflegebedürftigen Bewohner weiter zu entlasten116 (siehe Kapitel 2.3.2). Außerdem sollen die Beitragssätze für Mitglieder unter 25 Jahren differenziert werden, je nachdem, wie viele Kinder sie haben. Während bei einem Kind der allgemeine Beitragssatz von 3,4% gleichbleibt, sind es bei fünf und mehr Kindern nur 2,4% mit einem Arbeitnehmeranteil von 0,7%.117 Dementsprechend würde die soziale Pflegeversicherung weniger Einnahmen erzielen. Da aber im Durchschnitt sowohl Mann als auch Frau das erste Kind bei einem Alter über 30 bekommen, dürfte das keine zu hohen Auswirkungen haben.118
Es wird hiermit also deutlich, dass all die genannten Reformen zwar verbesserte Leistungen für alle Beteiligten mit sich bringen sollen, jedoch gehen diese eindeutig zu Lasten der Pflegeversicherung, die diese zusätzlichen Ausgaben wiederum an die Beitragszahler durch höhere Beitragssätze weitergibt. Es lässt sich darauf schließen, dass die nachhaltige Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung darin besteht, die Beitragssätze so weit anzuheben, dass die Ausgaben wieder ausgeglichen sind, anders als dies in der privaten
Pflegeversicherung der Fall ist. Dies ist schließlich der Preis für eine verbesserte Pflegeversorgung der Pflegebedürftigen.
3.4.2 Personalbezogene Reformen
Neben den bisher genannten Reformen, bei denen es sich eher um Leistungsverbesserungen und höhere Leistungssätze handelte, gibt es ebenso Reformen, die konkret Anpassungen bezüglich der Lage des Pflegepersonals betreffen. Eine dieser Reformen ist das PflegepersonalStärkungsgesetz, welches im Jahr 2019 in Kraft trat.119
Seit geraumer Zeit ist es so, dass im Bereich der Altenpflege Fachkräfteengpässe bestehen, die sich besonders in den Jahren zwischen 2011 und 2018 verschärft haben.120 Um diese Engpässe zu beheben, sollten im Rahmen des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes 13.000 neue Stellen für die Altenpflege geschaffen werden. Konkret bedeutet das, dass jede zusätzliche Stelle von den Kostenträgern refinanziert wird.121 Bei Einrichtungen mit bis zu 41 zu versorgenden Bewohnern wird z.B. eine halbe Stelle refinanziert während bei 41 bis 80 Bewohnern wiederum eine ganze Stelle refinanziert wird.122 Bzgl. der finanziellen Auswirkung war vorgesehen, dass sich die soziale Pflegeversicherung bis 2022 mit Mehrausgaben von insgesamt 900 Mio. € beteiligt, wovon 640 Mio. € für Pflegeeinrichtungen vorgesehen waren. Die private Pflegeversicherung hingegen beteiligte sich anteilig mit insgesamt 44 Mio. €.123
Bezüglich Fachkräfteengpässe ist es abseits der Reform außerdem so, dass die Einrichtungen oft auf Leiharbeitskräfte zurückgreifen müssen, um den Personalbedarf auszugleichen. Diese Leiharbeitskräfte sind dabei oft teurer als das eigene Personal.124 Es wird hier also deutlich, dass der Fachkräftemangel im Bereich der Altenpflege zu mehr Kosten führt, sowohl für die Einrichtungen selbst als auch für die Pflegeversicherungen wie an der Reform zu sehen ist.
Im selben Jahr wurde ansonsten ebenfalls das sogenannte Pflegelöhneverbesserungsgesetz herausgebracht, was darauf abzielte, durch Tarifvereinbarungen zwischen der ver.di und der BVAP, die Löhne, Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten etc. zu verbessern.125 Dazu wird im Rahmen des Gesetzes u.a. vorgesehen, dass eine fairere Bezahlung des Pflegepersonals entweder durch branchenweite Tarifverträge oder durch Mindestlöhne bewirkt werden kann.126 Dies soll selbstverständlich die Standards in Einrichtungen verbessern und bessere Bedingungen für das Personal bringen, allerdings bedeutet auch dies wieder höhere Kosten für die Einrichtungen, die am Ende ausgeglichen werden müssten.
Eine weitere Reform, was unter anderem das Personal betrifft, wäre das im Jahr 2021 in Kraft getretene Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung.127 Auch mit dieser Reform ging es im Wesentlichen darum, das Problem des Fachkräftemangels schrittweise zu beheben, indem man in stationären Pflegeeinrichtungen einen Personalschlüssel für die Pflegekräfte einführt.128 Je nach Anzahl und Pflegegrad der pflegebedürftigen Bewohner wird der Bedarf an Pflegepersonal berechnet.129 Ein weiterer Punkt der Reform war eine tarifvertragliche Regelung bzw. ein weiteres Gesetz, das im Jahr 2022 in Kraft trat. Bei dieser Regelung durften die Pflegeversicherungen nur noch mit den Einrichtungen einen Versorgungsvertrag abschließen, wenn in diesen entweder ein tarifvertragliches oder ein nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen festgelegtes Arbeitsentgelt für das Personal vorliegt.130 Es handelt sich hierbei konkret um das sogenannte Tariftreue-Gesetz, bei welchen die Einrichtungen bzw. die Träger ihre jeweiligen Pflege- und Betreuungskräfte nach einem Tarif entlohnen müssen, der am Tarif eines anderen Trägers angelehnt ist.131 Dazu wurden auch Mindestlöhne für ungelernte und gelernte Pflegehilfskräfte sowie Pflegekräfte festgelegt.132 In der Konsequenz führen diese Lohnanpassungen dazu, dass neue Kosten- bzw. Pflegesätze verhandelt werden, sodass diese wiederum auf die Kostenträger und auf die pflegebedürftigen Bewohnern umgelagert werden und der Eigenanteil sich dadurch erneut erhöht.133
Die Auswirkungen davon liegen hier darin, dass sich der Beitragssatz erhöht, wobei sich in diesem Fall der Kinderlosenzuschlag von bisher 0,25% auf 0,35% erhöht.134 Ebenso steigt die Leistung der Kurzzeitpflege von bisher 1.612€ auf 1.774€.135 Bei der Personalbemessung bzw. dem Personalschlüssel ist zu beachten, dass das Problem des Fachkräftemangels trotz dieser Regelung bestehen bleiben wird, da es hierbei eher um die Pflegequalität geht.136 Wie bereits erwähnt kann dies bedeuten, dass eine Einrichtung zwangsläufig auf Zeitarbeit zurückgreifen muss. Wenn allerdings kein ausreichendes Personal gefunden wird, kann dies im schlimmsten Fall bedeuten, dass eine Einrichtung einige Plätze stilllegen muss, was dazu führt, dass weniger pflegebedürftige Bewohner versorgt werden können.137 In Anbetracht der Kostenlage der stationären Einrichtungen (siehe Kapitel 3.2), könnten dadurch essenzielle Einnahmen verloren gehen.
Hier wird deutlich, dass auch der Fachkräftemangel sich auf die Finanzierung auswirken kann. Die beiden genannten Reformen zeigen hierzu den Kostenaufwand, den es mit sich bringt, sowohl für die Einrichtungen als auch für die Pflegeversicherung. Konkrete Ansätze, die Ausgaben oder Beitragssätze einigermaßen stabil zu halten, sind eine Sache, welche die vergangenen Pflegereformen bis auf die Errichtung eines Vorsorgefonds noch nicht geleistet haben.
3.5 Finanzierungslücke innerhalb der Pflegeeinrichtungen
Bisher wurden die steigenden Ausgaben bzw. steigenden Kosten seitens der Kostenträger und der Pflegeeinrichtungen thematisiert. Dabei wurde u.a. aufgezeigt, wie stark die Kostensteigerungen in den Pflegeeinrichtungen in verschiedenen Regionen ausgeprägt sind (siehe Abbildung 7). Trotz dessen, dass die pflegebedürftigen Bewohner für den Differenzbetrag aus den Gesamtkosten der jeweiligen Einrichtungen und Leistungsausgaben der Pflegeversicherungen über die Eigenanteile aufkommen müssen, gibt es viele Einrichtungen, die in die Insolvenz abtauchen. Allein im Jahr 2023 wurden bis Mitte Dezember insgesamt 783 Insolvenzen und Schließungen verzeichnet.138 Das sind täglich zwei Einrichtungen, die entweder Insolvenz beantragen oder komplett schließen müssen.139 Diese Insolvenzen sind dabei auf Zahlungsverzögerungen, nicht refinanzierte Kostensteigerungen und Umsatzrückgänge aufgrund des Fachkräftemangels zurückzuführen.140
Es wird hiermit deutlich, dass steigende Eigenanteile allein nicht immer ausreichen, um die Kosten einer Einrichtung zu decken bzw. um ihre Zahlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.
4. Mögliche Lösungsansätze und Reformvorschläge
Auf Basis der im letzten Kapitel beschriebenen Herausforderungen und zukünftigen Entwicklungen der Altenpflegefinanzierung wie u.a. die steigenden Ausgaben der Kostenträger oder die steigenden Beitragssätze, die insbesondere durch den Einfluss des demographischen Wandels hervorgerufen werden, soll es in diesem Kapitel nun schließlich darum gehen, für diese anhaltenden Probleme mögliche Lösungsansätze zu formulieren. Es kann sich dabei entweder um kleinere Anpassungen oder um konkrete Reformvorschläge handeln, sodass für Kostenträger und Pflegebedürftige eine etwas stabilere Ausgaben- bzw. Beitragssatzstabilität vorliegt. Gleichzeitig sollen die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile für die Pflegebedürftigen finanzierbarer werden, sodass sie etwas weniger abhängig von den Sozialhilfeträgern werden.
4.1 Pflege-Bürgerversicherung
Bei der sogenannten Pflege-Bürgerversicherung handelt es sich um ein einheitliches Versicherungssystem, welches sowohl die Versicherten der sozialen- als auch der privaten Pflegeversicherung einschließt.141 In Kapitel 2.3.3 wurden bereits die Unterschiede beider Versicherungsformen hinsichtlich ihres Aufbaus, ihrer Beitragseinnahmen und ihrer Leistungen beschrieben. Die Etablierung einer Pflege-Bürgerversicherung zielt darauf hinab, eine Angleichung einer Versicherungsform hervorzubringen, die entweder an die Form der sozialen Pflegeversicherung angelehnt ist oder aber auch an die Form der privaten Pflegeversicherung.142
Hierzu wäre in jedem Fall die Überlegung aufzustellen, wie eine Umsetzung erfolgen könnte, da es einige Faktoren gibt, die dabei eine Rolle spielen. Ein Aspekt, der z.B. berücksichtigt werden müsste, wäre die Frage, was mit den Altersrückstellungen der privaten Pflegeversicherung geschehen würde bei der Einführung einer solchen Pflege- Bürgerversicherung.143 Unter dem Aspekt könnte es dann Sinn machen, eine PflegeBürgerversicherung mit dem System einer kapitalgedeckten Finanzierung zu kombinieren, sodass auch die bisherigen Altersrückstellungen beibehalten bzw. ins System der PflegeBürgerversicherung aufgenommen werden können und auch weitere Rückstellungen dann auch für diejenigen gebildet werden können, die vorher in der sozialen Pflegeversicherung waren. Ansonsten könnte auch die Überlegung getroffen werden, eine stärkere Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze zu setzen, sofern die Beiträge einkommensabhängig eingenommen werden würden.144 Dies könnte eventuell zu einer Beitragssatzstabilität führen, da vor allem nicht mehr befürchtet werden müsste, dass Versicherte abwandern werden, weil es nur noch ein System geben würde.
4.2 Private Vorsorgemodelle
Statt sich nur von der Pflegeversicherung oder der Sozialhilfe abhängig zu machen, könnte ein weiterer möglicher Lösungsansatz darin bestehen, sich privat absichern zu lassen, was durch verschiedene Optionen möglich ist. Einerseits gibt es in vielen Betrieben die Möglichkeit, neben der gesetzlichen Rente, eine betriebliche Altersvorsorge zu vereinbaren, um daraus am Ende eine sogenannte Betriebsrente zu beziehen.145 Andererseits könnte diese betriebliche Altersvorsorge mit einer privaten Vorsorge kombiniert werden, sodass man am Ende im Rentenalter noch zusätzliche Einnahmen erhält, die im Falle einer künftigen Pflegebedürftigkeit in einer stationären Einrichtung zu den Eigenanteilen beitragen kann.
Eine Möglichkeit einer privaten Vorsorge wäre das Abschließen einer privaten Rentenversicherung neben der gesetzlichen Rentenversicherung. Die daraus bezogene Rente kann in zwei verschiedenen Formen vertraglich abgeschlossen werden: Die erste Form wäre die aufgeschobene Rente, wo die Rentenzahlung erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnt, während die sogenannte sofort beginnende Rente nach einem Einmalbetrag sofort bezogen werden kann.146 Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, sich durch eine Kapitallebensversicherung absichern zu lassen, bei der im Falle eines Todesfalls der versicherten Person ein garantierter Rentenbetrag an eine bezugsberechtigte Person ausgezahlt wird.147 Für beide der genannten Optionen gibt es allerdings auch die Möglichkeit, diese in Investmentfonds anzulegen, in der die Versicherten selbst bestimmen können, in welche Fonds sie investieren können aber das Risiko für die Ertragslage selber tragen müssen.148 Man müsste für diese bereits vorhandenen Optionen einer privaten Vorsorge im Wesentlichen dafür sorgen, dass genügend Menschen dazu sensibilisiert werden, eine solche Vorsorge abzuschließen, was die Finanzierbarkeit einer künftigen Pflegebedürftigkeit stärken könnte. Hierzu will das Bundesministerium der Finanzen das System der privaten Altersvorsorge reformieren.149 Die Altersvorsorge soll hierzu einfacher, transparenter und attraktiver gestaltet werden. Es sollen außerdem kostengünstige und renditestarke Angebotsmöglichkeiten mit mehr Ertragschancen geben.150
4.3 Generationenvertrag der PKV
Auch der Verband der privaten Krankenversicherung hat für die aktuellen Herausforderungen bezüglich der Finanzierung in der Pflegeversicherung ein Konzept präsentiert, welches darauf hinzielt, die Leistungsausgaben sowie die Beitragssätze zu stabilisieren.151 Dies soll in Rahmen eines sogenannten Generationenvertrages geschehen, worin folgende drei Gestaltungsoptionen vorliegen:
Die erste Gestaltungsoption besteht darin, dass Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung nur noch in dem Maße wachsen sollen, wie auch die Einnahmen wachsen. Das bedeutet, dass die Leistungen so angepasst bzw. dynamisiert werden müssten, dass sie unterhalb der Einnahmenentwicklung liegen.152 Die zweite Gestaltungsoption sieht vor, dass es überhaupt keine Dynamisierung bezüglich der Leistungen geben sollte, womit die Ausgaben dauerhaft weniger stark ansteigen würden und der Beitragssatz damit stabil bleiben würde.153 Die dritte Gestaltungsoption würde ähnlich aussehen wie die zweite Option, allerdings mit den Unterschied, dass die älteren Pflegebedürftigen einen Zuschuss zu den steigenden Pflegekosten gewährt bekämen. Auch damit würden die Beitragssätze stabil bleiben, jedoch nicht im selben Ausmaß wie in der zweiten Gestaltungsoption.154 Jedes dieser drei genannten Gestaltungsoptionen zielt darauf ab, dass sich die Pflegebedürftigen durch eigene private Vorsorge wie z.B. über Zusatzversicherungen eigenverantwortlich selbst absichern müssen, sodass die Leistungsausgaben und Beitragssätze stabil bleiben und sie trotzdem vollumfänglich für die Kosten in einer stationären Einrichtung aufkommen können.155
4.4 Weitere mögliche Maßnahmen
Andere Ansätze zur Lösung der Finanzierungsprobleme könnten allerdings auch durch kleinere Anpassungen der aktuellen Pflegeversicherung entstehen. Ähnlich wie das mit den Gesundheitsfonds in der gesetzlichen Krankenversicherung geschieht156 könnten z.B. die bisherigen Beitragseinnahmen der Pflegeversicherung mit Steuermittel bzw. einer Ausweitung von Steuermitteln ergänzt werden. Laut eines Gutachtens der AOK könnten systematische Ausweitungen von Steuermitteln die Beitragssätze über einen längeren Betrachtungszeitraum um durchschnittlich 0,5 Prozentpunkte entlasten.157
Auf Basis des demographischen Wandels und der damit immer weiter ansteigenden Anzahl an Pflegebedürftigen, wäre ein weiterer Lösungsansatz ebenso denkbar, dass die Pflegeversicherung in Zusammenarbeit mit der gesetzlichen Krankenversicherung gezielte Präventionsmaßnahmen einleitet, sodass eine Aufnahme in eine stationäre Einrichtung verhindert werden kann, was folglich dazu führen könnte, dass die Ausgaben der Pflegeversicherung stabilisiert werden könnten, wenn die Präventionsmaßnahmen erfolgreich durchgeführt werden können.158
Die Chancen einer Kostenreduktion innerhalb der stationären Einrichtungen können ebenso durch die Förderung der Digitalisierung ermöglicht werden, welches auch eines der Ziele ist, die mit der Digitalisierung verfolgt werden.159 Eine Maßnahme hierzu wäre z.B. die, dass Dokumentationen langfristig nur noch digital ablaufen sollen und damit papiergebundene Dokumentationen vollständig wegfallen.160 Eine weitere Möglichkeit, die Arbeitseffizienz und die damit verbundenen Kosten zu senken, wäre die Förderung des Einsatzes von robotischen Systemen im Bereich der Telepflege. Damit sind Systeme gemeint, die u.a. durch Sensoren jeweils Vitalfunktionen und Gefährdungssituationen bei pflegebedürftigen Bewohnern überwachen können.161 Auf ähnliche Art und Weise kann der Einsatz von Wearables in Form von Smartwatches o.Ä. zu einer Effizienzsteigerung beitragen, indem sie routinemäßig und automatisiert die Vitalparameter der Pflegebedürftigen erfassen.162
5. Empirische Untersuchung
In den letzten Kapiteln wurden nun alle wesentlichen Grundlagen zur Finanzierung in der stationären Altenpflege sowie die Entwicklung und die Herausforderungen bzw. Probleme davon benannt und erläutert. Weiterhin wurden im letzten Kapitel zu den genannten Herausforderungen ein paar mögliche Lösungsansätze formuliert, um die Herausforderungen nachhaltig zu bewältigen. Auf dieser Basis soll es in diesem Abschnitt der Arbeit jetzt darum gehen, empirisch zu analysieren, welche der genannten Lösungsansätze unter welchen Bedingungen bzw. welcher Modifikation in der Realität auch tatsächlich zur Lösung der Herausforderungen bzw. zur Beantwortung der ausgangs gestellten Forschungsfrage angewendet werden sollten.
5.1 Forschungsdesign
Um der Frage nach den idealen Lösungsansätzen zu den derzeitigen Herausforderungen in der Pflegefinanzierung nachzugehen und sie beantworten zu können, wird in dieser Arbeit die qualitative Forschungsmethode bzw. Inhaltsanalyse nach Mayring angewendet. Das bedeutet, dass hier im Gegensatz zur quantitativen Forschungsmethode keine konkreten Zahlenbegriffe oder Statistiken ausgewertet werden, sondern die zu ermittelnden Resultate werden ausschließlich in Worte gefasst und ausgewertet.163 Die Auswahl dieser Forschungsmethode ist daher aus dem Grund sinnvoller, da es sich bei der Suche nach Lösungsansätzen bezüglich der stationären Altenpflegefinanzierung um spezifische Maßnahmen zur Verbesserung handelt, die nicht mit Zahlen oder Statistiken beantwortet werden können, sondern lediglich mit gewissen Reformen oder Anpassungen, die nur in Worte gefasst werden können.
Diese qualitative Forschung soll dabei in Form von Experteninterviews durchgeführt werden, welche eine Unterkategorie der qualitativen Sozialforschung ist.164 Da es sich bei dieser Forschung um bereits existierende, aber zum Großteil nicht umgesetzte Ansätze handelt, die potenziell zur strategischen Lösung der derzeitigen Herausforderung führen könnten, werden hierfür Experten im Bereich der Pflegeversicherung herangezogen, um ihre fachliche Meinung über die Tauglichkeit dieser Lösungsansätze abzugeben. Bei der Auswahl der jeweiligen Experten war es demnach wichtig, dass diese ein fundiertes Wissen im Bereich der gesetzlichen Pflegeversicherung bzw. des Finanzierungssystems im konkreten Bezug zur stationären Altenpflege besitzen. Mit dieser gewählten Vorgehensweise wird folglich ein explorativer Forschungsansatz165 verfolgt, bei dem im Rahmen der Experteninterviews Informationen gesammelt und ausgewertet werden, die in einer Literaturrecherche in einer solchen Form nicht wiederzufinden sind.
Die Fragen, die zu den Interviews zuvor in einem Leitfaden konzipiert werden, sollen so gestellt werden, dass bei den jeweiligen Antworten hervorkommt, ob es sich um eine sinnvolle oder weniger sinnvolle Lösung handelt, welches dann schließlich als Material zur Auswertung verwendet wird. Weiterhin wird hier zur Untersuchung deduktiv vorgegangen. Das bedeutet, dass hier im Gegensatz zur induktiven Vorgehensweise, wie schon bereits erwähnt, keine eigene bzw. neue Theorie zur Beantwortung der Forschungsfrage hergeleitet wird, sondern es werden bereits bestehende Theorien geprüft, die durch Literaturrecherche gesammelt und aufgeschrieben worden sind166 (Siehe Kapitel 4).
5.2 Aufbau des Leitfadens
Zur Vorbereitung der Experteninterviews ist ein Leitfaden entwickelt worden, der den ungefähren Ablauf für alle zu befragenden Experten darstellen soll (siehe Anhang 7). Im Leitfaden ist zunächst die Forschungsfrage wiedergegeben, um den jeweiligen Experten zusammenfassend darzustellen, was der Zweck des Interviews ist. Vor Beginn des Interviews sollen mit den befragten Personen ein paar allgemeine Punkte zum Ablauf, zum Zweck und Weiteres geklärt werden. Die im Leitfaden aufgelistet sind. Daraufhin werden den jeweils befragten Personen ein paar Einstiegsfragen zu sich und ihrer Tätigkeit gestellt, um das Interview aufzulockern und ihre Expertise zum Thema einordnen zu können. Danach kommt es zum Hauptteil des Interviews, wo es schließlich zur eigentlichen Befragung der möglichen Lösungsansätze kommt. Das Interview wird danach beendet und der weitere Ablauf entsprechend dem Leitfaden bezüglich der Ergebnisse des Gesprächs wird mit der befragten Person besprochen.
Dieser Leitfaden ist für jeden der Experten einheitlich aufgebaut und beinhaltet für jeden dieselben Fragen. Es werden insgesamt elf Fragen gestellt, die spezifisch in vier verschiedene Blöcke aggregiert sind. Diese Blöcke bilden jeweils Fragen der in Kapitel 4 benannten Lösungsansätze. Konkret sind es vier Fragen zur Pflege-Bürgerversicherung, zwei Fragen zu privaten Vorsorgemodellen, zwei Fragen zum Generationenvertrag der PKV und schließlich drei Fragen zu weiteren möglichen Maßnahmen, die in Kapitel 4.4 beschrieben wurden.
5.3 Auswahl der Experten
Für die Durchführung der Experteninterviews sind insgesamt vier verschiedene Experten ausgewählt und interviewt worden, die über ein fundiertes Fachwissen zum Thema des Finanzierungssystems der Pflegeversicherung verfügen und somit die bisher genannten Herausforderungen bezüglich der Finanzierung kennen. Zunächst wurde ein Experte, „Person 1“, befragt. Dieser wurde als geeigneter Experte für das Interview ausgewählt, da sein Schwerpunkt in seiner Tätigkeit als Jurist auf der Beratung und Vertretung von Trägern sowie Leistungsanbietern der Sozialwirtschaft liegt. Als weiterer Experte wurde hier „Person 2“ ausgewählt. Dieser arbeitet bei der privaten Krankenversicherung „DKV“ als Abteilungsleiter im Bereich „Pflegeservice“, womit die Pflege und Pflegeversicherung ebenfalls in seinem Schwerpunkt liegen. Der dritte ausgewählte Experte „Person 3“ ist Geschäftsführer eines ambulanten Pflegeanbieters. Damit liegt zwar sein Schwerpunkt nicht auf dem stationären Bereich der Pflege, jedoch liegen in seinen Kenntnissen dennoch Verknüpfungspunkte durch das Finanzierungssystem, welches im ambulanten Bereich ähnlich ist. Schließlich wurde ein vierter Experte, „Person 4“, ausgewählt, welcher als Vorstandsmitglied der Stiftung Liebenau tätig ist. Es handelt sich um eine Stiftung mit verschiedenen Geschäftsbereichen, wo u.a. auch die Pflege einen Geschäftsbereich darin bildet. Person 4 ist in seiner Funktion für die Altenpflegegesellschaften zuständig, wodurch auch er die fachlichen Kenntnisse zum Thema besitzt, um das Interview entsprechend durchführen zu können.
5.4 Datenerhebung und Datenverarbeitung
Die jeweiligen Interviews fanden alle per Videoanruf auf der Plattform Microsoft Teams statt, womit u.a. Fahrtwege für ein physisches Treffen erspart worden sind. Diese fanden jeweils an unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten statt, wobei der Zeitrahmen der Interviews unterschiedlich war. Der Austausch in den jeweiligen Videoanrufen verlief nahezu reibungslos. Die Ton- und Videoqualität war sehr stabil und es gab keine anderweitigen Verständnisprobleme oder andere gravierende Störungen im Hintergrund. Das Gespräch der jeweiligen Interviews wurde ab Beginn der Einstiegsfragen bis zum Ende der letzten Interviewfrage unter mündlicher als auch schriftlicher Einwilligung der Befragten mit einer Audioaufnahme-App auf dem Handy aufgezeichnet und in einem sicheren Ordner ohne fremden Zugriff gespeichert. Anschließend wurden die aufgezeichneten Interviews manuell transkribiert und im Anhang hinzugefügt (Siehe Anhang 8). Die Transkription der jeweiligen Interviews wurde dabei gemäß der einfachen Transkriptionsregel nach Dresing und Pehl durchgeführt. Unter anderem bedeutet das, dass hier zwar Wort für Wort transkribiert, wurde inklusive umgangssprachlicher Partikeln, allerdings wurde hier Wortverschleifungen, Interpunktionen, Doppelungen, Stottern usw. geglättet bzw. weggelassen. Die jeweiligen Interviewten bzw. Befragten wurden im Transkript mit „B#“167 abgekürzt, wobei der Interviewer mit „I“ abgekürzt wurde. Die jeweiligen Befragungen verliefen semi-strukturiert ab. Das bedeutet, dass hier zwar alle vorgesehenen Fragen aus dem Leitfaden gestellt und beantwortet worden sind, allerdings wurden je nach Antwort der Befragten zusätzliche Fragen bzw. Rückfragen ergänzt und in das Material mitberücksichtigt.
Diese aus den Interviews ausgefertigten Transkripte dienen folglich als Material für die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring und für die Auswertung darüber, welche Lösungen zu den Herausforderungen der Finanzierung umgesetzt werden sollten. In den nachfolgenden Unterkapiteln wird daher auf dieses Material verwiesen. Dabei wurden lediglich die Inhalte bzw. Daten des Interview Transkriptes verwendet, die für die nachfolgende Analyse eine Aussage darüber liefern, ob der Lösungsansatz sinnvoll oder eher weniger sinnvoll ist. Alle weiteren Inhalte, bei denen eine Aussage nicht klar ersichtlich oder irrelevant für die Analyse war, wurden nicht berücksichtigt, befinden sich aber der Vollständigkeitshalber dennoch im Transkript.
5.5 Datenanalyse
Wie bereits in Punkt 5.1 beschrieben, wurden die Daten aus dem Interview Transkripte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring analysiert. Die Auswahl dieser Analysemethode anstelle einer quantitativen Inhaltsanalyse ist dadurch begründet, dass es in dieser Forschung nicht darum geht, eine Vielzahl an Materialien zu untersuchen und somit Häufigkeiten nach bestimmten Schlüsselwörtern oder bestimmte Trends oder Muster zu identifizieren, sondern es geht eher darum interpretativ bei einer geringen Menge von Materialien vorzugehen, um die Forschungsfrage nach den optimalen Lösungsansätzen beantworten zu können. Der interpretative Ansatz erschließt sich aus der Betrachtung der Daten aus den Interview Transkript.
Da es sich hier schließlich um Daten eines Interview Transkriptes handelt, wird hier die strukturierende Inhaltsanalyse als Form der qualitative Inhaltsanalyse verwendet. Sowohl die Form der zusammenfassenden als auch der explizierenden Inhaltsanalyse eignet sich aufgrund ihrer Komplexität eher weniger für die Forschung dieser Arbeit. Bei der strukturierenden Inhaltsanalyse sieht die Vorgehensweise zunächst so aus, dass bestimmte Informationen aus dem Material herausgefiltert werden und in sogenannte Kategorien bzw. einem Kategoriensystem zugeordnet werden.168 Es handelt sich dabei sozusagen um ein Raster aus verschiedenen Informationsgruppen, die als Kategorien bezeichnet und ggf. auch in weitere Unterkategorien untergliedert werden, wo gleichermaßen die entsprechenden Daten bzw. Informationen des Interview Transkripts zugeordnet werden.169 Die Zuordnung dieser Informationen in die bestimmten Kategorien erfolgt über die sogenannte Kodierung gemäß eines Kodierleitfadens. Der Kodierleitfaden enthält im Wesentlichen die Kategorien mit jeweils einer Definition dieser Kategorie, einem Ankerbeispiel und einer Kodierregel.170 Das Ganze wird tabellarisch aufgestellt. Dabei werden die einzelnen Kategorien zunächst in einer Spalte gebildet und anschließend klar definiert. In diesem Fall wurden zur Vereinfachung der Ergebnisdarstellung im nachfolgenden Kapitel die Kategorien mit Kürzeln neben der Kategoriespalte abgebildet (siehe Anhang 9). Danach werden in einer weiteren Spalte für die einzelnen Kategorien sogenannte Ankerbeispiele genannt, wo lediglich eine exemplarische Textstelle des Materials hineingebracht wird. Abschließend werden die Kodierregel in der letzten Spalte aufgestellt, wo Entscheidungsregeln gebildet werden, sodass Textstellen in diese Kategorie hinzugefügt werden.171
Für den Kodierleitfaden dieser Forschung wurden als Kategorien die einzelnen Lösungsansätze genommen und jeweils mit den Unterkategorien „Stärken und Schwächen“ bzw. abhängig von der Kategorie auch mit „effizient, nicht effizient“ oder „sinnvoll und weniger sinnvoll“ ergänzt. Der vollständige Leitfaden mit den Definitionen und Ankerbeispielen ist dem Anhang 9 dieser Arbeit zu entnehmen.
Schließlich wurde im Gesamtverlauf der qualitativen Untersuchung darauf geachtet, dass die typischen Gütekriterien eingehalten wurden. Diese wären die Transparenz, Intersubjektivität und Reichweite der qualitativen Forschung. Die Transparenz ist hierbei insoweit gegeben, dass sämtliche Vorgehensweisen zur Vorbereitung, Durchführung sowie Verarbeitung und Auswertung in diesem Kapitel stets beschrieben werden. Im Anhang dieser Arbeit sind hierzu weitere wesentliche Dokumentationen wie ein Leitfaden zum Experteninterview oder Transkripte aufzufinden, die die wesentlichsten Informationen bezüglich der Untersuchung darlegen. Die Intersubjektivität der erhobenen Ergebnisse ist ebenfalls insofern gegeben, dass diese in Kapitel 5.6 zunächst dargestellt und in Kapitel 5.7 unter verschiedenen Aspekten diskutiert wurde, sodass jedem außenstehenden Leser Raum zur Interpretation gegeben wird. Zum Schluss wurde auch beim Güterkriterium der Reichweite festgestellt, dass diese gegeben ist, da hier bei allen befragten Experten die gleiche Vorgehensweise mit demselben Leitfaden angewandt wurde und festgestellt wurde, dass durchaus ein paar Überschneidungen in den Ergebnissen vorliegen. Das heißt, dass die Forschung mit der gewählten Methode und den gewählten Fragen reproduzierbar ist.
5.6 Ergebnisdarstellung
In diesem Abschnitt werden nun die Ergebnisse der erhobenen und analysierten Daten aus den Experteninterviews gemäß des Kodierleitfadens systematisch dargestellt und ggf. erklärt. Jegliche Interpretation der Ergebnisse bzw. der Lösungsansätze wird allerdings nicht in diesem Abschnitt weiter durchgeführt. Dies ist Bestandteil des nachfolgenden Kapitels 5.7.
5.6.1 Kategorie 1: Pflege-Bürgerversicherung
Für diesen bereits genannten Lösungsansatz wurde eine eigene Kategorie im Kodierleitfaden mit den jeweiligen Unterkategorien „Stärken“ und „Schwächen“ erstellt. In der Unterkategorie der Stärken wurden aus den Transkripten der Experteninterviews bzw. aus dem Material jede Aussage der befragten Experten zugeordnet, die die positiven Aspekte einer möglichen PflegeBürgerversicherung angesprochen hat. Umgekehrt wurden in der Unterkategorie der Schwächen die Aussagen zugeordnet, die eher die negativen Aspekte bzw. Herausforderungen mit der Einführung einer solchen Pflege-Bürgerversicherung angesprochen haben. Für diesen und alle weiteren Lösungsansätze wird hierzu Bezug auf die einzelnen Experten genommen.
Zu der Unterkategorie der Stärken bzw. der positiven Aspekte der Pflege-Bürgerversicherung wurden diverse Einschätzungen getroffen. Teilweise wurde die Pflege-Bürgerversicherung zumindest als eine ganz gute Alternative im Vergleich zum derzeitigen System wahrgenommen.
So findet beispielsweise Person 1, dass die Pflege-Bürgerversicherung als Idee gut ist.172 Auch Person 2 ist der Überzeugung, dass eine Pflege-Bürgerversicherung einige Vorteile mit sich bringt, und meint, dass die Möglichkeit bestehe, mit einer Pflege-Bürgerversicherung Ungleichheiten im Gesundheitswesen zu verringern, so wie Versicherungs- und Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Weiterhin kann die Pflege-Bürgerversicherung in Kombination mit einer Abschaffung der gesetzlich festgelegten Beitragsbemessungsgrenze dafür sorgen, dass die Einnahmen der Pflegeversicherung erhöht werden und sich insgesamt die Ausgabensituation verbessert und in Bezug darauf eine breitere Finanzierung dazu beitragen kann, die Belastungen gleichmäßiger zu verteilen.173
Person 2: „[...] durch Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze würde höhere Einkommensstärke zur Finanzierung der Pflegeversicherung beitragen. Das könnte die Einnahmen signifikant erhöhen und somit dazu beitragen. dass Finanzierungslücke geschlossen werden. Dazu verbesserte Ausgabensituation als Ergebnis.“174
Auch Person 1 ist der Ansicht, dass man mit der Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze „sicherlich mehr Geld in das System bekommen [würde]“175 Person 4 teilt ebenfalls die Auffassung, dass diese einen positiven fiskalischen Effekt hätte, der eine Menge Geld ins System hineinbringen würde.176
Ansonsten gab es neben der Idee einer Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze ebenso die Überlegung, die Pflege-Bürgerversicherung mit einer Kapitaldeckung zu kombinieren. Hier ist Person 1 ebenso der Auffassung, dass die Idee gut ist und zumindest in Zeiten von hohen Zinsen eine Chance hätte.177 Bisherige Ansprüche und Ersparnisse der Altersrückstellungen könnten bei einem solchen Modell gewahrt werden und es würde außerdem das Vertrauen ins System stärken.178 Hätte man mit einem solchen Modell viel früher angefangen, wäre es nach Aussagen von Person 4 heute sicherlich ein wirkungsvolles Modell, da die Wirkungen solcher Modelle ihre Zeit brauchen.179
Schlussendlich kann auch in der Einführung einer derartigen Pflege-Bürgerversicherung eine Chance gesehen werden, wo es im Grunde eine mehrheitliche parlamentarische Zustimmung in der Politik dafür bräuchte.180 Person 2 spricht neben einer mehrheitlichen Zustimmung ebenso von einem politischen Willen zur Pflege-Bürgerversicherung, die es geben muss, damit diese auch durchgesetzt werden kann.181
Neben den bisher genannten Stärken gibt es seitens der Expertenaussagen auch einige Schwächen bzw. Probleme, die zur Pflege-Bürgerversicherung genannt worden sind.
Person 3: „Ist keine Alternative, weil das Grundproblem der Finanzierung damit nicht gelöst wird [...] der Großteil der Leute, die da einzahlen an der Bürgerversicherung einzahlen würden sind ja, ist ja die Babyboomer-Generation und die erwerben ja auch Leistungsansprüche. De facto haben wir ja durch die einheitlichen Beiträge eine Pflege-Bürgerversicherung, weil der die Leistung der privaten Pflegeversicherung bisher nicht höher als die der gesetzlichen ist ja normiert also insofern ist das jetzt nur ein Showkampf“182
Die Pflege-Bürgerversicherung wird von Person 3 demnach nicht als passende Alternative angesehen. Ähnlich wird das auch von Person 1 gesehen, nämlich, dass eine PflegeBürgerversicherung zwar eine Chance bieten könnte, aber die strategischen Probleme mit stationären Altenpflegefinanzierung nicht lösen wird.183 Schließlich sieht auch Person 4 keine Lösung mit der Implementierung einer Pflege-Bürgerversicherung.
Person 4: „Also das Wort Bürgerversicherung ersetze ich für mich so, dass das Prinzip einer Verschmelzung gesetzlicher Pflegeversicherung und privater Pflegeversicherung beinhaltet [.] Das halte ich nicht für eine Lösung, weil dann würde ich in beiden Versicherungsbereichen und die (und.) Menschen, die halt entsprechende Versicherungsanspruch haben und Notwendigkeiten, also in der Summe ändert sich das nicht viel [.] wenn wir und das jetzt zu Ende denken würde, wären die ganzen rechtlichen Fragestellungen hinten dran und die verfassungsrechtlichen Fragestellungen und den Eingriff in die Eigentumsrechte und so ein Scheiß.“184
Person 2: „Es könnte Widerstand von verschiedenen Interessensgruppen geben, natürlich auch von den Versicherten, die von Sorgen Unsicherheiten geprägt sind, ob die finanzielle Eigenbelastung möglicherweise noch weiter steigen oder Benachteiligungen in der Betriebswirtschaft ja “ (...)
Bezüglich einer Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze sieht Person 1 es so, dass eine beliebige Erhöhung oder Abschaffung dessen in der Form nicht möglich sei, da eine gewisse Äquivalenz zwischen Beitragspflicht und zu erwartenden Leistungen sichergestellt werden muss.185 Auch Person 2 sieht in dem Aspekt mögliche Folgen bei einer starken Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze.
Person 2: „Eine Erhöhung oder eine Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze könnte natürlich auf Widerstand stoßen insbesondere bei den gutverdienenden Bürgern, die höhere Beiträge zu zahlen hätten. Das macht keiner freiwillig“186
Eine Mehrbelastung insbesondere derjenigen, die ein Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen, wird von Person 4 genauso angesehen.187 Auf dieselbe Frage zur Thematik sieht das Person 3 lediglich so, „dass wir keine sinnvolle Verwendung der höheren Einnahmen der Pflegeversicherung haben, weil da wird so Wort politisch Wohltaten verteilt, die mit der heißen Idee der Pflegeversicherung gar nichts zu tun haben.“188
Person 3: „Wir haben heute schon ganz viele quasi versicherungsfremde Leistungen, in der die Pflegeversicherung, die dort gezahlt werden [...] also insofern haben wir nicht das Problem, dass wir zu knappe Mittel haben, sondern wir geben das Geld falsch aus.“189
Person 3: „Also das sind so Modelle, wir müssen raus aus diesem Thema: Wie kriegen wir einfach nur mehr Geld ins System? Weil das muss ja irgendeiner bezahlen und ehrlich gesagt mit den Abgaben, die da sind, sozusagen ja, wir heben die Beitragsbemessungsgrenze auf, dann ist alles gelöst. Das ist falsch, wir geben das Geldfalsch aus.“190
Für die Kombination der Pflege-Bürgerversicherung mit einer Kapitaldeckung gibt es ähnliche Bedenken, die zu benennen sind.
Person 1: „[.] wenn wir eine Niedrigzinsphase haben, führt halt ein kapitalgedecktes System dazu, dass kaum Mittel zur Verfügung stehen, und deshalb kann man eventuell über kombinierte Systeme nachdenken, ich glaube persönlich nicht daran, dass die Kapitaldeckung das eigentliche Problem strategisch löst.“191
Person 1: „[...] wenn sie eine Verzinsung von vielleicht 2% haben und eine Geldentwicklung, Geldwertentwicklung von 3% und vielleicht noch eine Sonderheit bei Lohnsteigerung, vielleicht 6 oder 7% stehen haben, dann werden sie mit einem kapitalgedeckten System nicht so richtig was werden“192
Eine Kombination aus Pflege-Bürgerversicherung und Kapitaldeckung könnte also auch genauso gut in Phasen mit niedrigen Zinsen oder ungleichmäßiger Entwicklung von Geld- und Zinswert ineffektiv sein. Außerdem wäre eine solche Einführung komplex und kostenaufwendig.
Person 2: „Die Einführung eines solchen Modells könnte ich die Komplexität des Pflegeversicherungssystems deutlich erhöhen [...] Es besteht die Möglichkeit, dass nicht alle Versicherten in der Lage sind, ausreichende Rückstellungen zu bilden, was zu Ungleichheiten führen könnte [.] Die Einführung einer solchen Kombination könnte anfällige Kosten verursachen sowohl für die Verwaltung auch für die Anpassung bestehender Systeme, ja und Verwaltungskosten.“193
Schließlich kann es offenbar auch so sein, dass es rechtliche Schwierigkeiten mit der Einführung einer Pflege-Bürgerversicherung seitens der Politik geben könnte, laut Auffassung von Person 3.194 Person 4 teil dieselbe Überzeugung und dass es aufgrund dessen zu keiner mehrheitlichen Abstimmung kommen wird. Es wäre demnach so, dass sich eine mehrheitliche Abstimmung für eine Verfassungsänderung aussprechen würde.195
5.6.2 Kategorie 2: Private Vorsorgemodelle
Zu den Stärken bzw. Chancen des Lösungsansatzes für private Vorsorgemodelle gibt es ebenfalls diverse Aussagen. Die Idee mit der Kombination aus betrieblicher und privater Altersvorsorge könnte bei der Finanzierung der Eigenanteile helfen, denn „alles, was im Ergebnis Pflegebedürftige Menschen zu Geld verhilft, hilft natürlich bei der Finanzierbarkeit der Eigenanteile.“196 Person 2 sieht in diesem Vorschlag einige positive Aspekte, und zwar: Je mehr Rücklagen gebildet werden, desto geringere Druck könnte auf die Eigenanteile ausfallen.
Ebenso werden steuerliche Vorteile dadurch betrachtet, individuelle Ausgestaltung der Beiträge, Flexibilität, Arbeitgeberattraktivität und finanzielle Absicherung.197
Person 3: „betrieblicher und privater Altersvorsorge ergänzend das macht Sinn wie die IG BCE die hat ja das entsprechende in ihren Tarifvertrag implementiert so wie ich heute Zusatzversicherung für Zahnersatz etc.“198
Auch Person 3 sieht grundsätzlich Chancen bei betrieblichen und privaten Vorsorgemodellen durch anteilige Finanzierung der betrieblichen Altersvorsorge zwischen einer Person selbst und ihrem Arbeitgeber, wo auch steuerliche Vorteile hinzukommen. Es könne außerdem möglich sein, bei dieser Idee steuerlich bezuschusst zu werden, wenn eine bestimmte Einkommensgrenze unterschritten wird, ähnlich wie bei der sogenannten Riester-Rente.199 Person 4 sieht ebenfalls darin Chancen und findet, dass dies in Deutschland ähnlich wie es in der Schweiz implementiert wurde, gut umsetzbar ist.200 Die Idee mit den eigenen betrieblichen Vorsorgefonds bietet ebenfalls einige Chancen.
Person 2: „Also die Idee ist gut, ist sehr gut f..]Einmal kann man es individuell gestalten, ja, dass die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter eines Unternehmens die Altersvorsorge entsprechend ihrer persönlichen finanziellen Situation [...] gestalten können, also mit der höchstmöglichen Flexibilität [...] Dann natürlich die Förderung der Altersvorsorge, das gibt es ja heute schon eine durch die Einrichtung von Fonds beispielsweise könnten mehr Menschen motiviert werden, aktiv für ihre Altersvorsorge zu sparen insbesondere wenn natürlich die Arbeitgeber einen Teil der Beiträge übernehmen.“201
Hinzu kommt, dass der Arbeitgeber bei einem solchen Modell die Beiträge auch steuerlich absetzten kann. Auch ein Mindesteinzahlbetrag für so ein Modell könnte sinnvoll sein, sodass alle Mitarbeiter zumindest einen Grundstock an Altersvorsorge aufbauen können.202
Person 2: „Dass ein einheitlicher Mindesteinzahlbetrag dazu beiträgt, dass in eine Altersvorsorge eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermutigt werden, bestimmten Betrag zu sparen, dass das transparent wird und ihnen am Ende auch aufzeigt, dass man dadurch auch die Eigenanteile dann deutlich reduzieren kann das müsste allerdings auch flexibel gestaltet werden von den jeweiligen unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten der Mitarbeiter, vielleicht Gehaltseinkommensbetragsmäßig, also Bruttoverdienst, zumindest Einsparhöhe [...]“
Nun gibt es auch zu diesem Lösungsansatz einige mögliche Schwächen, die genannt werden. Dies wäre einerseits, dass es bei Menschen mit geringem Vermögen mit einem solchen Modell schwierig werden könnte, sowohl bei der Kombination von betrieblicher und privater Altersvorsorge als auch bei betrieblichen Vorsorgefonds gemäß der Aussage von Person 1.203
Person 1: „Also wirklich einfaches Kontrollbeispiel: Eine Person, die, sagen wir mal eine alleinerziehende Mutter, die 2.000€ Netto hat. Das ist gar nicht mal wenig Geld. Etwa 3,5 Brutto, vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber 3,5 wird sie etwa verdienen. Das ist schon ganz ordentliches Geld. Die hat 2.000 Netto, davon zahlt die sagen wir mal, 800€ Miete. Das ist auch nicht viel. Und die und ihr Kind brauchen zum Leben nochmal 900€. Dann sind wir bei 1.700 und da sind noch kein Urlaub und sonst was drin. Und der jetzt zu sagen, Wissen Sie was? Wir haben eine gute Idee für Sie. Geben sie im Monat nochmal 150€ ab!“204
Auch Person 2 sieht eine finanzielle Belastung bei gewissen Leuten darin. Darüber hinaus können solche Rückstellungen mit dem Modell bei einem Wechsel des Unternehmens auch verloren gehen.205 Person 3 findet die Lösung aus genau dem Grund für weniger sinnvoll, da man bei einem Unternehmenswechsel die eingezahlten Beträge verliert und eine Übertragung nicht so gut funktioniert.206
Person 4: „Ich halte es nicht für sinnvoll, wenn die Betriebe einen eigenen Vorsorgefonds einrichten. Es wären viel zu große Verwaltungsschwierigkeiten, aber auch zu Fragen der Absicherung wie sollen Vorsorgefonds usw. Das ist technisch sehr schwierig, es ist aufwendig und mit vielen Preisen behaftet.“207
Person 4 findet außerdem, dass bereits bestehende Partnerschaften mit Versorgungsunternehmen wie Lebensversicherungen dagegen zwar eine gute Idee sind, allerdings werden diese von Mitarbeitern auf dem Arbeitsmarkt wenig wertgeschätzt.208
5.6.3 Kategorie 3: Generationenvertrag
Als Unterkategorie hierzu gibt es zunächst „unzureichende Finanzierung.“ Dies bezieht sich darauf, dass die erste Gestaltungsoption (siehe Kapitel 4.3) dazu führen könnte, dass langfristig betrachtet bestimmte Leistungen nicht mehr gezahlt werden, wenn sich das Volumen der Leistungsausgaben an dem Volumen der Beitragseinnahmen orientieren soll. Dieses hatte, wie zuvor benannt, den Zweck, die Leistungs- und Beitragsentwicklung zu stabilisieren, allerdings mit der Konsequenz, dass die Eigenanteile in stationären Einrichtungen für die Pflegebedürftigen umso höher werden.
Person 1: „Natürlich, die aktuelle oder die demographische Situation, sowie sie zu erwarten steht, in der Menschen meines Alters immer einen sehr großen Anteil an der Bevölkerung darstellen, und das ist so lange gar kein Problem solange die erwerbstätig sind, aber wenn diese sogenannten Boomer eben nicht mehr erwerbstätig sind, dann entsteht eben das Problem [...]“209
Die Pflegebedürftigen könnten durch dieses Modell höhere Eigenanteile zahlen müssen.210 Person 3 findet, dass dies von der zukünftigen Entwicklung abhängt und differenziert da bei inflationsbedingten Ausgabensteigerungen, die sich mit den Beitragseinnahmen wieder ausgleichen würde.211
Person 4: „Es würde dazu führen, dass die Preise vereinheitlicht werden, die Angebote vereinheitlicht werden und Lohnsteuern vereinheitlicht werden, das halten wir für völlig kontraproduktiv.“212
Bezüglich der Unterkategorie „Effektivität bei Kombination mit Zusatzversicherungen“ bei der es darum geht, die nicht mehr abgedeckten Leistungen mit einer Zusatzversicherung zu decken, ist Person 2 der Ansicht, dass in diesem Fall individuelle Anpassungen möglich sind z.B. mit einem Tagegeld.213 Person 4 betrachtet es so, dass es regionale Unterschiede gibt, wie stark die Menschen auf Sozialhilfe angewiesen sind aber hält es auch für sinnvoll, dass eine solches Modell mit einer Zusatzversicherung abgemildert wird.214
Bei der Unterkategorie „Ineffektivität bei Kombination mit Zusatzversicherung“ hingegen liegt die Meinung der Experten eher darauf, dass die Pflegebedürftigen immer noch auf Sozialhilfe angewiesen sein werden bzw. sich keine Zusatzversicherung leisten können. So sagt unter anderem Person 1, dass alle Pflegebedürftigen mit niedrigen Einkommen auf Sozialhilfe angewiesen sein werden.215 Auch Person 3 findet, dass so wie die PKV das in ihrem Modell berechnet hat, eine Abdeckung mit einer Zusatzversicherung nicht ausreichend sein wird.216
5.6.4 Kategorie 4: Steuerfinanzierung
Bei der Frage nach einer ergänzenden Steuerfinanzierung zur Pflegeversicherung ist nun herauszufinden, ob diese effizient oder ineffizient ist. Entsprechend hat die Unterkategorie „effizient“ wesentliche Vorteile in Bezug auf eine potenzielle Steuerfinanzierung.
Person 2: „[...] natürlich hat eine Steuerfinanzierung auch Vorteile, logischerweise die steuerfinanzierte Pflegeversicherung könnte zum Beispiel eine breitere Basis für die Finanzierung bieten, das Steuern von allen Bürgern unabhängig von ihrem Einkommen erhoben werden. Das könnte dazu beitragen, die finanziellen Mittel zu erhöhen und die Abhängigkeit von Beiträgen aus der Sozialversicherung zu verringern. Dann haben wir das eben angesprochene Solidaritätsprinzip durch steuerfinanzierte Pflegefinanzierungsbeiträge könnte das Solidaritätsprinzip stärker betont werden, indem alle Bürger zur Finanzierung der Pflegeleistungen beitragen, unabhängig von ihrem individuellen Risiko oder Pflegebedarf.“217
Person 3 findet, dass eine Steuerfinanzierung zumindest für versicherungsfremde Leistungen aufkommen sollte.218
Bei der Unterkategorie der „Ineffizienz“, bei der es um Aussagen oder Argumentationen geht, die sich gegen eine solche Steuerfinanzierung richten, gibt es einerseits die Einschätzung, dass eine Steuerfinanzierung bei den Bürgern zu Widerstand führen könnte.219 Ansonsten heißt es, dass eine Steuerfinanzierung per se bereits schon über die Sozialhilfe stattfindet.
Person 1: „[...] Ich meine nicht, dass wir dieses im stationären Bereich (...) angelegte System auf Unterkunftverpflegung und Pflegeleistung integrierende Systeme stark machen sollten, sondern ich meine, wir sollten die Unterkunfts- und Verpflegungsleistung aus dem System rausnehmen und die sollen steuerfinanziert als Sozialhilfe laufen, sofern persönlicher Bedarfe“
5.6.5 Kategorie 5: Präventionsmaßnahmen
Zu den Präventionsmaßnahmen gibt es die Kategorie „Effizient“, wo sich die Experten einig sind, dass die Investition von Präventionsmaßnahmen zur Reduktion von Pflegebedürftigkeit angewendet werden sollte. Hier ist z.B. Person 1 der Meinung, dass Präventionsmaßnahmen durchgeführt werden sollten.220
Person 2: „wenn weniger Menschen neu pflegebedürftig werden würde das natürlich spürbaren Kosteneinsparungen beitragen.“221
Person 3 findet, dass für diese Investition idealerweise der Entlastungsbeitrag des Pflegegrad 1 verwendet werden sollte.222
Person 4: „Das ist umsetzbar, das ist total sinnvoll, das ist wünschenswert und es ist eigentlich gesetzlich jetzt schon gegeben, es wird nur nicht umgesetzt [...] ich glaub, es sind 0,6% der Beitragssummen, die genau dafür zur Verfügung gestellt werden sollten sein aus der Pflegekasse also.“223
Die zweite Unterkategorie wären in dem Fall „Schwierigkeiten“, wo es zur Effektivität bzw. Ineffektivität solcher Präventionsprogramme keine medizinisch-statistischen Auswertungen gibt.224
5.6.6 Kategorie 6: Digitalisierungsmaßnahmen
Schließlich gibt es zu der Kategorie der Digitalisierungsmaßnahmen wieder zwei Unterkategorien. Eine davon wäre „effizient“ bei der es hier konkret um Maßnahmen geht, die zu effizienteren Arbeitsprozessen in der stationären Pflege führen können, um somit Kosten reduzieren und ggf. damit die Ausgaben der Leistungsträger und Selbstzahler etwas mildern könnte. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die von den Experten genannt werden. Hier gibt es z.B. die Idee, Staubsauger oder Reinigungsroboter einzusetzen225
Person 1: „Also alles, was man einsetzen kann, soll einsetzen, weil das Personal knapp und teuer wird., und im Übrigen muss man viel ausprobieren [,..]“226
Ansonsten gibt es diverse andere Bereiche in stationären Pflegeeinrichtungen, die digitalisiert werden können. Eine Möglichkeit wäre z.B. das Anwenden von künstlicher Intelligenz, die die Effizienz bei Dokumentationen steigern und Fehler reduzieren würde, die sonst ein Mensch begehen würde und somit den Verwaltungsaufwand reduziert. Ähnliches gilt für die Verwendung von elektronischen Patientenakten.227
Person 2: „Dann haben wir den Bereich Telemedizin und Fernüberwachung, Zugang zu Fachärzten, die Schnittstelle KV, Pflege [.l. Telemedizin ermöglicht Pflegeeinrichtungen schnelle Fachärzte zuzugreifen, ohne dass Patienten transportiert werden müssen. Das spart Zeit und Kosten für Transporte [.l Überwachung von Vitalzeichen digitale Gesundheitslösungen zur Fernüberwachung können helfen, den Gesundheitszustand der Bewohner kontinuierlich zu überwachen [.l so Kosten Krankenhausaufenthalte auch vermeiden [.l das ist ja auch ein Milliarden-Euro-Loch. [.l Wir hätten Optimierung von Pflegeabläufen auf jeden Fall auch, Planungstools, digitale Tools zum Beispiel zur Einsatzplanung, Ressourcenverwaltung [.l könnte zum Beispiel natürlich auch über Stunden oder sogenannte Leerlaufzeiten verringern. Dann ganz klar werden und Ihnen Aufgaben automatisiert, ja Robotics beispielsweise [.l.“228
Person 4 nennt ähnliche Digitalisierungsmaßnahmen wie z.B. den Einsatz von KI-Softwaren zur Entlastung der Dokumentationsarbeit oder das Einsetzen von Humanoid Robotern zur Kommunikation und Betreuung der Pflegebedürftigen. Ebenso nennt er die Möglichkeit, Sensortechnologie für Notfallsituationen einzusetzen, beispielsweise für den Fall, dass, wenn ein Pflegebedürftiger stürzt und nicht mehr aufsteht, dann folglich automatisch durch Sensorerkennung ein Notruf abgesetzt werden kann.
Ergebnisse der Unterkategorie „Schwierigkeiten“ bestehen dann darin, dass die stationären Einrichtungen für ihre Mitarbeiter in Weiterbildungsmaßnahmen investieren müssten, um mit digitalen Systemen arbeiten zu können.229
5.7 Diskussion der Ergebnisse
Insgesamt wurde mit dieser qualitativen Forschung die Effektivität der Lösungsansätze auf Basis einer Pflege-Bürgerversicherung, einer Kombination aus privater und betrieblicher Altersvorsorge, dem Generationenvertrag sowie kleinerer Maßnahmen wie einer ergänzenden Steuerfinanzierung, Präventions- und Digitalisierungsmaßnahmen untersucht. Um plausible Aussagen darüber zu treffen, welche der Maßnahmen nachhaltig sinnvoll sind und welche eher nicht, wurden diese wie bereits erwähnt in Kategorien und Unterkategorien unterteilt und im letzten Kapitel vollumfänglich dargestellt. Nun sollen diese Ergebnisse anhand der gesammelten Ergebnisse in diesem Abschnitt zusammen mit der bisher verwendeten Literatur und den Inhalten der Arbeit diskutiert bzw. interpretiert werden.
Zu den Ergebnissen der Pflege-Bürgerversicherung ist im Großen und Ganzen festzuhalten, dass die Ergebnisse und Meinungen durchwachsen sind. Während die eine Hälfte der befragten Experten die Idee einer Pflege-Bürgerversicherung grundsätzlich als eine gute Idee bezeichnet hat, fand die andere Hälfte, dass diese Idee eher weniger sinnvoll ist. Selbst von Person 1, der es erst als gute Idee bezeichnete, wurde dazu gesagt, dass es die Probleme der stationären Pflegefinanzierung nicht langfristig lösen wird.230 Also, es ist zu sehen, dass die Thematik einer Pflege-Bürgerversicherung doch sehr komplex ist, als, dass genau gesagt werden könnte, ob das eine adäquate Lösung ist oder nicht. Es würde offenbar einige Vorteile bringen, wie z.B. Ungleichheiten im Gesundheitswesen oder Verwaltungsaufwand reduzieren,231 jedoch scheint es in der mehrheitlichen Stellungnahme zum Thema so zu sein, dass eine PflegeBürgerversicherung keine nachhaltige Lösung bietet. Es bräuchte für die Umsetzung einer solchen Reform eine mehrheitliche Abstimmung in der Politik, welche sich allein deswegen schon als sehr schwierig erweist, weil es da rechtliche Rahmenbedingungen gibt, die da beachtet bzw. sogar verändert werden müsste, laut Aussage von Person 4.232
Ansonsten bestand die Idee, eine einheitliche Pflege-Bürgerversicherung so zu gestalten, dass es für jeden einen Nutzen hat. Hier wurde z.B. nach einer Erhöhung oder Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze gefragt, welche daran angelehnt ist, dass ein Gegenstand für eine Pflege-Bürgerversicherung als Vollversicherung darin besteht, die Beitragsbemessungsgrenze auf die Grenze der Rentenversicherung anzuheben.233 Wie erwartet wurde hier von den Experten bestätigt, dass eine solche Maßnahme dazu führen würde, dass mehr Geld ins gesamte System fließen würde und somit wahrscheinlich zu einer Stabilisierung der Beitragssätze für alle führen würde, allerdings erscheint dieser Ansatz dann doch als zu vereinfacht dargestellt. Einerseits könnte eine solche Maßnahme zu Widerstand führen, insbesondere von denjenigen, die über ein sehr hohes Einkommen verfügen234 und daher von einer solchen Maßnahme betroffen wären, und andererseits würde eine starke Anhebung bzw. Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze das Äquivalenzprinzip missachten, wo ein gewisser Ausgleich zwischen Einzahlungen und den damit zu erwartenden Leistungen bestehen muss.235 Eine minimale Anhebung könnte hier eventuell eher zielführend umgesetzt werden, aber einer zu hohe Anhebung könnte sich als problematisch erweisen.
Die weitere Gestaltungsmöglichkeit ist, eine Pflege-Bürgerversicherung mit einer Kapiteldeckung zu kombinieren, da in der privaten Pflegeversicherung, wie bereits in Kapitel 4.1 beschrieben, das Problem besteht, dass mit einem einheitlichen System ggf. die Altersrückstellungen verloren gehen würden. Auch hier würde wie erwartet ein Vorteil darin bestehen, dass durch eine einheitliche Kapitaldeckung für jeden die bisherigen Rückstellungen gewahrt werden könnten und somit das Vertrauen ins System gestärkt wird.236 In Zeiten mit hohen Zinsen würde sich ein solches System gut auszahlen, wohingegen es in niedrigen Zinsphasen eher weniger bringen würde.237 Hier wäre also demnach zu ermitteln, ob die hohen Zinsphasen die jeweils niedrigen Zinsphasen wieder ausgleichen würden oder ob langfristig eher niedrige Zinsphasen den Zweck einer einheitlichen Kapiteldeckung torpedieren würden. Ansonsten könnte mit einer Kapitaldeckung die Komplexität erhöht und anfällige Kosten verursacht werden. Außerdem besteht die Gefahr, dass nicht alle Versicherten in der Lage wäre, ausreichende Rücklagen zu bilden, was insbesondere bei denjenigen der Fall wäre, die weniger verdienen.238 Die Idee einer Pflege-Bürgerversicherung ist also mit all den Ergebnissen keine völlig irrsinnige Idee, aber auch keine perfekte Idee. Gleiches gilt ebenfalls für die Kombination mit einer Kapitaldeckung oder einer Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze. Damit würde die Pflege-Bürgerversicherung als optimaler Lösungsansatz hier wohl entfallen.
Bei den privaten Vorsorgemodellen haben die Ergebnisse gezeigt, dass diese eher umgesetzt bzw. angewandt werden könnten als eine Pflege-Bürgerversicherung. Bei den Befragungen über den Nutzen aus der Kombination von privater und betrieblicher Altersvorsorge wurde hier mehrheitlich zugestimmt, dass diese Sinn machen, um perspektivisch zum einrichtungseinheitlichen Eigenanteil beizutragen und die Pflegebedürftigen damit zu entlasten. Private und betriebliche Altersvorsorge hätten positive Effekte, um wie in Kapitel 4.2. eine zusätzliche private Rente zu beziehen. Diese können individuell nach den Bedürfnissen der Versicherten gestaltet werden. Das heißt, es kann frei entschieden werden, ob ein hoher oder ein geringer Beitrag eingezahlt wird.239 Mit betrieblicher Altersvorsorge kann darüber hinaus ein Arbeitgeberanteil beigetragen werden, welcher steuerlich abgesetzt werden kann.240 Bei dieser Idee besteht jedoch das Problem, dass diese sich für Menschen mit geringeren Einkommen nicht wirklich lohnen würde. Diese Menschen, die sowas am ehesten nötig bzw. von profitieren müssten, könnten nämlich nur einen kleinen Beitrag leisten im Vergleich zu Menschen mit höheren Einkommen.241 Es könnte an dieser Stelle damit argumentiert werden, dass es trotzdem mehr bringt, als gar nicht in eine solche Altersvorsorge einzuzahlen. Schließlich wäre eine solche Versicherung etwas sehr Langfristiges, wo sich die Zinsentwicklung insgesamt als sehr positiv erweisen könnte und am Ende eine höhere Rente dabei herauskommt als zuvor antizipiert. Je nach Einkommenssituation und den geleisteten Beiträgen der Versicherten würde die Idee mit der Altersvorsorge mit Sicherheit nicht zu einer kompletten Entlastung führen, was die Eigenanteile in den Einrichtungen angehen. Jedoch könnte es eine Unterstützung liefern, um weniger auf Sozialhilfe angewiesen zu sein oder auf angespartes Vermögen zurückzugreifen. Damit könnte die Idee mit privater und betrieblicher Altersvorsorge als einen Lösungsansatz wahrgenommen werden. Es müsste nur die entsprechende Akzeptanz vorliegen.
Bei den betrieblichen Vorsorgemodellen sieht es wiederum etwas anders aus. Dies wird mehrheitlich als eine eher schlechte Idee wahrgenommen. Dies liegt vor allem daran, dass hier das Problem besteht, dass, wenn Mitarbeiter ihren Betrieb wechseln, diese Rückstellungen nicht wirklich übertragen werden können. Darüber hinaus würde dies zu hohen Verwaltungsschwierigkeiten führen. Grundsätzlich würde es jedoch Chancen bieten, ähnlich wie bei privater und betrieblicher Altersvorsorge, die die Mitarbeiter möglicherweise motivieren könnte, für ihre Altersvorsorge zu sparen. Die Nachteile dieses Modells scheinen die Vorteile zu überwiegen, weshalb diese Idee als Lösungsansatz ebenfalls nicht weiterverfolgt wird.
Das Konzept des Generationenvertrags als möglichen Lösungsansatz verfolgt wie bereits beschrieben die Idee, die Pflegeausgaben und Beitragssätze zu stabilisieren, indem die Leistungsausgaben, wie in Kapitel 4.3 beschrieben, dynamisiert werden. Dies hätte aber die große Konsequenz, dass die Leistungsausgaben so gering ausfallen könnten, dass dies auf Kosten der Pflegebedürftigen ginge, die diese Kosten in den Einrichtungen durch die Eigenanteile wieder ausgleichen müssten. Die befragten Experten stimmen zu, dass höhere Eigenanteile die Folge von diesem Konzept wären, was schlussendlich wieder kontraproduktiv wäre. Jedoch ist Person 3 der Ansicht, dass die unzureichende Finanzierung von der Entwicklung abhängt und differenziert diese von einer inflationären Entwicklung.242 Person 4 ist der Überzeugung, dass die Preise vereinheitlicht werden, welches zusätzlich als kontraproduktiv betitelt wird.243
Nun gibt es allerdings die Möglichkeit, dieses Konzept mit Zusatzversicherungen wieder abzudecken. Die Experten haben unterschiedliche Ansichten über die Effektivität in diesem Bereich. Die eine Hälfte findet, dass Zusatzversicherungen durchaus dabei helfen könnten, die mit diesem Konzept entstehenden Finanzierungslücken abzumildern. Die andere Hälfte findet nicht wirklich, dass es effektiv ist. Damit ist es hier ähnlich wie mit der PflegeBürgerversicherung: Es ist schwierig zu sagen, ob das Konzept für eine nachhaltige Lösung sinnvoll ist. Man müsste sich eventuell zusätzlich die Frage stellen, ob eine Dynamisierung der Leistungsausgaben auch wirklich die Ausgaben- und Beitragssatzentwicklung langfristig stabilisieren kann, ohne dass Pflegebedürftige und Sozialhilfeträger an die Grenzen ihrer Zahlungsfähigkeit kommen. Es sei angenommen, dass dies der Fall ist, dann könnte es zumindest eine Option sein, die in Betracht gezogen werden könnte. Allerdings wäre diese Annahme unter der Beachtung des demographischen Wandels (siehe Kapitel 3.3) mit Vorsicht zu genießen, da es in naher Zukunft so kommen wird, dass die Anzahl an Pflegebedürftigen enorm ansteigt, während die Anzahl an Beitragszahlern absinkt. Gleichzeitig werden die Kosten für Pflege in stationären Einrichtungen weiter ansteigen (siehe Kapitel 3.2). Aufgrund dessen ist es höchstwahrscheinlich sicherer zu sagen, dass der Generationenvertrag als einen adäquaten Lösungsansatz ebenfalls entfallen würde.
Eine ergänzende Steuerfinanzierung zum System der Pflegeversicherung scheint offenbar schon heute z.T. zu geschehen,244 jedoch sind auch hier die Meinungen etwas verschieden. Wenn man es nämlich ganz genau betrachtet, wird eine Steuerfinanzierung auch schon in der Hinsicht durchgezogen, dass die Möglichkeit besteht, Leistungen über die Sozialhilfe zu beziehen, welche aus Steuern finanziert sind (siehe Kapitel 2.3.2). So hält es auch Person 1 für falsch, dass das System mit Steuergeldern bezuschusst wird und dass stattdessen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung lediglich über die Sozialhilfe abwickelt werden.245 Ansonsten gibt es auch die Überzeugung, dass eine ergänzende Steuerfinanzierung auf jeden Fall eine breitere Finanzierungsbasis hergibt, welche auch die Abhängigkeit von Sozialversicherung verringern und das Solidarprinzip damit nochmal verdeutlichen kann.246 Daraus folgend könnte eventuell auch angespartes Vermögen mehr geschützt werden, das primär aufgebraucht werden müsste für den Bezug von Sozialhilfe. Es könnte aber auch hier wieder zu Widerstand von einigen Bürgern führen.247 Wenn nun aber bedacht wird, für was alles Steuergelder ausgegeben werden, müsste dieser Punkt nicht notwendigerweise von großer Bedeutung sein, da es in einem solchen Fall sowieso nie jedem recht gemacht werden kann, wie oder für was Steuern ausgegeben werden. Etwas vertiefend zur Thematik ist es auch so, dass es offenbar einige versicherungsfremde Leistungen gibt, die trotzdem von der Pflegeversicherung getragen werden.248 In dem Fall ist es durchaus dann auch so, dass nicht notwendigerweise bloß Gelder fehlen, sondern die werden dann für die falschen Dinge ausgegeben. Daher ist Person 3 vor allem der Auffassung, dass zumindest diese versicherungsfremden Leistungen durch Steuerfinanzierung abgedeckt werden sollten. Mit dem Gesagten hätte eine ergänzende Steuerfinanzierung durchaus Vorteile, die die Pflegeversicherung und Pflegebedürftigen entlasten würde. Sehr viel bis auf die Argumente mit dem Widerstand und einer bereits existierenden Sozialhilfe spricht demnach nicht gegen eine Steuerfinanzierung, wobei auch diese bereits diskutiert wurde. Darüber hinaus ist eine solche Finanzierung, wie bereits erwähnt, auch schon existent. Daher kann die Idee der ergänzenden Steuerfinanzierung als Idee angewandt werden.
Bei der Investition in Präventionsmaßnahmen sind sich alle befragten Experten einig, dass diese eine sinnvolle Idee ist, die zielführend sein könnte und durchaus zu Kosteneinsparungen führen könnte.249 Offenbar ist diese Maßnahme auch schon sogar gesetzlich vorgegeben, was nur nicht wirklich umgesetzt wird.250 Das einzige Gegenargument für eine solche Maßnahme wäre, dass es keine statistischen Auswertungen über die Effizienz gibt.251 Die Effizienz müsste wohl demnach langfristig beobachtet und erfasst werden. Damit lässt sich eindeutig sagen, dass auch diese Idee als Lösungsvorschlag durchgeführt bzw. angewandt werden sollte.
Als letzte mögliche Lösungsmaßnahme sind hier die Digitalisierungsmaßnahmen gelistet, mit denen Kosteneinsparungen innerhalb der stationären Einrichtung angestrebt sind und damit weniger Ausgaben für die Pflegeversicherung oder den Pflegebedürftigen. Hierzu werden verschiedene Möglichkeiten genannt, die sich z.T. in der Literatur (siehe Kapitel 4.4) und in den Aussagen der Experten überschneiden. Es wurde z.B. genannt, dass durch den Einsatz von KI-Softwaren der Verwaltungsaufwand deutlich reduziert werden kann und darüber hinaus auch menschengemachte Fehler verringert werden können.252 Ebenso können robotische Systeme wie Reinigungsroboter eingesetzt werden, um Reinigungs- bzw. Hauswirtschaftskräfte zu entlasten253 oder sogenannte Humanoid-Roboter, die z.B. zur Kommunikation angewandt werden können.254 Auch im Bereich der Telemedizin sind Möglichkeiten vorhanden, Fachkräfte in der Pflege zu entlasten, indem z.B. Vitalzeichen über Sensortechnologie gemessen werden.255 Auch Sachen wie Fernüberwachung werden hier erwähnt, die hier u.a. Erleichterung des Übergangs von Krankenhaus zu Pflegeeinrichtung bringen.256
Es ist zu sehen, dass die Möglichkeiten vielfältig sind und hohe Chancen bieten. Nun wäre jedoch unter besonderem Bezug auf die Kosten- und Finanzierungssituation der stationären Einrichtungen die Frage zustellen, ob diese auch tatsächlich bereit wären, großartig in solche Digitalisierungsmaßnahmen zu investieren und sich diese Investition langfristig refinanziert. Dies ist nämlich auch eine genannte Schwierigkeit unter den ganzen Chancen, die es mit sich bringt, nämlich dass Einrichtungen u.a. in Weiterbildungsmaßnahmen zur Anwendung digitaler Geräte und Programme investieren möchten, was einen sicherlich wesentlichen Kostenblock darstellen würde. Hierzu wäre es eventuell sinnvoll, als Erweiterung der Forschung zu ermitteln, inwieweit stationäre Einrichtungen selbst digitale Innovation als Chance sehen. Auf alle Fälle wäre trotz des möglichen Kostenfaktors kurzuschließen, dass die genannten Digitalisierungsmaßnahmen: KI, Telemedizin und Robotik als langfristiger Lösungsansatz mit aufgenommen werden können.
Um schließlich auf diesen Ergebnissen aufzubauen wäre es notwendig, stetige Veränderungen zu beobachten, die einen Einfluss auf die Finanzierung ausüben könnten. Im Falle einer konsequenten Umsetzung der hier als sinnvoll diskutierten Lösungsansätze, wäre es außerdem wichtig, im Rahmen von Studien oder Untersuchungen ihre tatsächliche Wirksamkeit zu prüfen.
6. Fazit
6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
Insgesamt wurde in dieser Arbeit untersucht, welche der in Kapitel 4 genannten Lösungsansätze unter fundierter Einschätzung am ehesten die Herausforderung der stationären Pflegefinanzierung bekämpfen bzw. abmildern können. Konkret wurde mit Hilfe von selbst entwickelten Fragen ermittelt, welche der Lösungsansätze aus Pflege-Bürgerversicherung, privaten Vorsorgemodellen, Generationenvertrag der PKV, ergänzender Steuerfinanzierung, Pflegepräventionsmaßnahmen und Digitalisierungsmaßnahmen eine zielführende Lösung bieten und welche eher problematisch bzw. kontraproduktiv sein könnte. Die Ergebnisse aus den hierbei geführten Experteninterviews haben gezeigt, dass eine Kombination aus privater und betrieblicher Altersvorsorge, Steuerfinanzierung, Präventionsmaßnahmen sowie diversen Digitalisierungsmaßnahmen effektive Lösungsansätze sind, während eine PflegeBürgerversicherung, betriebliche Vorsorgefonds und der Generationenvertrag der PKV eher weniger zielführende Lösungsansätze sind.
Die Pflege-Bürgerversicherung hat sich aufgrund ihrer Komplexität, der rechtlich schwierigen Umsetzbarkeit sowie der teils angezweifelten Sinnhaftigkeit als keine adäquate bzw. optimale Lösung erwiesen und ebenso wenig unter der Prämisse, dies mit einer Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze oder mit einer einheitlichen Kapiteldeckung zu kombinieren. Bei den betrieblichen Vorsorgefonds hat sich die Problematik ergeben, dass die daraus gebildeten Rücklagen bei einem Betriebswechsel schwer übertragbar sind und es darüber hinaus Verwaltungsschwierigkeiten geben könnte. Schließlich hat sich auch der Generationenvertrag als ein eher schwieriger Lösungsansatz erwiesen, da es auf der einen Seite zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ausgaben der Pflegeversicherung und die der Beitragszahler stabilisieren würde, auf der anderen Seite aber auch dazu führt, dass die Pflegebedürftigen auf hohen Kosten bleiben.
Eine Kombination aus betrieblicher und privater Altersvorsorge hingegen hat in den Ergebnissen gezeigt, dass diese vor allem in guten Zinsphasen Chancen bietet für die Versicherten im Falle einer späteren Pflegebedürftigkeit Gelder zu beziehen, um ihre Eigenanteile zu decken, sodass Angehörige mit hohen Einkommen oder Vermögen geschützt werden, wenn dadurch die Abhängigkeit von Sozialhilfe gemildert werden kann. Hier wird allerdings noch nicht die Ausgabenbelastung der Pflegeversicherung mitberücksichtigt. Diese könnte aber bei einer ergänzenden Steuerfinanzierung dazu berücksichtigt werden, welche sich als Lösungsansatz ebenfalls als eher sinnvoll erwiesen hat, um vor allem eine breitere Finanzierungsbasis der stationären Versorgung zu bieten. Auch wenn diese bereits z.T. schon durchgeführt wird, könnte man überlegen, dies etwas verstärkt durchzuführen. Investitionen in Präventionsmaßnahmen zur Pflegebedürftigkeit haben sich auch als optimaler Lösungsansatz gezeigt, der bei effektiven Resultaten zu hohen Kosteneinsparungen in stationären Einrichtungen führen könnte, da die Kostenträger für weniger Pflegebedürftige Leistungen tragen würden. Als letztes geben die Ergebnisse verschiedene Digitalisierungsmaßnahmen her, die in Einrichtungen umgesetzt werden können, um Kosten zu sparen. Hierzu zählen der Einsatz von KI in sämtlichen Verwaltungs- und Dokumentationstätigkeiten, welche die Arbeit und damit die Zeit von Menschen deutlich reduzieren kann. Weiterhin werden Maßnahmen wie der Einsatz von Telemedizin für beispielsweise die Überwachung von Vitalzeichen oder der Einsatz von robotischen Staubsaugern zur Entlastung von Hauswirtschaftskräften genannt. Die Maßnahmen wären offenbar mit hohen Investitionskosten verbunden, welche sich aber langfristig refinanzieren könnten.
6.2 Beantwortung der Fragestellung
Um die eingangs gestellte Forschungsfrage hiermit final beantworten zu können, ist hier basierend auf den genannten Ergebnissen zu sagen, dass eine Kombination aus den Lösungsansätzen: private und betriebliche Altersvorsorge, Steuerfinanzierung, Präventionsmaßnahmen und die im letzten Abschnitt genannten Digitalisierungsmaßnahmen durchzuführen bzw. umzusetzen ist. Die Entlastung der Kostenträger würde sich wie bereits beschrieben, aus der Umsetzung der Steuerfinanzierung und den Präventionsmaßnahmen langfristig ergeben, während sich die Entlastung bzw. die verringerte Abhängigkeit von Sozialhilfe der Pflegebedürftigen aus den Lösungsansätzen der privaten und betrieblichen Altersvorsorge sowie der Kosteneinsparung durch Digitalisierungsmaßnahmen ergeben würde.
6.3 Ausblick
Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen im Großen und Ganzen auf, welche Lösungsansätze die höchsten Chancen liefern, die in Kapitel 3 genannten Herausforderungen abzumildern. Die genaue Wirksamkeit kann jedoch nicht vollständig erläutert werden. Hierzu müsste vor allem die Politik aktiv werden und diese Ansätze umsetzen oder ermöglichen, sodass man langfristig die Wirksamkeit der genannten Lösungsansätze messen kann und daraufhin genauere Aussagen darüber treffen kann, ob die Lösungsansätze tatsächlich so sinnvoll sind, wie zuvor antizipiert. Im weiteren Verlauf wäre es dann möglich unter diesen Messungen weitere mögliche Theorien und Anpassungen für Lösungsansätze zu formulieren, die auf diesen beschriebenen Ansätzen aufbauen. Letztendlich können sich Dinge immer wieder wandeln, weshalb ohnehin immer wieder neue Annahmen getroffen werden müssten, die durchaus auch einen Bezug zur Finanzierung in der stationären Altenpflege haben könnten.
Literaturverzeichnis
AOK. Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG). https://www.aok.de/pp/reform/gvwg/ (Zugriff: 07.11.2024)
AOK (2024). Gutachten der AOK bestätigt Reformdruck in der Pflegefinanzierung. https://www.aok.de/pp/bv/pm/prognos-gutachten-pflegefinanzierung/ (Zugriff: 21.11.2024)
AOK. Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG). https://www.aok.de/pp/reform/ppsg/ (Zugriff: 06.11.2024)
Augurzky, B./Krolop, S./Schmidt, H./Terkatz, S. (2006). Pflegeversicherung, Rating und Demographie: Herausforderungen für deutsche Pflegeheime. (Hrsg.): RheinischWestfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Heft 26, Essen.
Arbeitgeberverband Pflege (2023). Zwei Pflegeeinrichtungen pro Tag mussten Insolvenzen anmelden oder schließen. https://arbeitgeberverband-pflege.de/das-haben-wir-zu- sagen/altenpflege-2023-zwei-pflegeeinrichtungen-pro-tag-mussten-insolvenz- anmelden-oder-schliessen/ (Zugriff: 10.11.2024)
Bahnsen, L./Raffelhüschen, B. (2019). Zur Reform der Pflegeversicherung: Eine Generationsbilanz. (Hrsg.): ifo-Institut.
Bahnsen, L. (2024). Zur Zukunftsfähigkeit der sozialen Pflegeversicherung. (Hrsg.): Wirtschaftliches Institut der PKV.
BIVA-Pflegeschutzbund (2022). Tariflohn für Pflegekräfte ab 1. September 2022: Was bedeutet das? https://www.biva.de/presse/tariflohn-fuer-pflegekraefte-ab-1-september- 2022-was-bedeutet-das/ (Zugriff: 19.11.2024)
Bleses, H.M./Ziegler, S./Füller, M./Beer, T. (2017). Personen mit Demenz und Telepräsenzroboter: Virtuelle Begegnung in Alltagssituationen. In: Pfannstiel, M.A./Kramer, S./Swoboda, W. (Hrsg.): Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen III. Springer Verlag, Wiesbaden, S. 231-232.
Blüher, S./Kuhlmey, A. (2023). Demographischer Wandel, Altern und Gesundheit. In: Richter, M./Hurrelmann, K. (Hrsg.): Soziologie von Gesundheit und Krankheit (2. Aufl.), Springer Verlag, Wiesbaden.
Brinkmann, C./Bienentreu, M. (2018). Bewertung von Seniorenwohn- und - pflegeimmobilien. In: Bienert, S./Wagner, K. (Hrsg.): Bewertung von Spezialimmobilien. Risiken, Benchmarks und Methoden. (2. Aufl.), Springer Verlag, Wiesbaden.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2024). Kapitallebensversicherung. https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Versicherung/Produkte/Leben/kapitalleben arti kel.html (Zugriff: 21.11.2024)
Bundesministerium der Finanzen (2024). Fragen und Antworten zur Reform der geförderten privaten Altersvorsorge. https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/reform-der-privaten- altersvorsorge.html (Zugriff: 21.11.2024)
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2021). Betriebliche Altersvorsorge. https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Altersvorsorge/Zusaetzliche- Altersvorsorge/Betriebliche-Altersversorgung/betriebliche-altersvorsorge-art.html (Zugriff: 21.11.2024)
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Gesetz für bessere Löhne in der Pflege. https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und- Gesetzesvorhaben/pflegeloehneverbesserungsgesetz.html (Zugriff: 20.11.2024)
Bundesministerium für Gesundheit (2015). Leistungsansprüche der Versicherten im Jahr 2015 an die Pflegeversicherung im Überblick.
Bundesministerium für Gesundheit (2017). Die Pflegestärkungsgesetze: Alle Leistungen zum Nachschlagen (4. Aufl.).
Bundesministerium für Gesundheit (2017). Erstes Pflegestärkungsgesetz (PSG I). https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a- z/p/pflegestaerkungsgesetz-erstes-psg-i (Zugriff: 04.11.2024).
Bundesministerium für Gesundheit (2024). Gesundheitsfonds. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/gesundheitsfonds.html (Zugriff: 21.11.2024)
Bundesministerium für Gesundheit (2017). Pflegevorsorgefonds. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a- z/p/pflegevorsorgefonds.html (Zugriff: 07.11.2024).
Bundesministerium für Gesundheit (2017). Zweites Pflegestärkungsgesetz (PSG II). https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a- z/p/pflegestaerkungsgesetz-zweites-psg-ii.html (Zugriff: 05.11.2024).
Bundesministerium für Gesundheit (2023). Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG). https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/gesetze-und- verordnungen/guv-20-lp/pueg.html (Zugriff: 07.11.2024).
Bundesministerium für Gesundheit (2024). Pflegeversicherung, Zahlen und Fakten. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/pflegeversicherung- zahlen-und-fakten (Zugriff: 22.10.2024).
Bundeszentrale für politische Bildung: Sozialhilfe. https://www.bpb.de/kurz- knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20646/sozialhilfe/ (Zugriff: 08.10.2024).
Caritas Verband für die Region Krefeld e.V. : Sponsoring - ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. https://www.caritas-krefeld.de/spende-amp-engagement/sponsoring/sponsoring (Zugriff: 09.10.2024).
Curacon (2024). Insolvenzsituation in der Sozialwirtschaft. https://www.curacon.de/neuigkeiten/neuigkeit/insolvenzsituation-in-der- sozialwirtschaft (Zugriff: 10.11.2024).
Das gesamte Sozialgesetzbuch SGB I bis SGB XIV (38. Aufl.). Walhalla Fachverlag, Regensburg 2024.
Die Bundesregierung informiert (2024). Neue Beitragsbemessungsgrenzen für 2024. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/arbeit-und- soziales/beitragsbemessungsgrenzen-2024-2229320 (Zugriff: 07.10.2024).
Evans, M. (2018). Wege zur „inneren Aufwertung“ der Arbeit in der Altenpflege: Wie können Gestaltungskapazitäten der Betriebs- und Sozialpartner gestärkt werden? (Hrsg.): Institut für Arbeit und Technik, Gelsenkirchen.
Gasch, S. (2022). Die Problematik in der Inflation in der Rechnungslegung. Springer Verlag, Wiesbaden.
Hackmann, T./Klein, R./Schneidenbach T./Anders M./Vollmer J. (2016). Pflegeinfrastruktur: Die pflegerische Versorgung im Regionalvergleich. (Hrsg.): Bertelsmann Stiftung, Bielefeld.
Hanf, U. (2011). Non-Profit-Organisationen. In: Lewinski-Reuter, V./Lüdemann, M. (Hrsg.): Glossar Kulturmanagement. Springer Verlag, Wiesbaden, S. 272-278.
Herborth, R. (2014). Grundzüge des Sozialrechts für die Soziale Arbeit. Lambertus-Verlag, Freiburg in Breisgau.
Holderried, M./Holderried, F./Gugler, B. (2017). Aus der Praxis für die Praxis: Potenziale und Herausforderungen auf dem Weg zur Digitalisierung interprofessioneller stationärer Gesundheitsdienstleistungen. In: Pfannstiel, M.A./Kramer, S./Swoboda, W. (Hrsg.): Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen III. Springer Verlag, Wiesbaden, S. 1-14
Kochskämpfer, S. (2019). Pflegeheimkosten und Eigenanteile: Wird Pflege immer teurer? (Hrsg.): Institut der deutschen Wirtschaft, Köln.
Kochskämpfer, S. (2020). Altenpflegepersonal: Neue Personalbemessung - und nun? (Hrsg.): Institut der deutschen Wirtschaft, Köln.
Kohlhoff, L/Grunwald, K. (2017). Finanzierung der Sozialwirtschaft (2. Aufl.). Springer Verlag, Wiesbaden.
Ludwig, C./Evans, M. (2020). Löhne in der Altenpflege: Helferniveaus im Spiegel von Fachkräftesicherung und Lohnverteilung. Ein Beitrag zur Lohn- und Tarifdebatte. (Hrsg.): Institut Arbeit und Technik, Gelsenkirchen.
Lünger, M. (2020). Ausbau solidarischer Finanzierungsoptionen in der Pflegeversicherung. Führt der Weg zur Pflegebürgerversicherung. In: Jacobs, K./Kuhlmey, A./Greß, S./Klauber, J./Schwinger, A. (Hrsg.): Pflegereport 2020 - Neuausrichtung von Versorgung und Finanzierung. Springer Verlag, Berlin, S. 209-220.
Mayring, P. (2022). Qualitative Inhaltsanalyse - Grundlagen und Techniken. (13 Aufl.). Beltz Verlag, Weinheim/Basel.
Meissner, H./Schrehardt, A. (2022). Kompass 2/2022: Krankentagegeldversicherung, Reform der sozialen Pflegeversicherung durch GVWG, Betriebliche Krankenversicherung - neue betriebliche Gesundheitslösungen. Verlag Versicherungswirtschaft GmbH & Co. KG, Karlsruhe.
Mischak, R./Ranegger, R. (2017). Automatisierte Erfassung von Vitalparametern im Zusammenhang mit elektronischen Fieberkurven zur Effizienzsteigerung von Pflege- und Behandlungsprozessen. In: Pfannstiel, M.A./Kramer, S./Swoboda, W. (Hrsg.): Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen III. Springer Verlag, Wiesbaden, S. 87-100
Moeller-Bruker, C./Pfeil, J./Klie, T. (2019). Leben mit Pflegebedarf zwischen Vorsorge und Zukunftsängsten. In: Klie, T. (Hrsg.): Pflegereport 2019: 25 Jahre Pflegeversicherung: Kosten der Pflege - Bilanz und Reformbedarf (Bd. 30) . Medhochzwei Verlag GmbH, Heidelberg, S. 125-179.
Möller, R. (2022). Finanzierung und Organisation des Sozialstaates (2. Aufl.). Springer Verlag, Wiesbaden.
Moos, G./Schneider, H. (2019). Fundraising als zukünftiges Finanzierungskonzept für die Wohlfahrtspflege. In: Schubert, B./Clausen, H. (Hrsg.): Treasury in Unternehmen der Sozialwirtschaft. Springer Verlag, Wiesbaden, S. 105-114.
Pack, J./Buck, H./Kistler, E./Mendius, H./Morschhäuser, M./Wolff, H. (2000). Zukunftsreport demographischer Wandel - Innovationsfähigkeit in einer alternden Gesellschaft. (Hrsg.): Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bonn.
PKV. Die Pflege in einer alternden Gesellschaft. https://www.pkv.de/wissen/pflegepflichtversicherung/die-pflege-in-einer-alternden- gesellschaft/ (Zugriff: 02.11.2024).
PKV-Serviceportal (2023). Das ist der Arbeitgeberzuschuss 2024. https://www.privat- patienten.de/verbraucher/arbeitgeberzuschuss-private-krankenversicherung/ (Zugriff, 27.10.2024).
PKV-Serviceportal (2019). PKV schlägt neuen Generationsvertragfür die Pflege vor. https://www.privat-patienten.de/pflege/pkv-schlaegt-neuen-generationenvertrag-fuer- die-pflege-vor/ (22.11.2024)
Rischard, P. (2019). Die Kosten der Pflege in Deutschland - Auswertung von der Pflege und Sozialhilfestatistik . In: Klie, T. (Hrsg.): Pflegereport 2019: 25 Jahre Pflegeversicherung: Kosten der Pflege - Bilanz und Reformbedarf (Bd. 30) . Medhochzwei Verlag GmbH, Heidelberg, S. 181 -221.
Rothang, H./Domhoff, D. (2019). Die Pflegebürgerversicherung als Vollversicherung: Beitragssatz- und Verteilungseffekte bei Umwandlung der Pflegeversicherung in eine Bürgerversicherung mit Vollversicherung. (Hrsg.): Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf.
Simon, M. (2021). Das Gesundheitssystem in Deutschland (7. Aufl.). Hogrefe Verlag, Bern.
Statista (2024). Anzahl der Leistungsempfänger in der privaten Pflegeversicherung in Deutschland in den Jahren 1997 bis 2022. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6680/umfrage/leistungsempfaenger-in-der- privaten-pflegeversicherung-seit-1997/ (Zugriff: 27.10.2024).
Statista (2024). Anzahl der Mitglieder und Versicherten der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung in den Jahren 2021 bis 2024. https://de.statista.com/statistik/daten/ studie/155823/umfrage/gkv-pkv-mitglieder-und- versichertenzahl-im-vergleich/ (Zugriff: 27.10.2024).
Statista (2024). Durchschnittliches Alter der Mütter und Väter bei der Geburt eines Kindes in Deutschland von 1991 bis 2023. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1180171/umfrage/durchschnittliches-alter- der-muetter-und-vaeter-bei-der-geburt-in-deutschland/ (Zugriff: 07.11.2024)
Statista (2024). Entwicklung der Beitragseinnahmen der privaten Pflegeversicherung in den Jahren 1997 bis 2022. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6733/umfrage/beitragseinnahmen-der- privaten-pflegeversicherung-seit-1997/ (Zugriff: 27.10.2024).
Statista (2024). Entwicklung der Versicherungsleistungen der privaten Pflegeversicherung in Deutschland in den Jahren 1997 bis 2022. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6734/umfrage/versicherungsleistungen- der-privaten-pflegeversicherung-seit-1997/ (Zugriff: 27.10.2024).
Statista (2024). Inflationsrate in Deutschland von 1950 bis 2023. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4917/umfrage/inflationsrate-in- deutschland-seit-1948/ (Zugriff: 23.10.2024).
Statistisches Bundesamt (2024). Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nach dem SGB XII. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft- Umwelt/Soziales/Sozialhilfe/Tabellen/ausgaben-einnahmen-t01-bruttoausgaben-insg- hilfearten-ilj-zv.html (Zugriff: 29.10.2024)
Statistisches Bundesamt (2024). Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste, Zeitreihe. https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-Branche- Berufe/Tabellen/liste-bruttomonatsverdienste.html#fussnote-2-134694 (Zugriff: 23.10.2024).
Statistisches Bundesamt. 5 Millionen Pflegebedürftige zum Jahresende 2021. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/12/PD22 554 224.html (Zugriff: 27.10.2024).
Statistisches Bundesamt. Pflegekräftevorausberechnung. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft- Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsvorausberechnung/pflegekraeftevorausberechnu ng.html (Zugriff: 01.11.2024).
Statistisches Bundesamt. Zahl der Pflegebedürftigkeit steigt bis 2070 deutlich an. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft- Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsvorausberechnung/aktuell-vorausberechnung- pflegebeduerftige.html (Zugriff: 01.11.2024).
Stiftung ZQP. Prävention in der Pflege. https://www.zqp.de/schwerpunkt/praevention- pflege/#implementierung (Zugriff: 22.11.2024)
Vaubel, M. (2019). Sicherung der strategischen Finanzierungsfähigkeit von Sozialunternehmen. Zentrale Aspekte der Finanzierung durch Banken. In: Schubert, B./Clausen, H. (Hrsg.): Treasury in Unternehmen der Sozialwirtschaft. Springer Verlag, Wiesbaden, S. 115- 132.
Verband der Ersatzkassen (2024). Daten zum Gesundheitswesen: Soziale Pflegeversicherung (SPV). https://www.vdek.com/presse/daten/f pflegeversicherung.html (Zugriff: 23.10.2024).
Verband der privaten Krankenversicherung (2019). Die private Pflegepflichtversicherung. Köln.
Verband der privaten Krankenversicherung (2024). Ein neuer Generationsvertrag für die Pflege - Einstieg in eine generationsgerechte Reform der sozialen Sicherung. Köln
Verbraucherzentrale: Kosten im Pflegeheim: Wofür Sie zahlen müssen und wofür die Pflegekasse. https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/pflege-im- heim/kosten-im-pflegeheim-wofuer-sie-zahlen-muessen-und-wofuer-die-pflegekasse- 13906 (Zugriff: 06.10.2024).
Verbraucherzentrale: Private Altersvorsorge: Diese Möglichkeiten haben Sie. https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/altersvorsorge/private-altersvorsorge-diese-moeglichkeiten-haben-sie- 13896 (Zugriff: 21.11.2024)
Anhang
Anhang 1: Tabelle zur Finanzentwicklung der sozialen Pflegeversicherung 1995-2023
Anhang 2: Einnahmen und Ausgabenentwicklung der privaten Pflegeversicherung
Anhang 3: Anzahl der Leistungsempfänger zur PPV 1997 bis
Anhang 4: Anzahl der Mitglieder der GKV und PKV 2021 bis
Anhang 5: Einnahmen und Ausgaben der Sozialhilfe nach SGB XII
Anhang 6: Anzahl Leistungsempfänger von Hilfe zur Pflege nach SGB
Anhang 7: Experteninterviewleitfaden
Anhang 8: Experteninterviews
Anhang 8.1: Experteninterview 1
Anhang 8.2: Experteninterview 2
Anhang 8.3: Experteninterview 3
Anhang 8.4: Experteninterview 4
Anhang 9: Kodierleitfaden
Anhang 1: Tabelle zur Finanzentwicklung der sozialen Pflegeversicherung 1995-2023
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 2: Einnahmen und Ausgabenentwicklung der privaten Pflegeversicherung
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 3: Anzahl der Leistungsempfänger zur PPV 1997 bis 2022
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 4: Anzahl der Mitglieder der GKV und PKV 2021 bis 2024
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 5: Einnahmen und Ausgaben der Sozialhilfe nach SGB XII
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 6: Anzahl Leistungsempfänger von Hilfe zur Pflege nach SGB XII
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 7: Experteninterviewleitfaden
Leitfaden - Experteninterview zur Altenpflegefinanzierung
Forschungsfrage:
Wie lässt sich die Finanzierung im Bereich der stationären Altenpflege langfristig so anpassen, dass die Pflegebedürftigen ohne zu große Abhängigkeit von Sozialhilfeträgern die Kosten für Pflege tragen können und ohne dass die Kostenträger in ihren Ausgaben zu sehr belastet sind?
1. Vor dem Interview
- Begrüßung des Interviewpartners und Vorstellung der eigenen Person
- Bedanken für die Teilnahme am Interview
- Kurze Erläuterung des Zwecks für das Interview
- Beschreibung der Dauer und Ablauf des Interviews
- Klären der Datenschutzvereinbarung
- Ggf. offene Fragen des Interviewpartners klären
2. Einstiegsfragen
- Herr/Frau XY könnten sie sich einmal kurz vorstellen und ihre Funktion hier in der Einrichtung beschreiben?
- Was gehört alles zu ihrem Aufgabenbereich?
- Wie lange sind sie schon in der Einrichtung tätig?
3. Hauptteil
Befragung zu einer potenziellen Pflege-Bürgerversicherung
1. Halten sie in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen unseres Pflegesystem eine Umwandlung in eine einheitliche Pflege-Bürgerversicherung mit einheitlichen Leistungen für eine sinnvollere Alternative und können sie ihre Antwort dazu begründen?
2. Würden sie sagen, dass eine Pflege-Bürgerversicherung in Kombination mit einer drastischen Erhöhung oder sogar einer Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze die Ausgabensituation in der Pflegeversicherung verbessern würde? Und wenn ja könnte es dann auch dazu führen, dass die Beitragssätze stabil gehalten werden?
3. Fänden sie es sinnvoller, wenn man eine einheitliche Pflege-Bürgerversicherung mit einer Kapiteldeckung kombiniert, sodass PPV-Versicherte ihre Altersrückstellungen beibehalten können und nun für alle Versicherten Altersrückstellungen gebildet werden können?
4. Kann eine Pflege-Bürgerversicherung von der Politik realistisch umgesetzt werden? Und wenn ja, wie?
Befragung zu privaten Vorsorgemodellen
1. Könnte eine Kombination aus betrieblicher und privater Altersvorsorge helfen, die EEE’s für den Versicherten finanzierbarer zu machen?
2. Finden sie die Idee sinnvoll, dass alle Betriebe für ihre Mitarbeiter eigene Vorsorgefonds einrichten, wo jeder einen frei gewählten individuellen Beitrag einzahlen kann für seine zukünftige Altersvorsorge und welche möglichen Schwierigkeiten könnte es mit sich bringen? Würde ein Mindesteinzahlbetrag Sinn machen?
Befragung zum Generationenvertrag der PKV
1. Könnte der Generationenvertrag in seinen Gestaltungsoptionen dazu führen, dass die Versicherten im Falle einer Pflegebedürftigkeit höhere Eigenanteile zahlen müssen, wenn die Leistungsausgaben an den Beitragseinahmen angepasst werden würden?
2. Können die Kosten, die mit diesem Konzept nicht mehr von der Pflegeversicherung abgedeckt werden durch private Vorsorge wie z.B. Zusatzversicherung abgedeckt werden oder werden die Pflegebedürftigen immernoch zum Großteil auf Sozialhilfe angewiesen sein?
Befragung zu möglichen Anpassungen des aktuellen Finanzierungssystems
1. Sollte die Pflegefinanzierung mit einer Steuerfinanzierung ergänzt werden und würde dies allein schon einen Unterschied ausmachen?
2. Ist es umsetzbar, dass Kranken- und Pflegeversicherung in Präventionsmaßnahmen für zukünftige Pflegebedürftigkeit investieren, sodass die Pflegeversicherung für weniger Nutzer zahlen muss?
3. Welche konkreten Chancen bietet die Digitalisierung im Bereich der stationären Pflege, die zu einer Kostenreduktion und damit geringeren Ausgaben führen könnte?
3. Nach dem Interview
- Bedanken für die Teilnahme
- Erneut erklären wie die Daten und Inhalte verarbeitet werden
- ggf. Nachfrage zu Unklarheiten klären
- Verabschiedung
Anhang 8: Experteninterviews
Anhang 8.1: Experteninterview 1
Experteninterview 1
Interviewpartner: Person 1
Datum: 16.12.2024 um 16:00 Uhr
Ort: Microsoft Teams
00:00:00 - 00:28:36
I: Herr [Person 1], könnten Sie sich sonst einmal kurz vorstellen und ihre Funktion beschreiben? #00:00:12#
B1: Ich bin Jurist und Erziehungswissenschaftler und arbeite als Hochschullehrer und als Anwalt im Bereich Organisation und soziale Arbeit. #00:00:20#
I: Alles klar, vielen Dank. Ich glaube, das haben sie schon direkt beantwortet: Was alles zu ihrem Aufgabenbereich gehört, wie lange sie schon tätig sind? #00:00:30#
B1: Seit '94 habe ich eine Zulassung als Anwalt. #00:00:34#
I: Ok. Sehr interessant, alles klar. Dann danke ich ihnen auf jeden Fall. Ich würde dann direkt mit der ersten Frage dann beginnen (...) und zwar zu einer potenziellen Pflegebürgerversicherung. Und zwar gibt es ja die Diskussion, dass man (...) die soziale Pflegeversicherung als auch die private Pflegeversicherung vielleicht abschaffen sollte und etwas einheitliches etablieren sollte. Da wäre meine erste Frage: Halten sie in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen unseres Pflegesystems eine Umwandlung in eine einheitliche Pflegebürgerversicherung mit einheitlichen Leistungen für eine sinnvolle Alternative und können sie ihre Antwort dazu begründen? #00:01:17
B1: Das ist nach meiner Sicht eine gute Idee. Alles, die zwar die Aufgaben ausweiten würde, aber die Finanzierung verbreitern würde (...) vollständige Lösungen, substanzielle Lösungen der derzeitigen Schwierigkeiten ergibt sich aber noch nicht. #00:01:39
I: Alles klar (...) also, es gibt ja gewisse Unterschiede zwischen der sozialen als auch der privaten Pflegeversicherung, also die Leistungen sind mehr oder weniger gleich, aber unterschiedliche Beiträge aufgrund des unterschiedlichen Systems, daher gibt es ja zumindest die Diskussion, dass man es vereinheitlichen könnte. Und sie würden sagen es auf jeden Fall eine Option wäre? #00:02:09
B1: Ist gut. Nur die löst die strategischen Probleme der sozialen Pflegeversicherung nicht #00:02:14#
I: Alles klar. Danke. Dann würde ich zur zweiten Frage dann direkt übergehen: Würden sie sagen, also noch zur Pflegebürgerversicherung, würden sie sagen, dass eine Pflegebürgerversicherung in Kombination mit einer drastischen Erhöhung oder sogar einer Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze die Ausgabensituation in der Pflegeversicherung verbessern würde und wenn ja, könnte es auch dann dazu führen, dass die Beitragssätze stabil gehalten werden? Ist eine etwas längere Frage #00:02:45#
B1: Die Beitragsbemessungsgrenze ist ja ein Werkzeug, mit dem sichergestellt werden soll, dass (...) dass Äquivalenz zwischen Beitragspflicht und dann zu erwartenden Leistungen gesichert werden, das heißt in beliebige Höhe lässt sich das nicht verändern und deshalb wird man zu einer Er-//würde man mit einer veränderten Beitragsbemessungsgrenze sicherlich mehr Geld in das System bekommen, aber man müsste unter Äquivalenzgesichtspunkten auch noch irgendeine Relation zwischen dem zu zahlenden Beitrag und der erwartenden Leistung herstellen und deshalb ganz unlimitiert lässt sich die Beitragsbemessungsgrenze sicherlich nicht verschieben. #00:03:47#
I: Ah ich verstehe. Ja klar, macht auch Sinn. Warum sollte man letztendlich auch mehr zahlen, wenn man dann weniger Leistung in Anspruch bekommt, dann dadurch, jedoch sehe ich es so, weil die Ausgaben steigen, ja immer weiter über die letzten Jahre sind sie ja nur gestiegen, Beiträge steigen. Genauso haben wir auch das Ding mit Inflation (...) also wäre wahrscheinlich ein radikaler Umschwung und würde wahrscheinlich auch weniger Sinn machen, wenn man nicht die entsprechende Leistung bekommt, aber es würde zumindest die Ausgabensituation und vielleicht die Beitragsstabilität etwas verbessern, was dann vielleicht dann wieder einen positiven Effekt hätte. #00:04:25#
B1: Ja wie gesagt, es ist ganz gut (...) man kann ein bisschen was tun, nur (...), dass die Idee von Äquivalenz, muss auch im Zusammenhang gewählt mit einer Sozialversicherung erhalten bleiben #00:04:58#
I: Verstehe. #00:04:59#
B1: Und das heißt, es muss irgendeine Relation zwischen den Beitrag und der Leistung bestehen. #00:05:05
I: Relation muss gegeben sein. Also das heißt unendlich erhöhen könnte man demnach dann offensichtlich nicht, aber wenn es dann zu einer Pflegebürgerversicherung in dem Sinne kommen würde, wo es dann ein einheitliches System gibt, bisschen höher gehen wäre aber dann nicht wirklich problematisch? #00:05:25#
B1: Genau! Genau! #00:05:27#
I: Dann weiß ich Bescheid alles, alles klar. Vielen Dank, ich gehe zur nächsten Frage dann über (...): Fänden sie es sinnvoller, wenn eine einheitliche Pflegebürgerversicherung mit einer Kapitaldeckung kombiniert wird, sodass private Pflegeversicherte ihre Altersrückstellungen beibehalten können und somit nun für alle Altersrückstellungen gebildet werden können? (...) Also quasi Pflegebürgerversicherung, aber in Form einer Kapitaldeckung, wie es in der privaten Pflegeversicherung ist. #00:06:03#
B1: Kapitalgedeckte Systeme haben natürlich in Zeiten der Verzinsung viel Charm. Die Frage, die strategisch zu beantworten ist, ist wie geht man bei den kapitalgedeckten Systemen mit Kreditverhältnissen am Finanzmarkt//an den Finanzmärkten um? Und wenn wir eine Niedrigzins Phase haben, führt halt ein kapitalgedecktes System dazu, dass kaum Mittel zur Verfügung stehen, und deshalb kann man eventuell über kombinierte Systeme nachdenken, ich glaube persönlich nicht daran, dass die Kapitaldeckung das eigentliche Problem strategisch löst. #00:06:48#
I: Ah ok. Also es ist dann in dem Fall eher ein Risiko? Also es kann gut gehen//#00:06:55#
B1: Ja es bietet eine Chance, man freut sich in den Zeiten von guten Zinsen daran, aber wenn sie eine Verzinsung von vielleicht 2% haben und eine Geldentwicklung, Geldwertentwicklung von 3% und vielleicht noch eine Sonderheit bei Lohnsteigerung, vielleicht 6 oder 7% stehen haben, dann werden sie mit einem kapitalgedeckten System nicht so richtig was werden. #00:07:18#
I: Ah verstehe, ah ok. Hatte ich so nicht drüber nachgedacht, aber interessant zu wissen. Niedrigzinsphasen, dann würde es das dann doch vielleicht nicht lösen können, ok.
(...) Gut ich hätte keine weiteren Rückfragen, ich gehe dann zur nächsten Frage (...) Das wäre dann glaub ich auch die letzte Frage zur Pflegebürgerversicherung: Kann eine Pflegebürgerversicherung von der Politik realistisch umgesetzt werden und wenn ja, wie? #00:07:54#
B1: Indem man eine parlamentarische Mehrheit für eine Auflösung der privaten Systeme schafft, also das wird ja nicht gehen, ohne dass auch im Bereich der Krankenversicherung zum Bürgerversicherungsmodell kommt und dafür braucht man eine politische Mehrheit, die das will (...) derzeit gibt es die glaub ich nicht. #00:08:14#
I: Ja, die muss erstmal zustande kommen, also da gibt es ja immer Diskussionen, es gibt Leute, die dafür sind, es gibt Leute, die dagegen sind, sowie es in einer Politikebene nun mal ist. #00:08:22#
B1: Genau. #00:08:24#
I: Alles klar. Also nur eine mehrheitliche Zustimmung hindert den Ganzen? #00:08:29#
B1: Joa, das, das ist der Schlüssel, dass man eine parlamentarische Mehrheit für so ein Modell bekommt auf Bundesebene. #00:08:37#
I: Alles klar, weiß Bescheid. Joa, naja wer weiß vielleicht kommt die ja irgendwann mal zustande. Aber mhm, ja. Na gut, dann gehe ich zu den weiteren Fragenblock über. Zu privaten Vorsorgemodellen (...) Könnte eine Kombination aus betrieblicher und privater Altersvorsorge helfen die einheitlichen//Entschuldigung! Die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile für den Versicherten finanzierbarer zu machen? (...) Also in Bezug darauf// #00:09:13#
B1: Alles was (...) im Ergebnis Pflegebedürftige Menschen zu Geld verhilft, hilft natürlich bei der Finanzierbarkeit der Eigenanteile. Das Problem sind//besteht ja im Kern bei Menschen, die kein bedeutendes Vermögen haben und nur relativ geringe Renten. #00:09:36#
I: Ja #00:09.37#
B1: Und das sind Menschen, die auch schon keine bedeutenden Arbeitseinkommen erzielt haben und bei denen wird auch// werden auch betriebliche Altersversorgungssysteme, kapitalgedeckte, betriebliche Altersversorgungssysteme nicht zur grundlegenden Verbesserung führen, weil deren Beiträge einfach zu gering sind. Also wenn es dort etwas gibt, ist das gut, aber das wird auch nach meiner Sicht keine durchgreifende Verbesserung der Lage bringen für diese Gruppe. #00:10:09#
I: Also ich glaube da grundsätzlich kann man das komplett lösen ja natürlich nie, aber ich würde glaube ich auch denken, dass das ein bisschen helfen würde, dass dann auch Sozialhilfeträger weniger zahlen müssten, weil aus einer Rente, es gibt ja Eigenanteile, die ja, weiß ich nicht bei 4.000 teilweise sind und das zahlt natürlich keine Rente, da braucht es ja glaub ich solche Systeme, wo dann ein bisschen mehr rauskommt, dass eine Altersvorsorge// #00:10:39#
B1: Genau #00:10:41#
I: Joa (...) aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher wie viele Menschen tatsächlich eine private//also es gibt ja immer die Möglichkeit eine betriebliche Altersvorsorge, in sowas einzuzahlen. Man kann es aber auch mit einer privaten Altersvorsorge kombinieren. Wie viele das aber dann tatsächlich machen ist eine andere Frage, ich glaube die wenigsten wissen auch davon. Vielleicht sollte man mehr Leute dazu sensibilisieren, damit man später eher abgesichert ist, also mehr abgesichert #00:11:11#
B1: Ja. Alles gut. Das ist nur für Menschen mit geringen Einkommen nicht besonders attraktiv (...) also man bräuchte ja (...) eine hohe Arbeitgeberbeteiligung und wenn man (...), wenn man eine geringe Arbeitgeberbeteiligung hat, heißt es einfach schlicht die Aufforderung grade an (Beziehern?) niedriger Einkommen: Gibt mal mehr von euerm Geld ab, um die Sozialhilfeträger zu entlasten. Wer im Monat 2.000€ hat und vielleicht davon mit//auch noch mit einem Kind leben soll, wie soll er das machen? „Zahlen sie auch mal nur 150€ eine zusätzliche Altersvorsorge rein“ Der wird ein bisschen uneuphorisch gucken #00:12:10#
I: Logisch. Klar also (...) das ist für jeden immer ein bisschen unterschiedlich. Also die einen können sich das mehr finanzieren die anderen nicht. #00:12:23#
B1: Und die, die es sich leisten können haben das Problem nicht. Simpel gesagt. #00:12:28#
I: Das beantwortet sogar ein Stück weit auch sogar die Frage, die ich als nächstes gestellt hätte, und zwar: Finden sie die Idee sinnvoll, dass alle Betriebe für ihre Mitarbeiter eigene Vorsorgefonds einrichten, wo jeder einen frei gewählten individuellen Betrag einzahlen kann für seine zukünftige Altersvorsorge und welche möglichen Schwierigkeiten könne es mit sich geben? Würde ein Mindesteinzahlbetrag Sinn machen? Und ich glaube// #00:12:55#
B1: Ich finde, dass//Wie gesagt: Für die Leute, die Geld haben gibt es ja die Möglichkeit Geld anzulegen und zu sparen. Ich weiß auch nicht warum wir die//Das würde ja im Ergebnis zu einer Erhöhung der Arbeitskosten führen. Also: Wenn ein Arbeitgeber zusätzliche Mittel aufbringen müsste zur Altersversorgung, weil er z.B. einen Arbeitgeberanteil in die Sache zahlt (...) warum man das für reiche Leute tun sollte, wüsste ich nicht oder Leute mit gutem Einkommen. Die können das auch selber organisieren und die Menschen mit den niedrigeren Einkommen, für die ist es am Ende nicht wirtschaftlich attraktiv #00:13:34#
I: Ich verstehe. Ja müsste man (...) müsste man umdenken (...) #00:13:44#
B1: Also wirklich einfaches Kontrollbeispiel: Eine Person, die sagen wir mal eine alleinerziehende Mutter, die 2.000€ Netto hat. Das ist garnicht mal wenig Geld. Etwa 3,5 Brutto (...) Vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber 3,5 wird sie etwa verdienen. Das ist schon ganz ordentliches Geld (...) Die hat 2.000 Netto, davon zahlt die sagen wir mal 800€ Miete. Das ist auch nicht viel. Und die und ihr Kind brauchen zum Leben nochmal 900€. Dann sind wir bei 1.700 und da sind noch kein Urlaub und sonst was drin. Und der jetzt zu sagen „Wissen sie was? Wir haben eine gute Idee für Sie. Geben sie im Monat nochmal 150€ ab!“ #00:14:42#
I: Ja, schwierig (...) ja ist unlukrativ für die meisten #00:14:53#
B1: Und da rede ich nicht über Leute mit Mindestlohn, also für die ist das//also für die, die es am deutlichsten brauchen sowieso sinnlos. #00:14:59#
I: Ja (...) ja stimmt, stimmt. Da soll das System dabei helfen, dass man später, wenn man irgendwie pflegebedürftig ist, dass man da finanziell abgesichert ist, aber wenn man sich so eine Altersvorsorge überhaupt nicht mal leisten kann wegen geringen Einkommen, dann nützt es ja auch nichts ja. #00:15:22#
B1: (...) Ja. #00:15:25
I: Ja für die mit mehr Einkommen, die auch sowieso dann später mehr Rente bekommen lohnt sich sowas mehr, aber die, die dann wirklich am Ende wenig Rente bekommen würden, weil sie wenig Einkommen haben, ja woher sollen sie das Geld dafür nehmen? #00:15:38#
B1: Exakt #00:15:40#
I: Wobei ich denke, also so ein Einzahlbetrag kann man ja variabel gestalten, aber wie wenig will, man dann einzahlen, also wie viel bekommt man am Ende daraus dann auch? #00:15:50#
B1: Wenn sie 50€ im Monat einzahlen habe sie am Ende 600€ im Jahr, selbst wenn sie das so Verzinsen, dass so verzinsen über eine lange Laufzeit, dass sich der Betrag verzehnfacht, dann haben sie 6.000€. Wenn sie eine Zuzahlung 2.000€ im Monat haben, sind damit drei Monate Pflegebedürftigkeit bezahlt als Zuzahlung. #00:16:18#
I: Ja (...) ja dann doch eher schwierig. Alles klar, danke sehr. Na gut, ich komm dann mal zu der nächsten Frage, also sind noch fünf Fragen übrig. Diesmal zum Generationenvertrag der PKV. Das ist ja ein Vorschlag der PKV den sie glaub ich mal gebracht haben. Da wäre die erste Frage daraus: Könnte der Generationenvertrag in seinen Gestaltungsoptionen dazu führen, dass die Versicherten in Falle einer Pflegebedürftigkeit höhere Eigenanteile zahlen müssen, wenn die Leistungsausgaben an den Beitragseinnahmen angepasst werden würden? Also ich hatte mich ja mit der// in meiner Arbeit auch mit dem Generationenvertrag befasst und die haben ja drei verschiedene Gestaltungsoptionen und das ist sehr weit daran angelehnt, was man einzahlt, und das soll man als Leistung dann wieder bekommen mehr oder weniger, also hatte drei verschiedene Gestaltungsoptionen. Ich bin da nicht mehr ganz drin, aber vielleicht könnten sie was dazu sagen. #00:17:26#
B1: Aber gut, also als erstes ist es ja mal gar kein richtiger Vertrag, sondern das ist ja so eine Art//Dieser Generationenvertrag ist ja eine Art sagen wir mal gedankliche Grundlage der Gestaltung von Sozialversicherungen, so muss man das ja in etwa sagen. #00:17:42#
I: Ok, ja #00:17:43#
B1: Mehr ist es ja nicht, oder nicht weniger, es ist auf jeden Fall kein Vertrag in einem zivilrechtlichen oder sonstigen gemeinten Sinn. Wo und was, was führt zu den Ungleichgewichten? Natürlich die aktuelle oder die demographische Situation, sowie sie zu erwarten steht, in der Menschen meines Alters immer einen sehr großen Anteil an der Bevölkerung darstellen und das ist solange gar kein Problem solange die erwerbstätig sind aber wenn diese sogenannten Boomer eben nicht mehr erwerbstätig sind dann entsteht eben das Problem und (...) ich glaube persönlich, dass dadurch so Korrekturen an Beitragslasten bisschen was zu machen ist, bisschen durch Korrekturen an Eigenanteilen bisschen was zu machen, aber das eine strategische Lösung wird nur dadurch nach meiner Sicht zur erzielen sein, dass (...) der Character der Pflegeversicherung verändert wird, dass sie eben nur Pflegeleistung zuständig ist und nicht auch in den stationären Pflegen die Grundsicherungsleistung mit abdeckt. Die müssen rausgenommen werden und steuerfinanziert werden. #00:19:04#
I: Ja verstehe (...) jut ich hätte dem glaube ich nichts hinzuzufügen (...) also im Endeffekt gewisse Leistungen wie sie grade meinten werden herausgenommen und (...) es kann dann dazu führen, dass die Last erhöht, wird aber auch nicht? #00:19:35#
B1: Die Pflegeleistung an sich wird selbstverständlich teurer, weil das Personal teurer wird (...) Mann muss sich da an bestimmte Dinge mechanisieren und so das wird das kontrollierbar machen aber die Pflegeleistung wird teurer. Das ist aber eine Aufgabe der Pflegeversicherung das abzudecken, aber die steigenden Kosten für Unterkunft und Verpflegung, das müssen entweder die Menschen selber zahlen, was sie ja auch wenn sie nicht stationär pflegebedürftig werden, selber zahlen müssen oder wenn jemand seine Unterkunft und Verpflegung nicht zahlen kann dann muss das die Sozialhilfe zahlen #00:20:09#
I: Ja, ich verstehe alles klar. Gut dann die zweite Frage, die ich dazu hätte, also danke erstmal: Können die Kosten, die mit diesem Konzept nicht mehr von der Pflegeversicherung abgedeckt werden durch private Vorsorge wie zum Beispiel Zusatzversicherungen abgedeckt werden oder werden die Pflegebedürftigen immernoch zum Großteil auf Sozialhilfe angewiesen sein? Also immernoch in Bezug auf diesen Generationenvertrag in Anführungszeichen #00:20:40#
B1: Alle pflegebedürftigen Menschen mit niedrigen Einkommen werden im Alter auf Sozialhilfe angewiesen sein. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das ist eine große Qualität des Sozialstaats, dass es diese Garantie gibt und ich glaube (extrem wichtig?) ist es diese Lasten zu limitieren. Die Leistungen, die auch sonst beim SGB XII vorgesehen sind, nämlich die Verpflegung zu den Unterkunftskosten und diese etwas mischfinanzierte Pflege also die SGB XI Leistungen und so weiter aufzulösen und zu sagen: Pflege kümmert sich nur um Pflege. #00:21:20#
I: Ja klar, also bin voll und ganz bei ihnen. Also das ist dieses System gibt also da kann man auf jeden Fall ich sag mal sehr dankbar für sein, dass es so ein System gibt, dass man dadurch abgesichert ist. Auf der anderen Seite sehe ich das so, dass der Steuerzahler ja dafür aufkommt, also Sozialhilfe zahlt, soweit es geht und ich denk mal so wenn es irgendwie Möglichkeiten gibt, dass die Sozialhilfe weniger zahlen muss, dass sie irgendwie entlastet wird, dann würde man das natürlich irgendwie hinnehmen. Deswegen habe ich diese Frage so gestellt. Ja ärmere Leute werden dann mehr angewiesen sein. An sich jetzt nicht das große Problem. Ich glaube der Steuerzahler an sich würde sich mehr freuen, wenn das reduziert werden könnte, weil die Sozialhilfe selber//Sozialhilfeträger selbst// joa. #00:22:11#
B1: Ja, joa das wird immer so diskutiert. Ich freu mich natürlich, auch wenn ich weniger Steuern zahlen muss, aber eigentlich auch nicht so doll. Es gibt eine alte Regel: Nur reiche Leute könne sich einen armen Staat leisten und ich finde nicht, dass wir einen Staat konstruieren müssen, der vor allem Ding für reiche Leute da ist. Er soll für alle Leute da sein. Arme Leute können sich keinen armen Staat leisten. #00:22:36#
I: Eben (...) Joa. Ja gut alles klar (...) Na gut drei Fragen sonst noch. Das sind jetzt mehr so kleinere Fragen zu möglichen Anpassungen am Finanzierungssystem selbst: Sollte die Pflegefinanzierung mit einer Steuerfinanzierung ergänzt werden und würde diese allein schon einen Unterschied ausmachen? #00:23:03#
B1: Wie gesagt ich vertrete eine andere Auffassung. Ich meine nicht, dass wir dieses im stationären Bereich (...) angelegte System auf Unterkunftsverpflegung und Pflegeleistung integrierende Systeme stark machen sollten, sondern ich meine wir sollten die Unterkunfts- und Verpflegungsleistung aus dem System rausnehmen und die sollen steuerfinanziert als Sozialhilfe laufen, sofern persönlicher Bedarfe// #00:23:36#
I: Also die Hotelkosten meinen sie, also die Unterkunft und Verpflegung, also das sollte rausgenommen werden und//ok. Ja, ja (...) Wäre vielleicht glaube ich eine Idee. Also das zahlt ja sowieso ja der Pflegebedürftige selbst in Form seiner Eigenanteile und sie sagen, wenn das mit Steuerfinanzierung ergänzt, wird dann// #00:23:56#
B1: (Ganz formal?) Sozialhilfe! Für arme Leute zahlt es die Sozialhilfe, und zwar wie immer ergänzend. #00:24:03#
I: Ja ok. Ich glaub meine Idee war eher, dass diese Steuerfinanzierung eher auf die (...)
wie heißen die Kosten? Also Pflegekosten ergänzt wird. #00:24:16#
B1: Ja das halte ich für falsch #00:24:18#
I: Ah ok (...) also macht in ihrer Auffassung weniger Sinn? #00:24:23#
B1: Ja wenn man eine soziale Pflegeversicherung hat. Muss die soziale Pflegeversicherung aus Pflegeversicherungsbeiträgen so ausgestattet werden, dass sie ihre Aufgabe erfüllen kann. Und die Beiträge werden steigen ja, aber das ist eine bestimmte systematische Frage wie man das finanziert aber alles sozusagen alles mit allen Werkzeugen zu bedienen wird nicht dazu führen, dass irgendwas besser wird. #00:24:46#
I: Ok, alles klar ok (...) ja, also kann gut sein war jetzt auch nur sie eine Idee aber kann natürlich was Wahres dran sein, dass es dann tatsächlich nicht wirklich zu einer adäquaten Lösung führt. Na gut. Vorletzte Frage: ist es umsetzbar, dass Kranken und Pflegeversicherung in Präventionsmaßnahmen für zukünftige Pflegebedürftigkeit investieren, sodass Pflegeversicherungen für weniger Nutzer zahlen muss? Ich habe das jetzt ein bisschen komisch formuliert. #00:25:31#
B1: Ne, weil ich versteh die Frage und die Antwort auf die Frage ist ja #00:25.35#
I: Also quasi. Meine Idee war durch, dadurch, dass halt Präventionsmaßnahmen geführt werden, sodass Pflegebedürftigkeit reduziert wird. Und das ist umsetzbar? Ich glaube auch, dass nicht nur Pflegeversicherungen dafür aufkommen sollten, sondern auch Krankenversicherungen. Ich glaub, dadurch hätten alle einen Nutzen dadurch #00:25:56#
B1: Ja genauso. #00:25:58#
I: Man kann natürlich jetzt nur Schätzungen abgeben wie effizient dann sowas wird aber sie meinen das würde schon gut helfen? #00:26:10#
B1: Das weiß ich garnicht, aber es ist (...) nützlich alles zu machen, was man tun kann um Pflegebedarfe (unv.) stationären Pflegebedarfe zu limitieren. Wenn es dazu helfen kann, ist es gut #00:26:32#
I: Ok. Ok. Alles klar, danke sehr. Dann die letzte Frage zur Digitalisierung: Welche konkreten Chancen bietet die Digitalisierung im Bereich der stationären Pflege, die zu einer Kostenreduktion und damit geringeren Ausgaben führen könnte? #00:26:49#
B1: Ganz viele. (...) ein ganz einfaches Beispiel sind Staubsauger und Reinigungsroboter. #00:27:00#
I: Das habe ich auch schon gelesen. #00:27:03#
B1: Jeder Mensch kann für kleines Geld beim Saturn Markt kaufen. Sozusagen warum sollte man die nicht auch einsetzen und vieles andere mehr. Also alles, was man einsetzen kann, soll einsetzen, weil das Personal knapp und teuer wird, und im Übrigen muss man viel ausprobieren. Es kann gut sein, dass irgendetwas, was wir zurzeit uns noch garnicht vorstellen können im Bereich der Pflege gut eingesetzt werden kann und das werden//wird man wahrscheinlich nur durch ausprobieren rauskriegen #00:27:37#
I: Jaja genau ja, also die Digitalisierung ist ja noch eine// ja eine Welt, die in Deutschland nicht so krass fortgeschritten ist wie in anderen Ländern, aber auf jeden Fall bietet eine Chance, kann man ausprobieren und ich glaub ich würde das genauso sehen, also gerade in Pflegeheimen, stationären Pflegeeinrichtungen die Hauswirtschaftskräfte also man würde wahrscheinlicher weniger von denen brauchen, man könnte die entlasten, reduziert Personalkosten. Würde ich persönlich auch Chancen drin sehen. #00:28:07#
B1: Alles ausprobieren was geht! #00:28:10#
I: Joa, alles klar (...) gut, ich hätte dann nichts weiter zu ergänzen. Das wären alle meine Fragen gewesen. Herr [Person 1] ich bedanke mich vielmals für ihre Zeit und ihre Teilnahme am Interview und wie sie vermutlich ja schon wissen: Die (...) Aufnahme, die stoppe ich auch mal ganz kurz. #00:28:36
Anhang 8.2: Experteninterview 2
Experteninterview 2
Interviewpartner: Person 2
Datum: 27.12.2024 um 09:30 Uhr
Ort: Microsoft Teams
00:00:00 - 01:15:00
I: Herr [Person 2] können Sie sich einmal kurz vorstellen und ihre Funktion in der Einrichtung beschreiben beziehungsweise im Unternehmen, wo sie sind. #00:00:13#
B2: Gerne! Ja mein Name ist [Person 2] ich bin [50-60] Jahre alt und leitete bei der DKV und das ist ein Unternehmen des AWO Konzerns internationaler Versicherungskonzern die Abteilung Pflegeservice jetzt im 10. Jahr startete im September 2015 in dieser Abteilung und sie umfasst fünf Pflegeteams mit circa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und daneben verantworte ich noch 2 weitere Einheiten mit den privaten Sozialtarifen das ist der Basis der Notlagen und der Standardbrief in der Gesetzgeber Ende der 2000er einforderte, um ja finanzschwächeren Versicherten noch die Möglichkeit zu geben weiterhin privat versichert zu sein. #00:01:11#
I: Alles klar vielen Dank Herr [Person 2] sie haben damit auch schon direkt die zweite und dritte Frage der Einstiegsfrage beantwortet ich glaube da muss ich nicht noch mal stellen. Vielen Dank dann würde ich direkt zur ersten Frage übergehen, und zwar zur Pflege Bürgerversicherung. Ja zur Pflege Bürgerversicherung das ist ja ein Thema, das sie aktuell in der Politik immer wieder diskutiert wird, dann werden meine erste Frage direkt halten sie in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen unseres Pflegesystems eine Umwandlung in eine einheitliche Pflege Bürgerversicherung mit einheitlichen Leistungen für eine sinnvollere Alternative und können sie ihre Antwort dazu begründen? #00:01:52#
B2: Ja, die Diskussion über eine einheitliche Pflege Bürgerversicherung ist komplex und umfasst verschiedene Aspekte und eine solche Reform könnte potentiell einige Vorteile natürlich mit sich bringen da zähle ich mal drei Stück auf: Das ist zum ersten die Gleichheit der Leistungen an einheitliche Pflege Bürgerversicherung könnte dazu führen, dass alle Menschen in Deutschland unabhängig von ihrem Einkommen oder gibt Wohnort Zugang zu denselben Pflege Leistungen haben. Das könnte soziale Ungleichheiten im Gesundheitswesen verringern. Zum zweiten die finanzielle Stabilität. Durch eine zentrale Finanzierung könnten die Kosten für die Pflege besser kalkuliert und verteilt werden könnte im Besonderen in Anbetracht der demografischen Veränderungen und der steigenden Anzahl pflegebedürftiger Menschen sinnvoll sein wenn man sich im Besonderen vorstellt oder auch betrachtet, dass die Sterbetafel vor wenigen Jahren angepasst wurde, dass man sich in der Langzeitkalkulation Pflegebedürftiger verschätzt hat und die Anzahl in Deutschland deutlich steigt das sieht man hier im Besonderen auch in den letzten zwei Jahren. Als drittes die Vereinfachung von der Verwaltung. Eine einheitliche Versicherung könnte den Verwaltungsaufwand reduzieren, da weniger unterschiedliche Systeme und Regelungen verwaltet werden müssen. Das könnte sowohl für die Anbieter Leistungserbringer als auch für die Patienten und auch letztendlich die Kostenträger von deutlichem Vorteil sein. Dagegen gibt es natürlich auch einige Herausforderungen und die zu Bedenken führen können zu berücksichtigen sind. Auch hier habe ich drei Punkte: Das eine ist die Finanzierung. Die Einführung einer einheitlichen Bürgerversicherung erfordert eine klare und tragfähige Finanzierungsstrategie, die auch nachhaltig ist sicherzustellen, dass die Leistungen über viele Jahrzehnte getragen werden können. Das zweite ist die Umsetzung. die praktische Umsetzung so einer Reform könnte komplex sein, wird komplex sein, erfordert mit Sicherheit umfangreiche Anpassungen im bestehenden System. Da sind zwei (Player?), die zu berücksichtigen: Einmal die rund 90 gesetzlichen Kassen gegenüber den 40 privaten Kassen. Ja mit den unterschiedlichen Stakeholdern, die wir in Deutschland dazu haben. Und natürlich die Bevölkerung. Es könnte Widerstand von verschiedenen Interessensgruppen geben, natürlich auch von den Versicherten, die von Sorgen Unsicherheiten geprägt sind, ob die finanziellen Eigenbelastung möglicherweise noch weiter steigen oder Benachteiligungen in der Betriebswirtschaft ja. Die Sanitätshäuser beispielsweise, die Pflegehilfsmittelversorgung etc. Da kann es schon sehr gut sein, dass die deutlich dafür sind das bestehende System so stehen zu lassen, wie es heute ist. Insgesamt könnte eine einheitliche Pflege Bürgerversicherung eine sinnvolle Alternative darstellen, wenn sie allerdings sehr gut geplant und umgesetzt wird damit betone ich nochmal die Begrifflichkeit Nachhaltigkeit. Es bringt nichts für die nächsten fünf oder zehn Jahre zu schauen. Wir müssen generationsübergreifend denken. Da spreche ich halt von Jahrzehnten. Die Vorteile, die müssen sorgfältig gegen die potenziellen Herausforderungen und Bedenkenträger dann auch abgewogen werden. Das als Antwort. #00:05:43#
I: Alles klar vielen Dank Herr [Person 2]. Sehr detailliert, sehr sehr umfangreich ja genau die Bürgerversicherung würde ich glaub ich auch meinen, dass es sehr viele Vorteile mit sich bringen würde, aber natürlich wird das nicht so einfach sein, wie sich das immer vielleicht in erster Linie anhört. Muss durchdacht werden muss nachhaltig werden, wie Sie ja gesagt haben genau. Was ich bisher mitbekommen habe, weil in einer der nachfolgenden Fragen wird es ja darum gehen, was eine Umsetzung daran hindert und da habe ich gehört, dass im Wesentlichen das eine parlamentarische Mehrheit in der Stimmung//also es mehrheitlich dafür gestimmt werden sodass es umgesetzt werden kann. Es wäre eine radikale Veränderung natürlich. Aber ich glaube, wenn man das wie gesagt haben gut durchdenkt, gut plant dann könnte das theoretischer ja umsetzbar werden aber zu der Frage komm ich noch nachher. Na gut, dann würde ich direkt zur Frage übergehen: Würden Sie sagen, dass eine Pflege Bürgerversicherung in Kombination mit einer drastischen Erhöhung oder sogar einer Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze die Ausgabensituation der Pflegeversicherungen verbessern würde und wenn ja könnte es dann auch dazu führen dass die Beitragssätze stabil gehalten werden? #00:07:05#
B2: Könnte auf jeden Fall verschiedene Auswirkungen haben auf die Ausgabensituation die Kostensituation in der Pflege. Das ist einmal die Erhöhung der Einnahmen durch Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze würde höhere Einkommensstärke zur Finanzierung der Pflegeversicherung beitragen. Das könnte die Einnahmen signifikant erhöhen und somit dazu beitragen. dass Finanzierungslücke geschlossen werden. Dazu verbesserte Ausgabensituation als Ergebnis. Mit den höheren Einnahmen könnte es möglich sein die Ausgaben für Pflegeleistungen zu erhöhen und die Qualität und den Zugang zur Pflege zu verbessern. Erst heute schon über das Pflegestärkungsgesetz 2 und 3 zum 1.1.2017 deutlich erleichtert wurde mit Bewertung der Selbstständigkeit beispielsweise Pflegegrad 1, wo aktuell auch Diskussionen entbrannten, ob der Einstieg zur Pflege nicht zu leicht bemessen wurde. Man spürt in den letzten zwei Jahren deutlichen Zugang von Pflegegrad 1 und dann hat man sich natürlich auch die Frage zu stellen, ob das möglicherweise ein zusätzlicher Ausgleich zum Erhalt von Finanzen geht. Bedeutet wir haben Inflation. Eine starke in den letzten Jahren. Und man sucht Mittel und Wege an Gelder ranzukommen ja ist es dann möglicherweise dann auch eben die Beschaffung eines Pflegegrades, das wird auch politisch diskutiert und da hat man auf jeden Fall ein wachsames Auge drauf zu legen. Die Diskussion wird sicherlich auch ins nächste Jahr eingetragen zu diesem Thema. Was die Stabilität der Beitragssätze angeht, da (unv.) finanziellen Grundlage könnte es leichter sein die Beitragssätze stabil zu halten oder zumindest moderate Erhöhungen zu vermeiden ja aber eine gewisse Zeit von Jahren. Was wir jetzt sehen, sind spitzen Anpassungen in den Beitragssätzen zur Pflegeversicherung. Das konnte man auch in den letzten Wochen gerade lesen, ich glaube die Techniker Krankenkasse beispielsweise hat den Satz der Krankenversicherung wie auch in der Pflege deutlich erhöht. Führte zu Schocksituation bei den Bundesbürgern. Und sowas muss besser geplant werden. Das (zahlt?) auf die Antwort von mir zu Frage 1 ein. Eine breitere Finanzierung könnte dazu beitragen die Belastung gleichmäßiger zu verteilen und die Notwendigkeit drastischer Beitragserhöhung//Beitragserhöhung genau zu verringern. Dafür braucht es meines Erachtens auch eine sehr schnelle Lösung. Die Bundesbürger können es nicht mehr verkraften in den nächsten zwei bis drei Jahren weitere Beitragsanpassungen zu erhalten und werden sie sicherlich auch so nicht mehr klaglos hinnehmen und dagegen gibt es natürlich dann auch wieder Herausforderungen bei den ganzen Überlegungen das (ist dann?) die Akzeptanz. Eine Erhöhung oder eine Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze könnte natürlich auf Widerstand stoßen insbesondere bei den gutverdienenden Bürgern, die höhere Beiträge zu zahlen hätten. Das macht keiner freiwillig. Dann sind wir wieder beim Thema langfristige Planung. Die langfristige Stabilität der Beitragssätze hängt nicht nur von den Einnahmen ab, sondern auch von den zukünftigen Ausgaben, die durch Monate// die durch die demographischen Veränderungen und steigende Pflegebedarfe beeinflussen werden und da sind wir wieder bei dem Anstieg der Pflegebedürftigkeit, die neu aufgesetzt wurde mit Blick auf 2050. Insgesamt könnte eine Pflegebürgerversicherung meines Erachtens in Kombination mit einer Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze zur Verbesserung der finanziellen Situation der Pflegeversicherung führen und potenziell die Beitragssätze stabilisieren. Die tatsächlichen Auswirkungen würden jedoch von der konkreten Ausgestaltung und Umsetzung abhängen, ja und dann das ist komplex dieses Thema und Bedarf einer sehr sehr guten Planung. ja das als Antwort. #00:11:33#
I: Alles klar vielen Dank. Im Wesentlichen mehr oder weniger das, was ich so hören wollte. Genau also was ich bisher gehört habe ähm ich hab auch schon gehört eine Beitragsbemessungsgrenze das zu erhöhen oder komplett abzuschaffen wäre eventuell eine Möglichkeit aber es heißt ja auch so dass man in einer Versicherung//Ich hab den genauen Begriff jetzt leider vergessen aber da war die Rede von Gerechtigkeitsprinzip mehr oder weniger das man nicht wirklich jetzt eine Beitragsbemessungsgrenze in dem Sinne abschaffen kann oder soll weil man ja im Grunde das einzahlen sollte was wir dann noch später an Leistung bekommen würde und wenn man jetzt sehr spitzen reiche enorme Beiträge an die Versicherung zahlen aber im Endeffekt nur allerhöchstens die derzeit 2005€ von der Pflegekasse bekommen dann wäre es halt nicht mehr dem Gerechtigkeitsprinzip entsprechend das habe ich gehört aber ansonsten habe ich das genau gehört dass eine Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze dazu führen könnte dass die Beiträge stabilisiert werden können und so weiter genau #00:12:55#okay
B2: Ja also die//Ich bin auf jeden Fall für das Solidaritätsprinzip grundsätzlich und es würde auch zu einem Ungleichgewicht mög-//also wahrscheinlich führen, wenn die Beitragsbemessungsgrenze abgeschafft wird. Denken wir auch über die Pflege hinaus an die private Krankenversicherung: sich dann erst privat krankenversichern zu können als Angestellter wir befinden uns ja nicht jetzt in der Sparte der (...) der Selbständigen und Freiberufler und das könnte natürlich das Gleichgewicht verschieben, ja das heißt all die, die gesund und jung sind könnten in eine private Krankenversicherung wechseln und die, die älter sind die bleiben dann in der GKV das würde Stakeholder GKV mit Sicherheit nicht mitmachen und einige Parteien in Deutschland die Beitragsbemessungsgrenze allerdings immer weiter anzupassen ist definitiv keine Lösung und führt allein zu einer Steigerung von Kosten und das hat die Politik in meinen Augen auch nicht verstanden. #00:14:08#
I: Ok. Joa wunderbar vielen Dank. Ja dem hätte ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde dann direkt zur dritten Frage übergehen zur Pflegebürgerversicherung, und zwar: Fänden Sie es sinnvoller, wenn man eine einheitliche Pflege Bürgerversicherung mit einer Kapitaldeckung kombiniert, sodass Privatversicherte ihre Altersrückstellung beibehalten können und nun für alle Versicherten Altersrückstellungen gebildet werden können? Also quasi sehr Bürgerversicherung aber nur in Form von einer Kapitaldeckung wie in der privaten Kranken- bzw. Pflegeversicherung #00:14:49#
B2: Ja also wie so vieles hat das auch Vorteile und wenn es nicht richtig ich sag jetzt mal durchdacht ist hat das natürlich auch Nachteile bzw. Herausforderungen ne das Ganze auch in die Tat umzusetzen Vorteil wäre beispielsweise individuelle Altersrückstellung. Pflegepflichtversicherte aus der privaten Pflegeversicherung also aus dem Bereich wo ich arbeite die Alterungsrückstellungen, die angespart worden sind, beibehalten können würden die dem Versicherten ermöglichen die bisherigen Ansprüche und Ersparnisse zu wahren das könnte natürlich das Vertrauen in das System deutlich nochmal stärken. Sind wir bei der langfristigen finanziellen Planung ne, dann wird durch die Bildung von Altersrückstellungen für alle Versicherten eine nachhaltige Finanzierung der Pflegeleistungen unterstützen. Das könnte helfen die finanzielle Belastung im Alter besser zu verteilen und bei Pflegebedürftigen darf man auch nicht vergessen denkt man oft dass man von einem höheren Alter spricht, ja in Deutschland haben wir sechsstellig Neugeborene bis zur Veränderung des 17.
Lebensjahr Kinder, Babys, Heranwachsende, die pflegebedürftig sind nicht selten mit einem hohen Pflegegrad da wir ein Leben lang die Leistung zur Verfügung zu stellen haben deswegen führe ich eben aus dass wir über Dekaden zu denken haben wenn wir da das System anpassen möchten. Was das System angeht, da geht es um Stabilität eine Kapitaldeckung könnte dazu beitragen, dass die Pflegeversicherung weniger anfällig für kurzfristige finanzielle Schwankungen ist, da Rücklagen gebildet werden in der Zukunft genutzt werden können in der privaten Krankenversicherung erfolgt das ja schon um die Alterungsrückstellungen in der in der gesetzlichen vermissen wir sowas und deswegen reden wir auch von Milliardenlöchern, das ist ja zu lesen in der Finanzierbarkeit von Pflege. Die Herausforderungen die ist auch zu berücksichtigen natürlich das ist einmal die Komplexität des Systems. Die Einführung eines solchen Modells könnte ich die Komplexität des Pflegeversicherungssystems deutlich erhöhen dazu ist es erforderlich eine klare Kommunikation und Transparenz vorzunehmen damit die Versicherten, die heute schon überfordert und überlastet sich im Pflegesystem da durchzublicken sicherzustellen, dass die Versicherten die Funktionsweise von Pflege mindestens genauso gut bestmöglich natürlich noch besser verstehen. Dann hat man aufzupassen auf finanzielle Ungleichheiten. Es besteht die Möglichkeit, dass nicht alle Versicherten in der Lage sind ausreichende Rückstellungen zu bilden, was zu Ungleichheiten führen könnte. Da kommen wir später noch zu und deswegen eine sorgfältige Ausgestaltung wäre notwendig, um sicherzustellen, dass das System gerecht ist. Und als drittes die Umsetzungskosten. Die Einführung einer solchen Kombination könnte anfällige Kosten verursachen sowohl für die Verwaltung auch für die Anpassung bestehender Systeme ja und Verwaltungskosten Quote sind ein nicht unwesentlicher Bestandteil von von Anpassungsbedarf und bei 80 Mio. Bundesbürger, die wir in Deutschland haben, wie eben angesprochen ca. 90, 85 gesetzlichen Kassen, 40 privaten Kassen, Stakeholder, die Leistungserbringer oder auch ja Zuträger zur Pflege wie beispielsweise Medicproof und der medizinische Dienst der Krankenkassen ist nicht zu unterschätzen. Und in Summe könnte die Kombination einer einheitlichen Pflege Bürgerversicherung mit einer Kapitaldeckung sinnvoll sein auf jeden Fall. Das aber auch dann nachhaltig und das für alle, um individuell als auch kollektiv Alterungsrückstellungen zu fördern. Die Umsetzung muss jedoch müsste sorgfältig geplant werden wie alles bei diesem Thema, um da keine Fehler auch direkt am Anfang zu machen ne und die Herausforderungen. Da wird es sicherlich noch weitere geben die werden dann erkannt in der Planung den auch begegnen zu können. Ja das dazu #00:19:35#
I: Ja vielen Dank. Alles natürlich sehr nachvollziehbar das einzige wo ich glaube ich (...) glaub ich was hinzu erwähnen würde wäre glaube ich zum Thema der Nachhaltigkeit. Was ich gehört habe, ist das eine Altersrückstellung natürliche sehr sinnvoll und helfen könnten. Ich habe allerdings gehört, dass es auch so sein kann, weil da ist ja so, dass die Altersrückstellungen auch verzinst werden und in Zeiten, wo es positive Verzinsung gibt kann das natürlich sehr positive Effekte mit sich bringen aber dann wenn wir in weiß nicht Niedrigzinsphasen jetzt grad sind oder wo die Zinsen wieder runter gehen könnte es dann wieder so sein dass das nachhaltig die Altersrückstellungen ja nicht das bewirken was sie bewirken sollten oder könnten. Genau #00:20:33#
B2: Ja da haben sie grundsätzlich recht und das sind die Herau-//also eine der vielen Herausforderungen, die man hat, ne, dass man ein Grundstock setzt für eine Kapitaldeckung, die halt auf Jahrzehnte ausgelegt ist ne. Und dann ein Fundament zu haben nämlich ein Niedrigzinsphasen dennoch entsprechend die die eine Mindestverzinsung die wir festzulegen halten zu können definitiv und bei einem Kollektiv von wie gesagt 80 Mio. Bundesbürger wir waren ja noch nicht bei der betrieblichen Pflegeversicherung etc. kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man, dass man, dass man dem ausweichen kann, auf jeden Fall, ja, dass man da nicht in diese finanzielle Falle hineintappt. So beschreibe ich das mal. #00:21:30#
I: Alles klar ok. Na gut, vielen Dank. Dann die vierte und letzte Frage zur Pflegebürgerversicherung. Darüber haben wir jetzt auch schon paar Mal gesprochen glaube ich jetzt: kann eine Pflege Bürgerversicherung von der Politik realistisch umgesetzt werden und wenn ja, wie? #00:21:47
B2: Ja in der Theorie ist das grundsätzlich möglich und das erfordert allerdings auf eine sehr breite Unterstützung, die wie eben ausgeführt von dem ganzen Beteiligen und da gibt es einige Aspekte, die halt zu berücksichtigen sind. Einmal haben sie schon selber mal eben kurz ausgeführt der politische Wille der Parteien. Es braucht unbedingt eine breite politische Einigung, um ja eine Umsetzung zu ermöglichen. Es bringt nichts, wenn man immer auf Stimmen Einzelner dann nachher auf dem Bundestag angewiesen ist, und das wäre das wäre die größte Reform seit Einführung der Pflegeversicherung zum 1.1.1995 und da hilft nur eine parteiübergreifende einigende Zielsetzung mit intensivem Dialog, um dann auch gemeinsame Ziele zum Wohle der Bevölkerung zu definieren und dann ja Gesetze zuzuschlüsseln. Ganz wichtig das erlebe ich aus meinem operativen und ja planerischen strategischen Tun in Pflege für die DKV. Es ist wichtig, dass man alle Interessensgruppen ja das man die abholt, frühzeitig also Beispiele: Pflegedienst, wir haben Pflegeeinrichtung, die Schnittstelle Krankenhäuser, wo Pflegebedürftigkeit festgestellt wird, die Verbände wo Pflegekräfte, Patientenvertretungen, Versicherungsunternehmen führte ich aus, Leistungserbringer. Die sind in den Prozess einzubeziehen. Es hilft der Überzeugung wenig, dass man sich Berlin einschließt mit ein paar Referenten und das Ganze dann zu Papier bringt, sondern die wesentlich//die wesentlichen Erfahrungswerte von den jeweils Beteiligten inklusive auch Patientenvertreter. Das halte ich auch für wichtig sind einzubeziehen, denn auf der einen Seite muss finanzierbar sein auf der anderen Seite muss Pflege verstanden werden das hatten wir eben schon und auf der anderen Seite ist Pflege viel zu komplex. Wenn wir da an die Geldtöpfe denken, wie komme ich an die Leistung das ganze Formularwesen dann Digitalisierung kommt später auch zu. Steht heute kaum das muss man so sagen mit absoluten Medienbrüche und nur das das schafft eine deutliche Erhöhung oder möglicherweise auch erstmaliger Akzeptanz für eine solche Reform. Dann ganz wichtig: Nennt das Gesetzgebungsprozess! Denn der gesetzliche Rahmen für eine Pflege Bürgerversicherung müsste entwickelt werden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich sowas innerhalb von 12 Kalendermonaten realisieren lässt. Das umfasst eine neue Definition meines Erachtens auch von Leistungen da führten wir schon aus und zu den Beitragssätzen. Der Prozess würde wahrscheinlich Ausarbeitungen für Verabschiedung von Gesetzen und durch den Bundestag erfordern nicht nur vielleicht sondern mit Sicherheit. Und darauf wieder den politischen Willen parteiübergreifend das so auch vorzunehmen. Dann sprachen wir schon gerade zweimal über Finanzierung Es braucht die Entwicklung ganz einfach eines tragfähigen Finanzierungsmodells. Nachhaltig, fair und für alle nachvollziehbar. So dann haben wir einen Großteil in Deutschland noch über 70 Mio. Bundesbürger, die eben nicht pflegebedürftig sind und die sind auch zu informieren es braucht also eine breit angelegte// ein breit angelegten Kommunikationsprozess. So wenn man das ganz ausprobieren möchte in meinen Augen so halte ich es bei mir immer, wenn wir Dinge anfangen mal umzusetzen nach Absprache jetzt zum Beispiel mit dem PKV- Verband, dass man ein Pilot durchführt, ja dass man das man eine Region rausnimmt vielleicht auch ein Bundesland und Dinge erst mal ausprobiert und vertestet. Das ist möglich, das kann man, dass der, dass der, dass der Rahmen auf jeden Fall (...) ja wie soll ich sagen also es ist einfach möglich und aus diesen Erfahrungswerten zu lernen vor allen Dingen aus den Fehlern ja das ist ein Pilot. Man muss auf lange Zeit halt denken ja der kann über 12 der kann, der kann über 24 Monate laufen und dann die ganzen Erfahrungswerte da mal zusammenzulegen. Ich halte nichts davon Gesetz zu verabschieden innerhalb von 2 Monaten, die dann für 30 Jahre gelten sollten. Man sieht beispielsweise, dass sie das nach 3 Jahren die Finanzierbarkeit nicht mehr gegeben ist etc. Auch so in einem Piloten kann man natürlich evaluieren, analysieren, bewerten, ob das ein tragfähiges Konzept ist. Anpassungen vornehmen dann Pilotphase 2 starten oder sicher sein, dass die Anforderungen standhalten nachhaltig und dann gesetzlich umsetzen. So stelle ich mir das Ganze dann vor ja #00:27:44#
I: Joa, vielen sehr sehr sehr ausführlich. Sehr sehr auch komplex dann, also komplexer als ich jetzt zumindest dachte. Kann ich nichts weiterzusagen, ist alles Wesentliche gesagt worden. Vielen Dank #00:28:02#
B2: Gern! #00:28:03#
I: Dann direkt zu den privaten Vorsorgemodellen dazu sind auch nur zwei Fragen: Könnte eine Kombination aus betrieblicher und privater Altersvorsorge helfen die einrichtungseinheitlichen Eigenanteil für den Versicherten finanzierbar zu machen? #00:28:19#
B2: Die Antwort ist ja. Beispielsweise mit einer mit einer ergänzenden Finanzierung da kommen wir zur betrieblichen Altersvorsorge, ja und privater Altersvorsorge. Das beides können zusätzliche finanzielle Mittel bereitstellen, die im Alter für Pflegeleistungen genutzt werden können. Das könnte natürlich helfen die Belastungen durch Eigenanteile zu verringern. Dann bei dem schon mehrfach angesprochenen Thema langfristige Planung: Frühzeitige strategische Planung der Altersvorsorge kann dazu führen, dass Versicherte besser auf die finanziellen Anforderungen im Alter vorbereitet sind. Je mehr Rücklagen selbstredend gebildet werden desto geringer könnte der Druck durch die Eigenanteile ausfallen. Das ist aber dann auch wieder eine Langzeitbetrachtung. Steuerliche Vorteile definitiv. Die gibt es nämlich in vielen Ländern und die bietet halt Anreize für betriebliche und private Altersvorsorge diese Vorteile könnten dazu führen, dass wir Menschen in der Lage sind Rücklagen zu bilden was heute selbstredend wiederholend nicht jeder tun kann mit den jeweiligen finanziellen Mittel und ja dann auch Vorsorge trägt einfach fürs Alter. Ein Vorteil sehe ich auch im Rahmen der Flexibilität. Ich könnte zum Beispiel eine Kombination aus betrieblicher Altersvorsorge und privater Altersvorsorge den Versicherten ermöglichen die Altersvorsorge individuell zu gestalten an ihre persönlichen Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten. Möglicherweise auch im Zusammenspiel mit dem An// mit dem Arbeitgeber. Dass das fängt, ja so langsam an die als finanzielle, ja finanziellen Anreiz oder (...) noch Anreiz kann ich gar nicht sagen oder beziehungsweise mit mehreren Mehrwerten, Verbundenheit, betriebliche Altersvorsorge in Form von privater Pflegepflichtversicherung oder Pflegezusatzversicherung sorry anbieten ja vom Arbeitgeber// als Arbeitgeberleistung. Möglicherweise auch den Arbeitgeber attraktiver dann zu machen, kann ich mir (zumindest?) sehr gut vorstellen. Und dann sind wir beim Thema Risikoabsicherung auch und durch die durch die verschiedenen Angebote der Altersvorsorge können die Risiken natürlich besser verteilt werden. Solide Altersvorsorge kann dazu beitragen die finanzielle Sicherheit im Alter zu erhöhen und damit auch die Sorgen hoher Eigenanteile zu verringern ja das fände ich auch nicht schlecht und auch hier gibts natürlich viele Herausforderung. Einmal die finanzielle Belastung während der sogenannten Erwerbsphase. Die Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge denk ich mir wie auch zur privaten Altersvorsorge in der sogenannten Erwerbsphase eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellt, wie es vorher in der Form nicht gegeben hat, die sich dann negativ auf den aktuellen Lebensstandard auswirken könnte. Und dafür bräuchte es vorher auch ganz genaue Berechnungen, wer sich was finanziell dann noch leisten kann oder auch gewillt ist ne halt selber zu leisten. Das ist auch eine Frage von Bewusstsein und Aufklärung meines Erachtens kennen und verdrängen heutzutage immer noch viele Menschen in Deutschland die Auswirkung einer Pflegebedürftigkeit zwei von drei Frauen, vier von fünf Männ// werdende Männer werden in Deutschland pflegebedürftig unterschiedlichen Alters rund 30% meines Wissens starten im Alter zwischen 56 bis 66 also auch mitten im beruflichen Leben noch und sind dann auch in der ambulanten Versorgung direkt im mit Eigenanteil belastet, die nicht selten vierstellig sind. Wir sind ja beim Thema stationäre Pflegebedürftigkeit da haben wir nicht selten von Eigenanteilen von 3000€ im Monat zu reden. Von daher ist meines Erachtens der// sind die Aktivitäten der Politik des Bundesgesundheitsministeriums heute noch viel zu gering, dass dieses Bewusstsein einfach zu erhöhen und über eine Aufklärung der Bundesbürger, die ich wiederhole, mich da (in meinen Satz?) heute derart noch nicht besteht: Würde die Akzeptanz davon bin ich überzeugt deutlich erhöht werden. Etwas vorbeugend für die Pflege für eine mögliche Pflegebedürftigkeit zu tun. Zum Beispiel auch für die Kinder, die man hat, also von daher bin ich überzeugt, dass die Kombination betrieblicher und privater Altersvorsorge auf jeden Fall sehr sinnvoll sein kann #00:33:43#
I: Vielen Dank #00:33:44#
B2: Ja #00:33:45#
I: Also ja wieder alles Wesentliche gesagt das Einzige, wo ich eine Rückfrage dazu gehabt hätte, wo sie mir aber schon vorweg gekommen sind, wäre, dass diejenigen mit etwas niedrigeren Einkommen wahrscheinlicher mehr belastet werden als die mit höheren Einkommen, die die es ja auch eigentlich notwendig hätten, so eine Altersvorsorge später in der Pflegebedürftigkeit. Genau aber im Großen und Ganzen würden sich Chancen dazu bieten, wie sie schon ausführlich gesagt haben. Hätte ich nichts weiter hinzuzufügen. #00:34:19#
B2: Joa, also ergänzend kann ich ihnen nur sagen man kann ja auch über Ausgleichsmodelle nachdenken ja nämlich Einkommens- (unv.), genau wie die wie die Steuersätze halt geregelt sind. Nach Einkommen, nach Bezug der Rente etc. Das ist transparent darzulegen und dann werden die die Zuschüsse auch entsprechend unterschiedlich verteilt und den Bürger also erst aus der Pflicht zu lassen etwas für die Altersvorsorge zu tun ne also für die// reden nicht von Gesunderhaltung sondern für den für das mögliche Risiko einer Pflegebedürftigkeit, um dann eine Nichtfinanzierbarkeit über Steuermittel zu erkennen, was heute im Jahr 2024 ja längst schon der Fall ist. Das ist meines Erachtens der falsche Weg #00:35:15#
I: Verstehe, jut alles klar alles klar. Ich würde dann die zweite Frage stellen, ist eigentlich sehr sehr ähnlich wie die erste, wenn ich jetzt noch so drüber schaue: Finden Sie die Idee sinnvoll, dass alle Betriebe für ihre Mitarbeiter eigene Vorsorgefonds einrichten, wo jeder einen frei gewählten, individuellen Betrag einzahlen kann für seine zukünftige Altersvorsorge und welche möglichen Schwierigkeiten könnte es mit sich bringen? Würde ein Mindesteinzahlbetrag Sinn machen? #00:35:47#
B2: Also die Idee finde ich gut ist sehr gut. Tatsächlich bin ich im mit der Frage wie Sie sagten schon darauf eingegangen. Einmal kann man es individuell gestalten ja, dass die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter eines Unternehmens die Altersvorsorge entsprechend ihrer persönlichen finanziellen Situation ist (Ziele?) gestalten können also mit der höchstmöglichen Flexibilität ja mitzugeben, mitzuteilen, was man gewillt ist, ne was man sich auch leisten kann, finanziell beizusteuern und normalerweise ist es ja, so dass man mit steigendem Alter auch mehr verdient. somit kann dann flexibel die Vorsorge ja auch entsprechend angepasst werden das ist für mich auch Grundvoraussetzung. Dann natürlich die Förderung der Altersvorsorge das gibt es ja heute schon ne durch die Einrichtung von Fonds beispielsweise könnten mehr Menschen motiviert werden aktiv für ihre Altersvorsorge zu sparen, insbesondere wenn natürlich die Arbeitgeber einen Teil der Beiträge übernehmen und dadurch Anreize schaffen. Ja das machen die auch teilweise natürlich zum Selbstzweck die Attraktivität eines Arbeitgebers zu erhöhen. Können sie können sie sich mal erkundigen wie viele Arbeitgeber bieten heute in Deutschland eine betriebliche Pflegeversicherung, Zusatzversicherung an ja sie kann in ganz Deutschland abgeschlossen werden für mittelständische Unternehmen, für Großunternehmen etc. Kaum war das Thema einfach noch nicht präsent. Und die Vertriebe das kann ich ihnen sagen sprechen es in größeren Unternehmen wie in Kleineren an und noch selten genug werden die Vorteile erkannt, weil der Arbeitgeber natürlich solche Beiträge auch wiederum steuerlich absetzen kann, ja dann befindet man sich in so, so ich sag jetzt mal Finanzier Modell so ein Kreislauf des Lebens praktisch, wenn man so sehen will. Betriebliche Bindung könnten solche Programme. Die könnten dazu führen, dass die Mitarbeiterbindung erhöht, wird auch über den Attraktivität einmal den Schritt zum Arbeitgeber. Die bieten auch eine betriebliche Pflegezusatzversicherung an als Sozialmodell und zahlt dann in die Altersvorsorge anteilig ein das ist sehr toll und auch dann dort zu bleiben ja das ist für mich wirklich ein nachvollziehbarer Aspekt einfach zu sagen ich bin 20 Jahre beim Unternehmen ja und jetzt seit 10 Jahren gibt es das Modell die zahlen da stetig für mich ein ich habe eine Altersvorsorge ja kann er mit Kündigung des Arbeitgebers auch verloren gehen ne. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die mitgenommen wird. Das wird dann in den Fond zurückgeführt von daher ist das für mich ein klarer Aspekt mit der betrieblichen Bindung. Und die sogenannte kollektive Verwaltung unterschiebt die Bündelung der Beiträge in einem Fonds könnten Verwaltungskosten auch deutlich gesenkt werden, besser Anlagemöglichkeiten schaffen. Da sprachen wir eben über die Zinsstärke oder die Zinsbelastung bei Niedrigzinsphasen etc. Das Risiko wird ehrlicherweise da auch garnicht mehr übersehen, weil wir dann über sehr hohe Beträge sprechen. Auf der anderen Seite gibts wie immer die Herausforderungen und da habe ich mir im Vorfeld auch Gedanken gemacht. Einmal sitzt die Verwaltungskosten, die müssen so niedrig wie möglich gehalten werden und denken wir grad an kleinere Unternehmen, so ein Einrichten eines Fonds kennen sich möglicherweise damit auch gar nicht mehr aus brauchen da auch entsprechend Unterstützung das ist eine finanzielle Belastung und von daher wäre es wichtig einfache Verwaltungsstrukturen für sowas zu entwickeln. Dann die Ungleichheit in den Beiträgen. Wenn Mitarbeiter frei wählen können, wie viel die einzahlen könnte das zu Ungleichheiten führen, insbesondere wenn einige Mitarbeiter nicht in der Lage sind, signifikant höher Beiträge zu entrichten und zu sparen. Dafür hab ich ehrlicherweise an auf Anhieb auch keine Lösung wenn es Mitarbeiter Mitarbeiterinnen gibt, die Schwierigkeiten haben ne ja Entscheidungen über ihre Beiträge und Anlagen zu treffen könnte das natürlich auch so unzureichender Altersvorsorge führen ja also dass sie nicht beraten werden, falsch beraten werden sich ein falsches ja Altersvorsorge Sparmodell zu überlegen da braucht es halt bei den Arbeitgebern entsprechende Ansprechpartner etc. die mit Rat und Tat zur Seite stehen dann sind wir wieder beim Thema Verwaltungskosten. Da gibt es sicherlich bei solchen Modellen, wenn flächendeckend in Deutschland sicherlich auch mit erweiterten Regelungen zu tun hat gibt es Rechts- und Steuerfragen und die rechtlichen Rahmenbedingungen von heute werden zu prüfen. Steuerliche Vor- und Nachteile wären zu klären, wie da transparent und informativ dann darzustellen auf jeden Fall damit die sogenannte Akzeptanz und das Nehmen von Sorgen Unsicherheit ich finanziere, was bleibt am Ende übrig? Das sie natürlich genommen werden, weil man in meinen//also ne wichtig auf Jahrzehnte am besten dann einzahlt. Seit den jungen Jahren für das Alter (...) sie sprachen von vom Begriff Mindesteinzahlbetrag ja genau. (...) Der Mindesteinzahlbetrag ja der könnte in der Tat sinnvoll sein das das alle Mitarbeiter zumindest einen Grundstock an Altersvorsorge aufbauen können das kann ja das kann auch natürlich Vorteile haben. Sicherstellung eines Grundschutzes der ansonsten gar nicht da wäre ja und eine sogenannte bestmögliche Gleichheit ne. Das ein einheitlicher Mindesteinzahlbetrag dazu beiträgt dass in eine Altersvorsorge eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermutigt werden bestimmten Betrag zu sparen dass das transparent wird und ihnen am Ende auch aufzeigt, dass man dadurch auch die Eigenanteile dann deutlich reduzieren kann das müsste allerdings auch flexibel gestaltet werden von den jeweiligen unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten der Mitarbeiter vielleicht Gehaltseinkommensbetragsmäßig also Bruttoverdienst zumindest Einsparhöhe und das könnte man so variiert in meinen Augen ja so eingrenzen so nenne ich das ja. Also betriebliche Vorsorgefonds bin ich ein Fan mit dem Wissen, was ich an Pflege aufgebaut hab und das unabhängig, dass ich für eine private Krankenversicherung arbeite #00:43:35#
I: Ja ist klar hört sich ja sehr positiv an trotz den Herausforderungen, die es natürlich mit sich bringt (...) genau also alles sehr ausführlich kann ich nichts weiterzusagen alles klar dann direkt zum nächsten Block der Generationenvertrag der PKV ein interessantes Thema in meinen Augen. Da wäre meine erste Frage zu: Könnte der Generationenvertrag in seinen Gestaltungsoptionen dazu führen, dass die Versicherten im Falle einer Pflegebedürftigkeit höhere Eigenanteile zahlen müssen, wenn die Leistungsausgaben an den Beitragseinnahmen angepasst werden würden? #00:44:16#
B2: Da habe ich//habe ich natürlich über strategische Gespräche, die ich auch immer wieder führe mit dem Verband eine klare Meinung und kann das mit einem deutlichen Ja beantworten: Da gibt es fünf Aspekte, die zu berücksichtigen sind, das eine ist das Finanzierungsmodell. Der Generationenvertrag basiert auf dem Prinzip der Solidarität zwischen den einzelnen Generationen und wobei die die aktiven Beitragszahler die Leistung für die gegenwärtigen Rentner und Pflegebedürftigen finanzieren. Wenn die Ausgaben für Pflegeleistungen steigen, was sie tun, jährlich und zwar deutlich kann das zu einem Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben führen. Bei der Anpassung der Beiträge, wenn die Beitragseinnahmen nicht im gleichen Maße steigen, wie die Leistungsausgaben könnte das natürlich bedeuten, dass die Pflegeversicherung nicht ausreichend finanziert ist und um die finanzielle Stabilität des Systems zu gewährleisten könnten die Eigenanteile für die Versicherten erhöht werden. Dann sprachen wir schon über die demografischen Veränderungen und angesichts der alternden Bevölkerung in Deutschland der damit verbundenen, steigenden Anzahl an Pflegebedürftige. Ich habe gelesen dieses Jahr um die 8% wir haben einen Anstieg bei uns von über 12% also deutlich höher und wir sehen auch kein Ende des spürbaren Anstiegs des Wachstums. Da könnte der Druck auf das System natürlich zunehmen und wenn die Anzahl der Beitragszahler nicht proportional zur Zahl der Pflegebedürftigen wächst, kann es natürlich ebenfalls zu höheren Eigenanteilen führen ja. Das ist echt ein Risiko, was wir da haben. Bei Leistungsanpassung ist ganz klar die finanzielle Belastung zu steuern könnten auch die Leistung selbst angepasst werden werden, was allerdings zu höheren Eigenanteil führen könnte ja was nicht mehr verträglich wäre. Dann wären wir// hätten wir klar den Blick auf finanzielle Unterstützung Sozialhilfe zu setzen da kommen wir ja gleich noch zu. Es könnten beispielsweise bestimmte Leistungen reduziert oder gestrichen werden, was die Versicherten dazu zwingt mehr aus eigener Tasche zu zahlen. Da halte ich persönlich gar nichts die Eigenbelastung ist heute schon zu hoch. Und letztendlich hängt es auch von den politischen Entscheidungen ab da haben wir auch schon drüber gesprochen wie hoch die Eigenanteile letztendlich gesetzt werden und eine politische Mehrheit konnte beispielsweise auch beschließen die Eigenanteile noch weiter zu erhöhen, um die finanzielle Stabilität des Systems zu gewährleisten. Das wäre// wäre der größte Fehler, die dann zu verantwortende Bundesregierung machen könnte. Also insgesamt ist es möglich mit der Anpassungen Leistungsausgaben an Beitragseinnahmen die Fort also beziehungsweise die Möglichkeiten dazu bei den bei den finanziellen Druck den die Pflegebedürftigen heute schon haben ja die sind mehr als dürftig und deswegen bin ich deutlich eher bei dem bei dem Punkt davor nämlich private und betriebliche Altersvorsorge anzubieten und darauf zu setzen und natürlich über Generationen hinweg. #00:48:00#
I: Ja, genau. Also das Thema mit Nachhaltigkeit. Ja genau. Also so wie//also erstmal danke schön. So wie ich das irgendwie sehe mit diesem Generationenvertrag das sieht irgendwie so aus, dass die Ausgaben mehr oder weniger also von den Leistungsträgern stabilisiert werden, aber hat natürlich seinen Preis das dann ja die Eigenanteile seitens der Pflegebedürftigen zu Lasten kommen. #00:48:26#
B2: (unv.) also definitiv ist ja. Und das ist ja// das ist ja die ungelöste größte Aufgabe, die das Bundesgesundheitsministerium hat, ja. Und sie wird nicht mit dem anstehenden Pflegekompetenzgesetz lösen auf keinen Fall #00:48:47#
I: Joa (...) naja. Gut dann gehe ich zur zweiten Frage über (...): Können die Kosten, die mit diesem Konzept nicht mehr von der Pflegeversicherung abgedeckt werden durch private Vorsorge wie z.B. Zusatzversicherungen abgedeckt werden oder werden die Pflegebedürftigen immer noch zum Großteil auf Sozialhilfe angewiesen werden? angewiesen sein? #00:49:12#
B2: Also mit der Brille eines privaten Krankenversicherers gesprochen führte ich ja zwei, dreimal kurz aus: Es gibt heute das Angebot von privaten Zusatzversicherung bei rund 40 privaten Krankenversicherungen und die spielen für mich eine wichtige und zentrale Rolle weil diese Zusatzversicherung wie der, wie das Wort schon sagt zusätzliche Leistungen (unv.), die gleich gleichen Pflegepflichtleistung anbieten die auch deutlich darüber hinausgehen was die gesetzliche Pflegeversicherung abdeckt und diese Versicherungen helfen einfach die finanzielle Belastung in Falle von einer Pflegebedürftigkeit deutlich zu verringern da gibt es Beispiele, die ich auch immer wieder bei uns in den Vertriebenen zeige wo man wirklich für kleines, überschaubares Geld einer privaten Pflegezusatzversicherung beispielsweise auch Pflegetagegeld als deutliche Defizite, monatliche Defizite teilweise auch vollständig auffangen kann das Ganze kann man individuell gestalten. Die private Vorsorge können individuell angepasst werden beispielsweise über ein sogenanntes Tagegeld wie von mir beschrieben, es gibt Tarife die die die Sachleistungen auffangen also wenn der Pflegedienst beispielsweise vor Ort ist und geht sehr individuell auf die spezifischen Bedürfnisse eines Pflegebedürftigen ein, wo die wo die finanzielle Lücken dann auch entstehen und dadurch ist man automatisch wenn man die richtigen Entscheidungen trifft finanziell auf die eigenen Bedürfnisse besser abgesichert und ja es ist ganz einfach letztendlich eigene Vorsorge zu betreiben. Die privaten Zusatzversicherungen können online abgeschlossen werden mitunter ohne Risikoprüfung ja, das heißt ohne Beantwortung von von medizinischen Fragen zum aktuellen Gesundheitszustand teilweise beitragsneutral dem Alter entsprechend also nicht kaskadisch dem Alter steigen auch die Beiträge und wie gesagt ne wir haben noch über 70 Mio., die heute keine privaten Pflegezusatzversicherung haben nicht jeder kann sich die leisten. Das Potential bewerte ich auf jeden Fall achtstellig und gehe davon aus, dass ich nur 10, 10 Mio. Menschen finanziell in der Lage wären eine solche abzuschließen, weil auch einiges mehr. Da könnte man ja der finanziellen Not könnte man da Vorsorge leisten. Meines Erachtens das Abschlusssatz dazu wäre es für mich auch Pflicht alle Neugeborenen entsprechend mit so einer Zusatzversicherung auszustatten. Der Blick wird von der Politik meines Erachtens gar nicht gefahren, weil wir einfach über Lebenserwartung von 80 Jahren und darüber hinaus sprechen Pflegebedürftigkeit kann zu jedem Zeitpunkt erfolgen, Unfallfolgen etc. (Da sind?) ja teilweise in Deutschland auch bei prominenten Fällen und mit so einer Absicherung wäre würde auf jeden Fall dann mit Anlage mit Alterungsrückstellung würde man die finanzielle Not gesamthaft deutlich lindern. Was die Abhängigkeit von Sozialhilfe angeht, kann ich Ihnen sagen, dass erleben wir jede Woche in Kundentelefonaten ne wenn die finanziellen Mittel eines Pflegebedürftigen nicht mehr ausreichend gerade im stationären Pflegefall in einem Pflegeheim denkt man oftmals man geht so zur Verwaltung zum Verwaltungsdirektor und sagt ich kann die Pflege, Pflegekosten nicht mehr entrichten und das Sozialamt kommt dafür auf. Mitnichten kann ich ihnen sagen da hat man erst 20 - 25 Seiten auszufüllen und dann werden die ganzen Vermögen geprüft ja von der Ehefrau, vom Ehemann, von den eigenen Kindern gibt es Eigentum gibt es Sparverträge, gibt es Schenkungen die nicht älter als zehn Jahre sind gibt es eines der Kinder die mindestens 100.000 Euro brutto jährlich verdienen, gibt es klare Vorgaben, die dazu führen, dass das ganze Vermögen abgezogen wird vom Sozialamt, um bis auf einen so genannten Schonbetrag. Und ja Menschen mit geringen Einkommen die haben wir auch bei uns. Die sind von der Sozialhilfe auf jeden Fall abhängig und Sozialhilfe wird finanziert von den Steuerzahlern und da sind wir schon wieder in dieser Spirale der wir ja gar nicht rein wollen und angesichts der demografischen Faktoren man wird immer älter es gibt immer mehr alte Menschen in Deutschland. Das ist kein zu unterschätzender Anteil also klare Aussage ist meines Erachtens, wenn sich nichts tut der Anteil der Sozialhilfeempfänger im Bereich von Pflegebedürftigkeit steigen wird dafür braucht es halt eine ja generationsübergreifende auch altersgerechte, nachhaltige, saubere Planung der Finanzierbarkeit ja #00:55:13#
I: Alles klar vielen vielen Dank. Ich hätte absolut nichts weiter zu ergänzen, wurde alles sehr ausführlich gesagt (...) Ja, wenn ich jetzt noch drüber nachdenke ich würde viel zu lange drüber nachdenken. Ich spring direkt zur nächsten Frage einfach rüber. Zum letzten Block. Ich sag jetzt mal eher kleinere Anpassungen sind es jetzt in diesen Fragen, und zwar: Sollte die Pflegefinanzierung mit einer Steuerfinanzierung ergänzt werden und würde dies allein schon ein Unterschied ausmachen also so ähnlich wie im Gesundheitsvorsorgefonds der Krankenversicherung? #00:55:56#
B2: Ja also, um es ja kürzer zu beantworten: Die gibt es ja heute schon und ist unzureichend. Und sie ist zu finanzieren da reden wir in Deutschland von Milliardenbeträgen und natürlich hat eine Steuerfinanzierung auch Vorteile logischerweise die steuerfinanzierte Pflegeversicherung könnte zum Beispiel eine breitere Basis für die Finanzierung bieten das Steuern von allen Bürgern unabhängig von ihrem Einkommen erhoben werden. Das könnte dazu beitragen die finanziellen Mittel zu erhöhen und die Abhängigkeit von Beiträgen aus der Sozialversicherung zu verringern. Dan haben wir das eben angesprochene Solidaritätsprinzip durch steuerfinanziertes Pflegefinanzierungsbeiträge könnte das Solidaritätsprinzip stärker betont werden indem alle Bürger zur Finanzierung der Pflegeleistungen beitragen, unabhängig von ihrem individuellen Risiko oder Pflegebedarf. Die Beitragszahler würden auf jeden Fall entlastet bei einer weiteren stetigen Ergänzung der Steuern dazu führen könnte, dass die Beitragssätze da sprachen wir auch darüber zur Pflegeversicherung stabiler gehalten werden würden. Und über die Steuerfinanzierung könnte sich das auf das fehlende Rezept nachhaltig langfristige Konzept könnte einen Plan, sogenannte Planungssicherheit erhalten ja wo man halt über die nächsten Jahrzehnte gesichert auch sagen könnte ob Beiträge steigen oder ob Eigenanteile vielleicht auch nochmal gesenkt werden, daher hat das auf jeden Fall Vorteile definitiv. Herausforderungen wie immer: Die steuerliche Belastung ja, Einführung oder Erhöhung von Steuern könnte natürlich auch Widerstand von der Bevölkerung sorgen da wir nicht nur in der Pflege, sondern auch über Krankenversicherung reden, über Inflation, über Steigerungen für Lebensmittelkosten, Strom, Gas, Lebenshaltungskosten usw. Ganz Pflege ist ja nur ein Baustein.
Verteilungsgerechtigkeit ist auch so eine Frage. Es wär auf jeden Fall wichtig ein gerechtes und transparentes Steuermodell zu entwickeln, führte ich am Anfang auch auf um sicherzustellen, dass die Belastungen fair verteilt werden, dass die finanzielle Unterstützung auch denjenigen zugutekommt, die es am Dringendsten benötigen da auch keine Schlupflöcher bestehen und politisch das Ganze umzusetzen ist ein Gesamtkunstwerk wie eben schon beschrieben sehr komplex sehr herausfordernd wir können einige Fehler halt gemacht werden da braucht es wirklich schlaue Köpfe der sich mit dem Thema so beschäftigen. #00:58:57
I: (...) Alles klar vielen Dank #00:59:02#
B2: Gerne #00:59:04#
I: Joa (...) Jetzt auch hier ich hätte keine weiteren Ergänzungen (...) na gut. Die zweite Frage, dich ich dazu hätte bzw. die vorletzte Frage: Ist es umsetzbar, dass Kranken- und Pflegeversicherung in Präventionsmaßnahmen für zukünftige Pflegebedürftigkeit investieren, sodass Pflegeversicherung für weniger Nutzer zahlen muss müssen? Also quasi ja Prävention also halt das es nicht mehr später zu einer Pflegebedürftigkeit später kommt. #00:59:40#
B2: Also Frage verstanden und ein ausdrückliches Ja! Es bieten auf Krankenversicherungsebene gesetzliche und private Krankenversicherungen auch schon Jahrzehnte an. Das sind sogenannte Gesundheitsprogramme Präventionsprogramme unabhängig auch des Alters Gesunderhaltung zu betreiben allerdings ist auch belegen natürlich Statistiken das Pflegebedürftigkeit ist ein breites Feld auch wie eben auch schon mal gesagt und urplötzlich eintreten kann Unfallfolgen, Schlaganfall, Herzinfarkt ja da gibt es auch Präventionsprogramme beispielsweise, um das Risiko Schlaganfall zu verringern, Herzinfarkt zu verringern das zahlt darauf ein definitiv. Da ist man, da ist man nicht vorgefeilt, wenn man das nochmal differenziert, einmal Unfallfolgen kann von jetzt auf gleich auf jeden Fall passieren da gibt es auch keine Präventionsprogramme große die angeboten werden und auf der anderen Seite Schlaganfall, Herzinfarkt oder auch im höheren Alter ist Demenz was er seit 2017 auch in die Pflege mit ein oder aufgenommen wurde als Krankheitsbild. Ja werden auf jeden Fall Gelder investiert dem entgegenzuwirken. Gibt es gibt es dazu belastbare medizinisch, statistische Auswertungen wie Präventivprogramme auf Pflegebedürftigkeit auf oder auf das Vermeiden einer Pflegebedürftigkeit wirken? Nein gibt es gibt es nicht. Natürlich können über Präventionsmaßnahmen oder frühzeitige Intervention wie man das so schön sagt kann man natürlich medizinische, gesundheitliche Probleme früher erkennen und die darauf einzahlen, dass eine Pflegebedürftigkeit vermieden wird, selbstredend.
Gesundheitsförderung habe ich auch schon ausgeführt auf der Hand liegt ganz klar, wenn weniger Menschen neu pflegebedürftig werden würde das natürlich spürbaren Kosteneinsparungen beitragen. Und das Ganze steht und fällt natürlich auch mit der Finanzierbarkeit der Präventionsmaßnahmen bei den Kostendruck in den Krankenkassen haben im Besonderen die Krankenkassen in der GKV kann man ganz klar sagen da gibt es ja auch Vergleiche (Beitragsanpassung?) der letzten 20 Jahre GKV und PKV da ist der ist der Ausgabendruck bei der GKV deutlich höher ist ja die Frage in welcher Art und Weise solche Präventionsprogramme noch angeboten werden sie müssen angeboten werden in der GKV beispielsweise aber in welcher Intensität ist natürlich die Frage. Messbarkeit der Erfolge schwierig habe ich schon ausgeführt, Akzeptanz bei den Versicherern mir geht es gut ich bin gesund was soll ich denn für meine Gesundheit tun? Warum soll ich zur Vorsorgeuntersuchung gehen? Und das würde ich sagen, dass es gegeben Integration solcher Präventionsmaßnahmen die bestehenden Systeme sage ich gibt es heute gab es gestern wird es morgen geben das ist das ist gesichert also ja Präventionsmaßnahmen können unterstützen. Ausreichend Akzeptanz bei den Menschen in Deutschland sage ich ist nicht gegeben, denn dafür muss man was tun damit sich bewegen, Sport machen und andere Dinge Vorsorgeuntersuchungen wickelhaft bedienen. Joa da liegt es an den Menschen selber. #01:03:53#
I: Verstehe, verstehe also kurz und knapp gesagt also wäre auf jeden Fall eine Option ist nützlich nur das Ding ist nicht so ganz aussagekräftig, weil fehlt an belegbaren Statistiken und dann das Thema mit der Akzeptanz. Ja ich glaube müsste man schauen bei dem Punkt. Ich persönlich würde darin Chancen sehen aber// #01:04:24#
B2: Ja, ich auch. Unterschreibe ich ja #01:04:30#
I: Vielen vielen Dank dann die letzte Frage zur Digitalisierung, eine ganz kleine Frage:
Welche konkreten Chancen bietet die Digitalisierung im Bereich der stationären Pflege, die zu einer Kostenreduktion und damit geringeren Ausgaben führen könnte? #01:04:48#
B2: Das ist für mich auch eines der maßgeblichen, zukunftsweisenden, Themen der nächsten Jahrzehnte, wenn wir an die sogenannte Transformation weltweit denken. Einführung künstlicher Intelligenz, Erweiterung jetzt mit Gen AI, womit sich die Krankenkassen wie auch die Privaten befassen das ist eine deutliche Chance also, also deutliche und konkrete Chance auf jeden Fall die Kostensteigerungen entweder zu begrenzen oder möglicherweise sogar zu reduzieren. Wir haben als Erstes haben wir eine//hätten wir eine klare Effizienzsteigerungen durch digitale Dokumentation dieses Jahr kommt der jetzt oder nächstes Jahr wir sind noch in 24 zum Beispiel die Einführung der elektronischen Patientenakte, was sich in der Krankenversicherung wie auch in der Pflegebedürftigkeit im stationären Pflegebereich auch auf jeden Fall kostenmäßig Leistungsausgabenmäßig positiv auswirken muss man hat durch digitale Dokumentation in ei Echtzeit Datenzugriff, die ermöglicht Pflegekräfte Patienten damit Echtzeit zu erfassen abzurufen das reduziert den Zeitaufwand für Verwaltungsaufgaben, administrative Aufgaben, verbessert auf jeden Fall auch die Pflegequalität. Denken wir an den Übergang von ambulanter Pflegeversorgung in den stationären Bereich beispielsweise oder Rückführung von stationär und in den ambulanten. Das sind ja klare Brüche in der in der pflegerischen Versorgung auch immer wieder zu erkennen. Fehlerreduktion durch die Automatisierung von Dokumentationsprozessen können menschliche Fehler verringert werden was die Qualität der Versorgung erhöhen könnte und auch natürlich Folgekosten minimiert. Dann haben wir den Bereich Telemedizin und Fernüberwachung, Zugang zu Fachärzten die Schnittstelle KV Pflege, ärztliche Versorgung, apothekerische Versorgung, Pharmaversorgung etc. Telemedizin ermöglicht Pflegeeinrichtungen schnelle Fachärzte zuzugreifen ohne das Patienten transportiert werden müssen. Das spart Zeit und Kosten für Transporte, reduziert den Aufwand für Notfälle, Fragen können schneller beantwortet werden etc. Überwachung von Vitalzeichen digitale Gesundheitslösungen zur Fernüberwachung können helfen den Gesundheitszustand der Bewohner kontinuierlich zu überwachen Pflegenotstand also Personalnotstand, den wir in Pflegeheimen haben, könnte gelindert werden. Frühzeitige Interventionen können so Kosten Krankenhausaufenthalte auch vermeiden da bin ich also bin ich sehr überzeugt von und das ist ja auch ein Milliarden Euro Loch, was wir haben, ja. Fehlerhafte Versorgung, zu lange Aufenthalte in Krankenhäusern zu späterem Übergang in stationärer Pflegeheimversorgung etc. Wir hätten Optimierung von Pflegeabläufen auf jeden Fall auch, Planungstools, digitale Tools zum Beispiel zur Einsatzplanung, Ressourcenverwaltung die könnten helfen Personaleinsatz zu optimieren das führt zu einer besseren Auslastung der Mitarbeiter zu naher und stressfreierer Arbeit und könnte zum Beispiel natürlich auch über Stunden oder sogenannte Leerlaufzeiten verringern. Dann ganz klar werden und Ihnen Aufgaben automatisiert ja Robotics beispielsweise ist bei uns auch in vielen Bereichen unterwegs mit automatisierten Systemen einfacher Abläufe könnten Routineaufgaben mindern, also reduzieren oder gar ganz entfallen also da sprechen wir beispielsweise handfest über Medikamentenausgabe über Reinigungsprozesse beispielsweise auch von Hardware etc. Da ist er der technologischen Entwicklung sind da keine Grenzen gesetzt wenn man sich heute an voll elektronische (Pflegebänden?) z.B. orientiert kann die Effizienz deutlich erhöhen Arbeitsbelastung, Pflegepersonal wie gesagt reduzieren und wir haben natürlich in Summe eine verbesserte Kommunikation bei der sogenannten interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Pflegefachkräften ne, Ärzten wie gesagt den ganzen Leistungserbringer, Hilfsmittel, Sanitätshausversorgung über eine einfach gleiche digitale Kommunikationsplattform kann die Zusammenarbeit auf jeden Fall deutlich erhöht werden Informationen werden zentral abgelegt die sind direkt zugänglich hätte natürlich zur Folge dass Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen erforderlich sind meines Erachtens lohnt sich dieser Invest ganz deutlich, ganz deutlich wenn das bei Pflege schaffen würde als Modell nochmal elektronische Patientenakte ist meines Erachtens nur der Anfang dann werden gleichartige Prozesse in der Krankenversicherung direkt aufgenommen werden und gerade im stationären Pflegeversorgungsbereich das halte ich für ein ganz klares (...) wie soll ich sagen, ja treffsicheres Pilotmodell. Wenn wir dann in der Digitalisierung sind als letztes dann könnten wir nämlich auch über längere Zeit Strecken Datenanalysen, saubere Projekte immer vornehmen. Und Daten Datenmanagement aufbauen ne zu welchem Zeitpunkt ist es sinnvoll jemanden in die stationäre Pflegebedürftigkeit zu bringen. Was ist erforderlich für eine gute Versorgung. Daraus ließe sich ganz viele ableiten, was als Ergebnis unter anderem zu einer Steigerung des Versorgungsmanagements führen würde, der Pflegebedürftige und ganz klar zu einer mindestens Reduzierung von der Steigerung von Kosten und Leistungsausgaben. Von daher bin ich da klar Unterstützer und abschließend dazu gesagt schauen sie bei uns auf der DKV-Homepage mal da gehen sie oben auf die Pflege klicken sie Pflege an dann sind sie in unserer Pflegewelt. Da sehen Sie online Angebote von vom Pflege online Antrag der vollautomatisiert bei uns durchgeführt wird innerhalb von Sekunden geht das ganze weiter bis zur vollautomatisierten Verarbeitung von anderen Angeboten, wo andere analog noch mit Formularen arbeiten. Das treiben wir Jahr für Jahr jetzt seit drei Jahren voran wir haben damit Alleinstellungsmerkmal in der GKV PKV. Wir gewinnen damit Zeit wir reduzieren Kosten. Wir erhöhen die Zufriedenheit in Zeiten von Sorge und Unsicherheit. Denn wir reden ja oftmals auch von Bevollmächtigten oder Angehörigen, die die Pflegebedürftigen zu versorgen haben und damit gewinnen wir das sowas erhalten oder messen wir auch über Kundenbefragungen und erhalten da sehr positive sehr positive Rückmeldungen und Mitbewerber schauen auch in den Bereich sage ich ihnen auf die DKV und ich habe auch schon Telefonate mit Mitbewerbern geführt die halt solche Angebote nicht leisten also von daher Digitalisierung es geht nicht ohne Digitalisierung, Punkt. #01:12:48#
I: Ja also Digitalisierung ist natürlich ein sehr wesentliches Thema. In Deutschland wir hängen da ja so ein bisschen hinterher so ein bisschen im Vergleich zu anderen Ländern. #01:13:00#
B2: Ja das kann man auch ganz deutlich sagen viel zu langsam, viel zu bürokratisch, viel zu datenschutzbelastet ja. #01:13:10#
I: Aber ich bin sicher also ist eine sehr große Chance mit der Digitalisierung und auf den Weg werden wir irgendwann mal kommen. Ich kann mir natürlich, aber auch gut vorstellen, dass es den einen oder anderen Mitarbeiter gibt, der sich dann mit digitalen Veränderungen schwer tun wird. Ich meine es tun sich auch jetzt gewisse Mitarbeiter damit schwer jetzt in ihren Dokumentationssystem da richtig einzufinden daher ja gibt die einen oder anderen Herausforderung aber natürlich Digitalisierung// #01:13:38#
B2: Und wenn wir Generationen// über Generation nachdenken, die heute da sind ja auch sehr jung noch haben wir auch so im höheren Alter ungefähr. Die gehen ganz andere mit den mit den mit den Medien um ja mit solchen Sachen. Gab es zu unserer Zeit gar nicht und wenn man jetzt einfach nochmal 20 Jahre weiterdenkt, ist der Anteil derer die, womit wir dann immer arbeiten, vielleicht hat hier direkt so eine Brille oder was auch immer. Ist das nochmal ganz andere in der in der Bevölkerung durchsetzt ja das kann ich Ihnen sagen. Die älteste Dame, die bei uns online so ein Pflegeantrag ausgeführt hat am Telefon mit einer Kollegin in 6 Minuten und sagt dann brauch ich ganzen Papierkram nicht mehr. War 94 ne wir haben also 70, 80-Jährige, die bei uns die online Sachen ausfüllen es ist also nicht eine reine Frage des Alters. #01:14:43#
I: Ja klar, klar man kann sich ja auch gut darin hineinarbeiten #01:14:48#
B2: Ja #01:14:49#
I: (...) jut #01:14:52#
82: Damit glaube ich haben wir es, ne?
I: Ja ja, das sind alle meine Fragen gewesen ich beende auch jetzt die Aufnahme hier. #01:15:00#
Anhang 8.3: Experteninterview 3
Experteninterview 3
Interviewpartner: Person 3
Datum: 03.01.2025 um 08:00 Uhr
Ort: Microsoft Teams
00:00:00 - 00:46:58
I: Alles klar Herr [Person 3] könnten sie sich kurz einmal vorstellen und ihre Funktion in der Einrichtung bzw. im Unternehmen, beschreiben wo sie tätig? #00:00:09#
B3: Ja also ich bin bei Homeinstead Geschäftsführer. Wir sind Deutschlands größter privater ambulanter Pflegeanbieter also nichts mit stationären Leistungen zu tun mehr. Und joa, wir sind mit 180 Betrieben in Deutschland aktiv als Franchise System und sitze hier in der Systemzentrale als einer von 2 Geschäftsführern. Das seit 2019 #00:00:33#
I: Ah ich verstehe, vielen Dank. Das heißt dann konkret mit der stationären Altenpflege haben sie nichts zu tun aber im Rahmen der Pflegeversicherung so also das ist ihr Gebiet dann in dem Sinne? #00:00:50#
B3: Genau ja ich kenn auch den anderen Bereich aber im Moment bin ich nicht im stationären Bereich aktiv. #00:00:57#
I: Alles klar, weiß Bescheid ok. Was würde ansonsten alles zu ihrem Aufgabenbereich gehören? Ich glaub das haben sie grade eben schon gesagt. #00:01:03#
B3: Ja gut, die strategische Steuerung des ganzen Ladens hier. #00:01:06#
I: Ja alles klar, danke. Und wie lange sind sie insgesamt schon dabei? #00:01:11#
B3: Ja ich sag ja, seit 2019, (Sommer?) 2019. #00:01:16#
I: Alles klar, alles klar vielen Dank ok. Na gut dann würde ich direkt zur ersten Frage übergehen und zwar zu einer potenziellen Pflegebürgerversicherung also quasi das jetzige Finanzierungssystem aus sozialer und privater Pflegeversicherung in einer Pflegebürgerversicherung zu vereinen, da wäre meine erste Frage: Halten sie in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen unseres Pflegesystems eine Umwandlung in eine einheitliche Pflege Bürgerversicherung mit einheitlichen Leistungen für eine sinnvollere Alternative und können sie ihre Antwort dazu begründen? #00:01:56#
B3: Ist keine Alternative, weil das Grundproblem der Finanzierung damit nicht gelöst wird und wenn ich mehr Beitragszahler habe, der Großteil der Leute, die da einzahlen an der Bürgerversicherung einzahlen würden sind ja, ist ja die Babyboomer Generation und die erwerben ja auch Leistungsansprüche. De facto haben wir ja durch die einheitlichen Beiträge eine Pflege-Bürgerversicherung, weil der die Leistung der privaten Pflegeversicherung bisher nicht höher als die der gesetzlichen ist, ja normiert also insofern ist das jetzt nur ein Show Kampf #00:02:40#
I: ja ich verstehe okay (...) #00:02:47#
B3: Bisschen anders als bei der GKV, ne? Da haben sie ein ganz anderes Leistungspaket und sie dürfen nicht in der stationären Pflege, gilt auch ambulant, aber in der stationären Pflege, ich sag jetzt den Einzelbettzuschlag oder die Einzelbett Präferierung die für privat versicherten im Krankenhaus machen. Das ist alles normiert, das ist alles auf einem auf einem Niveau also insofern bringt das nichts, null. #00:03:13#
I: Also sie sagen, dass bringt// also vielen Dank für ihre Antwort erstmal (...) Also ich habe bisher nur gehört also ich weiß ja dass das in der privaten der Pflegeversicherung zumindest ja (...) unterschiedliche Beitragssätze gibt sag ich mal also, also abhängig von verschiedenen Faktoren wie Alter, Gesundheitszustand usw. Und da dachte ich jetzt eine// #00:03:46#
B3: Klingt gut erstmal ja aber die Leistungen unterscheiden sich ja nicht, so und wenn jemand älter ist, muss er in der privaten Pflegeversicherung deutlich mehr zahlen, als wenn er jünger ist. Aber da findet eine Kapitalbildung statt in der privaten Pflegeversicherung, deswegen sind alle so scharf drauf, weil die dieses angesparte Kapital haben wollen da (dürfen?) sie bloß nicht rechtlich ran, weil das ist, ja von den Versicherten angespart worden um nachher eine Beitragszahlung zu dämpfen beziehungsweise überhaupt ein Geld Kapitalstock zu haben aus dem die Pflegeversicherung dann bezahlt werden kann ist hier kein// Ist ein völlig anderes System. Die SPV arbeitet im Umlagesystem. Ich zahle für den Pflegebedürftigen, der jetzt da irgendwo eine Leistung kriegt in der privaten Pflegeversicherung wird eben ein Teil, ein Großteil des Beitrages in Kapitalstock gelegt damit dann später der Beitrag von mir aus diesem Kapitalstock Schluss den anderen Beitragsmittel der Versicherung oder der Versicherten gezahlt wird, so aber das kann ich ja nicht einfach verwenden, ich kann ja nicht sagen „oh lösen wir jetzt alles auf“ führen den Kapitalstock in die SPV über und tun jetzt so als ob damit die Probleme gelöst sind sondern ich mach einmal Geld zu verfügen was dann verballert wird und dann muss ich wieder im Umlagesystem gucken wie ich das Geld in die Kasse kriege das wird nicht funktionieren. Das//weil der abseits der rechtlichen Fragen die ja auch darauf runter diskutiert werden aber das ist ein Einmaleffekt der nach hinten losgeht, weil das keine nachhaltige Lösung. Die einzige nachhaltige Lösung ist tatsächlich ein vergleichbar wie bei der privaten Versicherung von Kapitalstock aufzubauen, der nicht angetastet wird, wie es jetzt wieder gemacht worden ist. Das hat man eine Zeit lang gemacht und hat dann das Geld diese quasi eiserne Reserve der Pflegeversicherung während der Corona Zeit geplündert und plündert es jetzt auch wieder sodass also diese Reserve oder Kapitalstock der SPV inzwischen aufgebraucht ist dass das eigentliche Problem dass man sich da politisch in dem Moment wo Geld zur Verfügung steht für andere Zwecke ursprünglich gedacht dann bedient und damit der politische Wohltaten finanziert und jetzt steht man vor dem Problem dass das Geld weg ist das ist das Problem #00:06:34#
I: Oh vielen Dank. Im Wesentlichen alles gesagt, sie sind der Ansicht, dass würde eher weniger bringen. Ich hätte jetzt eigentlich noch drei weitere Fragen zur PflegeBürgerversicherung gehabt. Ich guck jetzt mal, welche davon noch Sinn ergibt (...) ja genau was ich// Es kann natürlich sein, dass es nicht alle wirklichen Probleme der Pflegeversicherung nachhaltig lösen wird, Also wie gesagt: Die genaue Antwort weiß man dazu natürlich auch nie. #00:07:08#
B3: Es gibt einen Vorschlag der Tisch liegt (irgendein Professor?) das erarbeitet habt mir fällt der Name jetzt nicht ein. Aber wie gesagt ja wenn man das jetzt umbauen würde dann könnte man hingehen und sagen man nimmt eine Altersgrenze ab der man sich voll ich sag jetzt mal privat// (...) anders rum gesprochen es gibt das Umlagesystem wie wir es jetzt haben und das wird ergänzt durch eine verpflichtende Zusatzversicherung also eine Versicherungspflicht wo ich die auch immer abschließe und die Beiträge der öffentlichen Hand aus Steuermitteln oder aus Teilen der SPV soll dann politisch ausklamüsern und finanzpolitisch wird also mit steigendem Alter der Versicherten wird dieser Zuschuss immer weiter erhöht ja weil wenn ich jetzt mit 50 anfange in eine privaten Zusatzversicherung zu zahlen wird da am Ende nicht viel bei rauskommen. Mach einfach eine Zinseszins Rechnung und umso jünger ich bin, umso mehr Anteile muss ich eben selbst tragen, weil die Versicherungsbeiträge ja damit ich eben einen Kapitalstock anspare mit 20 überschaubar groß sind. Da ist man irgendwie mit 10, 11€ dabei. Und das Ganze ist halt so eine Art aufsteigenden Kurve, müssen sie mal im Internet recherchieren beim PKV Verband glaub ich gibts das, gibts da eine Übersicht und dann hat man einen ausreichenden Kapitalstock bei der jüngeren Generation die dann für sich selber auch vorgesorgt hat und dann nicht in den Problem ist dass die Sozialversicherungsbeiträge nachher so hoch sind, dass sie im Grunde genommen Arbeit verhindern das ist eher eine Diskussion, die im Markt wieder läuft und auf der anderen Seite auch eine auskömmliche Finanzierung der Leistungen der Pflegeversicherung hat das überhaupt Pflege also noch einen Zuschuss zu ihrem Pflegebedarf bekommen beziehungsweise einen Wesentlichen. Man könnte sogar bis zur Vollversicherung denken je nachdem, was man als Zusatzversicherung dann abschließt, dass man mehr oder weniger abgesichert ist. Und davon will man aber an vielen Stellen nichts wissen, weil das natürlich unangenehm ist zu sagen „naja Pflege kostet halt in der Zukunft was“ und ich muss mit (unv.) in ihrem Alter muss ich mir schon Gedanken machen was in 40 Jahren oder 50 Jahren für Geld brauche, aber ich meine das gehört zur Wahrheit dazu. Da kann man nicht erst mit 60 drüber nachdenken, wie man sich dann absichern will und wo das Geld herkommt. Das Modell für die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber funktioniert auf Dauer sowie sie es im Moment fahren nicht mehr das ist einfach Fakt. #00:10:12#
I: Alles klar vielen Dank. Ja hat doch auch viel zu viele gesetzliche Regelungen viel zu viele Regularien und Bürokratie usw. Bin ich da ganz ihrer Meinung. Ja sie haben ja gerade hauptsächlich über jetzt ein Grundstück, ich glaube auch Kapitaldecken jetzt im Rahmen der Pflege Bürgerversicherung gesprochen. (...) Ich glaube man könnte es aber auch so machen, also das das wir jetzt seine zweite Frage dazu, dass man, dass eher jetzt in Form der sozialen Pflegeversicherung in Form einer Umlageversicherung durchführt und dafür die Beitragsbemessungsgrenze vielleicht ein bisschen anpasst oder vielleicht sogar komplett abschafft. Also das wäre jetzt genau die Frage: Würden Sie sagen, dass eine Pflege Bürgerversicherung in Kombination mit einer drastischen Erhöhung oder sogar eine Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze die Ausgabensituation in der Pflegeversicherung verbessern würde? Und wenn ja könntest dann noch dazu viel dass die Beitragssätze stabil gehalten werden? #00:11:12#
B3: Ja erste ist auch da haben wir wieder das Problem, dass hier keine sinnvolle Verwendung des höheren, der höheren Einnahmen der Pflegeversicherung haben, weil da wird so Wort politisch Wohltaten verteilt die mit der heißen Idee der Pflegeversicherung gar nichts zu tun haben. Wir haben heute schon ganz viele quasi versicherungsfremde Leistung in den, in der Pflegeversicherung, die dort gezahlt werden die (eigentlich gesetzliche Aufgaben?) sind also beispielsweise das gleiche gilt ja für die Krankenversicherung, aber wenn die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige zahlen, dann ist die Frage, ist das jetzt eine gesetzliche Aufgabe also eine die der Steuerzahler zahlen muss oder ist das eine die aus der Pflege Versicherung kommen muss. Und diese ganzen Corona Hilfen als Beispiele sind Zusagen gemacht worden, was alles aus der Pflegeversicherung bezahlt wird. Bis zu unternehmerischen Ausfallgrößen also quasi eine Umsatzkompensation Testkosten und so weiter und sofort, die mit der Pflege überhaupt nichts zu tun haben und in dem Moment wo die dann Geld in einem solchen System haben wird es ausgegeben und dann steht man nach 3, 4, 5 Jahren, 6 Jahren wieder vor dem Problem und sagt „oh das Geld reicht nicht aus wir müssen die Beiträge erhöhen“ also insofern haben wir nicht das Problem dass wir zu knappe Mittel haben sondern wir geben das Geld falsch aus. Und wie gesagt, das war ja ein Kapitalstock angelegt worden in der SPV den hat man wunderbar verballert der ist mehr oder weniger weg die Reserven sind auch weg und jetzt versucht man händeringend Geld in die Kasse zu kriegen und das ist das eigentliche Problem. Man müsste das eigentlich aus der politischen Willkürlichkeit rausnehmen und sagen worauf konzentriert sich die Pflegeversicherung wofür ist sie wirklich da? Jo ist der Zuschuss, der gezahlt werden soll der muss mal dynamisiert werden weil sonst und das Problem dass man die Leistung, die man eigentlich mit der, mit dem Versicherungsbeitrag ich sag mal als Anrechte erwirbt gar nicht in Anspruch nehmen kann, weil entweder der Zuschuss zu gering ist dann hat man nichts davon wenn man nicht selber ausreichend hohes Einkommen hat oder anderweitig vorgesorgt hat oder die Leistungssituationen der Pflegeversicherung so schlecht ist, dass die Leistungserbringer kein Interesse mehr haben beispielsweise an Pflegeversicherten die Leistungen zu erbringen oder sich zurückziehen, weil die Vergütung nicht auskömmlich sind und dann haben sie de facto ein Leistungsanspruch in der Pflegeversicherung, den sie aber nicht einlösen können, weil es eben keinen mehr gibt, der die Leistungen zu den Preis erbringt oder sie können sich das gar nicht mehr leisten, weil der Zuschuss zu gering ist sei es mit (einem Tier?) in der spannenden Frage „Wie sichert man das Leistungsversprechen der sozialen Pflegeversicherung und wie sichert man das so dass sie dahinter verbunden versprechen auch zur institutionellen Leistungen gesichert werden?“ So und dazu gehören zwei Wahrheiten ich muss erstens dafür für auskömmliche Preise sorgen oder die auskömmlichen Preise ermöglichen, dass die Leistungserbringer auch weiterhin bereit sind in auch wirtschaftlich schwierigen Regionen die Leistung erbringen das sind städtischen Regionen häufig einfacher oder Metropolregionen als den sehr ländlichen Regionen. Versuchen sie mal in der (Eifel?) einen Pflegedienst zu kriegen und das zweite ist dass man darüber dann auch gucken muss: Die Regulation, sie haben es ja schon angesprochen runterzuziehen also abzubauen damit ich dann auch als Unternehmen mit meinen Mitarbeitern Ideen entwickeln kann ja innovative Versorgungsmodelle aufzubauen, die immer mehr Geld kosten das ja auch ein Vorschlag den wir entwickelt haben mit mehreren Unternehmen zusammen, las und Zeitbudgets entwickeln, ermöglichen (lass uns sie poolen?) also die Versicherten können die zusammenwerfen, macht wenig Sinn, dass man alle Leistung 1:1 erbringt, viel interessanter wäre uns auch überlegen ob sich nicht 3, 4 aus der Nachbarschaft zusammen tun können, ihre Leistungen zusammenlegen können wie man das in der Eingliederungshilfe auch kennt und diese gemeinschaftliche Leistung wenn ich jetzt jeder eine Stunde Leistung in einen Topf wirft und ich hab 5 Leute hab ich statt einer Stunde alleine Leistung hab ich fünf Stunden gemeinsame Leistung. So und kommunizieren miteinander hat auch präventiven Charakter so und damit komme ich in eine deutlich größere Leistungssituation rein, Leistungsabdeckung rein würde das ist 1€ mehr kosten können sich ja jetzt keine 24/7 über die Pflegeversicherung in einer 1:1 Betreuung leisten, das kostet im Moment so um die 35.000€. Das geht ja gar nicht mehr (weg?). Also das sind so Modelle wir müssen raus aus diesem Thema wie kriegen wir einfach nur mehr Geld ins System? Weil das muss ja irgendeiner bezahlen und ehrlich gesagt mit den Abgaben, die da sind sozusagen ja wir heben die Beitragsbemessungsgrenze auf dann ist alles gelöst das ist falsch, wir geben das Geld falsch aus insofern andere Modelle denken und mit dem Geld sinnvoll und umgehen und dann kann man tatsächlich mal überlegen eine entsprechende Versicherungspflicht einzuführen, die mit überschaubaren Geldbeiträgen gefüttert wird unterhalb einer bestimmten Einkommensgrenze die mehr festlegen kann gibt es einen steuerlichen Zuschuss? Der Thomas Rabinski hat da gerade auch was wieder dazu veröffentlicht im Bereich der Krankenversicherung auch da geht es nicht in Richtung einheitlicher Beitrag und egal was man verdient wichtig ist dabei, dass die Leute, die sich den Beitrag nicht leisten können, dann wirklich zu unterstützen, das heißt also den Leuten die Hilfe zukommen zu lassen das Geld nicht haben. Das haben wir ja heute auch nicht. Wir sind ja nicht, wenn ich ein geringes Einkommen habe, geringes Gehalt habe zahle ich meinen Sozialversicherungsbeitrag entsprechend hohen Anteil in meinem Bruttoeinkommen. Also ich bin da viel stärker belastet als rein faktisch vom verfügbaren Einkommen, Haushaltseinkommen als wenn ich es eh schon höheren Verdienst hab, da bin ich noch gar nicht bei der Beitragsbemessungsgrenze, sondern noch unterhalb. Wenn ich jetzt sage, alle die unterhalb von einem Betrag von x verdienen kriegen ein Zuschuss zu dieser oder sogar voll übernommen dieser Pflegezusatzversicherung, kriege ich einen ganzen Teil des Problems gelöst und das gehört zur Wahrheit, dass man dann sagen muss, wo setze ich die Steuermittel ein und ich gebe die nicht pauschal in den Topf der Pflegeversicherung aus dem dann sich wieder irgendwie bedient wird und jeder davon ein Vorteil hat #00:18:44#
I: (...) Gut. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ja das ganze Thema ist natürlich sehr sehr komplex und was kann ich groß zu sagen? Ja also ich glaube immer darüber zu reden, wie man mehr Geld ins System bekommt ich glaub das wird die Probleme auch nicht strategisch wirklich lösen. Es ist ja aber faktisch so, dass die Ausgaben ja immer steigen, also die gehen ja nicht runter, sondern steigen immer weiter daher wohl oder übel muss man ja irgendwie versuchen mehr Geld in das System reinzubekommen also da jetzt 100% optimale Lösung zu finden ist das Schwierige daran. Sie haben ja Anfang gesagt, dass es ja sehr viele leistungsfremde Ausgaben dazu gibt. ich glaube das ist so ein Ding, das man eigentlich lösen können, sollte, wenn man einfach wirklich konsequent reguliert das diese Leistung ausschließlich jetzt in dem Fall für die Versicherung für die Pflegeversicherung also für Pflege verwendet wird und keine anderweitigen Leistungen dafür jetzt bezahlt werden, aber da bin ich nicht ganz drin natürlich kann ich nicht viel zu sagen. #00:20:04#
B3: Machen sie mal für ihre Arbeit eine Recherche wie häufig Saskia Esken, um mal so ein Beispiel zu nehmen, eine Reichensteuer was sie ja gerne formuliert, wie häufig sie das schon irgendwo hin für irgendwas verwenden wollte. Zählen sie diese Menge mal zusammen! in den letzten drei Jahren haben wir bestimmt acht oder neun Ideen, was man alles damit finanziert hätte. Jede Fünf-// Es kommt immer irgendeine Idee und jetzt sag mal braucht man die Steuer dann geht das. Wenn sie das mal zusammenzählen würden, würden sie feststellen es geht gar. Ich kann nicht jedes Mal// also nicht jede Idee, die ich habe sofort wieder mit der sogenannten Reichensteuer belegen, weil ich kann das Geld auch da nur einmal ausgeben, was ich einnehme also das ist die Gefahr dabei es wird immer geguckt wo krieg ich das Geld her damit ich nachher politischer Wohltaten wie ich das Geld ausgeben machen kann es gibt eine sehr schöne Aussage von einem maßgeblichen SPD Mitglied, dass alle sieben// Alle drei Legislaturen muss ich im Gesundheitswesen und dazu zählt die Pflegeversicherung drastisch einsparen dann kommt man wieder ins Geld ausgeben. Jetzt sind wir in der Situation, dass man sich mal ehrlich machen muss: Wo geben wir das Geld wie sinnvoll aus? Das ist ja// Einsparen gibt es ja in der Form nicht, dass man weniger ausgibt, man dämpft immer nur den Ausgabenanstieg über die letzten 40 Jahre läuft international das ist jetzt kein deutsches Problem und dann geht die Kurve wieder nach oben, meistens dann Konkurrent zu einer wirtschaftlichen Entwicklung, weil dann die Gelder steigen, dann der entsprechende Anteil der Sozialversicherung auch nach oben gehen und kann ich das Geld wieder schön ausgeben. Und im Moment sind wir eben in so einer Dämpfungsdiskussion und die ist für Politik immer unangenehm immer. Ja, weil ich den Leuten ja zumindest gefühlt was wegnehmen muss. Jetzt ist die Zeit, der Finanz- und der Haushaltspolitiker und nicht in der Ausgabenpolitik das ist so das hat überhaupt nichts mit Pflege zu tun, das finden Sie im Moment in allen Leistungsbereichen und insofern ist die Frage: Wie kann ich mit dem vorhandenen Mitteln ich rede ja gar nicht von weniger Geld sondern mit dem vorhandenen Mittel mehr erreichen sinnvoll erreichen und nach welchen Stellen gibt man das Geld falsch aus? Ich nehme mal am Beispiel eine Pflegeversicherung nehmen sie mal den Pflegegrad 1 den Entlastungsantrag 137€ (oder was ist der jetzt?) #00:22:47#
I: Ich glaub 125 #00:22:48#
B3: Ne der ist nicht mehr 100, der ist gestiegen jetzt zum 01.01. So wenn sie den mal nehmen und sich mal anschauen was passiert damit dann stellt man fest in diversen Statistiken das Geld wird für Putzleistung in Haushalten verwendet und wird auch so von den Pflegekassen angepriesen. Ich kann mir jetzt noch Putzfrau von der Pflegeversicherung bezahlen lassen. und da stelle ich mir dann die Frage hat das noch was mit Pflege zu tun und da muss man sagen: Nein, null, gar nichts. Da kommen jetzt auch die ersten um die Ecke richtigerweise und sagen na ja also das ist eine Fehlverwendung von Geld und der große Anstieg der Pflegebedürftigkeit den wir in den letzten drei, vier Jahren gesehen haben der in (D-Staat?), der es jetzt auch gerade veröffentlicht hat, ist in diesem Pflegegrad 1 das heißt der Ausgabenanstieg in der Pflegeversicherung durch einen steigenden Pflegebedarf ist vor allem in diesem Bereich Pflegegrad 1 zu sehen wo das Geld dann nicht den tatsächlich Entlastung läuft sondern in dem Punkt jetzt kann ich mir volle Pflegeversicherung zwei Mal im Monat die Putzkraft leisten. Und daher haben sie so ein Beispiel, wo man sagen kann, wollen wir das kann ich Wohnungsputzen nicht anders organisieren? Kann ich mir das nicht selber machen? Weil Pflegegrad 1 heißt jetzt nicht dass ich nicht selber mit einem Wisch Mob oder mit einem Staubsauger durch die Wohnung gehen kann und streicht diesen Betrag und dass dann die 137€ oder 135, die es da jetzt gibt die nehme ich dann aus der Finanzierungspflicht der Pflegekasse raus etwa an signifikanten Betrag gespart den kann man dann nicht einfach irgendwo versickern lassen sondern dann beispielsweise in Leistungserhöhung der Pflegegrade 2 bis 5 dann rein gucken und sagen dann erhöht sich da der Zuschuss eben um 3, 4€, 5€ pro Pflegestufe. Das wäre viel sinnvoller genau an der Stelle mal die Zielgenauigkeit der Leistungen zu überprüfen. #00:25:01#
I: Jap kann ich nichts gegen sagen, wäre ich eigentlich prinzipiell mit einverstanden. Es
wäre aber natürlich ein anderer Diskussionspunkt (...) ja dann müsste es natürlich auch anders bezahlt werden also jetzt, wenn Hauswirtschaftskräfte jetzt kommen, um zu putzen das hat ja an sich nichts mit der Pflege zu tun. #00:25:18#
B3: Ja sie haben über dem Pflegemindestlohn und sonst haben sie auch da gewisse Vorgaben was die Vergütung angeht, was die Beschäftigung angeht noch schlimmer ist wenn sie dann hingehen sagen ja ich zahle im Grunde genommen aus der Pflegeversicherung Leistungen an Firmen, die die das regulativ der Pflegeanbieter umgehen und reguliere auf der anderen Seite die professionellen Pflegeanbieter, die ja auch solche Unterstützung sei es im Haushalt anbieten ergänzend zu ihrem Kerngeschäft reguliere ich so kaputt, dass sie das nicht mehr aus einer Hand erbringen können also die ganze Leistung auch noch ineffizienter machen also das ganze Gebilde ist in sich nicht mehr logisch aufgebaut. #00:26:05#
I: Ja, vielen Dank für ihre Antwort aufjeden Fall jut. (...) Die dritte Frage, die ich dann dazu hätte, also darüber haben wir auch schon vorher ausführlich gesprochen, ich würd die der vollständigkeitshalber trotzdem stellen aber ich glaub da müsste man nicht mehr so tief drauf eingehen: Fänden Sie es sinnvoller wenn man eine einheitliche
Pflege Bürgerversicherung mit einer Kapitaldeckung kombiniert so dass private Pflegeversicherte ihre Altersrückstellung beibehalten können und nun für alle Versicherten Altersrückstellung gebildet werden können? #00:26:37#
B3: Also ich hatte es vorhin// ich hatte ja eben gesagt ich halte von einer einheitlichen Bürgerversicherung nichts. Es kommt ja weiter unten jetzt die Frage Kombination betrieblicher und privater Altersvorsorge ergänzend das macht Sinn wie die (IG BCE?) die hat ja das entsprechende in ihren Tarifvertrag implementiert so wie ich heute Zusatzversicherung für Zahnersatz etc. als Firma unterstützen kann könnte ich ja auch hingehen und sagen ich kann eine Gehalts-// anteilige Gehaltsumwandlung anbieten und sagen du kriegst sozialversicherungs- und steuerfrei ein Teil deines Gehaltes was dann über Mitarbeiter in eine private Zusatz Pflegeversorgung einzahlen kannst und wenn man das richtig aufbaut dann reden wir nicht von riesigen Beträgen dann kann ich ja mit 30€ anteiligen Gehalt muss er dann keine Sozialversicherung, keine Steuer draufgezahlt werden muss das heißt dem Nettoeinkommen spürt der Mitarbeiter das gar nicht dass deswegen gibt es ja viele dieser Umwandlungsmöglichkeiten wie zum Beispiel bei Job Bike und würde sagen: „Netto merke ich gar nicht“ dass sich der Arbeitgeber mir über dieses Modell ein Fahrrad quasi finanziert. Da habe ich Netto unterm Strich ein Abzug von 10€ oder so. Also das kriege ich// Das sind so Modelle mit denen man arbeiten kann da muss man natürlich sagen jawohl das hat natürlich ein Einfluss auf die Sozialversicherungsbeiträge und eben auch auf die Steuereinnahmen aber das würde sofort wie man auch in anderen Ländern sieht sofort die entsprechende Vorsorgemodelle nach oben ziehen und hätte dann auch ausreichend Geld, was abseits von irgendwelchen politischen Ausgabewünschen ist was dann später für die Pflege Bedarfe der Menschen zu Verfügung steht und nicht irgendwo falsch ausgegeben worden ist. #00:28:50#
I: Alles klar vielen Dank (...) jap zu den Vorsorgemodellen würde ich gleich noch kommen jap. Gut sie haben ja jetzt schon alles Wesentliche gesagt zur Pflegebürgerversicherung, sie halten davon nichts, es ist keine strategische Lösung und so. Ja könnte man an der Stelle auch sein lassen. Ich würde aber trotzdem fragen, auch wenn Sie jetzt sagen das ist jetzt keine Lösung: Würden sie sagen, dass das trotzdem vor der Politik realistisch umgesetzt werden könnte? #00:29:17#
B3: Nö! Es kann nicht umgesetzt werden, wie gesagt, weil es da rechtliche Probleme gibt und klar Politik kann alles irgendwie gesetzlich machen, aber das wird wahrscheinlich so ein (unv.) werden, dass das jetzt auch nicht die kurzfristige Lösung sein kann. #00:29:34#
I: Alles klar. Ok danke sehr. Na gut, dann gehen wir jetzt zu den privaten Vorsorgemodell da haben sie auch schon die erste Frage// #00:29:43#
B3: (Habe ich grade?) was dazu gesagt. #00:29:44#
I: Ja. Genau genau. Zur ersten Frage, das heißt ich glaube die überspringen wir dann einfach. Was ich glaub ich noch dazu sagen könnte: Ich meine, weil sie hatten ja gesagt dass das eher eine Lösung ist. Da gibt es jetzt aber Leute, die ja vom Einkommen her nicht so viel verdienen, die das dann auch eher nötig hätten so eine private Altersvorsorge oder eine Kombi mit einer betrieblichen Altersvorsorge. Da wäre die Frage, wenn man zu den jetzt sagt Sie müssen einen gewissen Betrag einzahlen, sodass sie irgendwann später weiter abgesichert sind, da wäre jetzt die Frage: Könnten die das dann in der Phase ihrer Erwerbstätigkeit dann auch aufbringen? Also das habe ich mit anderen Experten genauso gesprochen da war auch die Ansicht: Ist auf jeden Fall eine Lösung aber Leute mit geringem Einkommen für die ist das eine Belastung dann. #00:30:38#
B3: (...) Also das es Geld kostet ist klar, ich sag ja eben also erstens der erste wichtige Punkt ist, wenn ich ein solches betriebliches Modell mache, dann muss ich in der Lage sein als Betrieb bis zu einem wirklich realistischen Betrag eine Entgeltwandlung machen zu können die dann steuer- und sozialversicherungsfrei dann tut sich da unterm Strich netto nicht allzu viel. Die (...) Der zweite Punkt ist das hatte ich eben gesagt ist dann einen entsprechenden Zuschuss aus Steuermitteln zu geben sozusagen unterhalb einer bestimmten Einkommensgrenze bekommst du steuerlich einen Zuschuss für diesen// oder einen tatsächlichen faktischen Zuschuss wie man sie auch in der Riester Rente gemacht hat. Hat man es leider nur regulativ völlig gegen die Wand gefahren aber den Grundansatz ist ja da. Ich zahle dann für diejenigen die sich selbst nicht leisten können einen entsprechenden Betrag aus dem (Steuersek?) Und damit was mach ich dann da sozialpolitisch etwas, was genau richtig, ist dass ich mich den Menschen das Geld ich habe in der steuerlichen Umverteilung dann tatsächlich alle Unterstützungen gebe und nicht letztendlich die dann wieder ausschließen. Das ist ja bei vielen Modellen, die wir heute haben an Fördermaßnahmen bis oder sich als derjenigen für den es eigentlich gedacht ist durch irgendwelche Anrechnungsfaktoren und Voraussetzung eigentlich gar nicht das habe davon immer mal das Beispiel Kindergeld was ist eigentlich verspricht, aber weil es immer mit irgendwas anderem gegengerechnet wird. Hier ist der Gesetzgeber dann gefragt zu sagen: „Ok wer unterhalb von X Euro verdient, der kriegt seinen Beitrag von 30€ von uns bezahlt. Und oberhalb einer gewissen Einkommensgrenze gibt dann eben diesen Effekt nicht mehr. Der muss selber bezahlen (unv.) deren System. #00:32:52#
I: Alles klar, würde ich aber auf jeden auch eine Möglichkeit so darin sehen, vielen Dank alles klar. Ich lese dann mal die zweite Frage davon vor, die ist ein bisschen länger gestellt: Finden Sie die Idee sinnvoll, dass alle Betriebe für ihre Mitarbeiter eigene Vorsorgefonds einrichten, wo jeder einen frei gewählten individuellen Beitrag einzahlen kann für seine zukünftige Altersvorsorge und welche möglichen Schwierigkeiten könnte es mit sich bringen? Würde ein Mindesteinzahlbetrag Sinn machen oh? Also ist ähnlich// #00:33:26#
B3: Ist Quatsch diese Lösung, weil sie haben Leute, Mitarbeiter die wechseln die Firma so und wie übertragen sie dann die entsprechenden Ansparung das funktioniert nicht das können sie nur über eine separate Versicherungslösung oder Fondslösung separiert von einem Unternehmen machen kennt man übrigens in der Lebensversicherung mit entsprechenden Altersfondsmodellen, die werden über Versicherungen abgewickelt und die kann ich dann mitnehmen die Ansprüche und der nächste Arbeitgeber zahlt dann da ein das kann man machen dann ist der Gesetzgeber gefragt solche Vorsorgemodelle aufzuziehen aber wie gesagt da sind wir bei den was ich eben gesagt hab private Zusatzversicherung da kann man eben Pflichtversicherung draus machen oder man macht eine freiwillige Sache wie jetzt ein Tarifvertrag der IG BCE hilft nur nichts wenn man eben kleine Firmen haben die alle nicht in einem Tarif eines Arbeitgeberverbandes sind also sofern würde eine Versicherungspflicht sinnvoll sein so und dann kann ich ja meine Beitragszahlung zahle ich ja ein und meine Ansprüche nehme ich ja automatisch mit weil ich einen individualisierte persönlichen Anspruch hab auf völlig unabhängig vom Arbeitgeber. #00:34:46#
I: Ja alles klar. Ok. Hatte ich so vorher nicht betrachtet. Macht natürlich so Sinn. Vielen Dank. Hätte ich so nichts weiter zu ergänzen alles klar. Na gut, dann weg von den privaten Vorsorgemodellen jetzt gehen wir noch den sogenannten Generationenvertrag von der von der PKV also vom Verband der PKV hat ja, soweit ich weiß, drei verschiedene Gestaltungsoptionen Ich lies da einfach mal die erste Frage vor ist ja auch irgendwie so ein Konzept von ihnen entwickelt worden. Könnte der Generationenvertrag in seinem Gestaltungsoptionen dazu führen, dass die Versicherten im Fall einer Pflegebedürftigkeit höhere Eigenanteile zahlen müssen, wenn die Leistungsausgaben an den Beitragseinahmen angepasst werden? Also das war ja eines der Gestaltungsoptionen, dass die Ausgaben nur noch so steigen wie auch die Einnahmen sich entwickeln #00:35:45#
B3: Das hängt dann von den zukünftigen Entwicklungen ab. Klar, wenn ich das so einfach jetzt richtig, aber ich habe ja in einem Versicherungs- und Kapitalbildungsmodell habe ich auch Zinserträge oder Renditen die Zinseszinseffekt bestimmte Puffer zur Abdeckung der Inflationsrisiken da sind. Ich glaube wir müssen uns bei den Leistungsausgaben und Beitragseinnahmen zwei Dinge unterscheiden das eine ist die inflationsbedingte Preisentwicklung also ich hab ja höhere Ausgaben über Personal und Sachkosten sind bei den Leistungserbringern damit auch höhere Preise was zu höheren Leistungsausgaben führt damit einhergehende aber auch höhere Beitragseinnahmen, die eben an beispielsweise sowie man es bei anderen kapitalbildenden Versicherungen kennt wenn die dann anhand der Inflationsraten oder anderer Indexe eine Dynamisierung in Beitragseinnahmen haben dann gleicht sich das wieder aus und dann haben wir eine reale Leistungsausgabensteigungen, die mit anderen Leistungsempfängern zu tun hat. Beispielsweise wenn ich jetzt sage es gibt irgendwie ein neues Leistungspaket in der Pflegeversicherung und da bin ich dann sofort bei dem Thema höhere Eigenanteile ich kann mir mehr Leistung einkaufen also wenn meine Versicherung dass nicht vorsieht krieg ich das eben aus der Versicherung nicht bezahlt und muss das eben aus eigener Tasche zahlen und das wird eben häufig nicht betrachtet bei all diesen Diskussionen sich neben der inflationsbedingten Preisentwicklung und damit weiter so Ausgabenentwicklung eben auch über die Frage habe wer verteilt soziale Wohltaten, wo entstehen neue Leistungsansprüche? Die müssen ja irgendwo herkommen und dafür muss irgendeinen Beitrag bezahlt haben. #00:37:45#
I: Klar logisch, logisch ja (...) muss mal überlegen (...) Ja also auch hier alles gesagt worden. Ja genau, also ist halt auch wieder ein komplexes Thema und das mit Inflation, ja. Solche Sachen werden ja wirklich immer wenig beachtet, diskutiert ich habe da auch irgendwie wenig dazu gelesen, obwohl es eigentlich auch ein Faktor ist, ja. Müsste man schauen. Die zweite Frage die dazu noch zusammenhängt, Sie haben ja am Anfang über Pflegezusatzversicherung also Pflichtversicherung dann gesprochen, dass das auf jeden Fall Sinn macht, ich glaub das hängt jetzt so ein bisschen mit der zweiten Frage hier zusammen: Könnten die Kosten die mit diesen Konzepten nicht mehr von der Pflegeversicherung abgedeckt werden durch private Vorsorge wie zum Beispiel Zusatzversicherung abgedeckt werden oder werden die Pflegebedürftigen immer noch zum Großteil auf Sozialhilfe angewiesen sein also das ist in dem Sinne gemeint die Eigenanteile werden ja häufig durch// #00:38:58#
B3: (unv.) wie die PKV das gerechnet hat, ja eben nicht. Und wenn sie jetzt heute mal eine Pflegetagegeldversicherung anschauen, die einigermaßen sinnvoll abgedeckt oder abgeschlossen ist dann haben sie im Monat, wenn sie jetzt mal rechnen, wenn sie ein Pflegetagegeld in einen Pflegegrad unter 20€ kriegen bei 22 Tage, dann haben sie allein knapp 3000€ an zusätzliche Leistung aus der Pflegetagegeldversicherung also das ist ja noch gar keine Pflegezusatzversicherung in dem Sinne wie sie angelegt gedacht ist. Es reicht tageweise Zahlung. Sie können auch welche abschließen mit höheren Beiträgen aber mit höheren Zahlungsgrößen, also sie nehmen für ein Großteil der Menschen und dann das allein über Pflegetagegeldversicherung das Risiko einer Sozialhilfeabhängigkeit raus. Das ist ja auch die Idee das Konzept des PKV-Verbandes und weil ich eben nicht mehr abhängig bin von den Umlagen bedingt oder Umlagebasierten Einnahmen der SPV die dann wieder eben zu einer mangelnden Dynamisierung der Ausgaben führt ne also wir haben nur damit zu meinem Gefühl haben wir haben Gehaltssteigerung von 24 auf 25 Uhr gesetzlich vorgegeben. Das ist jetzt nicht von uns ausgesucht von den Anbietern gesetzlich vorgegeben von über 10% dann teilweise 14% Geiststeigerung und sie haben eine Dynamisierung in der SPV in den Leistungen nach §36 SGB V von 4,5%. So da brauchen sie jetzt mal keinen Taschenrechner haben um zu wissen, dass diese Schere größer wird und das heißt derjenigen die durch die steigenden Preise der Leistungsanbieter gerade im stationären Bereich auf die Sozialhilfe angewiesen wird nimmt zu und das hat nichts mit irgendwie steigenden Inflationsraten zu tun sondern es hat damit zu tun, dass meine gesetzlich bedingt Gehaltssteigerungen vorgibt dann auf der anderen Seite nicht bereit ist über Steuermittel oder Anderes die Refinanzierung und nicht des Pflegebedürftigen zu bezahlen. #00:41:27#
I: (...) Ich verstehe, ich verstehe. Ja ist natürlich ein Aspekt, der mir so noch nicht wirklich bekannt war. Ja gut vielen Dank. Damit wurden all meine Fragen jetzt hierzu beantwortet. Na gut, gehe ich einfach zu den letzten drei Fragen hier noch über das sind jetzt Fragen zu eher kleineren Anpassungen sag ich jetzt mal in Anführungszeichen da wäre die erste Frage dazu: Sollte die Pflegefinanzierung mit einer Steuerfinanzierung ergänzt werden und würde dies allein schon einen Unterschied ausmachen? Also so ähnlich wie beim Gesundheitsfonds der Krankenversicherung, also der gesetzlichen Krankenversicherung #00:42:14#
B3: Naja es würde schonmal reichen, wenn aus Steuern die versicherungsfremden Leistungen finanziert werden, hätte man zumindest da eine Fokussierung und dann wäre es auch nicht einfach nur wie bei der Krankenversicherung ein pauschaler Zuschuss, wo das Wohl und Wehe der Krankenversicherung von einem Steuerzuschuss abhängig ist. Gucken sie sich mal das NHS an in Großbritannien rein steuerfinanziert. Das ist jetzt gerade kein gutes Beispiel für steuerfinanziertes Gesundheitssystem. Das funktioniert auf Dauer letztendlich nicht. Das machen die Menschen, die versichern sich zusätzlich privat damit sie überhaupt noch Gesundheitsleistung ich sag jetzt mal leisten können bzw. dass sie überhaupt Leistungen bekommen können. Also insofern ist eine Steuerfinanzierung, die dann vom Daumen hoch oder runter des Gesundheitsministers abhängig ist auf Dauer glaube ich keine gute Lösung, sondern wie sagt alles rausnehmen was nicht mit der eigentlichen Pflegeversicherung zu tun hat und da sich ehrlich machen und da sagen das zahlen das sind Steuersäckel. #00:43:24#
I: Alles klar danke schön. Dann die vorletzte Frage: Wäre es eine Lösung bzw. ist es umsetzbar das Kranken- und Pflegeversicherung in Präventionsmaßnahmen für zukünftige Pflegebedürftigkeit investieren, sodass Pflegeversicherung dann für weniger Nutzer zahlen müssen? Also Präventivemaß-// #00:43:48#
B3: Ja es ist grade in der Diskussion und hier könnte man beispielsweise den sogenannten Entlastungsbetrag aus Pflegegrad 1 für einsetzen daraus einem Präventionsbudget zu machen was dann genau dazu führen würde, dass man//Das ja hat die Adelheid Kuhlmey von der Charité ja auch in mehreren Publikationen und Studien gezeigt, was die Pflegebedürftigkeit nach hinten schieben kann. Und ich muss natürlich Prävention machen als dann ich erst mit 70 in der stationären Pflege sondern ich muss die Prävention quasi mit 60, 65 anlegen, los gehen und ich muss natürlich auch als Menschen im höheren Alter auch was dafür tun, das ist nicht damit getan, dass es jetzt irgendeiner im Gesetz schreibt sondern wenn ich eben selber mich nicht ja vorsorgend verhalte, kann ich noch so viel Geld da irgendwo reingeben in eine Maßnahme das kommt weil es zeigt keine Wirkung, aber wenn ich jemand sagen kann dein Leben wird besser würde dich mal vernünftig verhältst, dich mal ein bisschen bewegst nicht alleine zuhause vor dem Fernseher sitzt, sehr plakativ. Wir unterstützen das auch noch, wenn du dich auf dem Weg machst, könnte schon für einen Teil der Menschen eine tatsächliche Verschiebung dahin ermöglichen, was auch das gesamte System entlasten würde. #00:45:18#
I: Alles klar, joa vielen Dank, vielen Dank (...) dann die letzte Frage #00:45:27#
B3: Poah da kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen #00:45:30#
I: Ja welche konkreten Chancen die Digitalisierung im Bereich der stationären Pflege bietet, die zu einer Kostenreduktion führen könnte. Also das hatte ich auch schon mit// Also genau die Frage hatte ich auch schon mit anderen zwei Experten besprochen also da waren beide der Ansicht, dass es diverse Chancen gibt, also da gibt es keine Ahnung Sachen wie Robotik in der Pflege, die man einsetzen könnte, Telemedizin ad hoc fällt mir jetzt auch nicht gerade viel mehr ein, aber da würde ich auch z.B. sagen Verwaltungsaufwand reduzieren und so weiter. Würden sie das jetzt vom Prinzip her genauso sehen? #00:46:08#
B3: Ja, alles, was sie im Hintergrund machen können, aber das ist ja nicht nur stationär haben sie ja in jedem Unternehmen #00:46:15#
I: Ja natürlich, natürlich. Kann man in diversen Bereichen genauso einsetzen. Das Ding ist ich muss mich ja irgendwie auf stationär beschränken, weil das ja in meiner Bachelorarbeit das Thema ist, aber ja, wenn sie sagen, dass (...) lässt sich da irgendwie einrichten, kann Chancen bieten// Die Sache, die ich darin sehen würde, es würde natürlich dann ein großer Investitionsaufwand dann sein für die stationären Einrichtungen. #00:46:42#
83: Ja das müssen sie dann refinanzieren #00:46:45#
I: Jaja, aber (...) joa, ja gut. Müsste man natürlich in die Zukunft schauen usw. Das war dann tatsächlich die letzte Frage, ich beende an der Stelle auch die Aufnahme. #00:46:58#
Anhang 8.4: Experteninterview 4
Experteninterview 4
Interviewpartner: Person 4
Datum: 15.01.2025 um 11:00 Uhr
Ort: Microsoft Teams
00:00:00 - 00:38:41
I: Alles klar dann, Herr [Person 4] können Sie sich einmal kurz vor schon Ihre Funktion im Unternehmen beschreiben? #00:00:09#
B4: [Person 4] Mitglied des Vorstandes der Stiftung Liebenau. Die hat zwei Vorstände also außer mir noch eine (...) zugleich auch Vorstand der Stiftung Hospital zum heiligen Geist, das sind wir eine Schwesterstiftung der Stiftung Liebenau auch nochmal 1000 Mitarbeiter ungefähr also auch (nicht?) ganz klein und noch Vizepräsident einer italienischen Stiftung mit Sitz in (Booßen?). Jawoll, was gehört alles zu ihrem Aufgabenbereich? Ich mach das schematisch, funktio-// was die operativen Tätigkeiten anbelangt sind, insbesondere im Sozialbereich den ganzen internationalen Angelegenheiten und in Deutschland die Altenhilfe Angelegenheiten. Und funktional sind die Bereiche Recht, Kommunikation, Marketing, Politik, Ethik und einige ganz (unv.) weiterer Geschichten, interessante Aufgabengebiete, die auch noch dazugehören sind, das Thema Quartiersarbeit, mehr Generationenarbeit. Diese Geschichten sind bei mir auch angesiedelt (...) und eine Reihe weiterer soziale Aufgaben fällt aber von den ganz großen Punkten (unv.) #00:01:26#
I: Also sehr vielfältig, hört sich interessant an. #00:01:29#
B4: Jaja es ist//wir sind (unv.) Anteil so 10.000 Mitarbeiter ungefähr. Da haben wir (unv.) zusammen Tätigkeit bei uns zu finden. Auf der einen oder anderen Weise und insofern mache ich das immer so ein bisschen Kraft, weil (unv.) mehr Unklarheit schafft als Klarheit #00:01:47#
I: Verstehe verstehe. Aber jetzt mit der Pflegeversicherung da haben sie auch einen direkten Bezug jetzt mit ihrer Tätigkeit oder sie kennen sich einfach nur daran aus? Oder halt, ja// #00:01:59#
B4: Alle unsere Altenhilfegesellschaften sind mir zugeordnet, das heißt wir haben also jeweils einen eigenen Geschäftsführer in Deutschland und anderen Ländern, in denen wir Tätig sind und in Summe denke ich (unv.) ich überschlag mal so ganz kurz: drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, so ein Dutzend Altenhilfegesellschaften haben wir bei uns international #00:02:21#
I: Eine gute Zahl. Alles klar gut, vielen Dank dann die letzte Frage davon: wie lange sind sie dann schon bei der Stiftung da tätig? #00:02:30#
B4: Nächstes Jahr 25 Jahre und jetzt glaub ich im 23. Oder 24. Jahr Vorstand, also war ich die ganze Zeit Vorstand. #00:02:39#
I: Ah, sehr schön. Alles klar vielen vielen Dank, gut. Dann würde ich zur ersten
Interviewfrage kommen, und zwar zu einer potenziellen Pflege-Bürgerversicherung, hab insgesamt vier Fragen dazu. Die erste Frage, die dazu stellen würde, wäre: Halten sie in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen unseres Pflegesystems eine Umwandlung in eine einheitliche Pflege Bürgerversicherung mit einheitlichen Leistungen für eine sinnvollere Alternative und können sie ihre Antwort dazu begründen? #00:03:11#
B4: Also das Wort Bürgerversicherung ersetze ich für mich so, dass das Prinzip einer Verschmelzung gesetzlicher Pflegeversicherung und privater Pflegeversicherung beinhaltet, deshalb dieses politische Konzept so versteh ich das Bürgerversicherung, das heißt so wie im Krankenkassenbereich, wo es ja auch diskutiert wird also gesetzlichen Kassen und Privatkassen zusammen zu schmeißen auch im Pflegebereich das so zu diskutieren. Das halte ich nicht für eine Lösung, weil dann würde ich in beiden Versicherungsbereichen und die (unv.) Menschen die halt entsprechende Versicherungsanspruch haben und Notwendigkeiten also in der Summe ändert sich das nicht viel also in Summe sind also die privat versicherten ein Ticker besser verdienend als die gesetzlich Versicherten also es lieg am Prinzip eine minimalen Ausgleichs Effekt auf die Gesamtsumme, wenn wir und das jetzt (unv.) denken würde, wären die ganzen rechtlichen Fragestellungen hinten dran und die verfassungsrechtlichen Fragestellungen und den Eingriff in die Eigentumsrechte und so ein Scheiß, man darf (unv.) muss man das sich grundsätzlich so verunmöglicht oder auch für nicht wünschenswert macht, aber auch wenn man sich das theoretisch zu Ende denken würde, so fehlt da die Summe der Versicherten am Ende da und kein (Grund?) mehr (unv.) von der ganzen Angelegenheit #00:04:28#
I: Verstehe verstehe, alles klar vielen Dank. Ja ich habe auch schon mitbekommen, dass es vor allem auch rechtlich sehr sehr schwierig ist und auch sehr komplex das Thema ist und ja. Also die Meinungen waren da ein bisschen durchwachsen aber ja// #00:04:44#
B4: (Unv.) komplette Eigentumssystematiken, geschützte Eigentumsrechte sind heut schon am Ende also zu der jetzigen Verfasstheit in Deutschland wäre es also so sicher nicht umsetzbar, aber es wäre auch nicht wünschenswert am Ende (für halten?) #00:04:58#
I: Alles klar ja #00:05:00
B4: Es wird aber keine Lösung reinliefern, also es würde dieses Problem nicht im Zustand sehr verändern. #00:05:05#
I: Alles klar weiß Bescheid. Joa dann sie haben ja eigentlich im Wesentlichen schon alles gesagt, drei Fragen hätte ich aber dennoch dazu aufgeschrieben. Ich stell sie mal trotzdem vor na gut: Würden sie denn// #00:05:19#
B4: Ich lese grad die zweite Frage hier #00:05:21#
I: Ja. Genau also würden sie// (...) genau genau #00:05:29#
B4: Also die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze hatte einen ganz anderen Effekt auf die (Satzungssystematik?) also, weil das spült natürlich massiv mehr Geld in die Kassen rein also. Führt zu einer (unv.) Mehrbelastung für bestimmte Personengruppe vor allem für die, die weit über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen also, die dann entsprechend mehr belastet werden und entsprechend hier mehr Geld hineinspülen in die ganze Geschichte. Es hat einen positiven fiskalischen Effekt ob es positiv, wirtschaftlich oder gesellschaftspolitisch als positiv betrachten würde, weiß ich jetzt noch nicht so richtig müsste ich jetzt mal drüber (repetitiv?) nachdenken, also wäre ich zurückhaltend also. Ich kann beides// es kommt sicher die nächste Frage was halten sie für sinnvoll (...) aber der positive Effekt wäre da jedenfalls deutlich also an dieser Stelle (unv.). Fänden sie es sinnvoll, wenn man eine einheitliche PflegeBürgerversicherung mit einer Kapitaldeckung kombiniert, sodass private Pflege Versicherte ihre Altersrückstellungen beibehalten können und nun für alle Versicherten Altersrückstellungen gebildet werden können? Also wir hatten tatsächlich vor Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung es war eher Mitte der 90er Jahre zu Zeiten der Stiftung Liebenau damals für eine zumindest teilweise, mindestens teilweise Kapitaldeckung der Pflegeversicherung votiert seiner Zeit, weil es schon damals klar war, dass genau die Entwicklung so sein wird wie sie jetzt zu sehen sind also es ist keine Überraschung oder irgendetwas, sondern es war ja sicher reichte Arithmetik irgendwo. Deswegen war das damals schon (unv.) für die Stiftung für die Kapitalbindung also teilweise sie zu nutzen, aber leider verschlafen zurzeit in Deutschland wie manches andere auch. Aber es wäre sinnvoll gewesen. Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, weil (...) je früher man damit anfängt, desto wirkungsvoller wird die Sache natürlich. Hätte man vor 30 Jahren damit angefangen wäre es heute ein wirkungsvolles Instrumentarium (unv.) dauert es sehr lange bis es irgendeine Wirkung entfaltet also. Aber besser spät anfangen als nie #00:07:30#
I: Jaja man fängt// also meine Erfahrung so man fängt immer spät mit Lösungen an so in Deutschland #00:07:36#
B4: Zu spät, sehr spät also das Problem ist das in einer Demokratie, dass die aktuell Handelnden belastet werden und das ist so eine Aktion (man nimmt denen das weg?) Also man muss im Prinzip diejenigen, die das (opfern?) so ein Umlagesystem eigentlich finanzieren, weil es keinen (Kapital?) gibt aber gleichzeitig Kapital eben aufbauen, also ist man doppelt belastet für die (Ex-Handelnden?). Wenn man es aber nicht tut, werden die Künftigen noch mehr belastet werden also, aber die jeweils// die Generation, die jeweils am Drücker ist hat keine Lust eigentlich die Lasten auf jeden Zukünftigen zu tragen, da ja eben das Problem drin ist also. Eigentlich wäre es ein Gebot der moralischen Fairness, dass die heutige Generation also im Prinzip teilweise die Lasten aus der Zukunft schultert, tut sie aber nicht also (...) #00:08:22#
I: Joa #00:08:23#
B4: Aber könnte die Pflege-Bürgerversicherung von der Politik realistisch umgesetzt werden und wenn ja, wie? Nein, also das wäre meines Erachtens rechtlich also in unserem Verfassungsgefüge nicht darstellbar also und es würde sich zum jetzigen Zeitpunkt ja hoffentlich auch keine Mehrheit finden. #00:08:40#
I: So habe ich es auch irgendwie verstanden, dass es rechtliche Schwierigkeiten geben wird. Andere meinten, dass es möglich wäre, wenn es eine parlamentarische Mehrheit geben würde aber dann auf der anderen Seite hat es auch rechtliche Schwierigkeiten. Das, was ich bisher gehört habe. #00:08:53#
B4: (Hier geht’s nicht um groß sein?) die müsste verfassungsändern sein. Die Mehrheit also und Verfassungsänderung so etwas beizutreten, da eine Mehrheit in weiter Form glaube ich also, gehe ich da definitiv nicht in Sichtweite. Es würde zu einer radikalen Veränderung unseres gesamten (Gesellschaftssystem?) führen also. #00:09:13#
I: Ja verstehe. Na gut, das war alles zur Pflege-Bürgerversicherung. Ja komplex dann insgesamt. Na gut, dann zu privaten Vorsorgemodellen. Genau da wäre die erste Frage: Könnte eine Kombination betrieblicher und privater Altersvorsorge helfen die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile für den Versicherten finanzierbar zu machen oder eher für den Pflegebedürftigen? #00:09:39#
B4: Unbedingt ja, also bin ich ein großer Befürworter von Beidem. Ein Musterbeispiel ist die Schweiz das wird also insbesondere die betriebliche Altersversorgung viel stärker lange Zeit schon betrieben aber auch die private Altersversorgung wir habe das klassische sogenannte drei Säulenmodell es gibt öffentliche Altersversorgung es gibt private Altersversorgung und die betriebliche Altersversorgung und (die haben?) jeweils erhebliche Bedeutsamkeit in der Schweiz. In Deutschland haben sich Leute lange Zeit in der Masse auf die öffentliche Versorgung verlassen, was tatsächlich Quatsch ist, also, haben die Private vernachlässigt an vielen Teilen also und die betriebliche Altersversorgung ist also meines Erachtens (untertätig?) in Deutschland aus vielerlei Gründen raus. Hat mit verschiedenen Komponenten zu tun. Ließe sich ja politisch sehr wohl entwickeln meines Erachtens. Wir müssen als wirkliche Ziele verfolgen würde und wenn ich also halte ich Beides für sinnvoll und richtig #00:10:33#
I: Ah ok, alles klar alles klar. #00:10:37#
B4: Finden sie die Idee sinnvoll, dass alle Betriebe für ihre Mitarbeiter eigene Vorsorgefonds einrichten, wo jeder einen frei gewählten individuellen Beitrag einzahlen kann für seine zukünftige Altersvorsorge und welche möglichen Schwierigkeiten könnte es mit sich bringen? Würde ein Mindesteinzahlbetrag Sinn machen? #00:10:50#
I: Eigentlich ziemlich gleich die Frage. #00:10:52#
B4: Es ist tatsächlich eine Frage der Ausformung der betrieblichen Altersvorsorge. Ich halte es nicht für sinnvoll, wenn die Betriebe einen eigenen Vorsorgefonds einrichtet es wären viel zu großen Verwaltungsschwierigkeiten aber auch zu Fragen der Absicherung wie sollen Vorsorgefonds usw. Das ist technisch sehr schwierig, es ist aufwendig und mit vielen Preisen behaftet. Es gibt natürlich auch heute schon Unternehmungen in Deutschland die haben eigene Pensionsfonds. Es führte bei diesen alles zu Verunglücklichungen über diese Konstruktion also (...) viel sinnvoller ist es da tatsächlich aber das zu tun aber nicht aber alles selber tun. Mit einfachen Varianten, wie jetzt z.B. denen zu sagen: Okay wir haben Partnerunternehmen (unv.) oder eine Partnerschaft mit irgendein Versorgungsunternehmen z.B. eine Lebensversicherung was auch immer, Pensionsbogen was gibt es in der Art. Die sind auch reguliert in Deutschland also die sind auch entsprechend finde ich kontrolliert was Sicherheit und Standards angeht und anderen Kriterien, andere Dinge. Wir sind da, denn Regulierungen unterworfen. Also eine sichere Angelegenheit jedenfalls. Den kann man natürlich, das tun z.B. wir ja auch in manchen Bereichen aber wir haben da verschiedene Modelle. Da im Prinzip als Gehaltsbestandteil für die Mitarbeiter da jeder da was einzahlt und idealerweise tun es die Arbeitnehmer auch. Und das finde ich ist eine sehr gute Angelegenheit, total sinnvoll also. Leider, jetzt kommt das Leider. Wird es von den Mitarbeitern auf den Arbeitsmarkt wenig wertgeschätzt. Also die meisten Mitarbeiter schätzen es viel mehr die haben viel mehr Cash also verfügbar und schätzen es nicht, wenn da große Summen in irgendwelche Altersversorgungen reinfließen, also, es bringt keine Vorteile im Arbeitsmarkt, es ist (öde?) das muss man so sagen. Es wäre sehr wünschenswert es würde ja auch entsprechend auf den Arbeitsmarkt von den Mitarbeitern honoriert. Andere tun es aber nicht effektiv. Ein Beispiel: Wir haben ja verschiedene Versorgungssystematiken und so verschiedene Unternehmensgruppierungen, die wir da haben auch in Deutschland. Teilweise gleichzeitig nebeneinander, sodass man dann (den Arbeitsmarktbau?) dann vergleichen und beobachten können die Arbeitsmarkteffekte, also wir haben in Liebenau Hauptteil Hammer eine öffentliche Zusatzversorgungskasse die kostet uns rund 10% der Gehaltskosten nochmals drauf für den Arbeitgeber das ist richtig viel Asche. Das sind richtig große Summen über, die wir da reden also hohe Millionen Beträge. (...) So es bringt uns am Arbeitsmarkt maximal keine Nachteile sicher kein Vorteil gegenüber Gesellschaften, wo man dies in exorbitanten Systematiken nicht drinn haben also können wir so aus eigener Erfahrung berichten, das heißt er wird nicht wergeschätzt von den Mitarbeitenden und das ist ein Problem an der Geschichte. #00:13:40#
I: Ja, weil sowas ist eigentlich nicht so selbstverständlich das ist ja mehr was Soziales #00:13:45#
B4: Man könnte politisch flankierend weitere Anreize geschaffen werden im Sinne von Steuerbegünstigungen was auch immer also bisschen (unv.) es könnte ausgebaut werden, um hier auch die Anreize klarer zu sitzen auf beiden Seiten unternehmensseitig wie arbeitnehmerseitig, dass dann Interesse auf beiden Seiten da ist, also tatsächlich ein bisschen Systematiken einzuführen aber auch anzuwenden also auszubauen. Also notwendig und sinnvoll, ist es. #00:14:13#
I: Alles klar, alles klar. Na gut, was ich sonst aber noch gehört habe ist, dass es// also da gibt es das Eine mit der Akzeptanz oder der Wertschätzung. Andererseits jetzt Leute mit einem geringeren Einkommen, wenn die dann noch zusätzlich was einzahlen müssen, also da wäre dann die Akzeptanz noch geringer wahrscheinlich dann. #00:14:29#
B4: Das ist so, dass setzt voraus, dass man sich dann (irgendwann mal mühsam?) im eigenen Alltag durchkämpft, also keine Möglichkeiten sich auf die Zukunft was zurückzulegen, also das ist das Kernproblem an der Geschichte natürlich, ja ist so. #00:14:44#
I: Aber eigentlich hat das Potenzial? #00:14:46#
B4: (...) Ja, ja #00:14:49#
I: Alles klar, vielen Dank für ihre Antwort. Für ihre ausführliche Antwort. Joa das waren dann die beiden Fragen, dann direkt zum Generationenvertrag der PKV, war ja auch ein Konzept, um ja die Ausgaben der Pflegversicherungen in den Griff zu bekommen, und zwar da habe ich jetzt meine erste Frage zu: Könnte der Generationenvertrag in seinen Gestaltungsoption dazu führen, dass die Versicherten im Falle einer Pflegebedürftigkeit höhere Eigenanteile zahlen müssen wenn die Leistungsausgaben an den Beitragseinnahme angepasst werden würden? Also in dem Sinne also der Generationenvertrag da gibt es ja drei verschiedene Gestaltungsoptionen eine war ja, dass die Ausgaben sich in dem Maße entwickeln sollen, wie sich die Beitragseinnahmen auch entwickeln das quasi die Beitragseinnahmen geringer ausfallen dann wäre noch die Pflegeausgaben was die Leistungsausgaben geringer deswegen die Frage. #00:15:38#
B4: (...) Also ich hol jetzt mal aus: Also in Deutschland die Soziallandschaft hat da lange Zeit das diskutiert des sogenannte (unv.) -tausch in der Pflegeversicherung, haben sie sicher schon davon gehört, das heißt, dass die pflegebedürftigen Versicherten eigentlich immer dasselbe bezahlen und die öffentliche Seite spricht die Versicherungsseite auf der anderen Seite dann also (...) ich mache ihnen kurz an der Skizze deutlich, was ich ihnen sagen möchte (...). Das ist nicht so real, wie groß das ist aber (unv.) wir haben die mal höher mal tiefer irgendwo (unv.) und bisher schaut es so aus, dass unten dran sage ich mal bewegt es sich, wenn die Pflegeversicherung bestimmte Leistungen hatte und drüber halt damit offene Zahlen es ist mal mehr mal weniger. Und so tauscht es (unv.) also nein, also da bewegen wir uns noch (unv.) das Gleiche zahlen und die andere Seite soll über (unv.) finanzieren mal mehr, mal weniger also wir halten es von Liebenau für keine gute Idee das sind einige wenige (unv.) die wir da abwägen aus mehreren Gründen. Es würde zwingend dazu führen, wenn z.B. (stets Kombi Öl streiche?) und lange besteht also, das heißt der Staat muss mehr regulieren, (das System steuert?) und Bürger als Untertanen und von Obrigkeit verwaltet wird am Ende also. Jetzt haben wir hier mit dem (unv.) kein Grund mehr durch die Über- (unv.) stehen. Es würde dazu führen, dass die Preise vereinheitlicht werden, die Angebote vereinheitlicht werden und Lohnsteuern vereinheitlicht werden, das halten wir für völlig kontraproduktiv also #00:17:37#
I: Also jetzt das Konzept an sich meinen Sie? #00:17:40#
B4: Deswegen sind wir halt gegen dieses Konzept, also wir sind immer dafür gewesen, dass die Pflegeversicherung eine Teilkaskoversicherung ist keine Vollkaskoversicherung. Vollkaskoversicherung wäre zum einen nicht bezahlbar, wäre viel zu teuer. Zum andern jetzt auch Geldsteuerungsanreize für alle Beteiligten zum einen für die, die es nutzen also wenn es nichts kostet, wer nimmt es in Anspruch? Eh klar. Und zum andern aber auch für die Angebotsseite (sie wird steigen?) wird das Angebot von der öffentlichen Steuerung reguliert im Sinne von verknappt also. Das möglichst das Angebot knapp als möglich ist also, weil zusätzliches Angebot kostet zusätzliches Geld. Das ist dann die österreichische Spielvariante, die halte ich für sehr unschick also. (...) Deswegen sind wir immer für Teilkaskomentalität da kann man sich fragen: Wo liegt da die tatsächliche, sinnvolle Aufteilung zwischen öffentlicher Pflegeversicherung und privat? Als Unternehmen wird hier führen, dass momentan also das Gleiten mitgeht, und geführt wird mit der Kostensituation, dass die Relation ungefähr gleich bleiben also. Und dann unter sich (unv.) 50/50 öffentliche Kasse, privater Anteil. Faktisch die Frage, die sie stellen, natürlich wenn es// wir haben in der sozialpolitischen Wirtschaft das Problem wir schon riesige Kostenbelastungen von Unternehmungen, die dann Kosten (unv.). Wenn die Arbeitskosten steigen, wird die Produktionskosten in Deutschland teurer (unv.) da reden wir momentan ja, weil es einfach zu teuer wird in Deutschland und da ist der Hebel dran. Man kann die Kuh melken, dann kippt die halt vielleicht mal um die Kuh. Deswegen ist da aus meiner Sicht Sättigungsgrenzen, die massiv erreicht sind, was die Sozialversicherungskosten da anbelangt und deswegen wird es nicht dran vorbeiführen können als das die Eigenanteile steigen. (unv.), dass da viele Leute nicht mehr nach sind, diese Eigenanteile selber leisten zu können Klammer auf (unv.) Klammer zu, weil ein Vermögensanteil schon längst rechtzeitig an Kindern anteilig verschenkt und übergeben worden, was ein gängiges Modell in Deutschland ist, also. Das Haus wird halt frühzeitig auf die Kinder überschrieben dann ist es weg. Ist weder solidarisch noch moralisch noch sonst irgendwas, sondern ist (eben?) die Praxis. Und gleichzeitig (jammern?) als ob alles so teuer wäre also. #00:20:11#
I: Das ist halt leider das Ding ja. #00:20:14#
B4: Den Trieb bei uns in unserem System dann die öffentliche Sozialhilfe ein also, die werden (unv.) finanziert also so. Auch da muss man sich der tatsächlich sinnvollerweise verhalten (unv.) Gesundheitsbereiche. Das sind nur noch Grundrechnungen. Fragt sich die Krankenversicherung finanziert werden und alles Übrige und nicht mehr finanziert ist sicher schon (unv.) wieso. Im Gesundheitsbereich also. Es wird im Pflegebereich verzögert aber irgendwann vielleicht auch in diese Richtung sich entwickeln also wir setzen da kein (Feld und kein Heu?) davon in Liebenau, weil wir sagen von uns aus vorrangig ist z.B. viele unnützen Kosten reduzieren, die da sind und die Bürokratiekosten in dem ganzen Bereich Gesundheitsund Sozialwesen sind riesig. Also einer meiner Brüder ist Hausarzt und er sagt immer Folgendes zum Ärztebereich, dass (Anfänger?) in Deutschland weniger als die Hälfte der arbeitenden Ärzte an Patienten arbeiten. Die andere mehr als die Hälfte arbeitet in Kammern, Verbänden, Behörden, Versicherungen, Betrieb weiß es nicht mehr überall. Aber nicht an Patienten (unv.) Wer jemals Medizin studiert hat (unv.) nicht tun (unv.) ekelhaft. Ich spitze es etwas zu aber// und paar Beispiele, dass sie es mal nachvollziehen können. Guck wir haben jetzt viele Pflegeeinrichtungen vielleicht 80 Stück oder so nur Pflegeheime so nur für dieses Modell. Da kommt da in einem Pflegeheim (unv.) Datenschutzbehörde zur Datenschutzprüfung dieses einen Pflegeheimes mit vier Mann inklusive (Bemachtung?) also zwei Tagespreise zur Datenschutzprüfung dieses einen Pflegeheimes also diese vier Menschen könnten vielleicht auch was Produktiveres tun in ihren Leben also und sich vielleicht von 150 anderen Beispielen, die wir haben. Da wird Geld ohne Ende an allen Ecken haufenweise aus dem Eimer ausgekippt und keinen interessierts. Solange das geschieht, sage ich immer wir haben nicht zu wenig Geld, wir haben zu viel Geld im System also man müsste das sinnvoll einsetzen. #00:22:20#
I: Ja auf jeden Fall ja, da hatte ein anderer Experte auch eine ähnliche Ansicht, so dass das Geld für die falschen Sachen ausgegeben wird, ja. #00:22:29#
B4: Aber großflächig. #00:22:30#
I: Ja. #00:22:31#
B4: Da könnte ich ihnen jetzt einen dreistündigen Vortrag ohne Punkt und Komma und alles machen zum Thema. #00:22:36#
I: Ja ja würde auch glaub ich ein bisschen den Rahmen sprengen aber ja verstehe, würde auf jeden Fall// #00:22:42#
B4: Aber der Staat lässt zu (unv.) Macht ab, gibt zu (unv.) Macht ab. (unv.) also jeder der Macht hat da gibt’s eine ganz (unv.) von Führung, danach das ist der Hauptpunkt an der Geschichte dran. #00:22:53#
I: Ja das ist das Ding hier bei uns naja #00:22:57#
B4: Das ist das Ding. #00:22:59#
I: Na gut vielen Dank für die ausführliche Antwort, die zweite Frage. #00:23:04#
B4: Können die Kosten, die mit diesem Konzept nicht mehr von der Pflegeversicherung abgedeckt werden durch private Vorsorge wie z.B. Zusatzversicherung abgedeckt werden oder werden die Pflegebedürftigen immernoch zum Großteil auf Sozialhilfe angewiesen sein? Also tatsächlich ist es so, dass in Deutschland es ja Unterschiede sich darstellen. Im Süden, wo wir ja hier sitzen, also da ist der kleinere Teil, der auf Sozialhilfe angewiesen ist. Also der größere Teil macht etwa den privat aus der Tasche raus also. Jetzt wenn man da ins Ruhrgebiet schaut oder in andere Ecken Deutschlands uns bewegen, da sieht es anders aus. Da haben wir nämlich hohe Sozialhilfeanteile. Aber für uns sind die am Wachsen (unv.) etwa 15% Sozialhilfeempfänger in Einrichtungen hier (zulande?) in Süden Deutschlands, wobei nicht alle dann voll Sozialhilfe finanziert sind, sondern teilweise oft nur zum Teil Sozialhilfe finanziert also. Aber dieser Prozentsatz ist am Steigen auch im Süden Deutschlands also. (Unv.) 22% irgendwo wird das sein also. So und das Geschäft wird nicht ruhen natürlich nicht, weil wir müssen die Kommunen dann zahlen also. Dann hätten die Landkreise oder Städte oder wer immer dann hat der Sozialhilfeträger bei (Österreich?) kommunale Aufgaben in Deutschland. Und die plädieren ganz stark dafür, dass es entsprechend mehr Pläne (unv.) das sind dann Seiten der Kommunen also beim (unv.) Und natürlich halte ich es für sinnvoll also private Vorsorgemodelle also hier es abzumildern und tatsächlich gibt es jede Menge Möglichkeiten private Pflegeversicherungen, Zusatzversicherungen alles der Gleichen abzuschließen also total sinnvoll für den Einzelnen (unv.) dafür halten. Aber die Gesamtsystematik, die müssen da systemisch neu betrachtet werden und (meine?) dafür halten im Sinne einer Gesamtsystematik wie die Dinge ineinandergreifen. Ich habe es vorhin erwähnt also wird Vermögen von der älteren auf die jüngere Generation verschoben, die eigentlich auch sinnvollerweise dafür zur Verfügung stehen müsste Eigenvorsorge zu betreiben, für die eigenen Dinge aufzukommen also. Also die Lasten werden ständig sozialisiert in diesem Land und das ist// halte ich nicht für schick. Nehmen wir ein anderes Beispiel, um es mal deutlich zu machen. Gebäudeversicherung: Wir im Süden, wir haben früher eine staatliche Zwangsgebäudeversicherung, deswegen haben heute noch die aller meisten Menschen also ihre Gebäude versichert, weil es da sehr sehr warm. (Unv.) 94% aller Wohngebäude sind gebäudeversichert. Und andere Bundesländer wurde es nie der Fall, weil wir (unv.) eine Zwangsversicherung (unv.) aber ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen. Da haben wir ganz geringe oder viel geringere Versicherungsquoten, was die Gebäudeversicherung anbelangt. Dann kommt also irgendwie so eine Flutwelle oder ein (Unv.) oder ein Brand oder weiß wer was für (Unv.) des Lebens da alles gibt eben. (Bin?) kaputt, Vaterstaat müsste (unv.), weil ich bin ein Armer also brauche ich das Geld jetzt. Du musst mir das zahlen. Hättest längst versichern können also. Hat sich so die jährliche Beitragszahlung von so und so vielen 100.000€ gespart ja. Lasten werden sozialisiert, jetzt soll der Staat einspringen. Diese Fragestellungen müssen gesellschaftlich diskutiert werden (das ist wichtig?) gesellschaftlich als auch zum jetzigen Zeitpunkt auch in Zeit der Pflegeversicherungen und anderen Dingen. (Unv.) Aufgabe der Gemeinschaft, also es ist Aufgabe des Einzelnen, natürlich in Politik streitet man sich drum rum, weil es nicht (unv.) #00:26:31#
I: Ja. Ja auf jeden Fall #00:26:35#
B4: (...) Aber es ist wie gesagt, es wäre wünschenswert, sinnvoll und richtig. #00:26:44#
I: Alles klar ja. Also ich bin auch der Ansicht, dass es auf jeden Fall ein bisschen helfen würde also komplett die Sachen lösen wird es natürlich nicht dafür ist das ganze Ding viel zu komplex. #00:26:54#
B4: Es wäre ein Baustein und wir bewegen uns dann entsprechend auch politisch flankieren wird, dass es ins Laufen kommt, also (unv.). #00:27:07#
I: Na gut das wäre mal spannend zu sehen, wenn mal sowas umgesetzt wird, also sowas wie ein Generationenvertrag, also ich persönlich halte auch nicht sehr viel davon so aber wenn sowas umgesetzt wird dann mit diesen Zusatzversicherungen ob es dann einen Unterschied macht naja #00:27:22#
B4: Und ich (unv.) sie mal vor, wer vor 30 Jahren vertreten hatte, also schon lange her also ich glaub, dass die heute (unv.) die waren hier für viele Stellen natürlich also ist die also. Warum soll ich (ein bisschen?) meines Vermögens aufbrauchen also im Sinne mein Haus, mein Häuschen? Das will ich doch lieber meinen Kindern vermachen da. Wenn ich da genau die gleiche Leistung bekomme, wie derjenige der bisher nie was auf die Seite gelegt hat, also öffentlich von der Sozialhilfe finanziert wird, bekommt genau die gleiche Leistung also (unv.) das ist nicht motivierend das System also. Die Qualität sollte es vorgeben, da hat er denke ich recht einfach mit dieser Sichtweise. Die Motivation fehlt da einfach. Aber man sollte es nutzen können. Der Mensch ist sehr nutzenorientiert an den Dingen. Und wenn er viel zahlt, möchte er auch sehen, das bringt ihn irgendwas. #00:28:12#
I: Ja auf jeden Fall, auf jeden Fall #00:28:14#
B4: Ja #00:28:15#
I: Ich meine die Pflegeversicherung, das ist für jeden einheitlich so egal wie Einkommen ist, jeder kriegt die gleichen Leistungen. #00:28:21#
B4: Ob du was zahlst oder nicht (ist egal?) oder was gespart hast oder nicht völlig egal, am Ende kriegst du, wenn irgendwas ist (unv.) #00:28:30#
I: Ja genau, genau. Ist sehr sehr schwierig so, ja. #00:28:33#
B4: Ist ein Problem einfach. #00:28:34#
I: Ist aber auch auf jeden Fall schwierig zu lösen, ich weiß auch nicht, naja. Na gut, sind auch schon fast durch. Ich komm dann zu den letzten drei Fragen, also zu eher kleineren Anpassungen sage ich jetzt mal. Da wäre die erste Frage: Sollte die Pflegefinanzierung mit einer Steuerfinanzierung ergänzt werden und würde dies allein schon einen Unterschied machen ausmachen? Sowas ähnliches wie in der Krankenversicherung, dass was in den Gesundheitsvorsorgefonds eingeführt wird. #00:29:02#
B4: Meines Wissens also ich bin mir ziemlich sicher, dass sind heute schon hohe Summen, die von der Steuer rein in die Pflege reinfließen #00:29:09#
I: Habe ich auch schon mitbekommen #00:29:11#
B4: Und zwar deswegen, weil Väterchen Staat auch laufend Ausgaben beschließt, die mit Versicherungsbauten nichts zu tun haben. Also sowas (unv.) derjenige der da nicht reinbezahlt hat. Soll die Versicherungsleistung bekommen. Eine Versicherung heißt was anderes. Wer darin bezahlt, bekommt irgendwann auch was, also so ist Versicherung. Versicherungsprinzip. Das Versicherungsprinzip ist da schon längst abhängig (unv.) drum zahlt auch Väterchen Staat da viel Geld rein also in all diese Sozialversicherungssysteme, am meisten in die sogenannte Rentenversicherung. Zur Rentenversicherung sind 30% des gesamten Bundeshaushaltes per annum. 120, 129 Milliarden in diesem Jahr. Das sind 30% des gesamten Bundeshaushaltes. (Nur mit dem?) Zuschuss zur Rentenversicherung. (Unv.) Ich weiß, dass die Zahlungen zu den Kranken- und Pflegeversicherungen jetzt nicht// die sind kleiner, aber die sind auch (unv.) sind heute schon massiv also #00:30:08#
I: Verstehe (...) naja. #00:30:12#
B4: Also versicherungslogisch da in der (unv.) sehr eingeschränkt mit der ganzen Systematik da, mit den gesetzlichen Versicherungen also bei den normalen Versicherungen, wir nehmen mal dieses Beispiel an privaten Gebäudeversicherungen. Ich kann das mal zeigen ob das Haus zu 300.000, 500.000 oder 700.000 versichern möchte, also entsprechend zahle ich dann mehr oder weniger Beitrag dann also so rum. Das wäre eine Versicherungslogik. Wir haben eine Versicherungslogik, wenn es nicht so eine Art Sozialsteuer ist, weil wir entwickeln, hier noch das, was rauskommt. #00:30:42#
I: Ja #00:30:43#
B4: Versicherung funktioniert leider anders also grundsätzlich, aber es gibt besseres. Sozialsystem klingt besser als Sozialsteuer. #00:30:52#
I: Ja hier wird alles komplizierter gemacht als es sein muss, naja #00:30:59#
B4: Ist es umsetzbar, dass Kranken- und Pflegeversicherung in Präventionsmaßnahmen für zukünftige Pflegebedürftigkeit investieren, sodass die Pflegeversicherung für weniger Nutzer zahlen muss? Das ist umsetzbar, das ist total sinnvoll, das ist wünschenswert und es ist eigentlich gesetzlich jetzt schon gegeben es wird nur nicht umgesetzt also. Und wird nicht umgesetzt, (derweil?) liegt schon ein bestimmter Prozentsatz, ich glaub es sind 0,6% der Beitragssummen, die genau dafür zu Verfügung gestellt werden sollten sein aus der Pflegekasse also. #00:31:26#
I: Das höre ich zum ersten Mal #00:31:28#
B4: Sie können es nachlesen irgendwo also ich glaube die 0,6 ist die Größenordnung ungefähr. Ist ja schon ganz schön Menge Geld, wenn (unv.) was so reinfließt, also ja schonmal was für den Anfang. Es geschieht aber meines Wissens nicht also, weil wir selber machen auch solche Dinge, die könnten genau aus sowas finanziert werden Quartierskonzepte, Präventionskonzepte (diese Art von Volkswirtschaft?) ist super sinnvoll, momentan wird es von niemanden bezahlt und drum wird es auch nicht richtig gemacht, ganz einfach also so. Aber würde die Volkswirtschaft nicht mit der Gesellschaft insgesamt da sehr viel Geld sparen (unv.) da man natürlich auch sehr vieles abfangen könnte, wenn man es richtig gemacht hätte und fügig könnte man da breitflächig viele Leute erreichen usw. also. Da gibt es viele Modelle dazu (unv.) auch vieles in den Bereich (...) also es wäre super sinnvoll das auszubauen um da unten von dieses jetzige, was gesetzlich schon jetzt gegeben ist, gesetzlich einfach mal umzusetzen also. Da mach ich halt eine Umsetzung. #00:32:29#
I: Ja es ist dann immer die Praxis bei sowas, die dann irgendwie ein bisschen mangelt.
Ich denke auch dass es wahrscheinlich helfen würde es hängt aber ein bisschen auch von den Leuten ab so wie die Akzeptanz da ist so die es dann fragen ok warum soll ich jetzt dies und das machen warum schlägt mir die Pflege- oder Krankenversicherung dies vor jetzt Präventionsmaßnahmen nicht gibt viel Geld aus #00:32:47#
B4: Ja also das ist ein generelles Thema, dass man wahrscheinlich nicht vor Augen hat (unv.) es gibt natürlich in dem Bereich, was Pflege und Pflegeprävention angeht natürlich auch Begleitung von Pflegebedürftigkeit. Inzwischen auch so viele gebrauchte Modelle, die wir bei uns (unv.) andere Generation haben. Als Zeitbeispiel Quartierskonzepte an unserem Beispiel. Wir haben Technikkombinationsgeschichten mit verschiedenen Modulen aus familiärer Hilfe, Nachbarschaftshilfe so, die allen daran kranken, dass es im Regelfall keine (Finanzierhilfe?) dafür gibt. Man kommt mit sehr viel weniger Geld relativ weiter mit diesen Konzepten also und das hat einen Wert also wird (betriebswirtschaftlich?) evaluiert das (unv.) an wissenschaftlichen Studien untersucht also das konnte nachgewiesen werden. Den Effekt gibt es tatsächlich also. Aber am Ende würde ich (unv.) #00:33:43#
I: (...) Ja #00:33:47#
B4: Ja #00:33:49#
I: Alles klar, alles klar. Na gut. #00:33:52#
B4: Welche konkreten Chancen bietet die Digitalisierung im Bereich der stationären Pflege, die zu einer Kostenreduktion und damit geringeren Ausgaben führen könnte? Ja da gibt es ganz konkrete Möglichkeiten, also die werden teilweise in (unv.) schon beginnend genutzt oder geprobt. Da geht es z.B. darum diese ganze Dokumentationslyrik, die man da so hat von ChatGPT oder anderen KI-Softwaren machen zu lassen. Das wäre grundsätzlich vorstellbar und das wird in einigen Jahren so der Fall sein da bin ich sehr überzeugt das wird so kommen also. Auch weitere Verwaltungsvorgänge in diesen ganzen Geschichten auch drum rum, also lass es sichere KI-Konzepte künftig denken auch da gibt es sicher Potenziale. In der eigentlichen Pflege also kann man bestimmte Betreuungsgeschichten sich denken. Da haben wir z.B. immer (unv.) aber in Wirklichkeit sind wir 10, 20, 30 weiterdenken, während sich da manches entwickelt. Wir haben da so einen kleinen laufenden Humanoid-Roboter in eine Pflegeeinrichtung geschickt mit großen Kulleraugen und der hat dann die Möglichkeit dann einen Tag Kommunikation zu tätigen also. „Wie geht es dir heute? Ach, mir geht es gut, wie geht’s die? Ach, mir geht es auch gut.“
Also das hatten wir sag ich mal, hat einen Betreuungseffekt im Sinne von Kommunikation und unsere Erfahrung war ganz entspannt. Die Leute lieben lieber so eine Kommunikation als gar keine Kommunikation also so. Also solche Dinge kann man da sicher, also es ist zeitnah. Also das ist jetzt nicht in (Sonnen, Galaxien?), sondern das erleben wir (medial?) glaub ich. #00:35:38#
I: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube auch dass es// #00:35:32#
B4: (unv.), dass es in dem Bereich denkbar ist, also. Dann gibt es natürlich auch solche wie (unv.) das nennt sich (unv.) -assisted living. Das sind Sensortechnologien z.B. und alles Mögliche, wo man ohne direkte Überwachungssystematiken aber mit den Leuten z.B. aus Sensortechnologien, Bewegungs- (unv.) nachvollziehen kann. Also normalerweise steht da nachts zwei oder drei Mal auf Toilette, es ist jetzt nicht (unv.) Da ist jetzt was passiert und damit muss ich mich mal auseinandersetzen und solche Dinge. Bei meinen häuslichen (unv.) Komplex auch einsetzen (...) und das gibt es auch schon bei uns also das haben wir auch schon im Einsatz also. Das ist nicht nur Verprobung sondern auch schon im Einsatz solche Dinge, Modelle. Oder jemand stürzt also und wenn kein Notruf abgesetzte wird bestimmte KI-Softwaren werden also mit Sensortechnologie. Also der Mensch stürzt, steht nicht mehr auf, atmet, Notfallsituation kann Notruf abgesetzt werden gibt es auch schon solche Sachen und solche Dinge da gibt es große Entwicklungen, die meines Erachtens dazu führen können und werden, dass vor allem im vorstationären Bereich, im häuslichen Umfeld Leute länger verbleiben können und (unv.) Druck auf das System in stationären Einrichtungen usw. trotzdem bestehen bleiben, zumal auch die ambulanten Dienste also am Anschlagen sind und auch da ist viel Überlastungssituation (unv.) Kleine Anekdote also das ist jetzt nicht wirklich zitierfähig also im Sinne aber (unv.) zitieren sie es eh nicht. (unv.) Und (unv.) wir sind doch keine Bananenrepublik, sage ich (unv.) kommt man eigentlich nur mit Beziehungen bei uns, ohne Beziehung kein Pflegeplatz und das ist für mich stets eine Bananenrepublik. Sagt wir sind doch keine Bananenrepublik sagt Herr Schneider. Doch eben schon wir sind schon eine Bananenrepublik geworden also (...) also und wir sind am Anfang der Entwicklung (...) ja die Digitalisierung da gibt es Chancen, die werden das System nicht retten aber sie werden Entlastungen (unv.) #00:38:09#
I: Ja es ist sehr sehr vielfältig. Das eine kann funktionieren das andere vielleicht auch nicht ja. Was man auf jeden Fall weiß ist wir liegen in der Digitalisierung im Vergleich zu anderen Ländern ein bisschen hinterher, ja müssten da aufholen #00:38:21#
B4: Also zum Schluss würde ich ein paar allgemeine Anmerkungen hinzufügen, für mich (unv.) #00:38:29#
I: Bitte was? #00:38:30#
B4: (unv.) noch nicht gestellte Fragen beantworten. #00:38:34#
I: (...) War eigentlich nicht vorgesehen. Ich beende mal ganz kurz die Aufnahme, weil ich glaube alle Fragen wurden schon gestellt. #00:38:41#
Anhang 9: Kodierleitfaden
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Vgl. Simon, 2021, S. 267
2 Vgl. Kochskämper, 2019, S. 3
3 Vgl. Augurzky et al., 2006, S. 13
4 Vgl. Augurzky et al., 2006, S. 21
5 Vgl. §71 Absatz 2 SGB XI
6 Vgl. Simon 2021, S. 279
7 Vgl. §42 Absatz 2 Satz 1 SGB XI
8 Vgl. §42 Absatz 1 SGB XI
9 Vgl. Hackmann et al., 2016, S. 33
10 Vgl. Hackmann et al., 2016, S. 33
11 Vgl. ebenda, S. 33
12 Vgl. §14 Absatz 1 SGB XI
13 Vgl. Kochskämper, 2019, S. 21
14 Vgl. Simon, 2021, S. 274 f.
15 Vgl. §43 Absatz 2 SGB XI
16 Vgl. §43 Absatz 2 SGB XI
17 Vgl. §43 Absatz 3 SGB XI
18 Vgl. §41 Absatz 2 SGB XI
19 Vgl. §42 Absatz 2 Satz 1 SGB XI
20 Vgl. Simon, 2021, S. 270
21 Vgl. Kohlhoff, 2017, S. 4 f.
22 Vgl. §12 SGB I
23 Vgl. §1 Absatz 3 SGB XI
24 Vgl. Möller, 2022, S. 47
25 Vgl. Simon, 2021, S. 278
26 Vgl. Möller, 2022, S. 4
27 Vgl. Kohlhoff, 2017, S. 3
28 Vgl. §1 Absatz 6 Satz 1 SGB XI
29 Vgl. §226 Absatz 1 Nr. 1 SGB V
30 Vgl. §226 Absatz 1 Nr. 2 SGB V
31 Vgl. §55 Absatz 1 und 3 SGB XI
32 Vgl. §55 Absatz 1 SGB XI
33 Vgl. Möller, 2022, S. 189 f.
34 Vgl. Kohlhoff, 2017, S. 6
35 Vgl. ebenda, S. 6
36 Vgl. ebenda, S. 4
37 Vgl. ebenda, S. 4
38 Vgl. Meissner, 2022, S. 61
39 Vgl. ebenda, S. 62
40 Vgl. ebenda, S. 62
41 Vgl. Verbraucherzentrale, Zugriff: 06.10.2024
42 Vgl. §43c SGB XI
43 Vgl. §§1601 ff BGB.
44 Vgl. §94 Absatz 1 und 1a SGB XII
45 Vgl. §1 DVO zu §90 Absatz 2 Nr. 9 SGB XII
46 Vgl. Verbraucherzentrale, Zugriff: 06.10.2024
47 Vgl. Bpb, Zugriff: 08.10.2024
48 Vgl. §1 Absatz 2 SGB XI
49 Vgl. Die Bundesregierung informiert, Zugriff: 07.10.2024
50 Vgl. Die Bundesregierung informiert, Zugriff: 07.10.2024
51 Vgl. ebenda, Zugriff: 07.10.2024
52 Vgl. Möller, 2022, S. 165
53 Vgl. Verband der privaten Krankenversicherung, 2019, S. 5
54 Vgl. Simon, 2021, S. 290
55 Vgl. ebenda, S. 3
56 Vgl. Verband der privaten Krankenversicherung, 2019, S. 5
57 Vgl. Simon, 2021, S. 290 f.
58 Vgl. Hanf, 2011, S. 272
59 Vgl. Kohlhoff, 2017, S. 100
60 Vgl. ebenda, S. 103
61 Vgl. Caritas Krefeld, Zugriff 09.10.2024
62 Vgl. Moos/Schneider, 2019, S. 107
63 Vgl. ebenda, S. 108
64 Vgl. Kohlhoff, 2017, S. 108
65 Vgl. Vaubel, 2019, S. 116 f.
66 Vgl. Kohlhoff, 2017, S. 72 f.
67 Vgl. ebenda, S. 73
68 Vgl. Simon, 2021, S. 267 f.
69 Vgl. ebenda, S. 268
70 Vgl. BMG, Zugriff 22.10.2024
71 Vgl. §70 Absatz 1 SGB XI
72 Vgl. Statistisches Bundesamt, Zugriff: 23.10.2024
73 Vgl. Statista, Zugriff: 23.10.2024
74 Vgl. Gasch, 2022, S. 9
75 Vgl. Statista, 2024, Zugriff: 24.10.2024
76 Vgl. Statistisches Bundesamt, Zugriff 27.10.2024
77 Vgl. Statista, Zugriff 27.10.2024
78 Vgl. Statista, Zugriff: 27.10.2024
79 Vgl. ebenda, Zugriff: 27.10.2024
80 Vgl. PKV-Service Portal, 27.10.2024
81 Vgl. §70 Abs. 1 SGB XI
82 Vgl. Bahnsen, 2024, S. 2
83 Vgl. ebenda, S. 2
84 Vgl. Bahnsen, 2024, S. 3
85 Vgl. ebenda, S. 3
86 Vgl. Rischard, 2019, S. 185
87 Vgl. ebenda, S. 186
88 Vgl. BMG, 2017, S. 7
89 Vgl. Moeller-Bruker et al., 2019, S. 162
90 Vgl. Rischard, 2019, S. 200
91 BMBF, 2000, S. 8
92 Vgl. Blüher/Kuhlmey, 2023, S. 332
93 Vgl. ebenda, S. 333
94 Vgl. statistisches Bundesamt, Zugriff: 01.11.2024
95 Vgl. Statistisches Bundesamt, Zugriff: 01.11.2024
96 Vgl. ebenda, Zugriff: 01.11.2024
97 Vgl. ebenda, Zugriff: 01.11.2024
98 Vgl. PKV, Zugriff: 01.11.2024
99 Vgl. ebenda, Zugriff: 02.11.2024
100 Vgl. PKV, Zugriff: 02.11.2024
101 Vgl. Simon, 2021, S. 49
102 Vgl. Simon, 2021, S. 49
103 Vgl. Herborth, 2014, S. 92
104 Vgl. BMG, Zugriff: 04.11.2024
105 Vgl. ebenda, Zugriff: 07.11.2024
106 Vgl. Herborth, 2014, S. 86
107 Vgl. BMG, 2015, S. 3
108 Vgl. ebenda, S. 3
109 Vgl. ebenda, S. 3
110 Vgl. BMG, Zugriff: 05.11.2024
111 Vgl. ebenda, Zugriff: 05.11.2024
112 Vgl. Brinkmann/Bienentreu, 2018, S. 802
113 Vgl. Bahnsen/Raffelhüschen, 2019, S. 29
114 Vgl. ebenda, S. 29
115 Vgl. BMG, Zugriff: 07.11.2024
116 Vgl. BMG, Zugriff: 07.11.2024
117 Vgl. ebenda, Zugriff: 07.11.2024
118 Vgl. Statista, Zugriff: 07.11.2024
119 Vgl. AOK, Zugriff: 06.11.2024
120 Vgl. Kochskämper, 2020, S. 3
121 Vgl. AOK, Zugriff: 06.11.2024
122 Vgl. ebenda, Zugriff: 06.11.2024
123 Vgl. ebenda, Zugriff: 06.11.2024
124 Vgl. Evans, 2018, S. 9
125 Vgl. Ludwig/Evans, 2020, S. 2
126 Vgl. BMAS, Zugriff: 20.11.2024
127 Vgl. AOK, Zugriff: 07.11.2024
128 Vgl. Meisner/Schrehardt, 2022, S. 68
129 Vgl. ebenda, S. 68
130 Vgl. Meisner/Schrehardt, 2022, S. 70
131 Vgl. BIVA, Zugriff: 19.11.2024
132 Vgl. ebenda, Zugriff: 19.11.2024
133 Vgl. ebenda, Zugriff: 19.11.2024
134 Vgl. AOK, Zugriff: 07.11.2024
135 Vgl. ebenda, Zugriff: 07.11.2024
136 Vgl. Kochskämpfer, 2020, S. 1
137 Vgl. Kochskämpfer, 2020, S. 3
138 Vgl. AGVP, Zugriff: 10.11.2024
139 Vgl. ebenda, Zugriff: 10.11.2024
140 Vgl. Curacon, Zugriff: 10.11.2024
141 Vgl. Lünger, 2020, S. 210
142 Vgl. ebenda, S. 211
143 Vgl. Rothang/Domshof, 2019, S. 37
144 Vgl. Rothang/Domshof, 2019, S. 11
145 Vgl. BMAS, Zugriff: 21.11.2024
146 Vgl. Verbraucherzentrale, Zugriff: 21.11.2024
147 Vgl. BaFin, Zugriff: 21.11.2024
148 Vgl. Verbraucherzentrale: 21.11.2024
149 Vgl. Bundesfinanzministerium, Zugriff: 21.11.2024
150 Vgl. ebenda, Zugriff: 21.11.2024
151 Vgl. PKV, 2024, S. 2
152 Vgl. ebenda, S. 7
153 Vgl. ebenda, S. 7
154 Vgl. ebenda, S. 7
155 Vgl. PKV-Serviceportal, Zugriff: 22.11.2024
156 Vgl. BMG, Zugriff: 21.11.2024
157 Vgl. AOK, Zugriff: 21.11.2024
158 Vgl. Stiftung ZQP, Zugriff: 22.11.2024
159 Vgl. Holderried et al., 2017, S. 3
160 Vgl. ebenda, S. 6
161 Vgl. Bleses et al., 2017, S. 224 f.
162 Vgl. Mischak/Ranegger, 2017, S. 96 f.
163 Vgl. Mayring, 2022, S. 15
164 Vgl. ebenda, S. 31 f.
165 Vgl. Mayring, 2022, S. 104
166 Vgl. ebenda, S. 84
167 Das „#“ Zeichen steht für die jeweilig Nummer der Personen in der Anonymisierung
168 Vgl. Mayring, 2022, S. 66
169 Vgl. ebenda, S. 33
170 Vgl. ebenda, S. 63
171 Vgl. Mayring, 2022, S. 98
172 Vgl. Person 1, Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
173 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
174 Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
175 Person 1, Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
176 Vgl. Person 4, Experteninterview 4, 15.01.2024, siehe Anhang 8.4
177 Vgl. Person 1, Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
178 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
179 Vgl. Person 4, Experteninterview 4, 15.01.2024, siehe Anhang 8.4
180 Vgl. Person 1, Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
181 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
182 Person 3, Experteninterview 3, 03.01.2025, siehe Anhang 8.3
183 Vgl. Person 1, Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
184 Person 4, Experteninterview 4, 15.01.2025, siehe Anhang 8.4
185 Vgl. Person 1, Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
186 Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
187 Vgl. Person 4, Experteninterview 4, 15.01.2025, siehe Anhang 8.4
188 Person 3, Experteninterview 3, 03.01.2025, siehe Anhang 8.3
189 Person 3, Experteninterview 3, 03.01.2025, siehe Anhang 8.3
190 Person 3, Experteninterview 3, 03.01.2025, siehe Anhang 8.3
191 Person 1, Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
192 Person 1, Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
193 Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
194 Vgl. Person 3, Experteninterview 3, 03.01.2025, siehe Anhang 8.3
195 Vgl. Person 4, Experteninterview 4, 15.01.2024, siehe Anhang 8.4
196 Person 1, Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
197 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
198 Person 3, Experteninterview 3, 03.01.2025, siehe Anhang 8.3
199 Vgl. Person 3, Experteninterview 3, 03.01.2025, siehe Anhang 8.3
200 Vgl. Person 4, Experteninterview 4, 15.01.2024, siehe Anhang 8.4
201 Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
202 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
203 Vgl. Person 1, Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
204 Person 1, Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
205 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
206 Vgl. Person 3, Experteninterview 3, 03.01.2025, siehe Anhang 8.3
207 Person 4, Experteninterview 4, 15.01.2024, siehe Anhang 8.4
208 Vgl. Person 4, Experteninterview 4, 15.01.2024, siehe Anhang 8.4
209 Person 1, Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
210 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
211 Vgl. Person 3, Experteninterview 3, 03.01.2025, siehe Anhang 8.3
212 Person 4, Experteninterview 4, 15.01.2024, siehe Anhang 8.4
213 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
214 Vgl. Person 4, Experteninterview 4, 15.01.2024, siehe Anhang 8.4
215 Vgl. Person 1 Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
216 Vgl. Person 3, Experteninterview 3, 03.01.2025, siehe Anhang 8.3
217 Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
218 Vgl. Person 3, Experteninterview 3, 03.01.2025, siehe Anhang 8.3
219 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
220 Vgl. Person 1, Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
221 Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
222 Vgl. Person 3, Experteninterview 3, 03.01.2025, siehe Anhang 8.3
223 Person 4, Experteninterview 4, 15.01.2024, siehe Anhang 8.4
224 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
225 Vgl. Person 1 Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
226 Person 1 Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
227 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
228 Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
229 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
230 Vgl. Person 1 Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
231 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
232 Vgl. Person 4, Experteninterview 4, 15.01.2024, siehe Anhang 8.4
233 Vgl. Rothang/Domshof, 2019, S. 11
234 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
235 Vgl. Person 1 Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
236 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
237 Vgl. Person 1 Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
238 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
239 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
240 Vgl. Person 3, Experteninterview 3, 03.01.2025, siehe Anhang 8.3
241 Vgl. Person 1 Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
242 Vgl. Person 3, Experteninterview 3, 03.01.2025, siehe Anhang 8.3
243 Vgl. Person 4, Experteninterview 4, 15.01.2024, siehe Anhang 8.4
244 Vgl. Person 4, Experteninterview 4, 15.01.2024, siehe Anhang 8.4
245 Vgl. Person 1 Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
246 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
247 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
248 Vgl. Person 3, Experteninterview 3, 03.01.2025, siehe Anhang 8.3
249 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
250 Vgl. Person 4, Experteninterview 4, 15.01.2024, siehe Anhang 8.4
251 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
252 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
253 Vgl. Person 1 Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
254 Vgl. Person 1 Experteninterview 1, 16.12.2024, siehe Anhang 8.1
255 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
256 Vgl. Person 2, Experteninterview 2, 27.12.2024, siehe Anhang 8.2
Details
- Titel
- Finanzierung in der stationären Altenpflege. Herausforderungen und Lösungsansätze
- Hochschule
- Fachhochschule Koblenz - Standort RheinAhrCampus Remagen
- Autor
- Desmond Ekpenisi (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2025
- Seiten
- 157
- Katalognummer
- V1563951
- ISBN (Buch)
- 9783389118894
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Pflege Finanzierung Herausforderungen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 46,99
- Arbeit zitieren
- Desmond Ekpenisi (Autor:in), 2025, Finanzierung in der stationären Altenpflege. Herausforderungen und Lösungsansätze, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1563951
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-