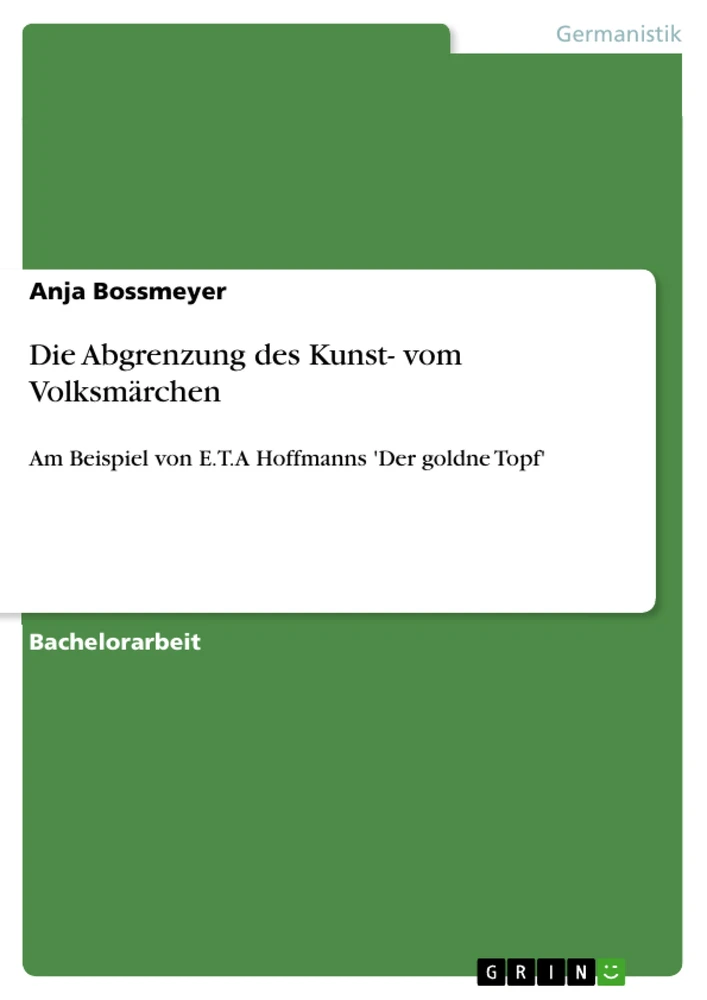
Die Abgrenzung des Kunst- vom Volksmärchen
Bachelorarbeit, 2009
41 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Abgrenzung des Volks- vom Kunstmärchen
- 2.1 Definitorische Abgrenzung des Volks- vom Kunstmärchen
- 2.2 Die wichtigsten Merkmale des Volksmärchens
- 2.3 Der goldne Topf Ein Kunstmärchen?
- 2.3.1 Märchenkonzeption und Sprache
- 2.3.2 Die Handlungsstruktur
- 2.3.3 Ironie und Humor
- 2.3.4 Der Mythos im Märchen – romantische Naturphilosophie
- 2.3.5 Lesarten und selbstreferentielle Intertextualität
- 2.3.6 Identifikation
- 2.4 Die Kunstmärchen als heterogene Gattung
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert E.T.A. Hoffmanns „Der goldne Topf“ im Hinblick auf seine Gattungszugehörigkeit. Sie untersucht, ob das Werk als Kunstmärchen oder Volksmärchen einzuordnen ist und beleuchtet dabei die Merkmale beider Gattungen. Darüber hinaus wird geprüft, ob „Der goldne Topf“ auch als (Märchen)novelle verstanden werden kann.
- Untersuchung der definitorischen Abgrenzung zwischen Volks- und Kunstmärchen
- Analyse der Merkmale des Volksmärchens und ihre Anwendung auf „Der goldne Topf“
- Beurteilung, ob „Der goldne Topf“ als Kunstmärchen einzuordnen ist, unter Berücksichtigung von Konzeption, Sprache, Handlungsstruktur, Ironie, Humor, Mythos und Identifikation
- Diskussion der Heterogenität der Gattung Kunstmärchen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Gattungszugehörigkeit von „Der goldne Topf“. Es wird auf die historischen und theoretischen Hintergründe der Unterscheidung zwischen Volks- und Kunstmärchen eingegangen. Das zweite Kapitel beleuchtet die Abgrenzung beider Gattungen anhand von Definitionen, Merkmalen und Beispielen. Dabei wird auch auf die Besonderheiten von Hoffmanns Werk im Kontext der Kunstmärchen diskutiert. Die Kapitel 2.1 und 2.2 befassen sich mit den definitorischen Grundlagen und den typischen Merkmalen des Volksmärchens. Kapitel 2.3 analysiert „Der goldne Topf“ im Hinblick auf seine Eignung als Kunstmärchen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Konzeption, Sprache, Handlungsstruktur, Ironie, Humor, Mythos und Identifikation betrachtet. Kapitel 2.4 widmet sich der Heterogenität der Gattung Kunstmärchen und diskutiert die Schwierigkeiten einer eindeutigen Gattungsdefinition.
Schlüsselwörter
Volksmärchen, Kunstmärchen, E.T.A. Hoffmann, Der goldne Topf, Gattung, Definition, Merkmale, Konzeption, Sprache, Handlungsstruktur, Ironie, Humor, Mythos, Identifikation, Heterogenität, (Märchen)novelle
Details
- Titel
- Die Abgrenzung des Kunst- vom Volksmärchen
- Untertitel
- Am Beispiel von E.T.A Hoffmanns 'Der goldne Topf'
- Hochschule
- Universität Osnabrück
- Note
- 1,3
- Autor
- Anja Bossmeyer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 41
- Katalognummer
- V157238
- ISBN (Buch)
- 9783640702848
- ISBN (eBook)
- 9783640702862
- Dateigröße
- 642 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Abgrenzung Kunst- Volksmärchen Beispiel Hoffmanns Topf Thema Märchen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anja Bossmeyer (Autor:in), 2009, Die Abgrenzung des Kunst- vom Volksmärchen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/157238
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









