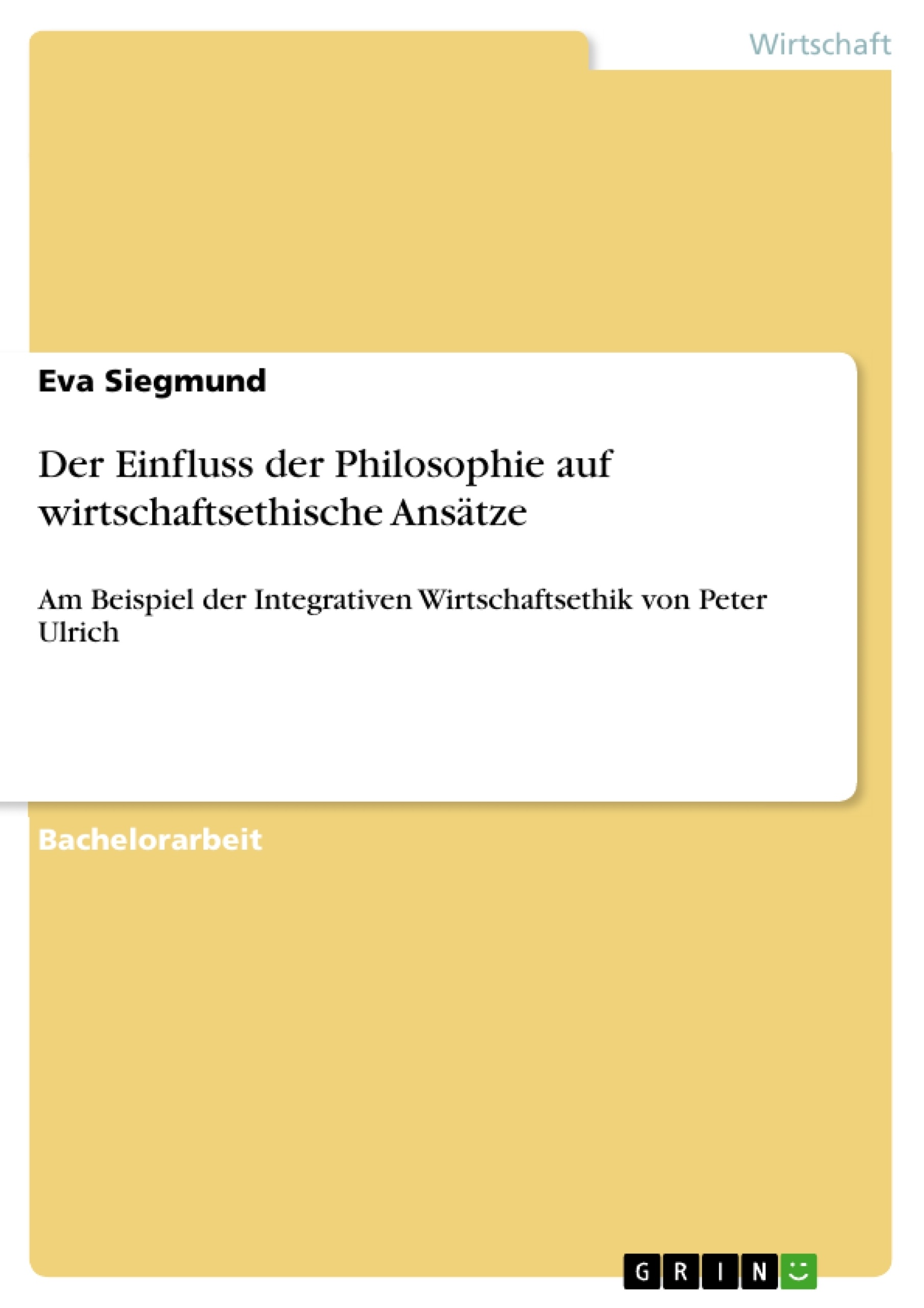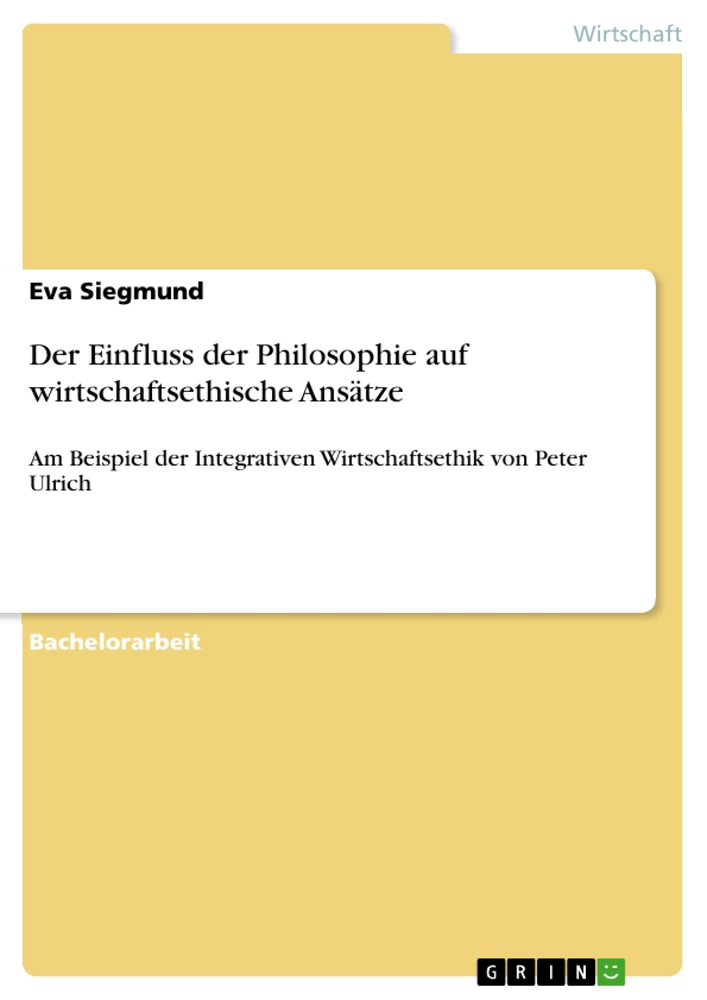
Der Einfluss der Philosophie auf wirtschaftsethische Ansätze
Bachelorarbeit, 2009
29 Seiten, Note: 1,8
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wirtschaftsethische Theorieansätze
- Unternehmensethik nach Horst Steinmann und Albert Löhr
- Ökonomische Ethik nach Karl Homann
- Integrative Unternehmensethik nach Peter Ulrich
- Wirtschaftsethik als Kritik der „reinen“ ökonomischen Vernunft
- Vermittlung zwischen ökonomischer Rationalität und ethisch-praktischer Vernunft
- Verantwortungsebenen für moralisches Wirtschaften
- Die Frage nach dem Einfluss der Philosophie auf Ulrichs integrativen Ansatz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem integrativen Wirtschaftsethikansatz von Peter Ulrich und analysiert dessen Verhältnis zur Philosophie. Sie untersucht, wie die philosophischen Ansätze von Kant, Rawls, Habermas und Apel den integrativen Ansatz beeinflussen.
- Der integrative Wirtschaftsethikansatz von Peter Ulrich
- Die Rolle der Philosophie im integrativen Ansatz
- Verantwortungsebenen im Wirtschaften
- Die Verbindung von ökonomischer Rationalität und ethischer Vernunft
- Die Kritik an der „reinen“ ökonomischen Vernunft
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Problematik von Entscheidungssituationen im Wirtschaftsleben heraus, in denen ökonomische und ethische Aspekte kollidieren. Sie zeigt die Notwendigkeit von moralischen Handlungsdimensionen und verdeutlicht die Relevanz des integrativen Wirtschaftsethikansatzes von Peter Ulrich.
- Das Kapitel „Wirtschaftsethische Theorieansätze“ beleuchtet exemplarisch drei Ansätze, die sich mit Fragen nach wirtschaftsethischen Handlungsanleitungen, Voraussetzungen und Bedingungen auseinandersetzen. Es werden die Unternehmensethik nach Steinmann und Löhr, die ökonomische Ethik nach Homann und der integrative Ansatz von Ulrich vorgestellt und miteinander verglichen.
- Das Kapitel „Die Frage nach dem Einfluss der Philosophie auf Ulrichs integrativen Ansatz“ analysiert den Einfluss philosophischer Ansätze auf den integrativen Wirtschaftsethikansatz. Es werden Bezüge zur Ethik Kants, dem Gesellschaftsvertrag von Rawls sowie der Diskursethik nach Habermas und Apel hergestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Wirtschaftsethik, integrative Unternehmensethik, Peter Ulrich, Philosophie, Kant, Rawls, Habermas, Apel, Verantwortungsethik, ökonomische Rationalität, ethische Vernunft, Moral, Handlungsanleitung, Entscheidungssituationen, Unternehmensethik, ökonomische Ethik.
Details
- Titel
- Der Einfluss der Philosophie auf wirtschaftsethische Ansätze
- Untertitel
- Am Beispiel der Integrativen Wirtschaftsethik von Peter Ulrich
- Hochschule
- FernUniversität Hagen (Institut für Philosophie)
- Note
- 1,8
- Autor
- Eva Siegmund (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 29
- Katalognummer
- V157290
- ISBN (eBook)
- 9783640702640
- ISBN (Buch)
- 9783640702756
- Dateigröße
- 517 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Die BA-Abschlussarbeit (Magister Philosophie/VWL) behandelt die Integrative Wirtschaftsethik Peter Ulrichs, sowie die wirtschaftsethischen Ansätze von Homann und Steinmann/Löhr.
- Schlagworte
- Einfluss Philosophie Ansätze Beispiel Integrativen Wirtschaftsethik Peter Ulrich
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Preis (Book)
- US$ 21,99
- Arbeit zitieren
- Eva Siegmund (Autor:in), 2009, Der Einfluss der Philosophie auf wirtschaftsethische Ansätze , München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/157290
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-