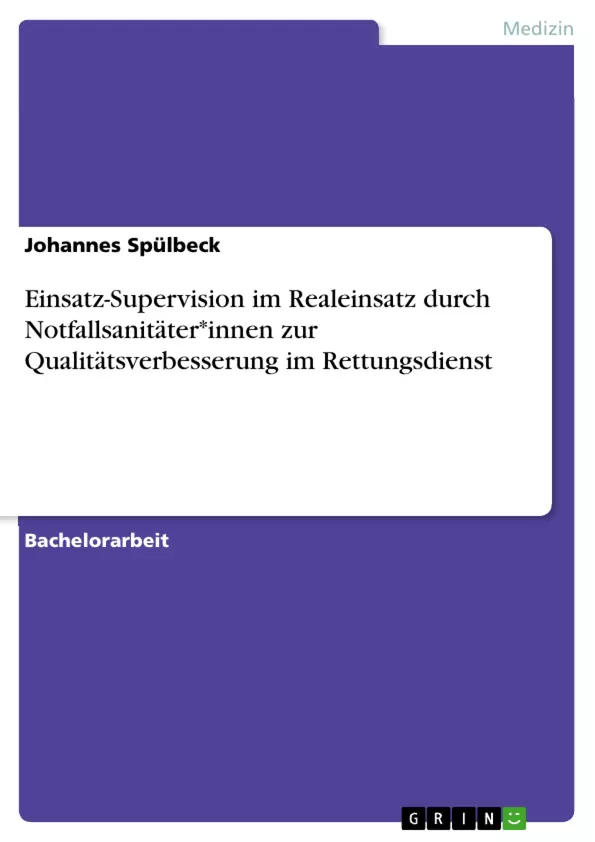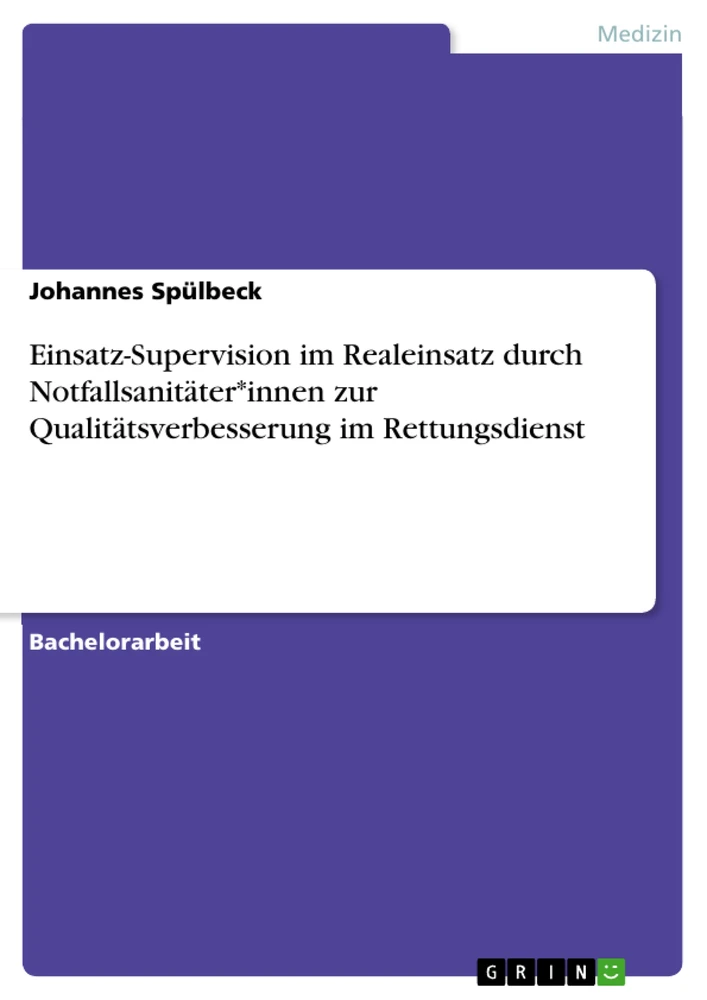
Einsatz-Supervision im Realeinsatz durch Notfallsanitäter*innen zur Qualitätsverbesserung im Rettungsdienst
Bachelorarbeit, 2024
161 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelblatt
Erklärung zur Eigenleistung
Zusammenfassung
Abstract
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretische Grundlagen
Definitionen und Begriffe
2.1 Qualitätsmanagement im Rettungsdienst
2.1.1 Strukturqualität
2.1.2 Prozessqualität
2.1.3 Ergebnisqualität
2.2 Qualität im Rettungsdienst
2.3 Qualitätssicherung im Rettungsdienst
2.4 Supervision und Coaching
2.4.1 CrewResourceManagement
2.5 Einsatz Supervision im Rettungsdienst
2.5.1 Das Qualitätssicherungspartner/Feldsupervisor Konzept des Wiener Roten Kreuz
2.5.2 Das Field Supervisor Konzept derWiener Berufsrettung
2.5.3 Das Einsatzbegleiter Konzept des Rettungsdienst Main-Kinzig-Kreis
2.6 Einsatz Supervision und Qualitätssicherung
3 Material und Methoden
3.1 Projektbeginn und Vorbereitungsphase Inhaltsverzeichnis
3.1.1 Konzeption des Projektablaufs und Projektdesign
3.1.2 Konzeption des Feedbackprotokolls
3.1.3 Gewählte Qualitätsindikatoren:
3.1.4 Auswahl der Probanden
3.1.5 PreTestdes Feedbackprotokolls
3.1.6 Information der Mitarbeiter
3.2 Schulungsphase
3.3 Durchführungsphase
3.3.1 Feedbackprotokoll
3.3.2 BefragungderTeilnehmer
3.3.3 Abschlussbefragung der Einsatzbegleiter
4 Ergebnisse
4.1 Ergebnisse der Feedbackprotokolle (Hauptfokus)
4.2 Ergebnisse der Abschlussbefragung der Teilnehmer
4.3 Ergebnisse der Abschlussbefragung der Einsatzbegleiter
5 Diskussion
5.1 Bewertung der Ergebnisse des Feedbackprotokolls
5.2 Bewertung der Teilnehmerbefragung
5.3 Bewertung der Abschlussbefragung der Einsatzbegleiter
6 Fazit
Literaturverzeichnis
7 Anhangsverzeichnis
8 Anhang
Zusammenfassung
Einleitung
Die Bedeutung der Qualitätssicherung in der notfallmedizinischen Versorgung hat im Kontext der Kompetenzerweiterungen von Notfallsanitätern und des demographischen Wandels zugenommen. In anderen Ländern bereits erfolgreich etabliert, spielt die Einsatz-Supervision dabei in der Zukunft eine zentrale Rolle. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Forschungsfrage, ob die Einsatz-Supervision ein geeignetes Mittel zur Qualitätssicherung im deutschen Rettungsdienst ist.
Material & Methoden
Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wurde eigens für diese Abschlussarbeit ein an das deutsche Rettungswesen angepasste Einsatz-Supervisions-Konzept entwickelt und getestet. Hierzu wurde ein Feedbackprotokoll basierend auf eigenen Qualitätsindikatoren erstellt und durch rekrutierte Probanden im Realeinsatz getestet. Die Feedbackprotokolle wurden im Anschluss ausgewertet sowie die Einsatzbegleiter und alle Teilnehmer befragt.
Ergebnisse
Insgesamt 62 Einsätze wurden von vier Einsatzbegleitern in einem Projektzeitraum vom 12.12.2023 bis zum 31.01.2024 begleitet. Die Bewertung vor allem von kommunikativen Skills, welche durch bisherige Qualitätssicherungssysteme nicht abgedeckt werden können, verliefeffizient und aussagekräftig.
Diskussion
Aufgrund der Komplexität des erstellten Feedbackprotokolls und der relativ kurzen Einarbeitungszeit, variieren die Bewertungen der kommunikativen Skills zwischen den Einsatzbegleitern. Die Dokumentation über Papierprotokolle erforderte einen verhältnismäßig hohen Aufwand zur Datengewinnung. Mit einer Digitalisierung und Anpassung der Protokolle würde dieses Problem behoben werden.
Fazit
Das Projekt kann als Erfolg betrachtet werden. Die Forschungsfrage ob die Einsatz-Supervision ein geeignetes Mittel zur Qualitätssicherung im Rettungsdienst ist, wurde bestätigt. Das Konzept wurde besser als erwartet von den Mitarbeitern akzeptiert und könnte anhand dessen ohne Probleme weitergeführt werden. Bevor das Konzept jedoch flächendeckend eingeführt werden kann, muss geklärt werden, wer hierfür die Kosten übernimmt.
Abstract
Introduction
The importance of quality assurance in emergency medical care has increased in the context of expanding the competences of emergency paramedics and demographic change. Already successfully established in other countries, operational supervision will play a central role in the future. This thesis deals with the research question of whether operational supervision is a suitable means of quality assurance in the German emergency medical services.
Materials and methods
To answer this research question, an operational supervision concept adapted to the German rescue services was developed and tested specifically for this thesis. For this purpose, a feedback protocol was created based on our own quality indicators and tested by recruited test persons in real operations. The feedback protocols were then analysed and the supervisors and all participants were interviewed.
Results
A total of 62 assignments were accompanied by four assignment supervisors during the project period from 12 December 2023 to 31 January 2024. The assessment of communication skills in particular, which cannot be covered by previous quality assurance systems, was efficient and meaningful.
Discussion
Due to the complexity of the feedback protocol and the relatively short familiarisation period, the assessments of communication skills vary between the mentors. The documentation via paper protocols required a relatively large amount of effort to collect data. Digitising and adapting the protocols would solve this problem.
Conclusion
The project can be considered a success. The research question of whether operational supervision is a suitable means of quality assurance in the rescue service was confirmed. The concept was accepted by the employees better than expected and could be continued without any problems on this basis. However, before the concept can be introduced across the board, it must be clarified who will bear the costs.
Abkürzungsverzeichnis
aCRF - Annotated Case Report File
ÄVRD - Ärztlicher Verantwortlicher Rettungsdienst
ÄLRD - Ärztlicher Leiter Rettungsdienst
CIRC-Circulation Improving Resuscitation
CIRS - Critical Incident Reporting System
CRM - Crew Resource Management
DIVI - Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e. V.
DRK - Deutsches Rotes Kreuz
DRK RDHU - Deutsches Rotes Kreuz Rettungsdienst Heidenheim-Ulm gGmbH
FiSu - Fieldsupervisor
KTW - Krankentransportwagen
LARD - Landesausschuss für den Rettungsdienst
MIND - Minimaler Notfalldatensatz
MKK - Main-Kinzig-Kreis
NEF - Notarzteinsatzfahrzeug
NKTW - Notfall-Krankentransportwagen
ORGL - Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
QSP - Qualitätssicherungspartner
QM - Qualitätsmanagement
QS - Qualitätssicherung
RTW - Rettungswagen
SOP - Standard Operating Procedure
SQR-BW - Stelle zur trägerübergreifenden Qualitätssicherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg
VICAR - Vienna Cardiac Arrest Register
Abbildungserzeichnis
Abbildung 1: Merkmale des QM im Rettungsdienst nach Redelsteiner et al. 2011.
Quelle: EigeneAbbildung
Abbildung 2: MIND4.0 Kerndatensatz (Quelle:https://www.divi.de/publikationen/alle-publikationen/220308-divi-mind-40-codes-pdf/viewdocument/224)
Abbildung 3: DIVI-Notarzteinsatzprotokoll (Quelle: https://www.divi.de/publikationen/alle-publikationen/220308-divi-notfall-einsatzprotokoll-6-1-pdf/viewdocument/223)
Abbildung 4: Digitale Einsatzdokumentation der Firma Pulsation (Quelle: https://pulsation-it.eom/losungen/#rettungsdienst2) 11
Abbildung 5: Qualitätsbericht 2022 der SQR-BW (Quelle: https://www.sqrbw.de/fileadmin/SQRBW/Downloads/Qualitaetsberichte/SQRBW_Qualitaetsbericht_2022.pdf)
Abbildung 7: Field Supervisor im Einsatz (Quelle:https://www.facebook.com/100067804177197/posts/2367601316724577/7checkpoint_src=any)
Abbildung 8: 1.Einsatzbeobachtung, die Technical Skills
Abbildung 9: Abschnitt der Non-technical Skills
Abbildung 10: Abschnitt der Non-technical Skills
Abbildung 11: Die Einsatznachbesprechung
Abbildung 12: Die Einsatzbeurteilung
Abbildung 13: Die Einsatzbeurteilung - Verbesserungsvorschläg
Abbildung 14: Unterstützung durch den Einsatzbegleiter
Abbildung 15: Kommunikation anhand des DRK-Codex
Abbildung 16: Erwartungstabelle
Abbildung 17: Feedbackprotokoll Vers. 3.4
Abbildung 18: Einsatzbuddy-Patch (Quelle:https://gearbuddies.de/en/collections/textil-lasercut-patches-feuerwehr- rettungsdienst/products/bester-einsatzbuddy-rettung-textil-patch) 39
Abbildung 19: Annotated CRF Feedbackprotokoll 3.4
Abbildung 20: Kommunikation nach DRK-Codex
Abbildung 21: Netz-Matrix Kommunikation nach DRK-Codex
Abbildung 22: Einsatz der CRM-Leiztsätze
Abbildung 24: Abschlussbefragung Teilnehmer
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Qualitätsaspekte des Rettungsdienstes
Tabelle 2: Übergeordnete Qualitätsziele für den Rettungsdienst des LARD
Tabelle 3: Konsentiertes Indikatorenset (SQR-BW 2014)
Tabelle 4: Einsatzindikationen der Wiener Field Supervisoren in eigener Darstellung (Redelsteiner, 2018)
Tabelle 5: Schichtabdeckung der Einsatzbegleitung
Tabelle 6: Technical Skills - Indikatoren
Tabelle 7: Non-technical Skills - Indikatoren
Tabelle 8: Einsatzbeurteilung - Indikatoren
Tabelle 9: Qualifikation der Probanden
Tabelle 10: Mitarbeiterumfrage kollegiale Einsatzbegleitung
Tabelle 11: Leitfadengestütztes InterviewderEinsatzbegleiter
Tabelle 12: Handlungsempfehlungen BW 3.1
Tabelle 13: Bewertung der Kommunikation
Tabelle 14: Notendurchschnitt CRM-Leitsätze
Tabelle 15: Kommunikation anhand des DRK-Codex
Tabelle 16: Abschlussbefragung Teilnehmer
Disclaimer
Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen. Aufeine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnung wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.
1 Einleitung
Im Zuge einer stetig fortschreitenden Entwicklung und Akademisierung des Gesundheitssektors gewinnt die Qualität der notfallmedizinischen Versorgung zunehmend an Bedeutung. Der Rettungsdienst steht dabei im Fokus gesellschaftlicher und fachlicher Diskussionen, da er als erste medizinische Kontaktstelle in Notfallsituationen fungiert. Mit dem Notfallsanitätergesetz von 2014 wurde die berufliche Tätigkeit im Rettungsdienst aufgewertet, verbunden mit einer umfassenden Kompetenzerweiterung (Lauer et al. 2022).
Angesichts dieser hohen Verantwortung und der komplexen Herausforderungen des Berufsfeldes rückt die kontinuierliche Qualitätsverbesserung im Rettungsdienst zunehmend in den Fokus von Wissenschaft und Praxis. Wesentlicher Kernpunkt eines effizienten und sich stets selbst evaluierenden sowie weiterentwickelnden Qualitätsmanagements ist die Qualitätssicherung.
Um die Qualitätssicherung und das Qualitätsmanagement an den Einsatzort zu bringen, hat das Wiener Rote Kreuz im Jahr 1996 ein Feld-Supervisionskonzept, genannt „Qualitätssicherungspartner“ eingeführt, welches später zu „Feld Supervisor“ umbenannt wurde (Redelsteiner 2018). In Deutschland hingegen wird die Supervision in der Notfallmedizin seit einigen Jahren diskutiert und gefordert (Häske et al. 2013; Heinzel 2021; Franke 2022; Redelsteiner 2018; Lauer et al. 2022). Ist jedoch laut eigener Recherche bis auf den Rettungsdienst Main-Kinzig-Kreis und einen privaten Rettungsdienstanbieter bundesweit in keinem Rettungsdienst ein getestetes und etabliertes System.
In zwei vorangegangenen Abschlussarbeiten wurde die Feld-Supervision und ihr Nutzen im deutschen Rettungsdienst in einem theoretischen Ansatz bereits aufgegriffen. Durch eine Literaturrecherche erarbeitete der Autor P. Heinzel die Fragestellung, inwiefern die „Field Supervision“ geeignet ist, um bestehende Problemfelder in den Bereichen Qualitäts-, Risiko- und Wissensmanagement im deutschen Rettungsdienst lösungsorientiert zu bearbeiten (Heinzel 2021). Die theoretische Umsetzung erörtert der Autor A. Franke in seiner Abschlussarbeit, durch eine Aufarbeitung des Wiener Field-Supervisor-Systems und zwei durchgeführte Experteninterviews (Franke 2022).
Diese Abschlussarbeit befasst sich mit den leitenden Hypothesen:
- Die Einsatz Supervision durch Notfallsanitäter*innen im Realeinsatz ist ein geeignetes Mittel zur Qualitätssicherung im Rettungsdienst.
- Die untersuchten Qualitätsindikatoren können, mit der Einsatz-Supervision, im Vergleich zu bestehenden Qualitätssicherungssystemen des Rettungsdienstes, präziser und effizienter gemessen werden.
Hierfür werden in einem ersten Schritt wichtige Begriffe wie Qualitätsmanagement sowie Qualität im Rettungsdienst und Supervision definiert und bestehende Qualitätssicherungskonzepte aufgezeigt. Des Weiteren werden die schon bestehenden Einsatz-Supervisionskonzepte sowohl des Wiener Rettungsdienstes wie auch des Rettungsdienst Main-Kinzig-Kreis (MKK) erörtert.
In einem zweiten Schritt wird das eigens für diese Abschlussarbeit entwickelte Einsatz-Supervisionskonzept des DRK Rettungsdienst Heidenheim-Ulm dargestellt - hier kollegialer Einsatzbegleiter genannt. Unter der Leitung des Geschäftsführers Herrn David Richter wurde das Konzept der kollegialen Einsatzbegleitung erarbeitet und in einer zweimonatigen Durchführungsphase getestet. Zur Qualitätssicherung und als Leitfaden für die Einsatznachbesprechung wurde hierfür ein Feedbackprotokoll entwickelt, welches im Anschluss ausgewertet wurde. Nach der Durchführungsphase erfolgte eine Befragung der Einsatzbegleiter und der teilnehmenden Rettungsdienstmitarbeiter zur Analyse und Weiterentwicklung des Konzepts.
2 Theoretische Grundlagen
Definitionen und Begriffe
2.1 Qualitätsmanagementim Rettungsdienst
„Die Durchführung der Einsätze in der Notfallrettung und deren Abwicklung sind zu Zwecken der Qualitätssicherung zu dokumentieren. Die am Rettungsdienst Beteiligten sind verpflichtet, Maßnahmen durchzuführen und zu unterstützen, die die Qualität im Rettungsdienst sichern. Dies umfasst auch die Mitwirkung an der landesweiten Qualitätssicherung und die Implementierung von anerkannten Qualitätsmanagementsystemen. Anhand einer standardisierten elektronischen Datenerfassung und differenzierten Datenauswertung ist von einer zentralen Stelle eine regelmäßige Analyse der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität des Rettungsdienstes vorzunehmen. Das Innenministerium regelt durch eine Rechtsverordnung das Nähere zur Qualitätssicherung.“^ 2 Absatz 3 RDGLand Baden-Württemberg).
Das am häufigsten verwendete Zertifizierungsverfahren für Qualitätsmanagementsysteme im Rettungsdienst ist das Verfahren DIN EN ISO 9001. Es ist ein branchenneutrales Kernmodell mit dem Fokus, ein funktionierendes und effizientes Qualitätsmanagementsystem zu etablieren (Hensen 2022). Trotz ihrer Beliebtheit in zahlreichen Einrichtungen des Gesundheitswesens, wurde die Darlegungsnorm DIN EN ISO 9001 nicht speziell für Gesundheitseinrichtungen entwickelt, was in einigen Bereichen einen gewissen Interpretationsspielraum offenlässt (Hensen 2022). Für das Gesundheitswesen gibt es deswegen seit 2012 die branchenspezifische Bereichsnorm DIN EN 15224, eine Erweiterung des Kernmodells DIN EN ISO 9001. Hier werden zusätzlich zu den Anforderungen an das Qualitätsmanagement auch fachliche Anforderungen an die Qualität der Produkte und Dienstleitungen, d.h. im engeren Sinne an die Erstellung von Gesundheitsleistungen vorgegeben.
Hervorzuheben ist, dass gegenüber der branchenneutralen Norm, bereichsspezifische Anforderungen an das Qualitätsmanagement in Gesundheitseinrichtungen gestellt werden. Diese Anforderungen werden als elf grundlegende Qualitätsaspekte formuliert, auf welche in „2.2 Qualität im Rettungsdienst“ näher eingegangen wird (Hensen 2022).
Aktuelle Qualitätsmanagementmodelle aus dem Bereich des Gesundheitswesens sowie das Landesrettungsdienstgesetz selbst, beziehen sich hingegen auf die drei Qualitätsdimensionen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität nach Avedis Donabedian aus den 1960er Jahren, welche im Folgenden näher erörtert werden (Hensen 2022; Franke 2022).
2.1.1 Strukturqualität
Die Strukturqualität bezieht sich auf die grundlegenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, die für die Durchführung des Rettungsdienstes erforderlich sind. Dazu gehören die Verfügbarkeit und Ausstattung von Rettungsfahrzeugen und - geräten, die Qualifikation und die Anzahl des Personals sowie die organisatorischen und infrastrukturellen Gegebenheiten der Rettungsdienstträger. Strukturqualität beinhaltet auch die Vorhaltung spezialisierter Einheiten wie z.B. Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF), Babynotarztwagen (vgl. RD Ulm „Baby-MUCK“), Rettungshubschrauber und das Einsatzfahrzeug des Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (ORGL), die für besondere Einsatzsituationen gerüstet sind. Effektive Kommunikationssysteme und Datenverwaltungstools, die eine schnelle und genaue Informationsübertragung ermöglichen, sind ebenfalls Teil der Strukturqualität. Die Sicherstellung einer hohen Strukturqualität ist grundlegend für die Gewährleistung einer effizienten und wirksamen Notfallversorgung (Hensen 2022; Franke 2022; Luxem et al. 2020).
2.1.2 Prozessqualität
Die Prozessqualität befasst sich mit den tatsächlichen medizinischen und organisatorischen Abläufen innerhalb des Rettungsdienstes. Sie umfasst die Durchführung der Notfallversorgung, einschließlich der Bewertung des Patientenzustands, der Anwendung von lebensrettenden Maßnahmen, der medizinischen Erstversorgung sowie der Entscheidungsfindung bezüglich Transport und Zielkrankenhaus. Ein zentraler Aspekt der Prozessqualität ist die Adhärenz zu evidenzbasierten Leitlinien und Protokollen, die Implementierung von Feedback- und Debriefing-Prozessen nach Einsätzen zur kontinuierlichen Verbesserung sowie die Integration von Forschung und Ausbildung in den Einsatzalltag. Die Prozessqualität beinhaltet auch die Kommunikation und Kooperation mit anderen Rettungs- und Notfalldiensten sowie die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung des Personals (Hensen 2022; Franke 2022; Luxem et al. 2020).
2.1.3 Ergebnisqualität
Die Ergebnisqualität misst den Erfolg und die Wirksamkeit des Rettungsdienstes anhand der Gesundheitsergebnisse der Patientinnen und Patienten. Theoretische Indikatoren für die Ergebnisqualität umfassen Überlebensraten nach außerklinischen Herzstillständen, die Qualität der kardiopulmonalen Reanimation, das Outcome nach schweren Verletzungen oder die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten mit der erhaltenen Versorgung. Ziel von Verbesserungen in der Struktur- und Prozessqualität, ist letztendlich eine Verbesserung der Ergebnisqualität zu erzielen. Eine kontinuierliche Erfassung und Analyse von Daten zu Patientenoutcomes würde es ermöglichen, gezielte Maßnahmen zur Qualitätssteigerung zu ergreifen und die Leistung des Rettungsdienstes systematisch zu verbessern (Hensen 2022; Luxem et al. 2020; Franke 2022).
Insgesamt zeigen diese Definitionen, dass Qualität im Rettungsdienst ein mehrdimensionales Konstrukt ist, das die organisatorische Struktur, die klinischen und operativen Prozesse sowie die Gesundheitsergebnisse der Patientinnen und Patienten umfasst. Die kontinuierliche Überwachung und Verbesserung aller drei Aspekte ist entscheidend, um eine hochwertige Notfallversorgung sicherzustellen.
2.2 Qualität im Rettungsdienst
Literaturrecherchen ergeben unterschiedliche Aussagen in Bezug auf eine Definition von Qualität. In der DIN EN ISO 9000:2015 definiert das Deutsche Institut für Normung Qualität als den „Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale eines Objekts Anforderungen erfüllt“ (Deutsches Institut für Normung e.V., S. 39). Passender für den Rettungsdienst sind jedoch die 11 in der DIN EN 15224 definierten grundlegenden Qualitätsaspekte, welche in der folgenden Tabelle mit Beispielen aus dem Rettungsdienst aufgezeigt werden.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Qualitätsaspekte des Rettungsdienstes (Hensen 2022)
Für Redelsteiner ist die Qualität im Rettungsdienst in 8 „tragenden“ Säulen aufgebaut, welche in Abbildung 1 erkennbar sind. Einige der Qualitätsmerkmale gleichen denen der DIN EN 15224, so zum Beispiel die Angemessenheit, die Verfügbarkeit mit der Sicherstellung, die Effizienz mit der Kosteneffizienz, die Gleichheit mit der Gleichmäßigkeit und die Rechtzeitigkeit/Zugänglichkeit mit Zeitgerechtigkeit sowie der Zugänglichkeit.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Merkmale des QM im Rettungsdienst nach Redelsteiner et al. 2011. Quelle: Eigene Abbildung
In der DIN EN 15224 nicht genannte Qualitätsaspekte, welche im Rettungsdienst jedoch eine wichtige Rolle spielen, sind einerseits die menschliche Anteilnahme, die rein durch Supervision oder durch nachträgliche Befragungen der Patienten gemessen werden kann. Andererseits das bessere Patienten-Outcome, welches nur mit einer Kontrolle der Ergebnisqualität - also einem Nachweis, dass durch die Behandlung des Rettungsdienstes messbar mehr Patienten überleben - gemessen werden kann.
Der Landesausschuss für Rettungsdienst (LARD) hat im Juli 2012 folgende übergeordnete Qualitätsziele für den Rettungsdienst in Baden-Württemberg beschlossen. Sie beschreiben den grundsätzlichen Anspruch and die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität (SQR-BW 2014).
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Übergeordnete Qualitätsziele für den Rettungsdienst des LARD
2.3 Qualitätssicherung im Rettungsdienst
In der Novellierung des Landesrettungsdienstgesetz Baden-Württemberg ist die Qualitätssicherung definiert durch „[...] alle Maßnahmen und Vorgaben, die geeignet sind, die Qualität der rettungsdienstlichen Versorgung vom Eingang des Notrufs beziehungsweise Hilfeersuchens in der Integrierten Leitstelle über die Anfahrt des Rettungsmittels und die Patientenversorgung am Notfallort bis hin zur Ankunft und Übergabe zur weiteren Versorgung im Zielkrankenhaus anhand von definierten Datensätzen oder sonstigen Indikatoren sichtbar zu machen und die auf die Gewährleistung, Weiterentwicklung und stetige Verbesserung der rettungsdienstlichen Versorgung abzielen (Land Baden-Württemberg, S. 10).
Um die Qualitätssicherung des Rettungsdienstes sicherzustellen, hat der Landesausschuss für den Rettungsdienst (LARD) im Jahr 2011 die Einrichtung einer Stelle zur trägerübergreifenden Qualitätssicherung im Rettungsdienst Baden- Württemberg (SQR-BW) beschlossen. Sie ist beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Baden-Württemberg als fachlich unabhängige und eigenständige Organisationseinheit angesiedelt (SQR-BW 2014).
Ergänzend hierzu und als Grundlage für ein medizinisches Qualitätsmanagement hat der LARD die einheitliche landesweite Dokumentation von Rettungsdiensteinsätzen auf Grundlage der MIND3 Datensätze beschlossen. Bei diesem, von anerkannten Fachgesellschaften entwickelte und konsentierte „Minimale Notfalldatensatz“ MIND3 handelt es sich um einen Kerndatensatz, der eine definierte Menge an Merkmalen und Merkmalsbeschreibungen zur Dokumentation der Notfallrettung enthält (SQR-BW 2014).
Mittlerweile wurde der Datensatz von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e. V. (DIVI) überarbeitet und 2021 der MIND4.0 veröffentlich.
Anbei ist zum Vergleich eine der insgesamt acht Seiten an vorgegebenen Kerndaten des MIND4.0. Der vollständige Datensatz ist in Anhang 1 einzusehen.
Auf Grundlage dieser Kerndaten wurden die Einsatzprotokolle für Notfalleinsätze entwickelt, wie z.B. das in Abbildung 3 sichtbare aktuelle Papier-Einsatzprotokolle der DIVI.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: MIND4.0 Kerndatensatz (Quelle: https://www.divi.de/publikationen/alle- publikationen/220308-divi-mind-40-çodes- pdf/viewdoçument/224)
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: DIVI-Notarzteinsatzprotokoll (Quelle: https://www.divi.de/publikationen/alle-publikationen/220308- divi-notfall-einsatzprotokoll-6-1-pdf/viewdoçument/223)
Auch auf Grundlage der MIND3 bzw. MIND 4 Datensätze ist die digitale Einsatzdokumentation der Firma Pulsation konzipiert worden, welche z.B. im DRK RDHU zur Dokumentation verwendet werden.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Digitale Einsatzdokumentation der Firma Pulsation (Quelle: https://pulsation-it
Um ihre Aufgabe wahrzunehmen hat die SQR-BW in Zusammenarbeit mit einer Expertengruppe Qualitätsindikatoren entwickelt. Das konsentierte Indikatorenset besteht aus 26 Qualitätsindikatoren, welche im Folgenden aufgezeigt werden:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3: Konsentiertes Indikatorenset (SQR-BW 2014)
Die Indikatorendatenblätter mit einer ausführlichen Beschreibung stehen separat unter https://www.sqrbw.de/indikatoren/datenblaetter zur Verfügung.
Um die Qualitätsindikatoren auswerten zu können, ist jeder Rettungsdienstträger in Baden-Württemberg dazu verpflichtet seine Datensätze der Einsatzprotokolle digital an die SQR-BW zu übertragen. Auf Grundlage dieser Datensätze erstellt die SQR- BW jährlich einen Qualitätsbericht, in dem frei zugänglich und öffentlich einsehbar alle ausgewerteten Qualitätsindikatoren für jeden Rettungsdienstbereich in Baden- Württemberg dargestellt sind.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Qualitätsbericht 2022 der SQR-BW (Quelle: https://www.sqrbw.de/fileadmin/SQRBW/Downloads/Qualitaetsberichte/SQRBW_Qualitaetsbericht_2022.pdf)
2.4 Supervision und Coaching
Der Begriff „Supervision“ im Kontext der Beratung setzt sich aus den Teilbegriffen „Super“ (lateinisch für „über“, „von oben“) und „Visio“ (lateinisch für „sehen“ oder „dem Anblick“) zusammen und bedeutet demgemäß „Überblick, Übersicht oder Kontrolle“. In Europa wird der Begriff auch im Sinne von Hilfestellung, Wissensvermittlung, Reflexionshilfe oder auch Anpassung an die vorgegebenen Arbeitsbedingungen verwendet und passt somit wie Coaching in den Bereich der berufsbezogenen Beratung (Belardi 2024).
Seinen Ursprung in den USA findet die Supervision laut Belardi als Beratungskonzept in der Sozialen Arbeit schon in den 1880 Jahren mit dem Begriff „case-work“ = „Einzelfallhilfe“ (Franke 2022). Das erste Buch über Supervision stammt von J. Brackett: „Supervision and Education in Charity“ (New York 1903). Jedoch eher für Zwecke der hierarchischen Organisation im Sinne der Kontrolle von Zielerreichung und Arbeitsvollzügen (Belardi 2024).
Basierend auf dieser Historie ist der Supervisor in den USA heutzutage eine weitläufig etablierte Position, so auch in der präklinischen Versorgung, jedoch eher als ein unmittelbarer Vorgesetzter, Anleiter und Aufsichtsführer (Redelsteiner 2018; Belardi 2024).
In die deutschsprachige Literatur kam der Supervisionsbegriff gegen 1950. Initial aus der Motivation heraus, die gesellschaftlichen Folgen und Herausforderungen des zweiten Weltkrieges zu überwinden. Von 1955 bis 1975 etablierten sich die Supervisionsansätze als unterstützende Methode der Einzelfallhilfe und wurden u.a. im Rahmen von Ausbildungssupervisionen angeboten (Belardi 2024; Franke 2022). Auf studentischer Seite als Praxisanleitungen und im Rahmen berufserfahrener Kolleginnen als Praxisberatungen bezeichnet, setzte sich der Begriff der Supervision jedoch erst später durch.
„Das allgemeine Ziel der Supervision ist es, die Arbeit der Ratsuchenden (Supervisanden) zu verbessern.“ (Belardi 2024, S. 15). Wobei sowohl die Arbeitsergebnisse als auch die Arbeitsbeziehungen zu den Kunden und Kollegen, wie auch organisatorische Zusammenhänge gemeint sind (Belardi 2024).
2.4.1 CrewResourceManagement
Die Entstehungsgeschichte von Crew Resource Management (CRM) in der deutschen Medizin kann nicht losgelöst von seinen Wurzeln in der Luftfahrt betrachtet werden. Ursprünglich entwickelt, um die Zusammenarbeit und Kommunikation in Cockpit-Besatzungen zu verbessern und so menschliches Versagen als Ursache für Flugunfälle zu reduzieren, fand das CRM-Konzept seinen Weg in die Medizin als Reaktion auf ähnliche Herausforderungen bei der Patientenversorgung (Rall und Langewand 2022).
Im Kontext der Medizin und speziell im Rettungsdienst adressiert CRM die Notwendigkeit, menschliche Faktoren wie Teamarbeit, Entscheidungsfindung, Führungsverhalten und Kommunikation zu optimieren. Die Übertragung des CRM auf medizinische Bereiche wurde durch die Erkenntnis vorangetrieben, dass ein erheblicher Teil der Behandlungsfehler und unerwünschten Ereignisse auf mangelnde Teamarbeit und Kommunikationsdefizite zurückzuführen ist. Im Jahr 2016 wurden in Deutschland schätzungsweise 19.000 Todesfälle jährlich mit Behandlungsfehlern in Verbindung gebracht, was die Dringlichkeit einer Verbesserung der Patientensicherheit unterstreicht (Rall und Langewand 2022; https://www.aps-ev.de).
CRM-Trainings im medizinischen Bereich zielen darauf ab, das Bewusstsein für die Bedeutung von nicht-technischen Fertigkeiten (Non-technical Skills) zu schärfen und das Personal zu befähigen, in kritischen Situationen effektiver zu agieren. Dies beinhaltet Übungen zu situativer Aufmerksamkeit, Stressmanagement, effektiver Delegation und der Fähigkeit, in Hochdrucksituationen klare Anweisungen zu geben und entgegenzunehmen (Rall und Langewand 2022).
Als Hilfestellung hierfür haben Rall & Gaba 15 CRM-Leitsätze entwickelt, die die Anwender bei den oben genannten Non-technical Skills unterstützt.
Die Einführung von CRM in der deutschen Medizin hat nennenswerte Vorteile und Benefits hervorgebracht:
1. Verbesserung der Patientensicherheit: Durch die Minimierung von Kommunikationsfehlem und die Optimierung der Teamdynamik kann CRM die Zahl der vermeidbaren Fehler verringern.
2. Stärkung der Teamarbeit: CRM fördert ein Umfeld, in dem alle Teammitglieder zur Sicherheit beitragen, indem sie Bedenken äußern und kollektive Entscheidungsfindung unterstützen.
3. Effizienzsteigerung: Durch die Verbesserung der Koordination und Kommunikation innerhalb des Teams können medizinische Interventionen schneller und zielgerichteter durchgeführt werden.
4. Erhöhung der Arbeitszufriedenheit: Ein klar strukturiertes Arbeitsumfeld, in dem die Rollen und Erwartungen definiert sind, kann zur Arbeitszufriedenheit beitragen und Burnout vorbeugen (Rall und Langewand 2022).
Unter anderem trägt CRM-Training zu einer Reduktion des empfundenen Arbeitsstresses um bis zu 80,6% bei, sowie führt zu einer Abnahme der Mitarbeiterfluktuation und des Krankenstandes im Gesundheitswesen (El Khamali etal. 2018).
Speziell im Rettungsdienst, wo Entscheidungen oft unter Zeitdruck und in dynamischen Umgebungen getroffen werden müssen, bietet CRM einen Rahmen für effektive Teaminteraktion. Durch Simulationstrainings und Debriefings werden Rettungsdienstmitarbeiter darin geschult, unter Stress koordiniert und patientenorientiert zu handeln.
2.5 Einsatz Supervision im Rettungsdienst
Im Rettungsdienst in den USA sind „Supervisors“ weit verbreitet. In manchen Rettungsdiensten sind sie klassische Führungskräfte und übernehmen in komplexeren Lagen im Sinne eines ORGL die Koordination. In anderen Bereichen haben sie routinemäßig als Hauptaufgabe die mobile Qualitätssicherung und achten in den Wachen und vor Ort auf den Einsatz- und Dienstablauf. Der Führungsstil variiert je nach Organisationskultur zwischen klassischem Vorgesetzen, Anleiter, Coach oder fast gleichwertigem Kollegen. Auch neben den USA sind International Feldsupervisorenmodelle etabliert und fester Bestandteil der dortigen Rettungsdienste, so unter anderem auch in Dänemark, Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland, in urbanen wie auch ländlichen Regionen. Vereinzelt gibt es auch Supervisionskonzepte in Tschechien, Slowakei, Slowenien und skandinavischen Ländern (Redelsteiner 2018).
1996 bereits erfolgreich von dem Wiener Roten Kreuz eingeführt und 2009 ebenfalls von der Berufsrettung Wien mit anderem Kernfokus eingeführt, ist die Einsatzsupervision seitdem ein nicht wegzudenkender Teil des Qualitätsmanagements und des Qualitätsanspruches des Wiener Rettungsdienstes (Redelsteiner 2018).
In Deutschland hingegen ist Einsatzsupervision noch nicht weit verbreitet; sie wird zwar in fast jeder Ausgabe deutschsprachiger Fachzeitschriften des Rettungsdienstes in mindestens einem Artikel erwähnt, jedoch ist sie noch kein etablierter Status Quo. Größte Hürde hierbei ist einerseits die deutsche Fehlerkultur, in der anders als in den USA die Supervision noch nicht lange etabliert ist, andererseits die Frage der Kostenübernahme. Vor allem in Süddeutschland ist der Rettungsdienst größtenteils von gemeinnützigen Hilfsorganisationen gestellt und alle anfallenden Kosten werden in Kostenverhandlungen mit den Kostenträgern vereinbart. So wurde die Einsatzsupervision bei Hilfsorganisationen schon überlegt einzuführen (Häske et al. 2013), ist letztendlich jedoch an dem Personalmangel und der Kostenfrage gescheitert. Dementsprechend gibt es bisher nur einen privaten Rettungsdienstträger (vgl. https://www.resqpool.de) und eine Kommune (Abschnitt 2.5.3 Rettungsdienst Main-Kinzig-Kreis), die Einsatzsupervision im deutschen Rettungsdienst bereits ausführen.
Hier sind einige Schlüsselaspekte, wie die Einsatz-Supervision zur Qualitätsverbesserung im Rettungsdienst beitragen kann:
1. Überwachung der Prozessqualität: Supervisoren beobachten die Durchführung medizinischer Maßnahmen und die Anwendung von Behandlungsprotokollen in Echtzeit. Dadurch können sie sicherstellen, dass die Rettungsdienstteams die aktuellen Leitlinien einhalten und qualitativ hochwertige Patientenversorgung leisten.
2. Direktes Feedback und Coaching: Nach dem Einsatz bieten Supervisoren den beteiligten Teams direktes Feedback zu ihrer Leistung. Dies ermöglicht eine sofortige Reflexion und Lernmöglichkeit für das Personal, was zur kontinuierlichen Verbesserung der individuellen und teambasierten Fähigkeiten beiträgt.
3. Identifizierung von Verbesserungspotenzial: Durch die Beobachtung der Einsatzabläufe können Supervisoren Bereiche identifizieren, in denen Schulungen, zusätzliche Ressourcen oder Änderungen in den Abläufen erforderlich sind, um die Versorgungsqualität zu erhöhen.
4. Förderung der Teamarbeit: Supervisoren können dazu beitragen, effektive Kommunikation und Koordination innerhalb der Einsatzteams zu fördern. Eine starke Teamdynamik ist entscheidend für eine erfolgreiche Notfallversorgung und kann die Patientenoutcomes positiv beeinflussen.
5. Daten sammeln für Qualitätsmanagement: Supervisoren sammeln wertvolle Daten über die Einsatzabläufe und Patientenversorgung, die zur systematischen Bewertung der Dienstleistungsqualität genutzt werden können. Diese Daten sind essentiell für das Qualitätsmanagement und für strategische Entscheidungen zur Verbesserung des Rettungsdienstes.
6. Sicherheit für Patienten und Personal: Die Supervision stellt sicher, dass alle Maßnahmen zum Schutz der Patienten und des Rettungsdienstpersonals ergriffen werden. Durch die Überwachung der Einhaltung von Sicherheitsprotokollen trägt die Supervision direkt zur Verringerung von Risiken und zur Förderung einer sicheren Arbeitsumgebung bei. Zudem gewährleistet selbst die bloße Anwesenheit des Supervisors eine erhöhte Patientensicherheit.
2.5.1 Das Qualitätssicherungspartner/Feldsupervisor Konzept des Wiener Roten Kreuz
Im Rahmen der QM-Zertifizierung zu ISO 9001 wurde 1996 beim Wiener Roten Kreuz ein Acting-Supervisor-Modell mit dem Namen „Qualitätssicherungspartner“ (QSP) eingeführt. Hierbei handelte es sich um erfahrene hauptberufliche Sanitäter, die in Abstimmung zwischen Geschäftsleitung, Rettungsdienstleitung, Chefarzt, QM und Betriebsrat ausgewählt und in einem 60-Stunden-Kurs auf diese Aufgabe vorbereitet wurden. Primäre Gesichtspunkte der Auswahl waren die soziale Kompetenz und die fachliche Eignung (Redelsteiner 2018).
Die QSP hatten keine Vorgesetztenfunktion und keine Sanktionsmöglichkeiten. Vielmehr „[...] fungierten (sie) als Partner, Berater und Anleiter ihrer Kollegen in Fragen der Prozessqualität. Sie begleiteten Einsätze, führten Nachbesprechungen mit den Kollegen durch und wurden, wenn erforderlich, auch zur Konfliktmoderation zwischen Patienten und Mitarbeitern [...] eingesetzt.“ (Redelsteiner 2018).
Die begleiteten Einsätze wurden hinsichtlich bestimmter Schwerpunktthemen dokumentiert. Eine mitarbeiterbezogene Dokumentation fand hingegen nicht statt. 2005 wurden die QSP in “Feldsupervisor“ umbenannt und mit einem eigenen Notfallkrankentransportwagen (N-KTW) ausgestattet (Redelsteiner 2018).
2.5.2 Das Field Supervisor Konzept der Wiener Berufsrettung
Grundstein für die Einführung des Field Supervisor (FISU) in der Berufsrettung Wien war die CIRC (Circulation Improving Resuscitation) Autopulse Studie 2009 - 2011. Zur Unterstützung und Sicherstellung der studienprotokollkonformen Abläufe forderte die Studienleitung die Durchführung einer Einsatzsupervision. Im Anschluss an die Studie führte die Wiener Berufsrettung das System der Field Supervisor weiter, baute es aus und etablierte es als festen Bestandteil des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung (Franke 2022; Mueller et al. 2023).
Aufgrund der Historie dieses System gehört zu den primären Schwerpunkten der Field Supervisoren die Reanimationseinsätze. Hierfür wurde im Anschluss an die Studie eine sogenannte qCPR-Datenbank und ein standardisiertes Reanimationsprotokoll (VICAR Vienna Cardiac Arrest Register), das aktuelle Kernstück der fachlichen Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements im Rettungsdienst eingeführt. „Die Field Supervisoren sind dem Fachreferat Qualitätssicherung [...] unterstellt und handeln im Auftrag des Leiters der Wiener Rettungsakademie Michael Girsa MBA unter Absprache mit dem Abteilungsleiter [..dem Rettungsdienstleiter [...], dem Chefarzt der Berufsrettung Wien [...] sowie dem medizinisch wissenschaftlichen Leiter (Franke 2022, S. 25).
Hauptaufgabe des FISU ist das mobile Qualitätsmanagement. Er wird in Wien bei Codes der höchsten Dringlichkeit zusätzlich zu RTW und NEF alarmiert, darunter fallen Kreislaufstillstand und Bewusstlosigkeit aller Ursachen (Redelsteiner 2018).
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Field Supervisor im Einsatz (Quelle: https://www. facebook. com/100067804177197/posts/23.
Zu den Ursachen zählen unter anderem:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 4: Einsatzindikationen der Wiener Field Supervisoren in eigener Darstellung (Redelsteiner, 2018)
Die Einsätze werden in der Beobachterrolle begleitet. „Der Beobachtungsfokus liegt dabei auf der Einhaltung von Handlungsanweisungen und Standard Operating Procedures, der sozialen Kompetenz, der Teamführung unter der Berücksichtigung der CRM-Leitsätze (Crew Resource Management) und dem Einsatzdebriefing.“ (Franke 2022). Auf Wien verteilt gibt es 3 permanent von den FISU besetzte Standorte, von denen aus im Jahresschnitt etwa 3600 Einsätze begleitet werden (Franke 2022).
„Im operativen Bereich ist Risikomanagement Aufgabe der FISU. Er ist in den permanenten Ablauf des Plan-Do-Check-Act-Regelkreises (PDCA-Kreislauf)[...], in die Planung von risikoreduzierenden Maßnahmen (Übung, Simulation etc.), die Umsetzung dieser und die Überwachung (z. B. Beobachtung vor Ort) und neuerliche Verbesserung (Feedback, Themenidentifikation für Schulung, persönliches Coaching, Nachschulung etc.) involviert. Ebenso obliegt dem FISU die Auswertung von Fallbeispielen aus dem Critical Incident Reporting System (CIRS).“ (Redelsteiner 2018, S. 194-195).
Vorrausetzungen um FISU zu werden, ist die abgeschlossene Ausbildung zum österreichischen Notfallsanitäter (100h theoretische- und 160h praktische Ausbildung zum Rettungssanitäter sowie 160h theoretische- und 320h praktische Ausbildung zum Notfallsanitäter) und der erfolgreiche Abschluss der Module Arzneimittellehre NKA (40h Theorie), Venenzugang und Infusion NKA (10h theoretische- und 40h praktische Ausbildung sowie Beatmung und Intubation NKI (30h theoretische- und 80h praktische Ausbildung) sowie eine Lehrtätigkeit als Lehrsanitäter an der Rettungsakademie. Zudem müssen sie den betriebsinternen Offizierslehrgang absolviert haben und die meisten FISU sind auch „Dipl. Notfallsanitäter“ durch Absolvieren der 4-jährigen Berufsbegleitenden internen Ausbildung der Berufsrettung. Allein die Tätigkeit als Lehrsanitäter an der Rettungsakademie schreibt eine 5-jährige Berufserfahrung vor. Die eigentliche Weiterbildung zum FISU ist eine 1-jährige Zusatzausbildung, in der die angehenden FISU nach einem Mentorenprinzip aktive FISU im Einsatz mit begleiten (Redelsteiner2018; Franke 2022).
2.5.3 Das Einsatzbegleiter Konzept des Rettungsdienst Main-Kinzig-Kreis
Laut Recherche der beiden Autoren A. Franke und P. Heinzel gibt es aktuell im Rettungsdienst in Deutschland kein laufendes Feld-Supervisionskonzept (Franke 2022; Heinzel 2021). Bei der eigenen Recherche hingegen wurde die Firma RESQPool, ein privater Rettungsdienstträger mit einem Supervisionskonzept gefunden (vgl. https://www.resqpool.de). Des Weiteren wurde ein Dokument des Gefahrenabwehrzentrum Main-Kinzig-Kreis (MKK) mit der Überschrift „Einsatzbegleitung - Merkblatt für Einsatzkräfte im Rettungsdienst“ von dem 16.08.2017 gefunden. Siehe hierfürAnhang 3.
Dem vorliegenden Merkblatt für Einsatzkräfte lässt sich entnehmen, dass ab dem August 2017 eine Testphase der Einsatzbegleitung durchgeführt wurde. Unter Einsatzbegleitung wird hier definiert, dass eine qualifizierte, erfahrene Einsatzkraft im regulären Einsatzdienst, die Realeinsätze begleitet und in einem anschließenden strukturierten Nachbesprechung („Debriefing“) Feedback gibt und der jeweilige Einsatz aufgearbeitet wird. Unter anderem wird die Einsatzbegleitung als „Live- Supervision“ bezeichnet und Verbindungen zum sog. „line check“ der Luftfahrt gezogen.
Die jeweiligen Einsatzbegleiter sind erfahrene, oft als Praxisanleiter und im CRM fortgebildete Einsatzkräfte, die durch einen speziellen Einsatzbegleiter-Workshop qualifiziert sowie vom Ärztlichen Leiter Rettungsdienst bestätigt wurden.
Anzumerken ist, dass die Organisation des Rettungsdienstes anders ist als im Rettungsdienst Heidenheim-Ulm. Weil der Main-Kinzig-Kreis in Hessen, also einem anderen Bundesland mit einem anderen Rettungsdienstgesetz liegt, läuft hier die Qualitätssicherung und Ärztliche Leitung über die Kommune, genauer gesagt über das Gefahrenabwehrzentrum. Dies bedeutet, es gibt einen Ärztlichen Leiter Rettungsdienst, welcher bei dem Gefahrenabwehrzentrum des MKK angestellt ist und verantwortlich für alle, einen Rettungsdienst betreibenden Hilfsorganisationen ist. Dementsprechend melden sich die Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen für eine Einsatzbegleitung selbständig an und werden an einem festgelegten Termin für einen oder mehrere Einsätze lang begleitet.
Nachdem keine weiteren Informationen über die Einsatzbegleitung des Main-Kinzig-Kreis gefunden wurden, wurde persönlich Kontakt zum Ärztlichen Leiter Rettungsdienst Dr. Manuel Wilhelm aufgenommen. In einem gemeinsamen Telefonat erklärte er, dass die Einsatzbegleitung seit der Testphase erfolgreich eingeführt sowie fortgeführt wurde und seitdem weiter ausgebaut wurde. Mittlerweile wird die Einsatzbegleitung auch als Rezertifizierung der Notfallsanitäter eingesetzt. Weil der Rettungsdienst in MKK aktiv ein Telenotarzt-System einsetzt, wird dieses auch teilweise für die (Tele-)Einsatzbegleitung benutzt.
2.6 Einsatz Supervision und Qualitätssicherung
Einsatzsupervision kann, wenn richtig implementiert, eine entscheidende Rolle bei der Qualitätssicherung im Rettungsdienst spielen, indem sie direkt vor Ort eine kontinuierliche Bewertung und Verbesserung der Notfallversorgung ermöglicht. Vergleichbar mit sog. Proficiency Checks, welche in großen gewinnorientierten Unternehmen sowie der Luftfahrt allgemeine Standards sind, können speziell ausgebildete Supervisoren bei Einsätzen die Einhaltung von Protokollen und Standards überwachen und unterstützen (Redelsteiner 2018).
Insgesamt unterstützt die Einsatz-Supervision eine Kultur der Exzellenz im Rettungsdienst, indem sie eine Brücke zwischen theoretischem Wissen und praktischer Anwendung bildet. Sie ist ein zentrales Element der Qualitätssicherung, das hilft, die Versorgungsstandards kontinuierlich zu überprüfen, zu erhalten und zu verbessern. Die Supervision ermöglicht es dem Rettungsdienst, sich an sich ändernde Anforderungen anzupassen und eine hochwertige Patientenversorgung zu gewährleisten.
3 Material und Methoden
Für die Testphase und deren Vorbereitung wurde eine Vielzahl an Material und Methoden verwendet. Es folgt eine detaillierte Auflistung und Beschreibung dieser Punkte, wohingegen die angefertigten Dokumente im Anhang dieser Arbeit zu finden sind. Sofern nicht anders gekennzeichnet oder zitiert, wurden sämtliche Unterlagen selbst erstellt.
3.1 Projektbeginn und Vorbereitungsphase
Am 12.05.2023 wurde das Projektvorhaben der kollegialen Einsatzbegleitung als Bachelorarbeitsthema dem Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuz Rettungsdienst Heidenheim-Ulm gGmbH (DRK RDHU) und gleichzeitigem Praxisansprechpartner vorgestellt und wurde durch diesen genehmigt.
3.1.1 Konzeption des Projektablaufs und Projektdesign
Aufgrund des hohen organisatorischen Aufwandes wurde ab der Genehmigung des Projektes mit der Ausarbeitung und Vorbereitung begonnen. In zwei weiteren Sitzungen im Mai 2023 mit dem Geschäftsführer und stv. Geschäftsführer (Fachbereichsleitung Zentrale Dienste im DRK RDHU) einigte man sich auf ein an das deutsche Rettungsdienstsystem angepasstes Konzept sowie die grundlegenden Regelungen der kollegialen Einsatzbegleitung. In den darauffolgenden Monaten wurden mehrere Versionen des Feedbackprotokolls für die Qualitätssicherung erstellt und der Geschäftsführung vorgestellt sowie gemeinsam diskutiert. Kritik und Verbesserungsvorschläge wurden notiert und im Anschluss umgesetzt.
Angesichts §35 Absatz 5a StVO dürfen Fahrzeuge des Rettungsdienstes Sonderrechte nur in Anspruch nehmen, wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden. Da die Einsatzbegleiter keine medizinischen Tätigkeiten mit oben genannten Kriterien durchführen, sondern rein für die Supervision und das mobile Qualitätsmanagement zuständig sind, liegt hier keine Berechtigung der Nutzung von Sonder- und Wegerechten vor. Aus diesem Grund wurde entschieden, dass die Einsatzbegleiter im Gegensatz, zu den Wiener Field Supervisoren, kein eigenes Einsatzfahrzeug besetzen. Stattdessen sind sie auf den zwei Hauptrettungswachen in Ulm und Heidenheim stationiert und steigen vor Einsatzbeginn zusammen mit der Besatzung auf den jeweiligen RTW mit dazu. Somit wird der Einsatz von Beginn bis Ende begleitet, mit einem anschließenden Einsatznachgespräch („Debriefing“) an der Zielklinik oder an der Rettungswache. Nach Rückkehr des begleiteten RTW auf die Rettungswache verlässt der Einsatzbegleiter das Einsatzteam und steigt bei dem nächstbesten geeigneten Einsatz auf den jeweiligen RTW mit dazu. Auf beiden Hauptrettungswachen sind tagsüber drei RTW zeitgleich stationiert und werden nach dem Zufallsprinzip begleitet, sodass es keine „1zu1“ Begleitung eines einzigen RTWs über eine gesamte Schicht gibt.
Arbeitszeiten
Arbeitszeiten der Einsatzbegleiter sind wochentags von 8:00 bis 16:00 Uhr. Wie in Tabelle 5 veranschaulicht, werden somit aufgrund der unterschiedlichen Schichtzeiten von jedem RTW die größtmögliche Menge an Schichten abgedeckt. Das bedeutet, pro Tag können in Heidenheim bis zu sechs unterschiedliche Einsatzteams und in Ulm bis zu fünf unterschiedliche Einsatzteams begleitet werden.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 5: Schichtabdeckung der Einsatzbegleitung
Durchführungszeitraum
Initial geplant war eine Durchführungsphase von dem 01.10.2023 bis zum 22.12.2023. Angesichts geplanter Mitarbeiterbesprechungen Anfang November wurde der Beginn der Durchführungsphase jedoch auf Dezember verschoben, um die Testphase hier den Mitarbeitern vorstellen zu können. Außerdem wurde die Testphase mit Beginn im Dezember gleichzeitig auf zwei Monate verkürzt, damit genügend Zeit zur Auswertung bis zur Abgabe dieser Arbeit bleibt.
Einsatzindikation
Indikation für die Begleitung durch einen Einsatzbegleiter war jeder RTW- Einsatz mit oder ohne Sonderrechte bei dem kein Notarzt mit alarmiert ist. Grund hierfür ist einerseits, weil die Qualitätssicherung primär bei DRK-Mitarbeitern erfolgen soll und andererseits, weil die Fokusgruppe für die Feedbackgespräche, Notfallsanitäter und Rettungssanitäter sein soll.
Handlungsvorgabe für die Einsatzbegleiter
Vor allem zu Beginn der Testphase war es wichtig, dass die Einsatzbegleiter sich bei Schichtbeginn einmal bei allen anwesenden Einsatzteams vorstellen und Ihre Aufgabe, die Grundregeln erklären sowie Unsicherheiten oder offene Fragen beantworten.
Hauptfokus während der Einsatzbegleitung ist einerseits das mobile Qualitätsmanagement in Form des ausgefüllten Protokolls und andererseits das qualitative Einsatznachgespräch fürdas Rettungsteam. Dementsprechend sind die Einsatzbegleiter den gesamten Einsatz über in der Beobachterrolle und sollen nicht aktiv an dem Einsatzgeschehen teilnehmen. Kleinere Hilfsstellungen wie Material mitnehmen oder beim Umlagern helfen sind erlaubt. Falls für die Versorgung eines kritischen Patienten eine zusätzliche Ressource benötigt wird, steht das Wohl des Patienten selbstverständlich im Vordergrund und das Einsatzteam wird aktiv unterstützt. Ansonsten soll der Einsatzbegleiter das Einsatzgeschehen nie aktiv beeinflussen. Tatsächlich eingreifen bzw. unterstützen soll er nur, wenn eine Patientenschädigung unmittelbar bevorsteht, wie z.B. bei der Gabe eines kontraindizierten Medikamentes. Aber auch hier darf erst unmittelbar vor Gabe des Medikamentes interveniert werden, um Sicherheitssysteme wie bspw. den 4- Augen-Check oder das 1O-für-1O zu kontrollieren.
Sondersituationen
Es wurden unterschiedlichste Sondersituationen definiert und mit der Geschäftsführung abgesprochen. Das gesamte Konzept sowie alle definierten Sondersituationen sind in Anhang 14 hinterlegt. Hier als Beispiel die Vorgabe, falls ein Notarzt mit am Einsatzort ist:
Nachforderung eines Notarztes:
- Sobald der Notarzt eingetroffen ist, endet die Dokumentation der medizinischen Maßnahmen
- Supervision der Non-technical Skills werden normal weitergeführt
- Hierbei beachten:
- Nur DRK-Mitarbeiterwerden begleitet, nicht die Notärzte
Folgeeinsatz mit Notarzt:
- Keine Dokumentation der med. Maßnahmen
- Weiterhin Supervision der Non-technical Skills
- Hierbei beachten:
- Nur DRK-Mitarbeiterwerden begleitet, nicht die Notärzte
Notarzt begleitet Patiententransport:
- Falls kein Platz mehr im RTW => Mitfahrt im NEF bis Zielklinik
3.1.2 Konzeption des Feedbackprotokolls
Wie in Abschnitt 3.1.1 bereits beschrieben durchlief das Feedbackprotokoll mehrere Entwicklungsschritte, welche in enger Absprache mit der Geschäftsführung verliefen. Alle unterschiedlichen Versionen des Protokolls sind in Anhang 4.1 bis 4.7 zu finden. Version 3.4 ist die finale Version, mit welcher in der Testphase dokumentiert wurde und hier aufgezeigt wird. Wichtiger Kritikpunkt in der Entwicklung des Protokolls ist die Anonymität der Mitarbeiter. Dies bedeutet, dass in keinem der Protokolle die jeweils begleiteten Mitarbeiter rückverfolgt werden können.
Das Protokoll bzw. der Fragebogen ist in drei Abschnitte unterteilt: 1. Die Einsatzbeobachtung, 2. die Einsatznachbesprechung und 3. die Einsatzbeurteilung. Dies soll eine feste Struktur sowie eine flüssigere Dokumentation während des Einsatzes gewährleisten. Im Folgenden werden die Abschnitte einzeln vorgestellt.
1. DieEinsatzbeobachtung:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: I.Einsatzbeobachtung, die Technical Skills
Hier geschieht die rein objektive Beobachtung und Dokumentation während des Einsatzes. Sie ist aufgeteilt in die Technical Skills (das Medizinische) und die Non¬technical Skills (die Kommunikation).
Begonnen wird mit dem angetroffenen Patientenzustand, um einen Zusammenhang zwischen dem initialen Patientenzustand und den anschließend getroffenen Maßnahmen zu untersuchen.
Die Technical Skills sind nach dem in der Medizin gängigen ABCDE-Schema strukturiert. Wie in Abbildung 8 erkennbar, wird zwischen der erhobenen Anamnese am Patienten, also was genau untersucht wurde und den durchgeführten Maßnahmen unterschieden. Die erhobene Anamnese soll Rückschluss darüber geben, ob und wie ausführlich die Patienten untersucht wurden. Als Beispiel, ob bei einem kritischen Patienten eine vollständige standardisierte Untersuchung nach dem ABCDE Schema durchgeführt wurde oder etwas vergessen wurde. Zudem lässt es Rückschlüsse ziehen, ob bei Erkennen einer Pathologie auch eine adäquate Maßnahme stattgefunden hat, z.B. ob bei einem Patienten mit Dyspnoe und einer niedrigen Sauerstoffsättigung überhaupt eine Sauerstoffgabe und in welchem Umfang erfolgt ist.
In dem Feld unter „E“ sind weitere unterschiedliche Indikatoren. Da die medizinische Dokumentation automatisch endet, sobald der Notarzt die medizinische Behandlung übernimmt, ist das Feld „Wenn Notarzt jemals anwesend war“ ein Kontrollfeld. Wenn hier angekreuzt ist, sind alle fehlenden Untersuchungsbefunde und Maßnahmen in Anwesenheit des Notarztes erfolgt.
Des Weiteren wird in dem Feld unter „E“ dokumentiert, ob die Aufklärung situationsangepasst stattgefunden hat, nach welcher Handlungsempfehlung gearbeitet wurde, ob von dieser Handlungsempfehlung abgewichen wurde, ob und nach welcher Zeit die Arbeitsdiagnose kommuniziert wurde und ob/nach welcher Zeit ein Notarzt nachgefordert wurde.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Abschnitt der Non-technical Skills
Die Non-technical Skills beziehen sich auf die Kommunikations- und Interaktionsskills während des Einsatzes. Der erste Part sind positive sowie negative Adjektive aus dem Verhaltenscodex des DRK RDHU, um die Kommunikation des Teams zu beschreiben. Unterschieden wird in der Bewertung zwischen der Kommunikation gegenüber dem Patienten und Angehörigen, im Einsatzteam selbst und gegenüber externen Akteuren wie z.B. der Integrierten Leistelle oder dem Krankenhaus.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 9: Abschnitt der Non-technical Skills
Der zweite Part ist eine Einschätzung, ob und in welchem Ausmaß die CRM- Leitsätze im Einsatz angewendet wurden und welche weiteren CRM-Ressourcen genutzt wurden.
2. Die Einsatznachbesprechung:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 10: Die Einsatznachbesprechung
Hier können während des Einsatzes bestimmte Ereignisse festgehalten werden, welche in dem Einsatznachgespräch angesprochen oder aufgearbeitet werden sollen. Das offen gestaltete Notizfeld soll den Einsatzbegleitern Struktur für ihr Nachgespräch geben und sie auf die 3 wichtigsten Ereignisse begrenzen, um die Teilnehmer nicht mit Informationen zu überladen. Einerseits, um eine einheitliche Debriefing-Struktur zwischen allen Einsatzbegleitern und andererseits ein wertungsfreies Debriefing zu gewährleisten, soll das Einsatznachgespräch anhand der in Simulationstrainerkursen gelehrten ,,3B- Methode“ strukturiert sein. Die 3B stehen für Beobachten/Benennen, Bewerten und Befragen. Hierbei wird die Beobachtung (Situation) von der Bewertung getrennt und gibt dem Gegenüber die Möglichkeit, seine Motivation hinter dem Verhalten zu erklären. (Heimberg et al. 2021)
Zudem kann, falls notwendig, stichwortartig die Begründung des Teamleaders für ein Abweichen von der Handlungsempfehlung, das Nachfordern des Notarztes oder eine unvollständige Aufklärung notiert werden.
1. DieEinsatzbeurteilung:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 11: Die Einsatzbeurteilung
Nach dem abgeschlossenen Einsatz erfolgt die Einsatzbeurteilung durch den jeweiligen Einsatzbegleiter. Begonnen wird mit der Aufklärung. Ob diese vollständig oder unvollständig war und wenn unvollständig, was gefehlt hat. Als Nächstes, ob die durchgeführten Maßnahmen indiziert bzw. nicht indiziert waren oder ob indizierte Maßnahmen nicht durchgeführt wurden, sowie ein Textfeld für die nicht durchgeführten Maßnahmen. Es folgen die CRM-Leitsätze und, falls der Patient ambulant versorgt wurde, ob dies indiziert oder nicht indiziert war.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 12: Die Einsatzbeurteilung - Verbesserungsvorschläge
Falls den Einsatzbegleitern Defizite oder Verbesserungsvorschläge während des Einsatzes aufgefallen sind, können diese hier dokumentiert werden. Defizite in den Technical-und Non-technical Skills können durch Fort- und Weiterbildungsangebote verbessert werden. Defizite oder Verbesserungsvorschläge in der Struktur- und Prozessqualität können z.B. durch das Anpassen von Arbeitsprozessen oder Standard Operating Procedures (SOPs) ausgebessert werden.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 13: Unterstützung durch den Einsatzbegleiter
Für den Fall, dass der Einsatzbegleiter aktiv mitarbeiten musste, wird hier dokumentiert aus welchem Grund er mitarbeite musste. Bspw. ob eine weitere Ressource benötigt wurde oder wichtiger, ob und was für eine Patientenschädigung unmittelbar bevorstand.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 14: Kommunikation anhand des DRK-Codex
Zum Schluss erfolgt die Beurteilung der Kommunikation durch den Einsatzbegleiter anhand des DRK RDHU Codex und der ebenfalls vorliegenden Erwartungstabelle.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 15: Erwartungstabelle
3.1.3 Gewählte Qualitätsindikatoren:
Aufgrund der Rahmenbedingungen dieser Arbeit können nicht alle Qualitätsindikatoren ausgewertet und die Ergebnisse aufgezeigt werden. Deswegen wurde sich bei der Auswertung auf Qualitätsindikatoren konzentriert, welche nicht durch die SQR-BW oder andere bestehende Qualitätssicherungssysteme untersucht werden können. Die in dieser Arbeit ausgewerteten Indikatoren sind in der untenstehenden Aufzählung in fett geschrieben.
Folgende aufgeführte Qualitätsindikatoren sind aus dem erstellten Feedbackprotokoll auswertbar:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 6: Technical Skills - Indikatoren
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 7: Non-technical Skills - Indikatoren
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 8: Einsatzbeurteilung - Indikatoren
Vollständiges Feedbackprotokoll Version 3.4
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 16: Feedbackprotokoll Vers 3.4
1.1.4 Auswahl der Probanden
Die Probanden wurden in Absprache mit der Geschäftsführung sowie der Projektleitung von der Rettungsdienstleitung ausgewählt. Auswahlkriterien waren eine Berufserfahrung von mind. 5 Jahren, bestenfalls eine Weiterbildung zum Praxisanleiter oder eine andere vergleichbare pädagogische Weiterbildung sowie als wichtigstes Auswahlkriterium, eine hohe Sozialkompetenz. Führungskräfte mit höhergradigen Führungspositionen fielen aufgrund des vorhandenen Hierarchieunterschiedes und damit Wegfällen einer stabilen Vertrauensbasis automatisch heraus. Ausgewählt wurden insgesamt vier Probanden - jeweils zwei pro Rettungswache - mit den folgenden Qualifikationen:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 9: Qualifikation der Probanden
1.1.5 PreTest des Feedbackprotokolls
Mit Fertigstellung der Version 3.0 (siehe Anhang 4.3) wurde ein PreTest des Feedbackprotokolls im Unterricht von Notfallsanitäter-Schüler bei Fallbeispielen durchgeführt. Für einen besseren Dokumentationsfluss und mehr Übersichtlichkeit während des Einsatzgeschehens wurden die CRM-Leitsätze ausgeschrieben und somit das Design von zwei auf drei Seiten erweitert.
Im Anschluss wurde Version 3.1 im Realeinsatz getestet, während Notfallsanitäter- Schüler des dritten Lehrjahres die Einsätze geleitet haben. Basierend auf dem dokumentierten Feedbackprotokoll wurde anschließend eine
Einsatznachbesprechung durchgeführt, um zudem die Praxistauglichkeit des Protokolls für Feedbackgespräche zu testen. Basierend auf dem zweiten PreTest wurde das Design erneut angepasst sowie die nummerischen Bewertungskriterien von einem sechsstufigen Notensystem in ein vierstufiges Bewertungssystem mit definierter Erwartungstabelle abgeändert. Einerseits, um ein Gefühl der schulischen Notenbewertung zu verhindern und andererseits, um eine Tendenz zur Mitte bei der Bewertung zu vermeiden. (Siehe hierfür Feedbackprotokoll Version 3.2 & 3.3 im Anhang 4.5 & 4.6)
1.1.6 Information der Mitarbeiter
Wie auch schon bei der Einführung des Qualitätssicherungspartners (später Feld Supervisor) des Wiener Roten Kreuzes oder des Field Supervisors der Wiener Berufsrettung mehrfach beschrieben, ist die Akzeptanz der Mitarbeiter ein wichtiges Kriterium für das erfolgreiche Einführen solch eines Konzeptes. Um eine möglichst hohe Akzeptanz der Mitarbeiter in Bezug auf die kollegiale Einsatzbegleitung zu erreichen, wurden unterschiedliche Ansätze gewählt. Wie oben schon angesprochen, wurde der Beginn der Testphase auf Dezember verschoben, sodass der Geschäftsführer die Testphase persönlich allen Mitarbeitern in den Mitarbeiterversammlungen Anfang November vorstellen kann. Mitte Novemberwurden die Mitarbeiter über ein Rundschreiben ausführlicher über das geplante Projekt informiert. Siehe hierfür Anhang 8.
Ein weiterer wichtiger Punkt in Bezug auf das Informieren und die Akzeptanz der Mitarbeiter war, die Auswahl der richtigen Einsatzbegleiter. Sobald die Einsatzbegleiter rekrutiert und eingearbeitet wurden, kamen viele Mitarbeiter von alleine auf die Einsatzbegleiter zu und informierten sich erneut und sprachen Unsicherheiten an.
Von Beginn des Projektes an wurde der Betriebsratsvorsitzende des DRK regelmäßig über den aktuellen Stand informiert. Sobald das Konzept und die Rahmenbedingungen größtenteils ausgearbeitet waren, wurde dieses dem gesamten Betriebsrat vorgestellt. Angefallene Kritik sowie Verbesserungsvorschläge wurden umgesetzt.
Ebenfalls von Beginn des Projektes an, wurde derÄrztliche Verantwortliche Rettungsdienst (ÄVRD) aus Ulm, Prof. Dr. med. Kühlmuß, regelmäßig über den aktuellen Stand des Projektes informiert und bei Fragen der Qualitätssicherung mit einbezogen. Vor Beginn derTestphase stellte Prof. Kühlmuß das Projekt bei den ÄVRD aus Heidenheim vor.
3.2 Schulungsphase
Einarbeitung der Einsatzbegleiter
Aufgrund der kleinen Gruppe an Probanden wurde sich zu einem vierstündigen Termin mit allen vier Einsatzbegleitern auf der Rettungswache Heidenheim getroffen. Zu Beginn wurde das Konzept der kollegialen Einsatzbegleitung sowie die Grundregeln und Sonderregelungen besprochen. Im Anschluss erfolgte die Vorstellung des Feedbackprotokolls. Jeder Abschnitt wurde gemeinsam durchgesprochen und Unklarheiten geklärt. Für Ausschnitte der Vorstellungspräsentation sieheAnhang 13.
Nach erfolgreicher Einarbeitung der Einsatzbegleiter bekam jeder Teilnehmer ein DIN A3 Klemmbrett zur leichteren Dokumentation während der Einsätze. Mit inbegriffen in dem Klemmbrett waren eine laminierte Version des DRK-Verhaltenscodex, ein Kugelschreiber und eine leere Tabelle für die Dokumentation der anzurechnenden Fortbildungsstunden (Anhang 15).
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 17: Einsatzbuddy-Patch (Quelle: https://gearbuddies.de/en/collections/tex til-lasercut-patches-feuerwehr-
Zusätzlich bekam jeder Einsatzbegleiter einen eigenen „Einsatzbuddy“-Patch zur Teamstärkung, Identifizierung mit dem Projekt und minimalistischen Kennzeichnung nach außen hin. Ob die Teilnehmer den Patch während des Einsatzes tragen, wurde Ihnen selbst überlassen.
3.3 Durchführungsphase
3.3.1 Feedbackprotokoll
Auf der Rettungswache Heidenheim standen während der Testphase zwei Dokumentenfächer in einem nicht öffentlich zugänglichen Büro, zu dem jedoch beide Einsatzbegleiter freien Zugang hatten. Hiervon war eine Dokumentenablage für neue, noch nicht ausgefüllte Feedbackprotokolle und eine Dokumentenablage für die ausgefüllten Feedbackprotokolle. Aufgrund des Datenschutzes für die bereits ausgefüllten Protokolle wurde sich explizit für ein nicht öffentlich zugängliches Büro entschieden. Alles ausgefüllten Protokolle wurden in dem Büro gesammelt und nach Ende der Testphase zurAuswertung abgeholt.
Angesichts Schwierigkeiten, den Datenschutz aufgrund räumlicher Umstände einzuhalten, wurde sich in Ulm dazu entschieden die neuen, noch nicht ausgefüllten Protokolle im Sekretariat vorzuhalten, welches tagsüber von 8-16 Uhr besetzt ist. Die ausgefüllten Protokolle wurden in den persönlichen Briefkasten der Projektleitung geworfen, sodass sie nicht öffentlich einsehbar waren.
Alle Protokolle wurden im Anschluss an die Testphase eingesammelt, eingescannt und mittels eines annotated Case Report File (aCRF) von Hand in Excel übertragen. Für den vollständigen aCRF siehe Anhang 5.
Annotated Case Report File des Feedbackprotokoll 3.4:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 18: Annotated CRFFeedbackprotokoll 3.4
3.3.2 Befragung der Teilnehmer
Nach Ende der Testphase wurde über den Blog des Mitarbeiterportal des DRK RDHU ein Rundschreiben sowie der Link für eine Google Forms Umfrage an alle Mitarbeiter verteilt. (Siehe Anhang 10)
Ziel der Befragung war zum einen, die Menge an teilgenommenen Mitarbeitern zu eruieren und zum anderen, die Akzeptanz und den Nutzen des Projektes für die Mitarbeiter herauszufinden. Zudem wurden Verbesserungsvorschläge und Kritik für die Weiterentwicklung des Konzeptes gesammelt.
Aufgrund der Rahmenbedingungen dieser Arbeit und weil die Befragung der Teilnehmer nicht dazu dient, die Forschungsfragen zu beantworten, wird die Befragung kurz aufgezeigt, jedoch nicht vollständig darauf eingegangen. Der vollständige Fragebogen ist im Anhang 11 zu finden.
Der Online-Fragebogen besteht aus 16 Fragen und dauert ca. 5 Minuten auszufüllen. Frage Nr. 1 bis 6 sind geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antworten zum Auswählen.
In Frage Nr. 7 bis 12 sollen die Teilnehmer die aufgeführten Aussagen mit einer Skala von 1 bis 5 Bewerten. (1 = Trifft gar nicht zu / 2 = Trifft eher nicht zu / 3 = Trifft teilweise zu / 4 = Trifft größtenteils zu / 5 = Trifft voll und ganz zu).
Frage Nr. 13 und 14 sind geschlossene Fragen mit den zwei untenstehenden Antwortmöglichkeiten.
Frage Nr. 15 und 16 sind offen gestellte Fragen mit einem freien Textfeld für die Antworten
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 10: Mitarbeiterumfrage kollegiale Einsatzbegleitung
3.3.3 Abschlussbefragung der Einsatzbegleiter
Nach Ende der Testphase wurde mit allen Einsatzbegleitern einzeln ein leitfadengestütztes Interview geführt. Das Interview ist aufgeteilt in die Themenbereiche Teilnehmer, Konzept, Feedbackprotokoll und Allgemeines mit jeweils zwei bzw. drei Fragen pro Themenbereich.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 11: Leitfadengestütztes Interview der Einsatzbegleiter
Es wurde sich explizit für ein leitfadengestütztes Interview entschieden, um eine bessere Vergleichbarkeit der persönlichen Aussagen und der beiden Rettungsdienstbereiche zu erzielen. Für den vollständigen Fragebogen siehe Anhang 12.
4 Ergebnisse
4.1 Ergebnisse der Feedbackprotokolle (Hauptfokus)
Aufgrund eines Krankheitsfalles konnte die Einarbeitung der Einsatzbegleiter erst am Freitag den 08.12.2023 stattfinden. Sie ist erfolgreich am 12.12.2023 gestartet und wurde am 30.01.2024 beendet. Es wurden in der Testphase insgesamt 62 Einsätze begleitet und 62 Protokolle ausgefüllt. Hiervon 44 durch die Einsatzbegleiter in Heidenheim und 18 In Ulm.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der ausgewählten Qualitätsindikationen vorgestellt. Die Exceltabelle mit allen gesammelten Daten ist in Anhang 16 zu finden. Alle ausgefüllten Feedbackprotokolle in Anhang.
Hat die Aufklärung situationsangepasst stattgefunden?
In 48 % (n = 30) der Einsätze hat die Aufklärung situationsangepasst stattgefunden
Wie häufig wurde nach einer Handlungsempfehlung gearbeitet?
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 12: Handlungsempfehlungen BW 3.1
Wurdevon den Handlungsempfehlungen abgewichen?
In n = 3 (0,4 %) Fällen wurde von der jeweiligen Handlungsempfehlung abgewichen. In einem Fall wurde durch den anwesenden Hausarzt abgewichen. Im zweiten Fall wurde abgewichen, weil zusätzlich zu dem Schlaganfall noch eine Fraktur versorgt werden musste. Im dritten Fall wurde bei einem Krampfanfall in der Titrierung der Midazolam-Gabe abgewichen, hierfür gab es auf Nachfrage jedoch keine Begründung seitens des Einsatzteams.
Nach welcher Zeit wurde die Arbeitsdiagnose kommuniziert?
Zu 74 % (n = 46) wurde eine Arbeitsdiagnose mit dem Team in einer durchschnittlichen Zeit von 5 Minuten und 20 Sekunden kommuniziert.
Nach welcher Zeit wurde ein Notarzt nachgefordert?
Bei allen 62 begleiteten Einsätzen wurde fünf Mal (8 %) ein Notarzt von dem anwesenden RTW-Team nach einer durchschnittlichen Zeit von 6 Minuten und 20 Sekunden nachgefordert. Angegebene Gründe für das Nachfordern des Notarztes waren ein aktiver Krampfanfall, Atemnot mit Schockzeichen und eine Analgosedierung bei schlechtem Allgemeinzustand.
Wie häufig und welche Medikamente wurden eigenständig gegeben?
In 12 % der Einsätze (n = 8) wurde eigenständig durch Notfallsanitäter ohne die Anwesenheit eines Notarztes Medikamente gegeben. Gegebene Medikamente waren einmalig Midazolam, um einen Krampfanfall zu durchbrechen; in zwei Fällen Urapidil, um den Blutdruck zu senken; Novalgin gegen Schmerzen; Salbutamol & Atrovent vernebelt, Adrenalin gegen eine Anaphylaxie und Midazolam mit Ketanest zur Analgosedierung. In einem weiteren Fall wurden Morphin, Urapidil, Ondansetron und Furosemid selbstständig aufgezogen und in Anwesenheit des nachgeforderten Notarztes verabreicht.
Wie positiv oder negativ war die Kommunikation gegenüber Patienten und Angehörigen / im Team / gegenüber Externen?
In insgesamt ausgefüllten 61 Protokollen, wurde ausgezählt, wie häufig, mit welchem Qualitätsaspekt der Kommunikation (Offen, Freundlich, Ruhig, etc...) bewertet wurde.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 13: Bewertung der Kommunikation
Zur leichteren Übersicht wurden alle Ergebnisse der positiven Bewertungen in Tabelle 13 zusammengefasst und in Abbildung 20 visualisiert. Zwischen den unterschiedlichen Kommunikationspartnern ergibt sich ein einheitliches Bild.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 19: Kommunikation nach DRK-Codex
Von 61 möglichen positiven Punkten wurden in allen drei Kategorien jeweils die Qualitäten Freundlich mit (n = 51 - 53), Ruhig mit (n = 50 - 54) und Professionell mit (n = 46 - 50) am häufigsten ausgewählt. Gefolgt von Sachlich mit (n= 34-41) und Offen mit (n = 32 - 37). Zum Schluss kommen Konstruktiv (n = 24 - 28), Adressatengerecht (n = 19 - 26) und Deeskalierend (n = 15 - 20).
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 20: Netz-Matrix Kommunikation nach DRK-Codex
Wird eine Netz-Matrix mit den vorliegenden Ergebnissen erstellt, zeigt sich ein einheitliches Bild, mit Stärken in Punkto Freundlichkeit, Professionalität sowie ruhiges und sachliches Auftreten. Demgegenüber liegen Defizite bei Adressatengerecht, Deeskalierend und Konstruktiv vor.
Bei den negativen Bewertungen hingegen wurde in der Kommunikation mit Patienten und Angehörigen nur einmal unfreundlich und einmal gestresst angegeben. Bei der Kommunikation im Team wurde zweimal gestresst angegeben. Bei der Kommunikation mit Externen wurde allerdings keine einzige negative Bewertung angegeben.
Wie häufig und in welcher Qualität wurden CRM-Leitsätze angewendet?
Insgesamt wurde 447 Mal einer der 15 CRM-Leitsätze in den 62 begleiteten Einsätzen angewendet. Im Durchschnitt sind das 7,2 angewendete Leitsätze pro Einsatz.
In einer Rangfolge der am häufigsten bis am wenigsten genutzten Leitsätze ist die Nr. 2 „Antizipiere und plane voraus“, mit n = 47 am häufigsten verwendet worden. Der am wenigstens Verwendete Leitsatz mit n = 6 ist die Nr. 11 „Verwende Merkhilfen und schlage nach“.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Jeder der verwendeten Leitsätze wurde mit einer 4 Stufen Bewertungstabelle bewertet, bestehend aus „Vollständig erfüllt“, „Überwiegen erfüllt“, „Teilweise erfüllt“ und „Gar nicht erfüllt“. Wenn diese Bewertungstabelle in ein Notensystem von 1 bis 4 abgeändert wird, ergibt sich ein Notendurchschnitt aller CRM-Leitsätze von 1,5.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 14: Notendurchschnitt CRM-Leitsätze
Am besten bewerteter Leitsatz ist hier die Nr. 1 „Kenne deine Arbeitsumgebung“ mit einer 1,2 und am schlechtesten bewerteter Leitsatz wieder die Nr. 11 „Verwende Merkhilfen und schlage nach“ mit einer 2,2.
War die Anamnese an die Situation angepasst und vollständig?
In 79 % (n = 49) der Fälle war die Anamnese an die Situation angepasst und vollständig. Siebenmal (11 %) wurde nichts angegeben und in sechs Fällen (10 %) war die Anamnese nicht vollständig. Als fehlend angegebene Anamnese waren jeweils einmalig die Auskultation, der Blutzucker, das ZOPS-Schema, das SAMPLERs Schema und Allergien.
Waren die durchgeführten Maßnahmen indiziert?
Die durchgeführten Maßnahmen waren zu 82 % (n = 51) indiziert. Zehnmal (16 %) wurde nichts angegeben und einmal (2 %) wurde eine indizierte Maßnahme nicht durchgeführt, weil der Patient sie verweigert hat.
Wurden alle notwendigen CRM-Leitsätze genutzt?
Zu 66 % (n = 41) der Zeit wurden alle notwendigen CRM-Leitsätze genutzt. Bei 8 % (n = 5) wurde angegeben, dass alle notwendigen Leitsätze genutzt wurden, aber noch weitere hätten benutzt werden können. Bei 10 % (n = 6) hätten weitere CRM- Leitsätze genutzt werden können. Zehnmal (16 %)wurde nichts angegeben.
An indizierten, aber nicht genutzten CRM-Leitsätzen wurde mit (n = 5) am häufigsten das 10-für-10-Prinzip angegeben. Zweimal wurde die Nr. 5 und jeweils einmal die Nr. 6, 7, 9, 12 und 15 angegeben.
War die ambulante Versorgung indiziert?
In sieben begleiteten Einsätzen wurden die Patienten ambulant durch das Einsatzteam versorgt. Aus Sicht der Einsatzbegleiter waren diese ambulanten Versorgungen zu 100% (n = 7) indiziert.
Verbesserungsvorschläge
Im Folgenden sind einige Beispiele der notierten Verbesserungsvorschläge, aufgeteilt in Technical-Skills, Non-technical-Skills und Struktur-/Prozessqualität.
Technical-Skills
- Funken
- Absicherung aller Nebenwirkungen
- Aufziehen der Medikamente
- In-Line Stabilisation
Non-technical-Skills
- Wertungsfreie Fragen
- Sicher kommunizieren
- Keine Suggestivfragen
- Eine Person spricht mit Pat., nicht drei
- Strukturierte Aufgabenverteilung, nicht zulassen, dass beide Teammitglieder den Einsatzort verlassen
- Notarzt aktiv zur Kommunikation auffordern
- Differenzialdiagnose kommunizieren
Prozess-/Strukturqualität
- CRM Effektiv nutzen
- Einsatzbereitschaft vor Ort
- 10-für-10optimieren
Wurde Unterstützung durch den Einsatzbegleiter benötigt?
Eine Unterstützung durch den Einsatzbegleiter wurde insgesamt vier Mal benötigt. Drei von den vier Mal wurde eine weitere Personalressource benötigt. Einmal hat der Einsatzbegleiter eine indizierte, abervergessene Maßnahme vorgeschlagen.
Kommunikation / Verhalten anhand des DRK-Codex
Die Beurteilung des Verhaltens anhand des DRK-Codex wurde 57 Mal ausgefüllt.
In den fehlenden 5 Protokollen wurde hierzu keine Aussage getroffen.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Auch hier zeigt sich ein einheitliches Bild in der Kommunikation sowohl mit den Patienten & Angehörigen, im Team, als auch mit den Externen.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 15: Kommunikation anhand des DRK-Codex
Wird die Bewertung in Notenwerte abgeändert, sodass „Vollständig erfüllt“ für eine 1, „Überwiegen erfüllt“ für eine 2, „Teilweise erfüllt“ für eine 3 und „Gar nicht erfüllt“ für eine 4 steht, ergibt sich ein Notendurchschnitt von:
- Kommunikation mit Patienten und Angehörigen: 1,4
- Kommunikation im Team: 1,3
- Kommunikation mit Externen: 1,3
Es gibt ein negatives Beispiel, bei welchem die Kommunikation mit Patienten & Angehörigen als „Gar nicht erfüllt (Note 4)“ und die Kommunikation im Team sowie mit Externen als „Teilweise erfüllt (Note 3)“ bewertet wurde.
4.2 Ergebnisse der Abschlussbefragung der Teilnehmer
Aufgrund der Rahmenbedingungen dieser Arbeit und weil der Hauptfokus auf dem Feedbackprotokoll liegt, werden die Ergebnisse der Teilnehmerbefragung nicht ausführlich aufgezeigt. Die vollständige Auswertung ist in Anhang 17 zu finden.
Zum Zeitpunkt der Auswertungen haben 18 Teilnehmer an der Umfrage teilgenommen. Hiervon sind 5 Notfallsanitäter und Praxisanleiter, 5 Notfallsanitäter, 1 Notfallsanitäter in Ausbildung und 6 RettungssanitäterAhelfer. Von den Teilnehmern arbeiten 14 in Ulm, 2 in Heidenheim und 2 in Blaubeuren/Ehingen.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
9 Teilnehmer hatten keine Einsatzbegleitung, n = 5 hatten eine und jeweils n = 1 Teilnehmer hatten drei oder vier Einsatzbegleitungen während der Testphase.
In der folgenden Tabelle sind die durchschnittlichen Bewertungen auf die jeweilige Aussage aufgezeigt. Die Bewertungskriterien waren: 1 = Trifft gar nicht zu / 2 = Trifft eher nicht zu / 3 = Trifft teilweise zu / 4 = Trifft größtenteils zu / 5 = Trifft voll und ganz zu
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 16: Abschlussbefragung Teilnehmer
Frage Nr. 13: Auch wenn bei Ihnen keine Einsatzbegleitung durchgeführt wurde, würden Sie sich trotzdem wünschen, dass in Zukunft sporadisch ein sehr erfahrener und sozialkompetenter Kollege bei Ihnen reale Einsätze begleitet und im Anschluss konstruktives Feedback gibt? Ist eine verzweigte Frage, auf welche die Teilnehmer automatisch weitergeleitet wurden, wenn sie „Ehingen/Blaubeuren“ als Wache oder dass bei Ihnen keine Einsatzbegleitung durchgeführt wurde, angegeben haben.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 22: Abschlussbefragung Teilnehmer
Hierbei wurde n = 7 Mal „Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen“, n = 2 Mal „Grundlegeng Ja, jedoch habe ich noch einige Bedenken“ und n = 2 Mal „Nein, definitiv nicht“ als Antwort ausgewählt.
Bei Frage Nr. 14, ob die Teilnehmer sich auf dem Zufallsprinzip basierende, sporadische Einsatzbegleitungen oder selbst buchbare Einsatzbegleitungen über einen gesamten Tag wünschen würden, wurde jeweils genau die Hälfte (n = 9) angegeben.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Ob die Teilnehmer in Frage Nr. 14 negative Erfahrungen oder Bedenken im Zusammenhang mit der kollegialen Einsatzbegleitung haben, wurde zwei Mal wie folgt beantwortet:
- „Qualifikation der Einsatzbegleiter für diese Tätigkeit. Bewertung auch abhängig von persönlichem Kontakt zum Einsatzbegleiter. Istggf. besser, wenn dies jemand aus einem anderen Bereich macht, so können persönliche Dinge besser außen vorgehalten werden.“
- „Unnötig. Eigene Kollegen zu kritisieren. Wird das gesamte Unternehmen spalten.“
Verbesserungen/Veränderungen für das zukünftige Konzept wurde insgesamt 8 Mal beantwortet. Im Folgenden sind die einzelnen Antworten sinngemäß zusammengefasst:
- „Mehr Einsatzbegleitungen, vllt. auch mal bei Notarzteinsätzen“
- „Es wäre besser, wenn man sich den entsprechenden Einsatzbegleiter heraussuchen kann. Das erhöht das gegenseitige Vertrauen und senkt die Hemmschwelle.“
- „Der Einsatzbegleiter sollte über jahrelange Erfahrung im RD, sowie eine sehr hohe Sozialkompetenz und B.Sc. o.ä. haben und nicht erst seit 3 Jahren fertiger NotSan, ORGL, PA usw... Die Einsatzbegleiter sollten von den Mitarbeitern direkt per Liste gewählt werden und die gewählten Personen werden noch dementsprechend geschult“
- „Verpflichtend nach einem Standard um echte Verbesserungen voranzubringen. Eigenen Standard im RDHU schaffen, der auf allen Wachen gilt - keine Ausnahmen.“
- „Sofort einstellen.“
- „Weiterer Ausbau in Anlehnung an FiSu Wien, um bei komplexen Einsätzen einen koordinierenden Leitervor Ortzu haben.
4.3 Ergebnisse der Abschlussbefragung der Einsatzbegleiter
Aufgrund der Rahmenbedingungen dieserArbeit und weil der Hauptfokus aufdem Feedbackprotokoll liegt, werden die Ergebnisse derTeilnehmerbefragung nicht ausführlich aufgezeigt. Stattdessen werden die Antworten mit gleicherAussage zusammengefasst und sinngemäß verkürzt wiedergegeben.
Teilnehmer
Wie war die Reaktion / das Feedback der Teilnehmer über die Einsatzbegleitung?
- Durchwegs positiv, ältere Kollegen waren zu Beginn teilweise etwas skeptisch, haben das Feedbackjedoch offen entgegengenommen.
- Teilnehmer kamen schon vor Projektbeginn auf Einsatzbegleiter zu und haben gefragt, wann die Testphase startet.
- Teilnehmer haben selbstständig in den Dienstplan geschaut, um zu sehen, ob und wer heute Einsatzbegleitung macht.
Waren die Teilnehmer offen gegenüber dem Einsatznachgespräch?
- Jüngere Kollegen waren tendenziell etwas offener für die Feedbackgespräche, ältere Kollegen waren initial nicht verschlossen, mussten aber erst „überzeugt“ werden. Sind im Verlaufe des Projektes jedoch genauso offen geworden.
- Kein Teilnehmer war komplett verschlossen, Feedback wurde mal mehr, mal weniger angenommen.
Konzept:
Was ist deine Meinung über die kollegiale Einsatzbegleitung?
- Gelungenes Konzept, hat in der Testphase gut funktioniert.
- Definitiv etwas, was man sich für die Zukunft vorstellen kann und wünscht.
- Trägt zu selbstreflektiertem Arbeiten im Rettungsdienst bei.
- Macht Rettungsdienst und Arbeitgeber deutlich attraktiver.
War es schwierig auf der Wache auf den RTW mit zuzusteigen?
- Nein, in Ulm kein Problem durch dieALAMOS-Monitore.
- In Heidenheim auch ohne Probleme, da Einsatzteams aktiv die Einsatzbegleiter angerufen haben, wenn ein Einsatz kam; wäre mit ALAMOS-Monitoren jedoch leichter gewesen.
Feedback-Protokoll:
Wie war das Ausfüllen der Protokolle während des Einsatzes?
- Recht viel auszufüllen, aber war machbar. Zu Beginn war es schwierig, den Einsatz aktiv zu beobachten und gleichzeitig das Protokoll auszufüllen; nach einigen Durchläufen hat sich das gebessert.
- Vom strukturellen Ablauf her gut, mehr Fokus auf dem Einsatznachgespräch.
Verbesserungsvorschläge / Wünsche für das zukünftige Feedbackprotokoll?
- Weniger aufwändige Protokolle, damit sich mehr auf den Einsatz konzentriert werden kann.
- Gezielter einzelne Themen untersuchen und hierfür lieber weniger, aber präziser das, was untersucht werden will dokumentieren.
- Digitale Dokumentation.
Allgemeines:
Allgemeine positive Aspekte, die beibehalten werden sollen:
- Information der Mitarbeiter kam gut an.
- Stationierung in Heidenheim aufder Hauptwache; hierdurch wird gesamtes Personal in Heidenheim begleitet.
- Hohe Sozialkompetenz und hohe Akzeptanz bei Kollegen als wichtiges Kriterium für Einsatzbegleiter.
Allgemeine Kritik:
- Testphase war zu kurz; viele Kollegen hatten sich auf Einsatzbegleitung gefreut, aber nie die Chance gehabt, begleitet zu werden.
- Ehingen, Blaubeuren und Laichingen auch mit einbinden, sodass einheitlich gesamter Rettungsdienst eingebunden ist.
Allgemeine Verbesserungsvorschläge:
- DeutlichlängereTestphase.
- Mehr Einsatzbegleiter, zwei pro Wache sind zu wenig. Mindestens vier pro Wache.
- Professionellere Einarbeitung und Vorbereitung, z.B. CRM-Kurse oder Supervisor-Kurse.
- ALAMOS-Monitore in Heidenheim.
5 Diskussion
Im Folgenden sollen die Ergebnisse bewertet, priorisiert und eingeordnet werden. Sofern nicht anderweitig gekennzeichnet, beziehen sich alle Schlussfolgerungen auf die in Punkt 4 genannten, durch das Projekt erlangten wissenschaftlichen Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungsmethoden.
5.1 Bewertung der Ergebnisse des Feedbackprotokolls
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass gerade in der stressigen und hektischen Notfallmedizin, Non-technical Skills einen essenziellen Effekt auf die Qualität medizinischer Maßnahmen spielt. In Fort- und Weiterbildungen wie z.B. hochrealistische Simulationen können diese Skills zwar vermittelt, ihre Anwendung in der Realitätjedoch nicht kontrolliert werden. Die Einsatzbegleitung hat sich als effektives Konzept bewiesen, diese Skills in realen Einsätzen zu kontrollieren - um Defizite aufzudecken - und die Entwicklung zusätzlich noch aktiv in Realeinsätzen zu fördern.
Wenn die Bewertungsergebnisse der Einsatzbegleiter einzeln betrachtet werden, fälltjedoch auf, dass gerade in der Dokumentation der Non-technical Skills einige anwenderbasierte Unterschiede auftreten. Im Hinblick aufdie subjektive Natur der Non-technical Skills war dies in einem gewissen Rahmen zu erwarten und wird auch nicht vollständig eliminiert werden können.
Die teilweise stark auffälligen Unterschiede in diesem Projekt lassen sich jedoch auf den komplexen Aufbau des Feedbackprotokolls, die kurze Einarbeitung der Einsatzbegleiter und die kurze Testphase zurückführen.
Der Indikator, ob die Aufklärung situationsangepasst stattgefunden hat, ist mit 48% auffällig niedrig. Auch hier lässt sich ein auf der Komplexität des Feedbackprotokolls basierender Dokumentationsfehler vermuten, weil der Abschnitt an seinem aktuellen Ort im Protokoll leicht übersehen werden kann.
Trotz der gleichen Anzahl an Einsatzbegleitern ist eine starke Differenz zwischen derAnzahl an begleiteten Einsätzen in Heidenheim und in Ulm erkennbar. Aufgrund seiner Zusatzfunktion als stv. Rettungswachenleitung und einer gleichzeitigen Krankheitswelle mit erhöhtem Personalausfall während der Testphase, konnte besagter Einsatzbegleiter wenige seiner geplanten Schichten antreten. Durch die geringeAnzahl an Einsatzbegleitern pro Wache, konnten die ausgefallenen Schichten durch den anderen Einsatzbegleiter nicht ausgeglichen werden.
Die Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die Struktur- und Prozessqualität weisen aufein fehlendes Grundverständnis der beiden Begriffsdefinitionen hin. Mit einem erweiterten Schulungsangebot kann hier entgegengewirkt werden.
Es konnten effektiver einzelne Qualitätsaspekte untersucht werden, welche durch bisherige Systeme nicht abgedeckt werden können. Eine tatsächliche Kontrolle der Ergebnisqualität konnte aufgrund fehlender Daten über das Patientenoutcome in der Klinikjedoch nicht nachgewiesen werden. Eine Kooperation mit den jeweiligen Kliniken und ein Abgleich der präklinischen und interhospitalen Diagnosestellung sowie des Patientenoutcomes wäre durch die Einsatzbegleiter problemlos möglich.
Für zukünftige Forschung auf dem Gebiet der Einsatzsupervision kann festgehalten werden:
- Die Studiendauer sollte verlängert werden, um einen größeren Anteil der gesamten Belegschaft mit Einsatzbegleitungen abdecken zu können.
- Es sollten mind. vierjedoch nicht mehr als sechs Einsatzbegleiter pro Rettungswache eingesetzt werden.
- Das Feedbackprotokoll sollte weniger und übersichtlicheren Inhalt besitzen, mit einem Fokus auf einzelnen Qualitätsindikatoren.
- Es sollte eine intensivere Einarbeitung auf das Feedbackprotokoll erfolgen, sowie ein Indikationskatalog erstellt werden, um Dokumentationsunterschiede zu vermeiden.
- Nach einer festgelegten Eingewöhnungsphase sollte sich erneut mit den einzelnen Einsatzbegleitern zusammengesetzt werden und gemeinsam die bisher ausgefüllten Protokolle besprochen werden.
- Die Dokumentation sollte digital gestaltet werden für eine erhöhte Flexibilität und eine erleichterte Auswertung
- Auf Basis dieser oder eigener Testphasen, kann sich intensiver auf einzelne spezifische Qualitätsindikatoren wie z.B. die ambulante Versorgung konzentriert werden.
- Die klinische Diagnosestellung und das Patientenoutcome sollten als Ergebnisqualitätssicherung, in Kooperation mit den behandelnden Kliniken, durch die Einsatzbegleiter ausgewertet werden.
5.2 Bewertung derTeilnehmerbefragung
Bemessen an der knapp 600 Mitarbeiter großen Belegschaft des DRK RDHU ist die geringe Teilnehmeranzahl von 18 Personen auffällig klein. Es wird vermutet, dass die Ursache der geringen Teilnahme auf der Verbreitung der Umfrage über die „Blog“-Funktion des Mitarbeiterportals zurückzuführen ist. Zum einen, weil diese Funktion relativ neu ist und zum anderen weil ältere Nachrichten automatisch von neueren Nachrichten nach unten geschoben werden, sodass diese ohne aktives Scrollen nicht mehr sichtbar sind. Für ein aussagekräftigeres Ergebnis sollte die Umfrage erneut als verpflichtendes Rundschreiben geteilt werden.
Die Ergebnisse der 7 Teilnehmerinnen, die bereits eine Einsatzbegleitung hatten, zeigen jedoch erste verwertbare Anhaltspunkte auf. Unter anderem gleicht sich die positive Bewertung derTeilnehmer mit der Rückmeldung der Einsatzbegleiter. Es bestätigt, dass bei der richtigen Etablierung die Einsatz-Supervision auch in der deutschen Feedbackkulturvon den Teilnehmern akzeptiert werden kann.
Das einzige negative Feedback durch zwei Teilnehmerinnen, die „Nein, definitiv nicht“ aufdie Frage, ob sie das Einsatzbegleiterprojekt als festen Bestandteil für die Zukunft im DRK RDHU sehen, angegeben haben, stammt interessanterweise beide Male von Notfallsanitäterinnen aus Ehingen/Blaubeuren, welche keine Einsatzbegleitung hatten.
Die Aussage einer der beiden Teilnehmerinnen aus Ehingen/Blaubeuren: „Unnötig Kollegen zu kritisieren, wird das gesamte Unternehmen spalten“ zeigt jedoch auch, wie wichtig die richtige Etablierung eines solchen Konzeptes ist. Um den Teilnehmern zu vermitteln, dass es sich nicht um eine Kontrolle oder Kritik handelt, sondern eine unterstützende Hilfestellung.
5.3 Bewertung der Abschlussbefragung der Einsatzbegleiter
Die Aussagen der Einsatzbegleiter sind zwar per se subjektive Eindrücke, zeigen jedoch ein homogenes Meinungsbild zwischen den Rettungsdienstbereichen Ulm und Heidenheim. Des Weiteren bilden sie einen Konsens mit den Ergebnissen der Teilnehmerbefragung.
6 Fazit
Die Testphase der „kollegialen Einsatzbegleitung“ konnte wie geplant durchgeführt werden. Während der Schulungs- und Durchführungsphase kam es zu keinerlei Problemen, die den Projektablauf gefährdeten. Die Planung und das Konzept bewährten sich.
Trotz initialer Bedenken war es möglich, mit der richtigen Informationskampagne und Auswahl der Einsatzbegleiter, eine hohe Akzeptanz des Konzeptes bei den Mitarbeitern zu erreichen.
Die teilnehmenden Einsatzbegleiter erwiesen sich nach der kurzen Schulung in der Lage, eine effiziente, mobile Qualitätssicherung und produktive Einsatznachbesprechung aufAugenhöhe durchzuführen.
Die wissenschaftlichen Hypothesen, dass:
- „die Einsatzsupervision durch Notfallsanitäter*innen im Realeinsatz ein geeignetes Mittel zur Qualitätssicherung im Rettungsdienst ist“
und
- „die untersuchten Qualitätsindikatoren mit der Einsatzsupervision, im Vergleich zu bestehenden Qualitätssicherungssystemen des Rettungsdienstes, präziser und effizienter gemessen werden können“
können somit positiv beantwortet werden.
Das Projekt wird damit grundsätzlich als erfolgreich bewertet. Die dargestellten Ergebnisse der Feedbackprotokolle und Befragungen sprechen für sich.
Mit einem dauerhaft implementierten Supervisionskonzept ist es möglich, den Grundgedanken der kontinuierlichen Verbesserung (das KVP-Prinzip), auf jeder Ebene des Rettungsdienstes zu etablieren. Weitergehend wird sich auf Basis der Einsatznachbesprechungen, die Fehler(zentrierte)kultur in eine Wahrnehmungskultur verändern.
Nichtsdestotrotz ist die größte Hürde nach wie vor die ungeklärte Kostenfrage. Zwei Vollzeit-Einsatzbegleiter, für einen Rettungsdienst mit über 600 Mitarbeitern, erscheint im Hinblick auf den bewiesenen Nutzen nicht sonderlich viel. Bei einer Personalkostenberechnung von 64€ pro Notfallsanitäter*in pro Stunde (aktuelle Berechnungsbasis Stand März 2024), belaufen sich jedoch allein die Personalkosten eines Monats auf ca. 20.000€.
In Anbetracht der Novellierung des Rettungsdienstgesetzes in Baden-Württemberg, mit einem verstärkten Fokus auf effizienter Qualitätssicherung, erscheint eine Kostenübernahme durch das Land und/oder die Kostenträger wahrscheinlicher als je zuvor.
Bei dem Pilotprojekt der kollegialen Einsatzbegleitung handelt es sich um die bundesweit erstmalige wissenschaftliche Begleitung eines Einsatzsupervisionskonzeptes in einem deutschen Rettungsdienst. Das Projekt erhebt keinen Anspruch auf eine Neuentdeckung der Einsatzsupervision, liefert jedoch Hinweise, dass ein derartiges Konzept von den Rettungskräften akzeptiert wird, effektive Qualitätssicherung betreibt und zu einer Qualitätsverbesserung im Rettungsdienst führt.
Mit den Worten von Redelsteiner, ob und wann die Supervision in den deutschen Rettungsdienst kommt: „Das „Ob“ ist keine Frage. Gerade dann, wenn Notfallsanitäter*innen verstärkt invasive Maßnahmen einsetzen.“
Literaturverzeichnis
Belardi, Nando (2024): Supervision und Coaching. Grundlagen, Techniken, Perspektiven. 6th ed. München: C.H. Beck (Beck'sche Reihe, v.2157). Online verfügbar unter https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?doclD=7415395.
Deutsches Institut für Normung e.V.: DIN EN ISO 9000:2015. Online verfügbar unter https://www.nautos.de/0JA/search/item-detail/DE30062915, zuletzt geprüft am 19.03.2024.
El Khamali, Radia; Mouaci, Atika; Valera, Sabine; Cano-Chervel, Marion; Pinglis, Camille; Sanz, Celine et al. (2018): Effects of a Multimodal Program Including Simulation on Job Strain Among Nurses Working in Intensive Care Units: A Randomized Clinical Trial. In: JAMA 320 (19), S. 1988-1997. DOI: 10.1001/jama.2018.14284.
Franke, Alexander (2022): Auswirkungen eines Field-Supervisor-Systems aufdie Versorgungsqualität des Rettungswesens. Optimierung der rettungsdienstlichen Versorgungsqualität mittels Einsatzsupervision am Beispiel derWiener Berufsrettung. Online verfügbar unter https://www.grin.com/document/1243994.
Häske, David; Kreinest, Michael; Wölfl, Christoph G.; Frank, Christian; Brodermann, Götz; Horter, Johannes et al. (2013): Bericht aus der Praxis: Strukturierte Fortbildung zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Rettungsdienst. Einsatz-Supervision als neuer Ansatz im Bereich der Rettungsdienst-Fortbildung in Wiesbaden und im Rheingau-Taunus-Kreis? In: ZeitschriftfurEvidenz, Fortbildung und Qualitatim Gesundheitswesen 107 (7), S. 484-489. DOI: 10.1016/j.zefq.2013.06.007.
Heimberg, E.; Daub, J.; Schmutz, J. B.; Eppich, W.; Hoffmann, F. (2021): Debriefing in der Kindernotfallversorgung: Grundlage für die Verbesserung der Patientenversorgung. In: Notfall&rettungsmedizin 24 (1), S. 43-51. DOI: 10.1007/s10049-020-00833-1.
Heinzel, Philipp (2021): „Field Supervision" eine Methode zur Weiterentwicklung von Risiko-, Qualitäts- und Wissensmanagement im deutschen Rettungsdienst. Online verfügbar unter https://opus.ostfalia.de/frontdoor/index/index/docId/1275, zuletzt geprüft am 20.11.2023.
Hensen, Peter (2022): Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
Land Baden-Württemberg: Neufassung des Gesetzes über den Rettungsdienst. LRDG-BW, vom 2023. Online verfügbar unter https://beteiligungsportal.baden- wuerttemberg.de/fleadmin/redaktion/beteiligungsportal/Dokumente/231130_Entwurf_ Gesetz_Rettungsdienst.pdf, zuletzt geprüft am 16.03.2024.
Land Baden-Württemberg: Rettungsdienstgesetz Baden-Württemberg. RDG-BW,vom 08.02.2010. Online verfügbar unter https://www.landesrecht-bw.de/jportal/recherche3doc/RettDG_BW_2010.pdf?json=%7B%22format%22%3A%22pd f%22%2C%22params%22%3A%7B%22fixedPart%22%3A%22true%22%7D%2C%22docPart %22%3A%22X%22%2C%22docId%22%3A%22jlr-RettDGBW2010V2P2%22%2C%22portalId%22%3A%22bsbw%22%7D&_=%2FRettDG_BW_ 2010.pdf, zuletzt geprüft am 22.03.2024.
Lauer, Daniel; Bandlow, Stephan; Rathje, Maik; Seidl, Andreas; Karutz, Harald (2022): Veränderungen und Entwicklungen in der präklinischen Notfallversorgung: Zentrale Herausforderungen für das Rettungsdienstmanagement. In: Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 65 (10), S. 987-995. DOI: 10.1007/s00103-022- 03588-x.
Luxem, Jürgen; Runggaldier, Klaus; Karutz, Harald; Flake, Frank; Blank-Gorki, V.;
Buschmann, C.; Sambale, T. (Hg.) (2020): Notfallsanitäter heute. Unter Mitarbeit von Alexander Lechleuthner. Urban-&-Fischer-Verlag. 7. Auflage. München: Elsevier. Online verfügbar unter http://shop.elsevier.de/978-3-437-46211-5.
Mueller, Matthias; Losert, Heidrun; Sterz, Fritz; Gelbenegger, Georg; Girsa, Michael; Gatterbauer, Mathias et al. (2023): Prehospital emergency medicine research by additional teams on scene - Concepts and lessons learned. In: Resuscitahon plus 16, S. 100494. DOI: 10.1016/j.resplu.2023.100494.
Rall, Marcus; Langewand, Sascha (2022): Crew Resource Management für Führungskräfte im Gesundheitswesen. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
Redelsteiner, Christoph (2018): Risiko- und Qualitätsmanagement am Einsatzort durch Feldsupervisoren. In: Agnes Neumayr, Michael Baubin und AdolfSchinnerl (Hg.): Zukunftswerkstatt Rettungsdienst. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, S. 187¬197.
Redelsteiner, Christoph; Kuderna, Heinz; Kühberger, Rudolf; Baubin, Michael;
Feichtelbauer, Erwin; Prause, Gerhard et al. (Hg.) (2011): Das Handbuch für Notfall- und Rettungssanitäter. Patientenbetreuung nach Leitsymptomen. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Wien: Braumüller.
SQR-BW (2014): Methodenbericht SQR-BW 2014. Qualitätsindikatoren für den Rettungsdienst in Baden-Württemberg. Online verfügbar unter https://www.sqrbw.de/fleadmin/SQRBW/Ergaenzende_Dokumente/Methodenbericht_2 014.pdf, zuletzt geprüft am 11.03.2024.
7 Anhangsverzeichnis
Anhang 1: DIVI MIND4.0 Codes
Anhang 2: DIVI-Notfalleinsatzprotokoll 6.1 MIND 4.0
Anhang 3: Merkblatt für Einsatzkräfte im Rettungsdienst für die Einsatzbegleitung des Gefahrenabwehrzentrum Main-Kinzig-Kreis
Anhang 4: Feedbackprotokolle DRK RDHU
Anhang 4.1: Feedbackprotokoll 1.0
Anhang 4.2: Feedbackprotokoll 2.0
Anhang 4.3: Feedbackprotokoll 3.0
Anhang 4.4: Feedbackprotokoll 3.1
Anhang 4.5: Feedbackprotokoll 3.2
Anhang 4.6: Feedbackprotokoll 3.3
Anhang 4.7: Feedbackprotokoll 3.4
Anhang 5: Annotated CRF Feedback-Protokoll 3.4
Anhang 6: Verhaltenscodex DRK RDHU
Anhang 7: Konzeptvorstellung kollegiale Einsatzbegleitung
Anhang 8: Mitarbeiterinformation kollegiale Einsatzbegleitung
Anhang 9: Rundschreiben ASB & Notärzte
Anhang 10: Rundschreiben - Mitarbeiterbefragung derTestphase kollegiale Einsatzbegleitung
Anhang 11: Online-Mitarbeiterbefragung derTestphase kollegiale Einsatzbegleitung
Anhang 12: Befragung derEinsatzbegleiter
Anhang 13: Einarbeitung und Konzeptvorstellung derEinsatzbegleiter
Anhang 14: Konzeptplan der kollegialen Einsatzbegleitung
Anhang 15: Fortbildungsstundennachweis
Anhang 16: Daten der Feedbackprotokolle in Excel
Anhang 17: Auswertung derOnline-Teilnehmerumfrage
Anhang 18: Ausgefüllte Feedbackprotokolle
8 Anhang
Anhang 1: DIVI MIND 4.0 Codes
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
(Quelle:https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/dokumentenordner/220308-divi-mind-40-codes.pdf)
Anhang 2: DIVI-Notfalleinsatzprotokoll 6.1 MIND 4.0
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
(Quelle:https://www. divi. de/Joomlatools-files/docman-files/dokumentenordner/220308-divi-notfall-einsatzprotokoll-6.1.pdf)
Anhang 3: Merkblatt für Einsatzkräfte im Rettungsdienst für die
Anhang 4: Feedbackprotokolle DRK RDHU
Anhang 4.1: Feedbackprotokoll 1.0
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 4.2: Feedbackprotokoll 2.0
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 4.3: Feedbackprotokoll 3.0
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 4.4: Feedbackprotokoll 3.1
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 4.5: Feedbackprotokoll 3.2
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 4.6: Feedbackprotokoll 3.3
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 4.7: Feedbackprotokoll 3.4
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 5: Annotated CRF Feedback-Protokoll 3.4
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 6: Verhaltenscodex DRK RDHU
Anhang 6 wurde im Rahmen derVeröffentlichung aufgrund urheberrechtlicher Vorgaben entfernt.
Anhang 7: Konzeptvorstellung kollegiale Einsatzbegleitung
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 8: Mitarbeiterinformation kollegiale Einsatzbegleitung
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 9: Rundschreiben ASB & Notärzte
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 10: Rundschreiben - Mitarbeiterbefragung der
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 11: Online-Mitarbeiterbefragung derTestphase kollegiale Einsatzbegleitung
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 12: Befragung der Einsatzbegleiter
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 13: Einarbeitung und Konzeptvorstellung der
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 14: Konzeptplan der kollegialen Einsatzbegleitung
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 15: Fortbildungsstundennachweis
Anhang 16: Daten der Feedbackprotokolle in Excel
Anhang 16 wurde im Rahmen der Veröffentlichung aufgrund von Datenschutz entfernt.
Anhang 17: Auswertung der Online-Teilnehmerumfrage
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Anhang 18: Ausgefüllte Feedbackprotokolle
[...]
Details
- Titel
- Einsatz-Supervision im Realeinsatz durch Notfallsanitäter*innen zur Qualitätsverbesserung im Rettungsdienst
- Hochschule
- Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, früher: Berufsakademie Heidenheim
- Note
- 1,7
- Autor
- Johannes Spülbeck (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2024
- Seiten
- 161
- Katalognummer
- V1573123
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Einsatzbegleitung Rettungsdienst Field Supervisor Notfallsanitäter Einsatz Supervision Notfallrettung Rettungsdienst Ulm Johannes Spülbeck Feld Supervision Qualitätssicherung im Rettungsdienst Qualitätsverbesserung im Rettungsdienst
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Arbeit zitieren
- Johannes Spülbeck (Autor:in), 2024, Einsatz-Supervision im Realeinsatz durch Notfallsanitäter*innen zur Qualitätsverbesserung im Rettungsdienst, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1573123
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-