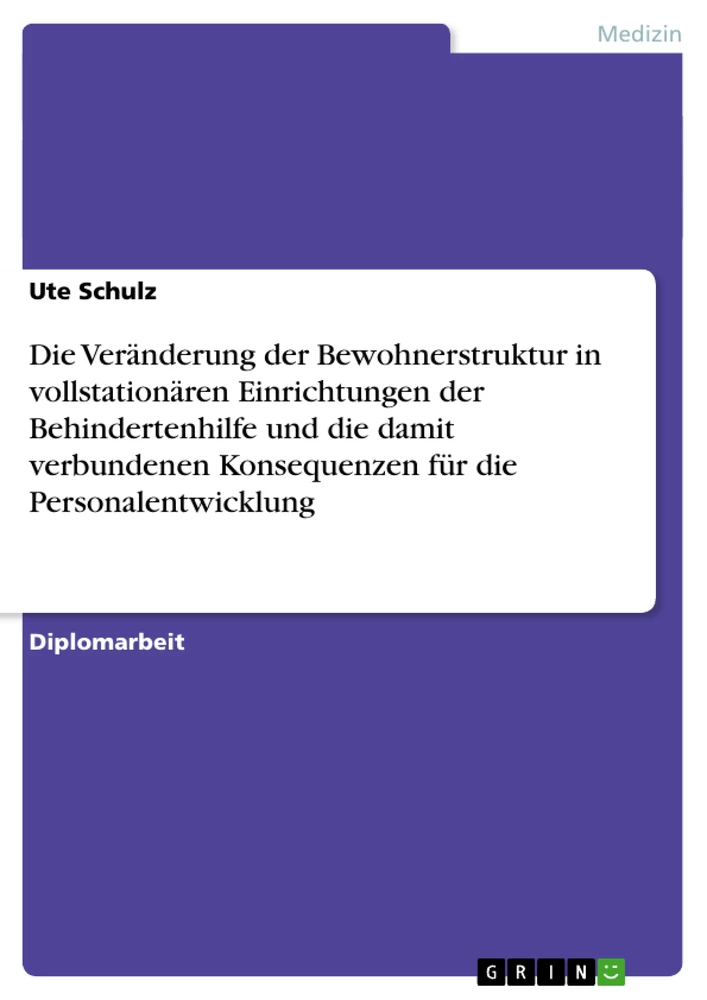
Die Veränderung der Bewohnerstruktur in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und die damit verbundenen Konsequenzen für die Personalentwicklung
Diplomarbeit, 2010
85 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Grundlagen zur Veränderung der Bewohnerstruktur in vollstationären Einrichtungen
- 1.1 Normalisierung
- 1.2 Selbstbestimmung/ Empowerment
- 1.3 Integration/ Inklusion
- 1.4 Teilhabe
- 1.5 Ausbau neuer Wohnmöglichkeiten
- 1.6 Demographische Entwicklung
- 1.7 Schlussfolgerung zur Fragestellung
- 2. Begriffserklärungen
- 2.1 Einrichtungen nach dem HeimG und Finanzierung im Gegensatz zu Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI
- 2.2 Tabellarische Darstellung der verschiedenen Berufe in Einrichtungen der Behindertenhilfe
- 2.3 Unterschiede Heilerziehungspfleger/ Pflegefachkraft
- 2.4 Grund- und Behandlungspflege aus verschiedenen Gesichtspunkten
- 3. Stellungnahmen zu behandlungspflegerischen Maßnahmen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe
- 3.1 Aus Sicht des Bundesverbandes der evangelischen Behindertenhilfe
- 3.2 Aus Sicht der Fachverbände der Behindertenhilfe
- 3.3 Aus Sicht der Diakonie
- 3.4 Aus Sicht der hessischen Heimaufsicht
- 3.5 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Stellungnahmen
- 4. Haftungsrechtlicher Aspekt
- 4.1 Fachaufsicht
- 4.2 Delegationsverantwortung
- 4.3 Übernahmeverantwortung/ Durchführungsverantwortung
- 4.4 Kommunikationsverantwortung
- 4.5 Deliktische Haftung
- 4.6 Vertragliche Haftung
- 5. Personalentwicklung
- 5.1 Grundlagen der Personalentwicklung
- 5.2 Einstellung von Pflegefachkräften
- 5.3 Kooperation mit benachbarten Einrichtungen
- 5.4 Erstellung eines „internen Pflegestützpunktes“
- 5.5 Entwicklung vorhandener pädagogischer ausgebildeter Mitarbeiter
- 5.5.1 Weiterbildung zum Altenpfleger für Heilerziehungspfleger
- 5.5.2 Interne Fortbildungen
- 5.5.3 Strukturierung der Fortbildungen
- 5.5.4 Weiterbildungsmöglichkeiten
- 5.6 Bildung von Pflegefachabteilungen
- 5.7 Bildung eines Fachkreises Pflege
- 5.8 Beauftragung eines externen Pflegedienstes
- 5.9 Veränderungen auf Grund des Paradigmenwechsels
- 5.10 Einsatzmöglichkeiten für ältere Mitarbeiter
- 5.11 Ausgliederung von Mitarbeitern aus den stationären Einrichtungen
- 5.12 Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kräften
- 5.13 Beauftragung eines externen Unternehmens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Veränderungen der Bewohnerstruktur in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Personalentwicklung. Das Hauptziel ist es, Möglichkeiten der Personalentwicklung aufzuzeigen, um den Herausforderungen des demografischen Wandels und des Paradigmenwechsels in der Behindertenhilfe zu begegnen.
- Veränderung der Bewohnerstruktur in der Behindertenhilfe
- Konsequenzen für die Personalentwicklung
- Behandlungspflege in Einrichtungen der Behindertenhilfe
- Haftungsrechtliche Aspekte
- Möglichkeiten der Personalentwicklungsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe, der zu veränderten Wohnformen und damit zu neuen Herausforderungen für die Mitarbeiter in stationären Einrichtungen geführt hat. Der Fokus liegt auf dem Wandel von einer umfassenden Betreuung hin zu einer individualisierten Unterstützung, die die Selbstbestimmung der Klienten in den Mittelpunkt stellt. Der zunehmende Bedarf an behandlungspflegerischen Maßnahmen in Einrichtungen, die primär pädagogisch ausgerichtet sind, wird als zentrales Problem hervorgehoben, das die Personalentwicklung stark beeinflusst.
1. Die Veränderung der Bewohnerstruktur in der stationären Behindertenhilfe: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss von Normalisierung, Selbstbestimmung, Integration/Inklusion und Teilhabe auf die Bewohnerstruktur stationärer Einrichtungen. Es wird der Wandel von großen Anstalten hin zu dezentralisierten, gemeindenahen Wohnformen beschrieben und der damit verbundene Rückgang von Menschen mit leichten Behinderungen in den Einrichtungen thematisiert. Die demografische Entwicklung mit einem steigenden Anteil älterer Bewohner und Menschen mit Mehrfachbehinderungen wird als wesentlicher Faktor für die veränderte Bewohnerstruktur und den steigenden Bedarf an Pflegeleistungen herausgestellt.
2. Begriffserklärungen: Dieses Kapitel klärt wichtige Begriffe im Kontext der Behindertenhilfe und Pflege. Es werden die Unterschiede zwischen Einrichtungen nach dem Heimgesetz und Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI hinsichtlich der gesetzlichen Vorschriften, des Personals und der Finanzierung erläutert. Die unterschiedlichen Ausbildungen und der Einsatz von Heilerziehungspflegern im Vergleich zu Pflegefachkräften werden detailliert beschrieben. Schließlich wird die umstrittene Unterscheidung zwischen Grund- und Behandlungspflege aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
3. Stellungnahmen zu behandlungspflegerischen Maßnahmen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe: Dieses Kapitel präsentiert und vergleicht verschiedene Stellungnahmen von Verbänden (Bundesverband der evangelischen Behindertenhilfe, Fachverbände der Behindertenhilfe, Diakonie) und der hessischen Heimaufsicht zum Thema Behandlungspflege in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Die Stellungnahmen beleuchten den steigenden Bedarf an Behandlungspflege, die rechtlichen Unsicherheiten und die Herausforderungen bei der Organisation und Qualitätssicherung dieser Maßnahmen in Einrichtungen, die primär pädagogisch ausgerichtet sind. Die verschiedenen Ansätze zur Lösung der Problematik werden verglichen und bewertet.
4. Haftungsrechtlicher Aspekt: Das Kapitel befasst sich mit den haftungsrechtlichen Aspekten bei der Durchführung von behandlungspflegerischen Maßnahmen. Es werden die verschiedenen Verantwortungsebenen (Führungs-, Anordnungs-, Organisations-, Delegations-, Übernahme- und Kommunikationsverantwortung) sowie die deliktische und vertragliche Haftung des Trägers und der Mitarbeiter erläutert. Die Bedeutung der Fachaufsicht und der Notwendigkeit einer klaren Regelung der Verantwortlichkeiten wird betont.
5. Personalentwicklung: Dieses Kapitel stellt verschiedene Möglichkeiten der Personalentwicklung in Einrichtungen der Behindertenhilfe vor. Es werden Maßnahmen wie die Einstellung von Pflegefachkräften, die Kooperation mit benachbarten Einrichtungen, die Einrichtung eines internen Pflegestützpunktes, die Weiterbildung von pädagogisch ausgebildeten Mitarbeitern (z.B. Weiterbildung zum Altenpfleger), die Bildung von Pflegefachabteilungen und die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kräften diskutiert. Die jeweiligen Vor- und Nachteile der einzelnen Maßnahmen werden abgewogen und Konsequenzen für die Umsetzung aufgezeigt. Der Paradigmenwechsel und seine Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und die Motivation der Mitarbeiter werden ebenfalls berücksichtigt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Veränderungen der Bewohnerstruktur in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und Konsequenzen für die Personalentwicklung
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht die Veränderungen der Bewohnerstruktur in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Personalentwicklung. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen des demografischen Wandels und des Paradigmenwechsels in der Behindertenhilfe.
Welche Veränderungen der Bewohnerstruktur werden behandelt?
Die Arbeit analysiert den Einfluss von Normalisierung, Selbstbestimmung, Integration/Inklusion und Teilhabe auf die Bewohnerstruktur. Sie beschreibt den Wandel von großen Anstalten hin zu dezentralisierten Wohnformen, den Rückgang von Menschen mit leichten Behinderungen und den steigenden Anteil älterer Bewohner und Menschen mit Mehrfachbehinderungen. Der zunehmende Bedarf an behandlungspflegerischen Maßnahmen wird ebenfalls thematisiert.
Welche Konsequenzen für die Personalentwicklung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen für die Personalentwicklung aufgrund der veränderten Bewohnerstruktur, insbesondere den steigenden Bedarf an Pflegefachkräften und die Notwendigkeit der Weiterbildung pädagogisch ausgebildeter Mitarbeiter. Verschiedene Personalentwicklungsmaßnahmen werden vorgestellt und bewertet.
Welche Begrifflichkeiten werden im Detail erläutert?
Die Arbeit klärt wichtige Begriffe wie die Unterschiede zwischen Einrichtungen nach dem Heimgesetz und Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI, die verschiedenen Berufe in der Behindertenhilfe (z.B. Heilerziehungspfleger vs. Pflegefachkraft) und die Unterscheidung zwischen Grund- und Behandlungspflege.
Wie wird die Behandlungspflege in Einrichtungen der Behindertenhilfe behandelt?
Die Arbeit analysiert den steigenden Bedarf an Behandlungspflege, die rechtlichen Unsicherheiten und die Herausforderungen bei der Organisation und Qualitätssicherung. Sie vergleicht verschiedene Stellungnahmen von Verbänden und der Heimaufsicht zu diesem Thema.
Welche haftungsrechtlichen Aspekte werden berücksichtigt?
Die Arbeit befasst sich mit den haftungsrechtlichen Aspekten bei der Durchführung von behandlungspflegerischen Maßnahmen. Sie erläutert die verschiedenen Verantwortungsebenen (Führungs-, Anordnungs-, Organisations-, Delegations-, Übernahme- und Kommunikationsverantwortung) sowie die deliktische und vertragliche Haftung.
Welche konkreten Personalentwicklungsmaßnahmen werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt verschiedene Personalentwicklungsmaßnahmen vor, wie die Einstellung von Pflegefachkräften, die Kooperation mit benachbarten Einrichtungen, die Einrichtung eines internen Pflegestützpunktes, die Weiterbildung von Mitarbeitern (z.B. Weiterbildung zum Altenpfleger), die Bildung von Pflegefachabteilungen und die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kräften. Die Vor- und Nachteile der Maßnahmen werden abgewogen.
Wie wird der Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe berücksichtigt?
Der Paradigmenwechsel von umfassender Betreuung hin zu individualisierter Unterstützung und Selbstbestimmung der Klienten wird als zentraler Hintergrund der Veränderungen und Herausforderungen für die Personalentwicklung beschrieben und in die Analyse der Maßnahmen mit einbezogen.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit enthält Kapitel zu Einleitung, Veränderungen der Bewohnerstruktur, Begriffserklärungen, Stellungnahmen zu Behandlungspflege, haftungsrechtlichen Aspekten und Personalentwicklung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung detailliert beschrieben.
Wo finde ich weitere Informationen?
(Hier könnten Sie einen Link zu der vollständigen Diplomarbeit einfügen, falls verfügbar)
Details
- Titel
- Die Veränderung der Bewohnerstruktur in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und die damit verbundenen Konsequenzen für die Personalentwicklung
- Hochschule
- Frankfurt University of Applied Sciences, ehem. Fachhochschule Frankfurt am Main
- Note
- 1,7
- Autor
- Ute Schulz (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 85
- Katalognummer
- V158277
- ISBN (eBook)
- 9783640711239
- ISBN (Buch)
- 9783640711536
- Dateigröße
- 3396 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Veränderung Bewohnerstruktur Einrichtungen Behindertenhilfe Konsequenzen Personalentwicklung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Ute Schulz (Autor:in), 2010, Die Veränderung der Bewohnerstruktur in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und die damit verbundenen Konsequenzen für die Personalentwicklung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/158277
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









