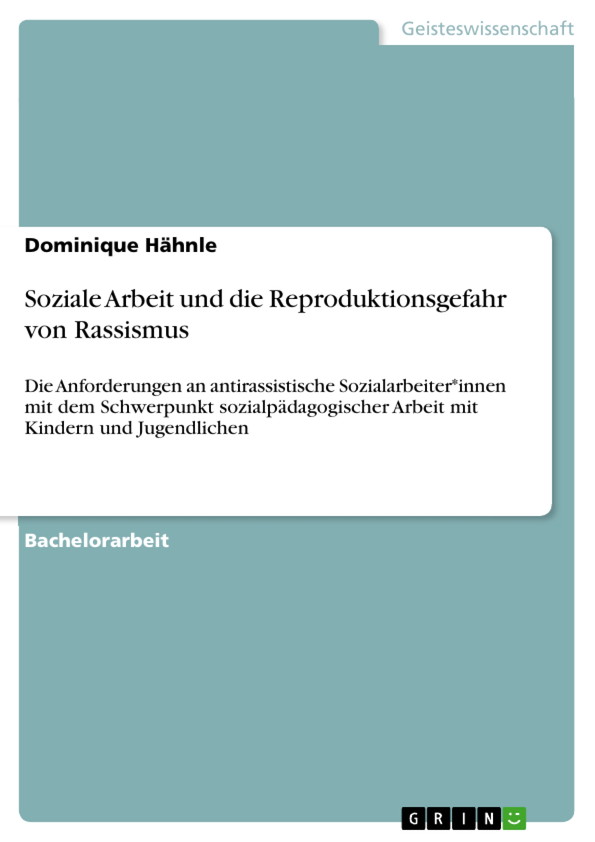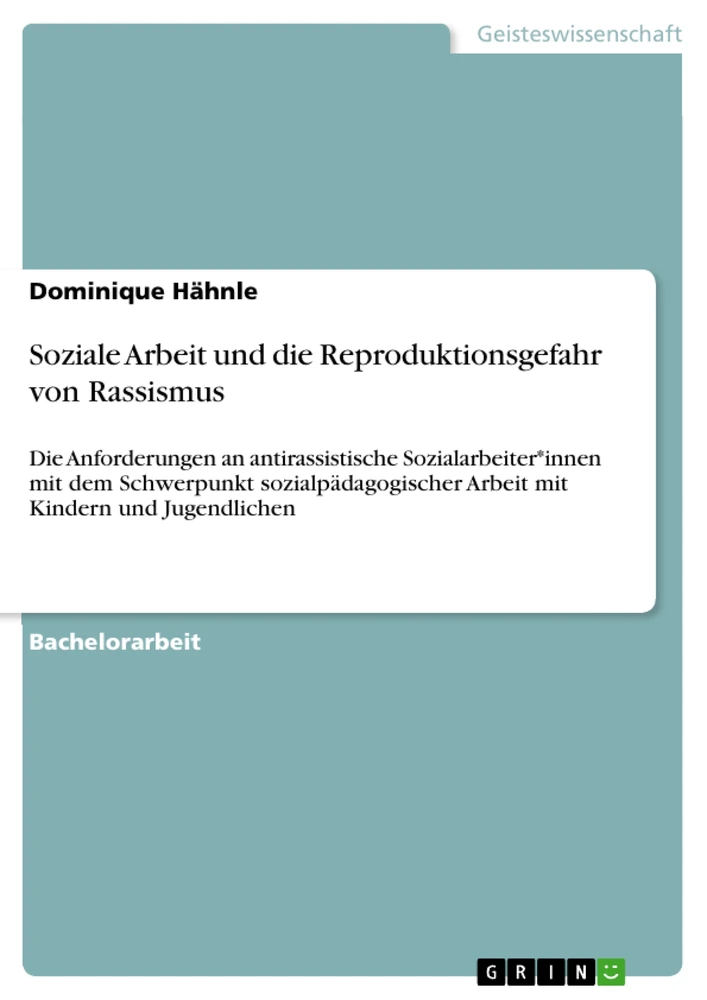
Soziale Arbeit und die Reproduktionsgefahr von Rassismus
Bachelorarbeit, 2022
88 Seiten, Note: 2,1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 0.1 Hinführung zum Thema
- 0.2 Rassismusforschung in Deutschland - Brauchen wir diskriminierungs- und rassismuskritische Wissenschaftler*innen?
- 0.3 Methodischer Aufbau der Bachelorarbeit
- 1. Begriffsbestimmungen
- 1.1 Der Begriff „Rassismus“
- 1.1.1 Kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff „Rasse“
- 1.1.2 Ist das „Rassismus“ oder was darf nicht weg?
- 1.2 Abgrenzung zu den Begriffen:
- 1.2.1 „Ausländerfeindlichkeit“
- 1.2.2 „Diskriminierung“
- 1.2.3 „Fremdenfeindlichkeit und Fremdenfurcht (Xenophobie)“
- 2. Exemplarische Übersicht an Rassismustheorien und Überlegungen des 20. und 21. Jahrhunderts
- 2.1 Stuart Hall - Braucht Rassismus eine soziale Praxis?
- 2.2 Robert Miles - Rassismus als ideologischer Diskurs
- 2.3 Mark Terkessidis - „Macht-Wissen-Komplex“
- 3. Geschichte des Rassismus in Deutschland - Der Blick auf Heute
- 3.1 Sklaverei und Kolonialzeit - Inwieweit profitieren wir davon?
- 3.2 Nationalsozialismus - Rassistischer Judenhass
- 3.2.1 Islamischer Antisemitismus
- 3.2.2 Antimuslimischer Rassismus - „Islamophobie“
- 3.3 Gastarbeiter*innen ab den 1950er Jahren
- 3.5 Asiat*innen - „Antiasiatischer Rassismus“
- 3.6 Sinti und Roma - „Antiziganismus“
- 4. Soziale Arbeit - Umgang mit Differenzierungen, Normen und Macht
- 4.1 Berufsethos vs. Machtstrukturen
- 4.2 Zentrale Ergebnisse aus den Forschungsprojekten: Zur Konstruktion und Dekonstruktion von Differenz in der Sozialen Arbeit und „Geflecht aus Machtverhältnissen“
- 4.2.1 Struktureller Rassismus
- 4.2.2 Institutioneller Rassismus
- 4.2.3 Alltagsrassismus
- 4.3 Anforderungen an institutionelle Rahmenbedingungen für eine antirassistische Arbeit - Zwischen Ansprüche und Erwartungen
- 4.3.1 Träger > Sozialarbeiter*innen
- 4.3.2 Sozialarbeiter*innen > Träger
- 4.4 Gesetzliche Grundlagen
- 4.4.1 Das Grundgesetz (GG)
- 4.4.2 Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- 4.4.3 Was sagen uns die Gesetze aus der Kinder- und Jugendhilfe?
- 5. Reproduktion von Rassismuserfahrungen
- 5.1 Was verstehen wir unter Reproduktion von Rassismuserfahrungen?
- 5.2 Wer reproduziert Rassismus?
- 5.2.1 Sozialarbeiter*innen
- 5.2.2 Kinder und Jugendliche - Was sind die Auswirkungen von Rassismus?
- 6. Anforderungen an antirassistische Sozialarbeiter*innen
- 6.1 Was bedeutet antirassistisch?
- 6.2 Anerkennung und Reflexion der eigenen Verflechtung
- 6.3 Was hat Rassismus mit mir zu tun? - Ein Blick in den Spiegel
- 6.4 Auswahl an Begleitliteratur und Hilfsmittel zur antirassistischen Arbeit für Sozialarbeitende
- 6.4.1 Happyland - Rassismuskritisch denken lernen
- 6.4.2 Check der Privilegien und IAT (Implicit Association Test)
- 7. Antirassistische Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Praxis
- 7.1 Wie können Sozialarbeiter*innen antirassistisch und sozialpädagogisch arbeiten?
- 7.1.1 Mit Kindern
- 7.1.1.1 Früh übt sich…
- 7.1.1.2 7 Schritte für das Gespräch mit Kindern über Rassismus
- 7.1.1.3 Was ist wenn…? Das Fünf-Schritte-Schema
- 7.1.2 Mit Kindern im Grundschulalter
- 7.1.3 Mit Teenagern und Pre-Teens
- 7.2 Hilfe das Kind erlebt Rassismus - Was kann getan werden?
- 7.3 Wo finden Sozialarbeiter*innen diversitätssensible und antirassistische Materialien für Kinder und Jugendliche?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Reproduktion von Rassismus in der Sozialen Arbeit, insbesondere im Kontext der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, die Anforderungen an antirassistische Sozialarbeiter*innen zu definieren und Handlungsempfehlungen für eine sozialpädagogische Praxis zu entwickeln, die Rassismus aktiv bekämpft und benachteiligte Gruppen unterstützt.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung von Rassismus, Diskriminierung und verwandten Begriffen
- Historische und gesellschaftliche Kontexte von Rassismus in Deutschland
- Analyse der Rolle der Sozialen Arbeit in der Reproduktion und Bekämpfung von Rassismus
- Entwicklung von Anforderungen an antirassistische Sozialarbeiter*innen
- Praktische Handlungsempfehlungen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und erläutert die Relevanz der Auseinandersetzung mit Rassismus in der Sozialen Arbeit. Sie skizziert den methodischen Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Forschungsfragen. Der Abschnitt zur Rassismusforschung in Deutschland betont die Notwendigkeit diskriminierungs- und rassismuskritischer Wissenschaftler*innen, um die komplexen Herausforderungen effektiv zu adressieren.
1. Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel klärt zentrale Begriffe wie „Rassismus“, „Rasse“, „Diskriminierung“, „Ausländerfeindlichkeit“ und „Xenophobie“. Es wird kritisch auf die soziale Konstruktion von „Rasse“ eingegangen und die feinen Unterschiede zwischen den Begriffen herausgearbeitet, um eine präzise und differenzierte Sprache im weiteren Verlauf der Arbeit zu gewährleisten.
2. Exemplarische Übersicht an Rassismustheorien und Überlegungen des 20. und 21. Jahrhunderts: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Rassismustheorien, insbesondere die Ansätze von Stuart Hall, Robert Miles und Mark Terkessidis. Es beleuchtet unterschiedliche Perspektiven auf den Rassismus, seine Manifestationen und seine gesellschaftlichen Ursachen. Die verschiedenen Theorien werden miteinander in Beziehung gesetzt und ihre Relevanz für die Sozialarbeit diskutiert.
3. Geschichte des Rassismus in Deutschland - Der Blick auf Heute: Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung des Rassismus in Deutschland, von der Sklaverei und Kolonialzeit über den Nationalsozialismus bis hin zu aktuellen Formen des Rassismus gegen verschiedene Bevölkerungsgruppen (z.B. Migrant*innen, Asiat*innen, Sinti und Roma). Es werden die Kontinuitäten und Brüche in der Geschichte des Rassismus aufgezeigt und deren Bedeutung für die Gegenwart herausgestellt.
4. Soziale Arbeit - Umgang mit Differenzierungen, Normen und Macht: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Sozialen Arbeit im Umgang mit Differenz, Normen und Machtstrukturen. Es wird auf das Berufsethos und die Herausforderungen im Kontext strukturellen, institutionellen und Alltagsrassismus eingegangen. Die gesetzlichen Grundlagen (Grundgesetz, AGG, Kinder- und Jugendhilfe) werden im Hinblick auf ihre Bedeutung für antirassistische Sozialarbeit beleuchtet.
5. Reproduktion von Rassismuserfahrungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Reproduktion von Rassismuserfahrungen im Kontext der Sozialen Arbeit. Es analysiert die Mechanismen, durch die Rassismus aufrechterhalten und weitergegeben wird, und betrachtet die Rolle von Sozialarbeiter*innen und den Einfluss auf Kinder und Jugendliche.
6. Anforderungen an antirassistische Sozialarbeiter*innen: Dieses Kapitel definiert die Anforderungen an antirassistische Sozialarbeiter*innen. Es betont die Bedeutung der Selbstreflexion, der Anerkennung von Privilegien und der Auseinandersetzung mit der eigenen Verflechtung in rassistischen Strukturen. Es werden auch hilfreiche Ressourcen für die antirassistische Arbeit vorgestellt.
7. Antirassistische Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Praxis: Dieses Kapitel bietet praxisorientierte Handlungsempfehlungen für die antirassistische und sozialpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unterschiedlichen Alters. Es werden konkrete Strategien und Methoden zur Prävention und Intervention vorgestellt, sowie Ressourcen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen genannt.
Schlüsselwörter
Rassismus, Antirassismus, Soziale Arbeit, Kinder und Jugendliche, Diskriminierung, Sozialpädagogik, Machtstrukturen, Reflexion, Interkulturalität, Diversität, Handlungsempfehlungen, Gesetzliche Grundlagen, Reproduktion von Rassismuserfahrungen, struktureller Rassismus, institutioneller Rassismus, Alltagsrassismus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die Reproduktion von Rassismus in der Sozialen Arbeit, insbesondere im Kontext der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, die Anforderungen an antirassistische Sozialarbeiter*innen zu definieren und Handlungsempfehlungen für eine sozialpädagogische Praxis zu entwickeln, die Rassismus aktiv bekämpft und benachteiligte Gruppen unterstützt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Bachelorarbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte:
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung von Rassismus, Diskriminierung und verwandten Begriffen
- Historische und gesellschaftliche Kontexte von Rassismus in Deutschland
- Analyse der Rolle der Sozialen Arbeit in der Reproduktion und Bekämpfung von Rassismus
- Entwicklung von Anforderungen an antirassistische Sozialarbeiter*innen
- Praktische Handlungsempfehlungen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Was ist das Ziel der Einleitung (Kapitel 0)?
Die Einleitung führt in das Thema ein, erläutert die Relevanz der Auseinandersetzung mit Rassismus in der Sozialen Arbeit, skizziert den methodischen Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Forschungsfragen. Der Abschnitt zur Rassismusforschung in Deutschland betont die Notwendigkeit diskriminierungs- und rassismuskritischer Wissenschaftler*innen.
Was wird im Kapitel "Begriffsbestimmungen" (Kapitel 1) behandelt?
Dieses Kapitel klärt zentrale Begriffe wie „Rassismus“, „Rasse“, „Diskriminierung“, „Ausländerfeindlichkeit“ und „Xenophobie“. Es wird kritisch auf die soziale Konstruktion von „Rasse“ eingegangen und die feinen Unterschiede zwischen den Begriffen herausgearbeitet.
Welche Rassismustheorien werden im Kapitel 2 vorgestellt?
Das Kapitel präsentiert verschiedene Rassismustheorien, insbesondere die Ansätze von Stuart Hall, Robert Miles und Mark Terkessidis. Es beleuchtet unterschiedliche Perspektiven auf den Rassismus, seine Manifestationen und seine gesellschaftlichen Ursachen.
Welche historische Entwicklung des Rassismus in Deutschland wird im Kapitel 3 untersucht?
Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung des Rassismus in Deutschland, von der Sklaverei und Kolonialzeit über den Nationalsozialismus bis hin zu aktuellen Formen des Rassismus gegen verschiedene Bevölkerungsgruppen (z.B. Migrant*innen, Asiat*innen, Sinti und Roma).
Was wird im Kapitel "Soziale Arbeit - Umgang mit Differenzierungen, Normen und Macht" (Kapitel 4) analysiert?
Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Sozialen Arbeit im Umgang mit Differenz, Normen und Machtstrukturen. Es wird auf das Berufsethos und die Herausforderungen im Kontext strukturellen, institutionellen und Alltagsrassismus eingegangen. Die gesetzlichen Grundlagen (Grundgesetz, AGG, Kinder- und Jugendhilfe) werden im Hinblick auf ihre Bedeutung für antirassistische Sozialarbeit beleuchtet.
Womit befasst sich das Kapitel "Reproduktion von Rassismuserfahrungen" (Kapitel 5)?
Dieses Kapitel befasst sich mit der Reproduktion von Rassismuserfahrungen im Kontext der Sozialen Arbeit. Es analysiert die Mechanismen, durch die Rassismus aufrechterhalten und weitergegeben wird, und betrachtet die Rolle von Sozialarbeiter*innen und den Einfluss auf Kinder und Jugendliche.
Was wird im Kapitel "Anforderungen an antirassistische Sozialarbeiter*innen" (Kapitel 6) definiert?
Dieses Kapitel definiert die Anforderungen an antirassistische Sozialarbeiter*innen. Es betont die Bedeutung der Selbstreflexion, der Anerkennung von Privilegien und der Auseinandersetzung mit der eigenen Verflechtung in rassistischen Strukturen. Es werden auch hilfreiche Ressourcen für die antirassistische Arbeit vorgestellt.
Welche Handlungsempfehlungen werden im Kapitel 7 gegeben?
Dieses Kapitel bietet praxisorientierte Handlungsempfehlungen für die antirassistische und sozialpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unterschiedlichen Alters. Es werden konkrete Strategien und Methoden zur Prävention und Intervention vorgestellt, sowie Ressourcen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen genannt.
Welche Schlüsselwörter werden verwendet?
Rassismus, Antirassismus, Soziale Arbeit, Kinder und Jugendliche, Diskriminierung, Sozialpädagogik, Machtstrukturen, Reflexion, Interkulturalität, Diversität, Handlungsempfehlungen, Gesetzliche Grundlagen, Reproduktion von Rassismuserfahrungen, struktureller Rassismus, institutioneller Rassismus, Alltagsrassismus.
Details
- Titel
- Soziale Arbeit und die Reproduktionsgefahr von Rassismus
- Untertitel
- Die Anforderungen an antirassistische Sozialarbeiter*innen mit dem Schwerpunkt sozialpädagogischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Hochschule
- DIPLOMA Fachhochschule Nordhessen; Zentrale
- Veranstaltung
- Wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des akademisches Grades Bachelor of Arts (B.A.)
- Note
- 2,1
- Autor
- Dominique Hähnle (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 88
- Katalognummer
- V1588014
- ISBN (Buch)
- 9783389141694
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Rassismus Antirassismus Soziale Arbeit antirassistische Reflexion für Sozialarbeitende Antirassismus für Kinder und Jugendliche Gerechtigkeit Macht in der Sozialen Arbeit Klassifikation
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 42,99
- Preis (Book)
- US$ 55,99
- Arbeit zitieren
- Dominique Hähnle (Autor:in), 2022, Soziale Arbeit und die Reproduktionsgefahr von Rassismus, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1588014
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-