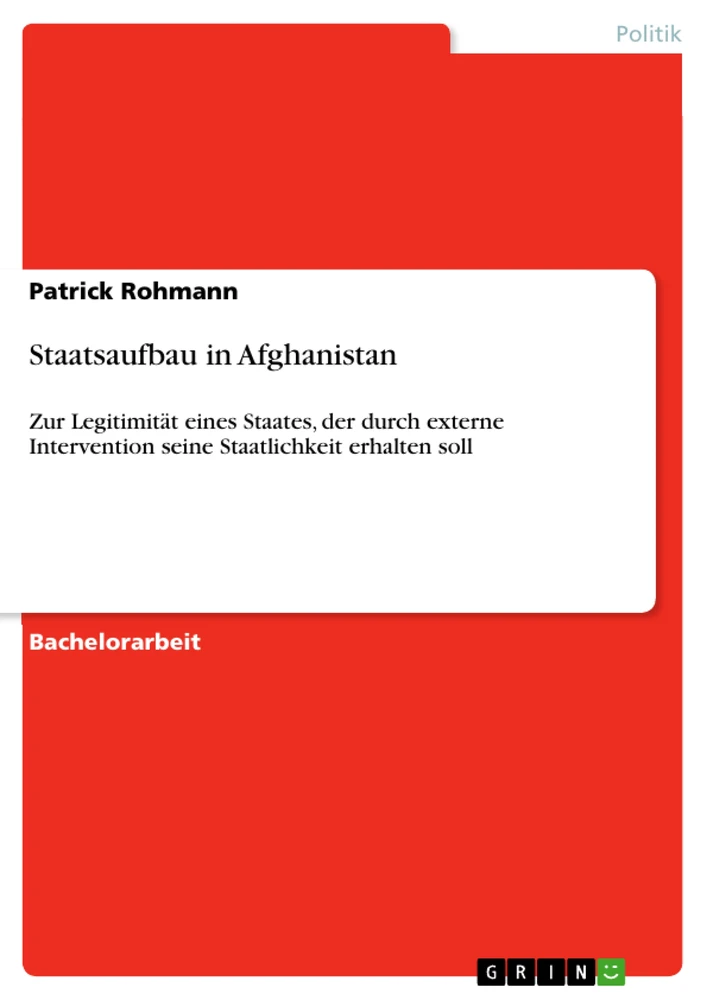
Staatsaufbau in Afghanistan
Bachelorarbeit, 2010
48 Seiten, Note: 1,8
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff der Legitimität
- Das europäische Ideal
- Staatliche Strukturen in Afghanistan
- Gewaltmonopol
- Rechtsstaatlichkeit
- Demokratische Beteiligung
- Soziale Gerechtigkeit
- Interdependenzen und Affektkontrolle
- Konstruktive politische Konfliktkultur
- Zur Notwendigkeit einer Strategieänderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Legitimitätskrise der gegenwärtigen afghanischen Regierung im Kontext des durch externen Interventionen erfolgten Staatsaufbaus. Sie analysiert die Diskrepanz zwischen den Zielen der internationalen Gemeinschaft und der lokalen Verwurzelung der neuen Institutionen. Die Arbeit beleuchtet die Frage, inwieweit die von außen oktroyierte Ordnung in Afghanistan Akzeptanz in der Bevölkerung findet.
- Legitimitätskrise der afghanischen Regierung
- Staatsaufbau in Afghanistan durch externe Intervention
- Diskrepanz zwischen internationalen Zielen und lokaler Verwurzelung
- Akzeptanz der neuen Ordnung in der Bevölkerung
- Vereinbarkeit von Islam und Demokratie in Afghanistan
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt die Legitimitätskrise der afghanischen Regierung dar und stellt die Frage nach den Gründen für die fehlende Akzeptanz der neuen Ordnung. Die verschiedenen Thesen zu diesem Thema werden vorgestellt, wobei die Diskrepanz zwischen den Zielen der internationalen Gemeinschaft und der lokalen Verwurzelung der neuen Institutionen im Vordergrund steht.
- Zum Begriff der Legitimität: Das Kapitel definiert den Begriff der Legitimität und zeigt auf, wie sich eine Legitimitätskrise äußert. Die Rolle der lokalen Bevölkerung und die Bedeutung demokratischer Institutionen für die Legitimität des Staates werden diskutiert.
- Das europäische Ideal: Dieses Kapitel stellt das europäische Ideal einer Demokratie vor und beleuchtet die Frage, inwieweit dieses Modell auf Afghanistan anwendbar ist. Die Kritiker des Demokratieprojekts in Afghanistan werden vorgestellt und ihre Argumente gegen die Durchsetzbarkeit westlicher Werte in einer islamisch geprägten Gesellschaft werden dargelegt.
- Staatliche Strukturen in Afghanistan: Dieser Abschnitt analysiert die staatlichen Strukturen in Afghanistan und untersucht, inwieweit diese die Kriterien einer modernen Demokratie erfüllen. Die Themen Gewaltmonopol, Rechtsstaatlichkeit, demokratische Beteiligung, soziale Gerechtigkeit, Interdependenzen und Affektkontrolle sowie eine konstruktive politische Konfliktkultur werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die zentralen Themen der Legitimität, Staatsaufbau, externe Intervention, Afghanistan, Demokratie, Islam, lokale Verwurzelung, Akzeptanz, Tradition, Stammeskultur, Staatsstabilität, und die Frage nach der Vereinbarkeit von westlichen Werten mit afghanischen Traditionen.
Details
- Titel
- Staatsaufbau in Afghanistan
- Untertitel
- Zur Legitimität eines Staates, der durch externe Intervention seine Staatlichkeit erhalten soll
- Hochschule
- Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg (Institut für Internationale Politik)
- Note
- 1,8
- Autor
- Patrick Rohmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 48
- Katalognummer
- V158821
- ISBN (eBook)
- 9783640713905
- ISBN (Buch)
- 9783640714056
- Dateigröße
- 811 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Statebuilding Nationbuilding Intervention Taliban State Building Legitimität Zivilisatorisches Hexagon Senghaas
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Patrick Rohmann (Autor:in), 2010, Staatsaufbau in Afghanistan, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/158821
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









