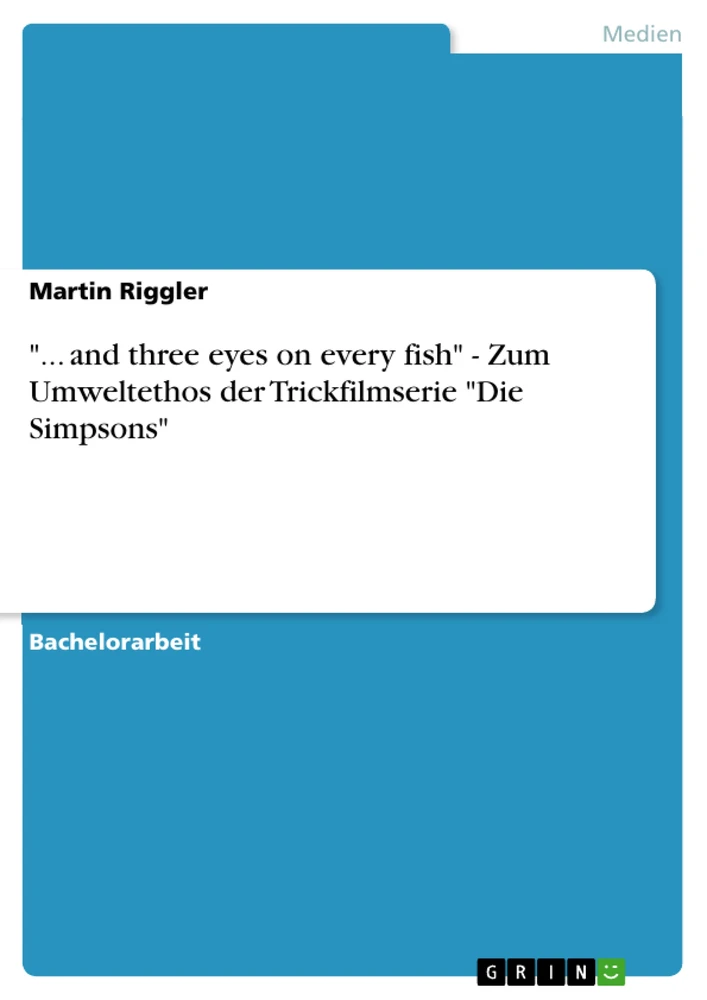
"... and three eyes on every fish" - Zum Umweltethos der Trickfilmserie "Die Simpsons"
Bachelorarbeit, 2009
41 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Zur Thematik
- 1.1 Forschungsstand
- 1.2 Methodik
- 1.3 Gliederung
- 2. Bestimmungselemente und Definitionsgrundlagen
- 1. Einführung in den Themenbereich,,Simpsons“
- 1.1 Daten, Fakten und Hintergründe
- 1.2 Story und Charaktere
- 1.3 Vorstellung der Familie
- 1.4 Die Stadt Springfield
- 3. Umweltethische Grundlagen
- 2.1 Darstellung eines gesellschaftlichen Problemfeldes
- 2.2 Ökologie und Umweltschutz in der modernen Gesellschaft
- 2.3 Nachhaltigkeit – ein umweltethischer Leitbegriff
- 2.4 Zwischenfazit
- III. Thesen und Kontexte
- 1. ,,Die Simpsons\" als ...?
- 1.1 Zeichentrick mit normativem Anspruch
- 1.2 Themenschwerpunkt: Gesellschaftliche Herausforderungen
- 1.3 Entwicklungslinien
- 2. Darstellung am Beispiel
- 2.1 Problemfeld Atomkraft
- 2.2 Problemfeld Zerstörung natürlicher Grundlagen
- 2.3 Problemfeld Artenschutz
- 2.4 Folgerungen
- 3. Im Zerrspiegel medialer Wirklichkeit
- 3.1 Anspruch, Hintergrund und Realität
- 3.2 Kontextualität von Serie und Gesellschaft
- IV. Schluss
- 1. Fazit
- 1.1 Die Simpsons als Gegenstand wissenschaftlicher Arbeit
- 1.2 Die Simpsons und die (,,Liebe\" zur) Umwelt.
- Darstellung umweltethischer Problemstellungen in der Serie „Die Simpsons“
- Analyse des Potenzials der Serie zur Vermittlung umweltethischer Themen
- Die Rolle der Simpsons in der gesellschaftlichen Moraldiskussion
- Das ökologische Ethos der Serie
- Entwicklung von Umweltschutzthemen in der Serie über die Jahre
- I. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beleuchtet die Relevanz der Fernsehserie „Die Simpsons“ als Medienphänomen sowie die Aktualität umweltethischer Fragestellungen. Der Forschungsstand in diesem Bereich wird beleuchtet, wobei die wenigen bestehenden wissenschaftlichen Arbeiten zu den Simpsons vorgestellt werden.
- II. Bestimmungselemente und Definitionsgrundlagen: Dieser Teil beschäftigt sich mit der Einführung in den Themenbereich „Die Simpsons“. Er liefert Daten, Fakten und Hintergründe zur Serie, beschreibt Story und Charaktere, stellt die Familie Simpson vor und schildert die Stadt Springfield.
- III. Umweltethische Grundlagen: Dieses Kapitel behandelt die Darstellung umweltethischer Probleme in der Gesellschaft. Es werden Themen wie Ökologie, Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Kontext der modernen Gesellschaft beleuchtet.
- III. Thesen und Kontexte: Dieser Abschnitt analysiert die Serie „Die Simpsons“ als Zeichentrickserie mit normativem Anspruch und beleuchtet den Themenschwerpunkt der gesellschaftlichen Herausforderungen. Es werden konkrete Beispiele aus der Serie herangezogen, um die Darstellung von Problemfeldern wie Atomkraft, Zerstörung natürlicher Grundlagen und Artenschutz zu analysieren.
- III. Im Zerrspiegel medialer Wirklichkeit: Dieser Abschnitt betrachtet die Serie „Die Simpsons“ im Kontext ihrer gesellschaftlichen Einbettung und beleuchtet den Anspruch, Hintergrund und die Realität der Serie.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Fernsehserie „Die Simpsons“ mit dem Fokus auf die Darstellung und den Umgang mit umweltethischen Problemstellungen. Ziel ist es, das Potenzial der Sendung zur Vermittlung dieser Themen zu untersuchen. Dabei steht nicht die pädagogische Dimension im Vordergrund, sondern die Frage, welche Rolle die Simpsons und ihr ökologisches Ethos in der gesellschaftlichen Moraldiskussion spielen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen „Die Simpsons“, Umweltethik, Gesellschaftliche Moraldiskussion, Medienphänomen, Ökologie, Nachhaltigkeit, Atomkraft, Zerstörung natürlicher Grundlagen, Artenschutz.
Häufig gestellte Fragen
Welches umweltethische Ethos vermittelt die Serie 'Die Simpsons'?
Die Serie vermittelt ökologische Themen oft subversiv statt offensiv. Sie nutzt Satire, um Umweltprobleme wie die Gefahren der Atomkraft oder die Zerstörung natürlicher Lebensräume in den Fokus der öffentlichen Moraldebatte zu rücken.
Wie wird das Thema Atomkraft in der Serie dargestellt?
Durch das Kernkraftwerk von Springfield und den Charakter Mr. Burns werden Sicherheitsmängel, Korruption und ökologische Folgen (wie der dreiäugige Fisch) humoristisch, aber kritisch als gesellschaftliches Problemfeld aufgezeigt.
Was bedeutet 'Nachhaltigkeit' im Kontext der Simpsons?
Nachhaltigkeit fungiert als umweltethischer Leitbegriff, der in der Serie oft durch das Scheitern der Charaktere an ökologischen Herausforderungen und die Darstellung kurzfristigen Denkens kontrastiert wird.
Warum sind die Simpsons Gegenstand wissenschaftlicher Arbeit?
Die Serie gilt als mediales Massenphänomen, das komplexe moralische Prinzipien und gesellschaftliche Vorgänge reflektiert und so eine neue Perspektive auf den gesellschaftlichen Moraldiskurs bietet.
Welche Rolle spielt die Stadt Springfield für die Umweltethik?
Springfield dient als Mikrokosmos einer postmodernen Gesellschaft, in dem die Wechselwirkungen zwischen Industrie, Politik und Umwelt exemplarisch und reflexiv dargestellt werden.
Details
- Titel
- "... and three eyes on every fish" - Zum Umweltethos der Trickfilmserie "Die Simpsons"
- Hochschule
- Universität der Bundeswehr München, Neubiberg
- Note
- 1,3
- Autor
- Martin Riggler (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 41
- Katalognummer
- V158895
- ISBN (eBook)
- 9783640719389
- ISBN (Buch)
- 9783640719747
- Dateigröße
- 863 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Umweltethos Trickfilmserie Simpsons
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Martin Riggler (Autor:in), 2009, "... and three eyes on every fish" - Zum Umweltethos der Trickfilmserie "Die Simpsons", München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/158895
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









